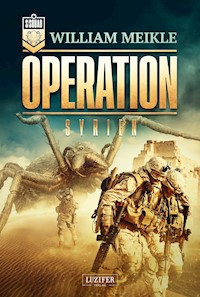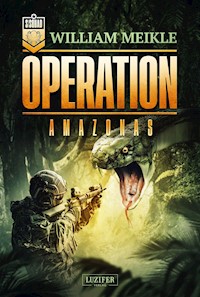Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lovecrafts Schriften des Grauens
- Sprache: Deutsch
Der Privatdetektiv Derek Adams wird von einer unbekannten Schönen beauftragt, nach einem gestohlenen Amulett zu suchen. Adams willig ein.Damit beginnt seine Alptraumfahrt durch das Reich des Grauens.Raymond Chandler trifft auf H. P. Lovecraft.Ein düsterer Noir-Kimi.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
William Meikle
Das Amulett
In dieser Reihe bisher erschienen:
2101 Das Amulett
William Meikle
Das Amulett
Aus dem Amerikanischen
© 2017 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 Windeck
Redaktion: Jörg Kaegelmann
Titelbild: Mark Freier
Satz: Winfried Brand
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-95719-421-3
1
Der Tag begann wie jeder andere. Ich zog mich an, rauchte zwei Zigaretten, blieb in meiner öden Wohnung hocken und wartete darauf, dass das Telefon klingelte.
Ich langweilte mich. Seit über einem Monat blieben die Aufträge aus, und mein letzter Fall hatte darin bestanden, eine verschwundene Katze aufzuspüren. Mir waren unglaubliche Geschichten über Kinderbanden untergekommen, die angeblich solche Fellknäuel stahlen und an Kleiderhersteller aus Fernost verkauften. Chinesische Abholrestaurants mit vollen Gefrierschränken und abwegige Mutmaßungen über Teufelsanbetung, bis hin zu rituellem Katzenschlachten. Wie auch immer, das unglückliche Tier blieb vermisst.
Nur die Aussicht aus meinem Fenster lieferte mir etwas Ablenkung. Studenten gingen Händchen haltend über die Byred Road und schienen die Welt ringsum vergessen zu haben. Schmuddelige, alte Männer warteten darauf, dass die Kneipen öffneten, kleine Großmütterchen in dicken Wollmänteln trugen Einkaufstüten, die viel zu schwer für sie waren, und der irre Joe sang weiterhin alle zehn Minuten lauthals O Sole Mio. Um halb elf ging ich hinüber in mein Büro, öffnete die Schreibtischschublade und nahm eine Flasche Whiskey heraus, um mich für den langen Absturz bis zur Schlafenszeit zu wappnen.
Nur ein weiterer einsamer Tag im Paradies.
Eine Stunde später betrachtete ich den letzten Rest meines Whiskeys und fragte mich, wie lange ich standhalten würde, ihn aufzusparen, als es an der Tür klopfte. Die Flasche wäre mir fast aus der Hand gefallen, als ich sie zurück in die Schublade legte. Ich hatte gerade Zeit genug, um meine Krawatte zu binden, bevor die Tür aufging und alle meine trüben Gedanken verflogen.
Sie war nicht einfach nur schön, sondern Ehrfurcht gebietend. Der Schnitt ihrer Kleider, ihre Haltung und die Art, wie sie ihr schwarzes Haar auffällig sorgfältig verstrubbelt hatte. Ich versuchte, nicht auf ihre Beine zu glotzen, während sie durch mein Büro ging. Ihre hohen Absätze klickten auf dem Hartholzboden. Als sie direkt auf mich zukam, gelang es mir endlich, meine Augen von ihren Schenkeln zu lösen.
»Adams? Mr Derek Adams?«, fragte sie.
Ihre Stimme passte perfekt zu ihrer Erscheinung. Der Traum von einem Fall, der Bogart würdig war, nahm langsam Gestalt an. Ich stand auf, gab ihr die Hand und merkte, wie kalt sie sich anfühlte. Meine eigene Hand war mit einem Mal schweißnass geworden.
»Genau, Adams’ Detective Agency oder kurz ADA. An erster Stelle im Telefonbuch, und wenn es um persönliche Dienstleistungen geht.« Ich achtete darauf, nicht zu sabbern. Nachdem ich ihr den abgewetzten Sessel vor meinem Schreibtisch angeboten hatte, setzte ich mich in meinen eigenen und hoffte, nur dieses eine Mal so überzeugend nonchalant aufzutreten, wie ich es seit Monaten vorm Spiegel geübt hatte.
»Sie stehen nicht mehr an erster Stelle im Telefonbuch«, sagte sie leichthin. »Ich habe es bereits bei Abrakadabra, wir bewirken Wunder versucht. Das Büro befindet sich in einer Lagerhalle drüben in Maryhill und scheint noch renovierungsbedürftiger als das Ihre zu sein. Ich sprach mit einem kleinen Mann, der mir jedoch nicht weiterhelfen konnte.« Sie lächelte mich mit ihren strahlend weißen Zähnen an.
»Ich weiß, wen Sie meinen«, entgegnete ich. »Jimmy Allen. Er ärgerte sich immer darüber, dass mein Name vor seinem eingetragen wird.«
»Vielleicht ist es an der Zeit, dass Sie sich zu irgendetwas mit aalglatt umbenennen«, schlug sie vor und lachte.
Mir wurde warm ums Herz. »Zwischen der Automobile Association und den Anonymen Alkoholikern fühle ich mich schlecht aufgehoben.«
Sie rutschte im Sessel herum und versuchte, es sich bequem zu machen.
Ich hoffte, dass sie eine Zeit lang blieb. Also sollte sie es gemütlich haben. »Bitte, was kann ich für Sie tun?« Ich lehnte mich zurück, um sie anzuschauen, während sie sprach.
»Vorgestern Nacht wurde bei uns eingebrochen«, begann sie langsam. »Mein Mann weiß noch nichts davon, er ist verreist. Der Dieb wusste allerdings genau, wonach er suchte. Er nahm nur ein Schmuckstück mit, ein sehr kostbares. Das Hochzeitsgeschenk meines Mannes. Der Schmuck bedeutet mir viel, er hat für mich einen hohen ideellen Wert. Ich möchte, dass Sie ihn finden.«
Ihren Mund zu beobachten war ein Genuss, dennoch hatte sie nicht die ganze Wahrheit erzählt. Das war mir während der Rede in ihren Augen aufgefallen. Mein innerer Lügendetektor schlug Alarm, obwohl es sich um eine ziemlich gewöhnliche Anfrage handelte. Solche Aufträge hatte ich schon reichlich erledigt. Davon abgesehen durfte sie mich belügen, wie sie wollte. Damit konnte ich in ihrem Fall umgehen. »Ihnen ist bewusst, wie schwer es ist, Schmuckstücke wiederzubeschaffen?« Ich bemühte mich, nicht auf ihren makellosen Oberschenkel zu starren, der sichtbar wurde, als sie ihr Gewicht im Sessel verlagerte.
»Ich glaube kaum, dass Ihnen der Auftrag Schwierigkeiten bereiten wird«, meinte sie. »Der Schmuck fällt schon sehr auf.« Sie kramte in ihrer exquisiten Handtasche, mit deren Gegenwert ich meine Miete einige Monate lang hätte begleichen können, und nahm ein Foto heraus, das sie mir über den Tisch reichte.
Ich nahm es behutsam aus ihrer Hand und hätte es beinahe fallen gelassen. Plötzlich mochte ich den neuen Auftrag nicht mehr, wollte wieder zum Whiskey greifen, der in meiner Schublade gerade danach schrie, herausgenommen zu werden. Doch sie lächelte mich nur an. Ich gab ihr das Bild zurück. Es war ein Anhänger, wie ich ihn noch nie gesehen hatte. Eine Figur an einer dicken Goldkette. Nichts auf dem Foto ließ auf seine genauen Maße schließen. Die Figur sollte wohl ein Tier darstellen, doch auch das kannte ich nicht. Seine Hinterläufe ähnelten denen einer Katze und waren gestreift wie bei Königstigern. Doch von den Hüften an aufwärts wirkte es grotesk, glich einem gestaltlosen, schwarzen Steinklumpen mit Saugnäpfen an langen Tentakeln, die wiederum von einem mehr ballförmigen Etwas ausgingen, möglicherweise dem Kopf.
»Hübsch hässlich, das Hochzeitsgeschenk«, bemerkte ich. »Hätte es mir gehört, wäre ich wohl ziemlich froh gewesen, es zu verlieren.« Ich schob das Bild von mir fort und klappte es auf dem Tisch um. Dann wischte ich mir die Finger an meinem Schlips ab, wurde aber das Gefühl nicht los, mich schmutzig gemacht zu haben.
»Sie würden es ungern verlieren, wenn Sie wüssten, dass es eine halbe Million Pfund wert ist«, entgegnete sie leise. »Es ist sehr alt, arabische Antike. Arthurs Herz hängt sehr daran. Er darf niemals erfahren, dass es gestohlen wurde. Aus diesem Grund bitte ich Sie, es zu finden, bevor mein Mann zurückkommt. Bitte!«
Das war immer noch nicht die komplette Wahrheit, doch jetzt klebte mir der Geruch des Geldes in der Nase. »Ich nehme 250 Pfund pro Tag plus Spesen. Zwei Tage Anzahlung.« Sofort wünschte ich mir, ich hätte mehr verlangt, als sie sofort ein Büchlein aus ihrer Tasche zog und mir einen Scheck ausstellte.
»Arbeiten Sie bitte korrekt und schreiben Sie alles auf«, fügte sie hinzu, als sie ihn mir gab.
»Meine Finanzsoftware befindet sich auf dem neusten Stand«, log ich mit Hinblick auf die alte Schreibmaschine hinten in meinem Regal. »Sie bekommen Einzelaufstellungen, detailliert bis auf den letzten Penny.«
Sie drehte sich nach dem Regal um, dann wieder zu mir. »Finanzsoftware?« Sie lächelte.
»Oh ja«, beteuerte ich und begab mich in Teufels Küche. »Mit allem Drum und Dran. Internetverbindung zu Amt und Steuerbüro, automatische Rechnungserstellung. Alles aktuell.«
»Und ich wette, Sie müssen das Farbband nicht häufiger als zweimal im Jahr wechseln.«
Das ließ ich so stehen. »Erzählen Sie mir mehr von dem Raub.«
Nachdem ich eine Zigarette aus der Packung neben mir genommen hatte, ließ sie sich auch eine geben. Um sie anzuzünden, beugte ich mich über den Tisch und erhaschte einen Hauch ihres berauschenden Parfüms. Es roch streng moschusartig und verboten sexy.
»Wie gesagt, es passierte vorgestern Nacht. Ich kam so gegen Mitternacht aus dem Theater zurück.«
»Waren Sie allein?«, fragte ich.
Sie nickte.
»Schade«, platzte es aus mir heraus, bevor mein Gehirn die Chance bekam, zu meinem Mund aufzuschließen.
»Möchten Sie etwas über den Einbruch erfahren oder mit mir flirten?«
Ich seufzte auffällig. »Nein, nur zu, fahren Sie fort. Selbstverständlich trenne ich Arbeit und Vergnügen strikt voneinander.«
»Schade«, konterte sie und hängte ein verstecktes Lächeln an, das jeden Eisberg zum Schmelzen gebracht hätte.
»Punkt für Sie. Bitte weiter.« Ich versuchte, lässig einen Rauchkringel auszustoßen, bekam dabei Qualm ins Auge und musste sie anblinzeln. Sie war so anständig, mich nicht auszulachen.
»Also, ich kam nach Mitternacht zurück. Erst fiel mir nichts Ungewöhnliches auf, doch dann stellte ich fest, dass jemand die Küchentür mit Gewalt geöffnet hatte. Nachdem ich rasch durchs Haus gegangen war, wusste ich, dass nichts außer meinem Amulett fehlte.«
»Besitzen Sie weitere Wertsachen?«
»Oh ja, Arthur ist ein wahrer Sammler. Wir verfügen über viele Stücke, die zum Teil sogar mehr wert sind.«
»Und das Amulett ist tatsächlich das einzige Stück, das entwendet wurde?«
Sie nickte. Irgendetwas stimmte nicht. Nicht der Auftragsraub, so etwas kam ständig vor. Sie log aus einem anderen Grund, den ich noch nicht bestimmen konnte. »Und was sagt die Polizei?«
»Ich möchte die Angelegenheit gerne diskret behandeln«, entgegnete sie. »Mein Mann …«
Es war die Art, wie sie die Mundwinkel anspannte. Ich vermutete, dass ihr Mann bereits davon wusste. Und das Amulett hatte etwas, das die Einmischung offizieller Gesetzeshüter ausschloss.
»Versicherung?«, fragte ich weiter.
Sie schüttelte den Kopf, wodurch sich mein Verdacht erhärtete.
»Tja, ich wiederhole mich, wenn ich Ihnen rate, sich keine allzu großen Hoffnungen zu machen. Ich drehe meine Runden und höre mich um. Vielleicht muss ich Sie auch zum gegebenen Zeitpunkt zu Hause besuchen, aber bereiten Sie sich schon einmal darauf vor, Ihrem Mann die Hiobsbotschaft zu unterbreiten. Möglich, dass wir Ihr Amulett niemals finden.«
»Geben Sie bitte Ihr Bestes, Mr Adams«, bat sie. »Wer weiß? Vielleicht liegt es schon im Geschäft irgendeines Antiquitätenhändlers für hochklassige Ware und wartet nur darauf, dass sie es im Vorbeigehen entdecken.«
Ihr Tonfall klang wie ein bewusst gestreuter Hinweis, um mir auf die Sprünge zu helfen. Doch als ich ihr in die Augen schaute, bekam ich wieder nur ein leichtes Lächeln zurück. »Okay, ich mache mich sofort an die Arbeit. Unter welcher Nummer darf ich Sie anrufen?«
Sie stand auf und legte eine Visitenkarte auf meinen Schreibtisch, direkt neben das Foto und meinen Scheck. Es wurde noch mal gelächelt, dann verschwand sie, und mit ihr auch nach und nach der Duft ihres Parfüms. Wenig später fiel mir ein, dass ich sie nicht nach ihrem Namen gefragt hatte. Die Karte gab mir diesbezüglich leider keinen Hinweis, A & F Dunlop, Antiquitätenhändler. Darunter eine Adresse in einem piekfeinen Vorort. Vermutlich stand das A für ihren Mann Arthur, und F? Der Buchstabe konnte alles Mögliche abkürzen. Ich nahm mir vor, mich zukünftig durch Lächeln und Parfüm nicht mehr ablenken zu lassen. Statt dem Drang nachzugeben, mit dem Scheck zu spielen, steckte ich ihn mit der Karte und dem Bild zu einer verängstigten Zehnpfundnote in meine Brieftasche. Dann ging ich zum ersten Mal seit einem Monat frisch ans Werk.
*
Der irre Joe vom Kiosk kramte bereits zwei Schachteln Marlboro hervor, bevor ich überhaupt an der Theke war. »Hab deinen Besuch heute Morgen mitgekriegt«, sagte er statt einer Begrüßung.
»Fein. Der Besuch sorgt dafür, dass ich meine Kippen wieder bezahlen kann.«
»Bei mir könnte die für was ganz Anderes sorgen. Die war heiß, oder? Ich hab ja keine Ahnung, was sie wollte, weiß aber, was sie braucht.« Der alte Joe machte eine obszöne Geste mit Daumen und Zeigefinger.
»Du solltest dich schämen«, rügte ich und lachte trotzdem. »In deinem Alter …«
»Ach, ich hab immer noch ordentlich Tinte auf dem Füller«, beteuerte er. »Und wenn ich mein Gebiss ausziehe, klappt’s perfekt mit dem Lecken.«
»Das wird jetzt aber ekelhaft.«
Er wackelte artistisch mit seiner oberen Zahnprothese im Mund. »Aber mal im Ernst«, meinte er dann. »Die hab ich schon einmal gesehen, kann mich aber nicht mehr erinnern, wo.«
»Falls es dir wieder einfällt, gib Bescheid.«
Er berechnete mir für die zwei Päckchen fast 30 Pence mehr als am Vortag. Ich zog kurz in Erwägung, die Qualmerei wieder aufzugeben, doch meine neue Kundin rauchte auch, und ich wollte mich ihr gegenüber gesellig zeigen. Also steckte ich mir eine neue Zigarette am Stummel der alten an, verließ den Laden und überquerte die Byred Road. Meine erste Anlaufstelle war die Glasgower Universität. Bis dorthin war es nicht weit. Nur fünf Minuten, nicht mehr. Beinahe zwanzig Jahre meines Lebens hatte ich dort verplempert. Die neugotischen Gebäude ragten immer noch Furcht einflößend über mir auf. Und vielleicht zum tausendsten Mal seit damals fragte ich mich, ob es die richtige Entscheidung gewesen war, alledem den Rücken zu kehren.
Als ich über düstere Korridore und Treppen ins noch dunklere zweite Untergeschoss ging, wo meine gescheitesten ehemaligen Kommilitonen arbeiteten, erkannte ich, ebenfalls zum gefühlt tausendsten Mal, warum ich es getan hatte. Doug Lang und ich, wir kannten uns schon ewig. Wir hatten als Studenten oft miteinander gesoffen und uns nicht einmal aus den Augen verloren, nachdem ich ausgeschieden war. »Du schürfst immer noch nach Gold, was?«, frotzelte ich, als ich die Tür zu seinem winzigen, fensterlosen Büro aufstieß.
Er hatte sich kaum verändert. Das ungekämmte Haar, die John-Lennon-Brille und eine schlecht sitzende Wollweste, alles Requisiten für die Rolle des exzentrischen Professors, den er verkörperte. Darunter jedoch verbarg sich eins der neugierigsten Gemüter, die ich kannte. Und das Beste daran: Er war Archäologe.
»Eines Tages wird jemand Schutt sieben und Überreste von dir darin finden«, meinte er.
»Ich lasse mich nach dem Tod verbrennen«, antwortete ich.
Er lachte und alles war wieder so wie früher. »Tut gut, dich zu sehen. Bist du gekommen, um mich auf ein Bier einzuladen?«
»Leider nein, diesmal ist es etwas Berufliches.«
Als ich ihm das Foto zeigte, zog er seine Augenbrauen fast bis zum Haaransatz hoch. »Das Johnson-Amulett«, flüsterte er ehrfürchtig.
Ich befürchtete, sein Speichel werde auf das Bild tropfen. »Dann kennst du es also?«
»Oh ja«, raunte er. Dann schlug er seinen schulmeisterlichen Ton an, den ich hinlänglich an ihm kannte. »Es wurde irgendwann um die letzte Jahrhundertwende in Ur gefunden und von James Johnson ins Land gebracht. Der war damals dick im Frachtgeschäft. Dem Amulett liegt eine lange Geschichte zugrunde, irgendetwas im Zusammenhang mit einem Satanskult, Schwarzer Magie und unsterblichen arabischen Zauberern im Altertum. Hokuspokus. In den 1920ern sorgte das Amulett für eine Menge Aufruhr. Es kam irgendwie zu einem Skandal und Johnson starb unter merkwürdigen Umständen. Das Amulett zählte nicht zu seinem Nachlass und gilt seitdem als verschollen.« Sein Blick nahm raubtierartige Züge an. »Woher hast du dieses Foto?«
»Von einer Klientin. Ich wurde angeheuert, um es zu finden.«
Er lachte. »Das haben schon ganz andere Kaliber als du versucht.«
»Ist es viel wert?«, fragte ich in der Hoffnung, wenigstens eine von Mrs Dunlops Lügen aufzudecken, wurde aber enttäuscht.
»Es ist unbezahlbar.« Diesmal geiferte er wirklich. »Archäologen weltweit würden Körperteile dafür hergeben, es nur sehen zu dürfen. Ich schätze, falls es je versteigert werden sollte, ginge es für viele Millionen über den Tisch. Aber wie gesagt: Es ist seit über achtzig Jahren verschollen. Vermutlich sitzt irgendein reicher Privatmann mit Sammelwut darauf und wärmt sich während langer Winternächte an seinem Anblick.«
»So lange kann es eigentlich nicht völlig verschwunden sein«, meinte ich. »Dieses Foto stammt aus deutlich jüngerer Zeit.«
Dougs Augen zeigten mir, dass seine Begeisterung deutlich zunahm. Nun war es an der Zeit, zu gehen. Er stand kurz vor einer seiner Phasen, in der er sich wie ein anhänglicher Schoßhund aufführte. Falls ich nicht einlenkte, würde er mir überallhin folgen.
»Sollte ich es finden, darfst du es mal knuddeln«, versprach ich. »Bevor ich es zurückgebe.«
»Komm schon, Derek. Darf ich dich begleiten?«
»Vergiss es. Erinnerst du dich noch an letztes Mal?« Doug hatte mich monatelang genervt, weil er einen Fall gemeinsam mit mir lösen wollte. Ich war so leichtsinnig gewesen, ihn an der Suche an einem vermissten Teenager teilnehmen zu lassen. Als wir im Garten des Ferienhauses der Eltern auf den Knaben gestoßen waren, musste er sich über der Leiche erbrechen.
»Das war etwas Anderes«, behauptete er mit flehentlicher Stimme. »Diesmal gehe ich mit Erfahrung ran.«
»Mag sein«, entgegnete ich. »Aber ich möchte dich wirklich nicht dabeihaben, wenn ich unterwegs bin. Die Leute meinen sonst, ich sei von der Wohlfahrt.«
»Das ist billig, Derek!«, beschwerte er sich. »Hör bitte auf, vom Thema abzulenken.«
»Tu ich doch gar nicht. Bei der Sache habe ich nur ein ungutes Gefühl. Und hier bist du mir eine größere Hilfe, weil das tatsächlich dein Erfahrungsgebiet ist. Davon abgesehen bezahlt dich die Universität dafür, dass du deinen Kram in dieser Bude erledigst, nicht draußen auf der Straße.«
Damit schaffte ich es immer wieder. Er knickte ein, sobald ich an sein Pflichtgefühl appellierte.
Als ich mich zur Tür umdrehte, hielt er mich zurück. »Warte«, verlangte er. »Du willst bestimmt weitere Infos zu dem Amulett. Irgendwo hier muss noch ein Buch rumliegen.«
Ich lachte, und er stimmte mit ein. Das war einer unserer klassischen Witze, es gab wenige Themen unter der Sonne, über die Doug kein Buch hatte. Irgendwo. Die Betonung lag auf irgendwo, denn solange er keine Bibliothekarin heiratete, standen die Chancen schlecht, dass er ein Buch fand, nachdem er suchte.
»Warte. Ich weiß, wo es ist.« Er stöberte in einem Haufen hinter seinem Schreibtisch und richtete sich schließlich mit einem kleinen verstaubten Band in der Hand auf, der in Leder geschlagen war. »Mit einem Philanthropen in Ur«, las er auf dem Rücken. »Von George Dunlop.«
Als er den Namen nannte, ließ ich fast das Foto fallen, als ich es in meinen Geldbeutel zurücksteckte.
»Dunlop ist hier jedem ein Begriff«, erklärte er weiter. »Er war hier an der Uni Professor für antike Geschichte und leistete vor der Expedition nach Ur zuverlässige Arbeit in der Türkei. Darüber, wie das Amulett entdeckt wurde, kennt man bestimmte Einzelheiten. Noch mehr Hokuspokus, fürchte ich. Der alte Dunlop hat in der Wüste offensichtlich zu viel Sonne abbekommen, aber zumindest wirst du einen besseren Begriff von dem erhalten, was du suchst.«
Ich nahm ihm das Buch ab. Es passte perfekt in meine Jackentasche. Dougs Gesicht verschaffte mir die Gewissheit, dass mein Fall jetzt einen Anfang hatte. Nachdem ich mich bei Doug bedankt hatte, brach ich mit dem Versprechen auf, ihm den ersten Blick auf das Amulett zu gewähren.
*
Ich machte mich auf den Weg zurück in die reale Welt. Es regnete wieder in Strömen. Das Wasser durchnässte meine Kleidung. Als ich die Bank erreichte, war ich aufgeweicht, obwohl die Länge des Fußwegs weniger als eine Viertelmeile betrug. Ich zahlte ein, der Angestellte am Schalter grinste. Zwei seltene Ereignisse.
Als ich das Gebäude verließ, schüttete es immer noch heftig, fast waagerecht. Kleine alte Damen trotzten dem Wind, indem sie sich in verwegenen Posen mit ihren Schirmen dagegenstemmten. Mehrere Jugendliche, in dünnen Shirts und luftigen Hosen, kamen vorbei, wollten cool aussehen, doch sie quälten sich durch die Gegend. Im Vorbeigehen lockte mich das Tennants. Ich wusste, ich hatte noch einen weiten Marsch vor mir, doch die Vorstellung, bei diesem Wetter weiterzugehen, gefiel mir nicht. Dafür drängte sich der Gedanke an ein gepflegtes Bierchen auf. Solche Ideen endeten oft in einem schlimmen Absturz. Ich riss mich zusammen. Jetzt war es wichtig, mehr über den Anhänger in Erfahrung zu bringen. Also kehrte ich in meine Wohnung zurück.
Ich wohnte im ersten Stock eines Hauses aus viktorianischer Zeit. Geschäfte unter mir, Studenten oberhalb. Dafür habe ich meine eigene Treppe und eine Tür parterre mit Sicherheitsschloss. Bei Tag pflege ich sie zuzumachen, aber nicht abzusperren. Und als ich mich nun näherte, fiel mir auf, dass sie ein Stück weit offenstand. Zu solchen Zeiten wünschte ich mir, anderswo zu wohnen, an einem beschaulicheren Ort, an dem man nicht Gefahr lief, von Dieben, Drogenabhängigen oder Trunkenbolden belästigt zu werden. Auf der Treppe war niemand zu sehen, allerdings roch es leicht nach Verdorbenem, ohne dass ich den Gestank hätte einordnen können. Doch der Geruch verflog, während ich nach oben ging. Mein Büro, oder besser gesagt der Raum, in dem ich meine Kundschaft empfange, ist in Wirklichkeit ein breiter Flur am oberen Treppenabsatz. Von dort gelangt man über einen Durchgang links in meine Wohnung, rechts ins Bad. Die Einrichtung besteht aus zwei großen Sesseln und einem Schreibtisch. Diese Möbel stehen mitten in dem breiten Raum und verleihen ihm eine bedrohliche kafkaeske Aura. Um ihn gemütlicher anmuten zu lassen, hatte ich mehrere große Topfpflanzen heraufgeschleppt, doch die starben nach und nach ab. Ihre welken Blätter lagen verstreut auf den Hartholzbohlen. Nicht zum ersten Mal wollte ich daran denken, eine Putzkraft einzustellen, doch solch einen Luxus konnte ich mir nicht leisten.
Zehn Minuten später ging ich in meinen eigentlichen Wohnbereich. Ich hatte die untere Tür verriegelt und war bald in meinem Sessel zur Ruhe gekommen. Bier und Zigaretten warteten griffbereit. Es dauerte nicht lange, bis ich in Dunlops Welt aus Sonne, Wüste und sengender Hitze verloren ging. Irgendwann döste ich ein, doch selbst im Traum spann sich der Faden weiter.
*
Wir waren knapp zwei Monate in der Wüste gewesen, ehe sich die Lage zugespitzt hatte.
Johnson wurde immer unzufriedener, weil wir nur selten Fortschritte machten. »Sie haben mir Entdeckungen versprochen«, sagte er zu mir. »Von Wundern, die Tutanchamun oder Troja den Rang ablaufen würden. Doch was habe ich bekommen? Tongefäße und bedeutungslose Schmierereien auf Steintafeln, mehr nicht.«
»Aber wir nähern uns weiter an«, wiederholte ich zum x-ten Mal in dieser Woche. »Die bedeutungslosen Schmierereien, wie Sie es nennen, sind eine Bestandsaufnahme, eine Liste aller Schätze, die gemeinsam mit den Priesterkönigen begraben wurden.«
»Das sagen Sie«, erwiderte Johnson übellaunig. »Aber wo sind die Gräber? Wo liegen sie, Ihre tollen Priesterkönige? Wann geben Sie mir etwas Besseres als Tonscherben?«
Darauf konnte ich ihm keine Antwort geben. Die Tafeln kündeten von großem Reichtum, aber was ich brauchte, war eine Karte, denn ohne gruben wir nur blindlings drauflos. Tafeln und Töpferware deuteten darauf hin, dass wir wohl die richtige Richtung eingeschlagen hatten, doch es konnte noch Monate dauern, bis wir etwas von Wert oder sogar die Gräber der Priesterkönige fanden.
Doch genau das wollte Johnson nicht hören. »Als ich Sie in Glasgow nach der Ausgrabungsstätte fragte, an der die Wahrscheinlichkeit, etwas zu entdecken, am höchsten sei, nannten Sie diese Stelle«, erinnerte er. Seine blauen Augen waren weit aufgerissen. Ich rechnete jeden Moment mit einem Wutausbruch. »Täuschte ich mich, als ich Vertrauen in Sie setzte?«
»Nein«, antwortete ich entschieden. »Es ist bloß so, dass die Arbeiten ihre Zeit brauchen. Jede Schicht muss katalogisiert und beschrieben werden, bevor man weitermachen kann.«
»Wieso?« Diesmal brüllte Johnson. »Packen sie das verfluchte Dynamit aus, dann sprengen wir die Düne!«
»Das können wir nicht!« Ich versuchte, ebenso laut zu sein. »Denken Sie an die Archäologie.«
»Die Archäologie ist mir egal!« Johnson nahm eine Tontafel vom Tisch und zerbrach sie an meinem Stuhl. »Ich will Ergebnisse sehen, und zwar sofort!« Damit stürmte er aus dem Zelt.
Ich sammelte die Scherben der Tafel auf. Zum Glück waren es nur wenige, die ich leicht wieder zusammensetzen konnte. Ob ich Johnsons Verhältnis zur Wissenschaft kitten konnte, war eine andere Frage. Doch dieses Ei hatte ich mir wegen des Geldes, das er zum Fördern der Ausgrabungen spenden sollte, selbst ins Nest gelegt. Beschweren musste ich mich also nicht.
Diesen Traum träumte ich nun schon seit vielen Jahren. Schliemann hatte sein Troja, Carter sein Ägypten, und ich sollte mein Ur haben, älter als beide. Die wahre Wiege der Zivilisation. Ich hatte lange nach einem Sponsor gesucht, die Akademie abgeklappert, Vorlesungen für die Royal Society gehalten, sogar vor Frauenorganisationen gesprochen, doch nie war etwas dabei herausgekommen. Bis ich eines Abends eine Dinnerparty in Kelvinside besuchte. Man stellte mich einem beleibten Mann mit funkelnden Augen und viel Geld vor. Johnson hatte sich von meinem Enthusiasmus anstecken lassen, wollte aber Gold, Sarkophage, Gesichtsmasken, Statuen und so weiter. Er wollte Carter übertrumpfen. Ich für meinen Teil wollte die Priesterkönige sehen, anfassen und mir die Gewissheit verschaffen, dass sie wirklich existiert haben. Ich wollte wissen, wie sie lebten, die, die den Beginn unserer Zivilisation markierten.
Ich widmete mich wieder der Übersetzung der Tafeln, wie ich es getan hatte, bevor Johnson in mein Zelt gestürmt war. Irgendwie fühlte ich mich ähnlich frustriert wie mein edler Spender. Diese Ausgrabung zählte zu den heißesten und staubigsten, die ich jemals beaufsichtigt hatte. Selbst Karthago war nicht so schlimm gewesen. Doch mir blieb nichts anderes übrig, als immer weiter zu katalogisieren. Die Methoden der Wissenschaft, beziehungsweise die Bedürfnisse der Archäologie, verlangten es, was gleichwohl nicht bedeutete, dass ich bisher nicht jeden Abend auf Erfolg gehofft hatte. Doch auch heute sollte er ausbleiben. Die Tafeln an jenem Tag sprachen von Getreide, Wein und Honigwaben. Alles sehr interessant, aber nichts, was Johnson zufriedengestellt hätte. Ich schleppte mich zu meinem Klappbett und betete erneut darum, etwas zu finden.
Am nächsten Morgen war es heiß und dunstig. Genauso wie immer. Ich aß zum Frühstück das trockene, harte Brot, das man in jener Gegend kannte, und spülte es mit einem Glas lauwarmem Tee hinunter, bevor ich hinausging, um zu begutachten, wie weit die Ausgrabungen fortgeschritten waren. Inzwischen waren wir fünfzig Fuß tief in die Seite der Düne vorgedrungen und mussten nun mehr Stützen aufstellen, um den Tunnel am Einstürzen zu hindern. Meine erste Arbeitsstunde verbrachte ich damit, eine weitere Lage Bretter zu kontrollieren, ehe ich zur Grabung selbst hinunterstieg. Der junge Campbell hatte erneut einen Stoß Tafeln gefunden, die er für vielversprechend hielt. Die Tatsache, dass er dies schon bei den letzten drei Stapeln Tafeln, die ihm in die Hände gefallen waren, gesagt hatte, schien seinen Feuereifer nicht zu mindern. Ich kniete mich neben ihn und half dabei, den Bereich zu säubern. In dieser gleichförmigen Tätigkeit verlor ich mich. Daher bemerkte ich erst, als Sonnenlicht in die Öffnung fiel und unsere Schatten dunkel auf den Boden warf, wie viel Zeit vergangen war.
Ich klopfte Campbell auf die Schulter. »Kommen Sie. Zeit für eine Pause und etwas Wasser.«
Dann passierte es. Etwas, das dieses Projekt, und mein Leben, für immer veränderte. Wir waren gerade aus dem Tunnel gestiegen, als weitere Schatten auf uns fielen. Ich blickte auf, blinzelte gegen die Sonne und sah, wie jemand über die Düne auf uns zukam. Zunächst erkannte ich nur ein unförmiges Ding, wie eine riesige Qualle. Womöglich trat ich sogar vor Furcht einen Schritt zurück, auf jeden Fall lief mir ein kalter Schauer über den Rücken. Mein junger Mitarbeiter stand hinter mir. Und zu dem Zeitpunkt, als ich mich wieder zusammengerissen hatte, war die Gestalt aus der Helligkeit getreten, sodass ich sehen konnte, dass es sich um einen alten Araber handelte, dessen Gewand gespenstisch flatterte. Als er näherkam, sah ich, dass er nicht nur alt, sondern uralt war. Seine Haut war faltig und fleckig wie die Rinde eines Jahrhundertbaums, während das Haar in einzelnen, grauen Strähnen von einer mit Altersflecken übersäten Kopfhaut herabhing. Die blauen Augen strahlten jedoch hell, und als er sprach, klang seine Stimme kraftvoll, sein Englisch makellos. »Ich suche Mr Johnson«, sagte er, als sei er gerade an einer stark befahrenen Verkehrsstraße auf uns gestoßen. »Wären Sie so freundlich, mich zu ihm zu bringen?«
»Ich bin Johnson.« Die Antwort kam aus dem Hintergrund.
Ich drehte mich um und sah meinen Förderer. Dass sich der Mann stark betrunken hatte, erkannte man deutlich. Seine Augen waren blutunterlaufen. Die Haare, sonst sorgfältig gekämmt, standen unordentlich von seinem Kopf ab. Die Haut zeigte eine kränklich graue Blässe.
Den alten Araber schien das nicht zu kümmern. »Mr Johnson. Freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Vermutlich verfüge ich über Informationen, die für uns beide von Wert sein könnten.«
Johnson schaute mich verwundert an.
Ich zuckte nur mit den Achseln, hatte keinerlei Erklärung zu unserem Besucher. Der griff unter sein Gewand und nahm eine Flasche heraus. »Ich habe hier einen guten Brandy. Dafür ist es spät genug, und in Ihrem Zelt wird es kühler sein als hier draußen. Ich verspreche Ihnen, mein Angebot wird Ihre Probleme lösen.« Den letzten Satz richtete er direkt an Johnson. Dessen Gesichtsausdruck veränderte sich. Er machte sich offensichtlich Hoffnungen. Der Araber packte ihn am Arm und führte ihn zum richtigen Zelt. Ich wurde sofort misstrauisch. Campbell suchte meinen Blick.
Ich zog die Schultern hoch. »Das Letzte, was er braucht, ist noch mehr Alkohol. Eigentlich brauchen wir jetzt etwas Wasser.«
Zehn Minuten später waren wir zum Tunnel zurückgekehrt. Johnson hatte sein Zelt noch nicht wieder verlassen. Er ließ sich auch nicht blicken, als ich mit Campbell Feierabend machte. Erst kurz vor Sonnenuntergang sah ich den Dicken wieder. Ich rauchte gerade eine zweite Zigarre und trank meinen dritten Gin. Die Temperaturen sanken, die Fliegen schwärmten nicht mehr, und ich trug mittlerweile einen sauberen Anzug aus sprödem Leinen. Für kurze Zeit war das Leben erträglich.
Johnson ging an meinem Zelt vorbei. Er wirkte geistesabwesend und wäre in Gedanken versunken weitergegangen, hätte ich ihn nicht gerufen. Seine Frisur lag wieder wie gewohnt glatt an, der trübe Blick war verschwunden. Womit er den Nachmittag auch immer verbracht hatte, Alkohol, da war ich mir sicher, hatte er nicht getrunken. »Ach. Hallo, Dunlop«, grüßte er, als sei er überrascht, mich in meinem eigenen Zelt anzutreffen. »Ich wollte nur noch etwas frische Luft schnappen.«
Ich lud ihn zu mir ein, bot ihm einen Drink und eine Zigarre an.
Die Zigarre nahm er, den Gin schlug er aus. »Ich fürchte, gestern Nacht habe ich es ein wenig übertrieben«, gestand er betreten. »Ein Versuch, meinen Kummer zu ertränken.«
»Was wollte der alte Araber hier?«, fragte ich. »Hatte er irgendetwas Interessantes für Sie?«
Er musste überlegen. »Nein, er ist nur ein Wüstenfuchs, der versucht, reichen Ausländern etwas Geld aus der Tasche zu ziehen«, behauptete er. Doch ein guter Lügner war er nicht. »Bitte vergessen Sie unsere Auseinandersetzung gestern Abend«, fügte er hinzu. »Ich bin mir sicher, dass Sie beizeiten fündig werden.« Daraufhin drehte er sich um und ging wieder.
Ich machte mich auf die Suche nach Campbell. Der junge Mann saß in seinem Zelt und brütete über den Tafeln, die er heute entdeckt hatte. »Langsam wird es spannend«, sagte er, als ich eintrat. »Diese Tafel zeigt mir, wie viele Diener mit dem großen König begraben wurden, zu welchen Familien sie gehörten und wie viel sie wert waren.«
Positive Neuigkeiten, doch mich beschäftigte Johnsons eigenartiges Verhalten. »Lassen Sie eine Minute davon ab«, bat ich Campbell. »Ich möchte, dass Sie nachsehen, ob unser Dynamit noch vollzählig ist.«
»Wegen Johnson, nicht wahr? Er spricht ja seit Tagen von nichts anderem.«
Ich nickte. »Er wird wissen, dass ich beunruhigt bin, wenn er sieht, dass ich mich in die Nähe des Sprengmaterials begebe. Vergewissern Sie sich einfach, dass es sicher verwahrt ist, dann können Sie gleich wieder zurückkommen. Am Morgen werde ich dann ein kurzes Gespräch mit ihm führen. Wir brauchen sein Geld, aber nicht um jeden Preis.«
Campbell salutierte wie ein Soldat, spöttisch, und ging. Als er fort war, betrachtete ich die Tafel, an der er gerade arbeitete. Er hatte Recht, sie war der Beweis, dass wir uns in der Nähe einer bedeutsamen Grabstätte befanden. Ich spürte, dass mein Herz schneller schlug, während ich weiterlas. Plötzlich zerriss ein Knall die nächtliche Stille. Ich fiel fast um vor Schreck, war aber schon aus dem Zelt Richtung Tunnel gelaufen, bevor meine Ohren aufgehört hatten, zu klingeln.
Unten fand ich Campbell, nicht weit entfernt von der Stelle, an der wir tagsüber gegraben hatten. Er hielt eine Öllampe, die fast erlosch, als ich sie ihm aus der Hand nahm, dann aber wieder aufflammte, als ich mich bückte, um ihn zu untersuchen. Eine Beule, so groß wie ein Ei, direkt über seinem rechten Ohr. Er atmete gleichmäßig, fror aber in der aufkommenden Kälte.
Staub und Sand legten sich in die Grube. Ich erkannte, dass die Explosion ein Loch in den Raum gesprengt hatte. Tiefe Schwärze, die sich bis weit in die Düne erstreckte. Ich war unschlüssig; sollte ich dem jungen Mann helfen oder Johnson in das Loch folgen? Natürlich half ich.
Campbells Augenlider flimmerten, als er zu mir aufblickte und sich an meinem Arm festklammerte. »Sie müssen ihn aufhalten«, wisperte er heiser. »Er wird die Ausgrabungsstätte zerstören.« Er wollte aufstehen, doch sein Schwindelgefühl zwang ihn wieder in die Knie. Dann stieß er mich von sich. »Gehen Sie! Verhindern Sie es. Bitte! Ich komme schon klar.«
Einer weiteren Aufforderung bedurfte es nicht. Ich stieg tiefer in die Düne hinab. Meine Laterne strahlte nicht hell genug, um dem Dunst etwas entgegenzusetzen, der noch vor mir waberte. Dennoch konnte ich die Fußspuren im Durchgang erkennen. Ich ging gebückt und hielt die Lampe dicht über den Boden. So konnte ich ihnen nach unten folgen. Nach zehn Yards wurde die Luft wieder klarer, und ich konnte erkennen, dass die Wände zu beiden Seiten nicht mehr aus gepresstem Sand bestanden. Es waren Steinblöcke. Wir waren wirklich nahe dran.
Ein Teil von mir wollte verweilen, um die Piktogramme zu untersuchen, die die Wände zierten, aber eine tiefe, beschwörende Stimme in mir zwang mich zum Weitergehen. Die Luft wurde kälter, stickig und modrig, der Sprechgesang lauter. Erneut durchfuhr mich ein kalter Schauder, der nicht auf den plötzlichen Temperatursturz zurückzuführen war.
*