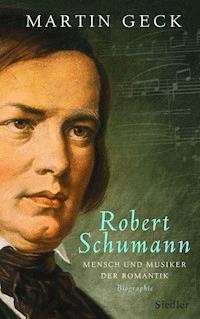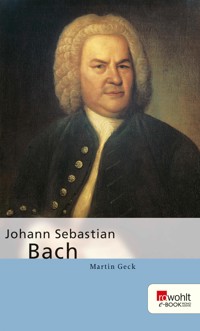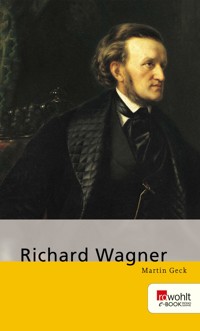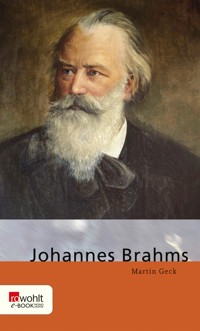9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Rowohlt E-Book Monographie Ludwig van Beethoven steht in seiner Zeit und zugleich über ihr. Bedeutend sind die Anregungen, welche der schulisch kaum gebildete, seinem geistigen und politischen Lebensraum jedoch engagiert und skeptisch zugewandte Künstler durch Aufklärung, Französische Revolution, Napoleonkult, Weimarer Klassik und idealistische Philosophie erhalten hat. Nicht minder imponierend ist die ästhetische Summe, welche der sein Zeitalter überragende Komponist letztlich zieht: Sein Werk, ein Wunder an Prägnanz, Vielfalt und Differenziertheit, wird für Zeitgenossen und Nachfahren zum Inbegriff von Musik als kraftvoll zusammengefasster Individualität. Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Martin Geck
Ludwig van Beethoven
Über dieses Buch
Rowohlt E-Book Monographie
Ludwig van Beethoven steht in seiner Zeit und zugleich über ihr. Bedeutend sind die Anregungen, welche der schulisch kaum gebildete, seinem geistigen und politischen Lebensraum jedoch engagiert und skeptisch zugewandte Künstler durch Aufklärung, Französische Revolution, Napoleonkult, Weimarer Klassik und idealistische Philosophie erhalten hat. Nicht minder imponierend ist die ästhetische Summe, welche der sein Zeitalter überragende Komponist letztlich zieht: Sein Werk, ein Wunder an Prägnanz, Vielfalt und Differenziertheit, wird für Zeitgenossen und Nachfahren zum Inbegriff von Musik als kraftvoll zusammengefasster Individualität.
Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.
Vita
Martin Geck, 1936–2019. Studium der Musikwissenschaft, Theologie und Philosophie in Münster, Berlin und Kiel. 1962 Dr. phil., 1966 Gründungsredakteur der Richard-Wagner-Gesamtausgabe, 1970 Lektor in einem Schulbuchverlag, nachfolgend Autor zahlreicher Musiklehrwerke, 1974 Privatdozent, 1976 ordentlicher Professor für Musikwissenschaft an der Universität Dortmund. Seit 1996 Leiter der Internationalen Dortmunder Bach-Symposien.
2001 mit dem Gleim-Literaturpreis ausgezeichnet. Zahlreiche, in 15 Sprachen übersetzte Bücher zur deutschen Musik- und Kulturgeschichte des 17. bis 19. Jahrhunderts. Im Rowohlt Verlag sind von ihm erschienen: «Bach. Leben und Werk» (2000); «Von Beethoven bis Mahler. Leben und Werk der großen Komponisten des 19. Jahrhunderts» (2000); «Johann Sebastian Bach» (2000, rm 50637); «Ludwig van Beethoven» (2001, rm 50645); «Die Bach-Söhne» (2003, rm 50654); «Richard Wagner» (2004, rm 50661); «Mozart. Eine Biographie» (2005); «Wenn Papageno für Elise einen Feuervogel fängt» (2007); «Felix Mendelssohn Bartholdy» (2009, rm 50709); «Johannes Brahms» (2013, rm 50686). Ferner erschienen im Siedler Verlag: «Robert Schumann. Mensch und Musiker der Romantik» (2010); «Wagner. Biographie» (2012); «Matthias Claudius. Biographie eines Unzeitgemäßen» (2014); «Beethoven. Der Schöpfer und sein Universum» (2017); «Von den Wundern der klassischen Musik: 33 Variationen über ein Thema» (2017); im Olms Verlag: «Die Sinfonien Beethovens. Neun Wege zum Ideenkunstwerk» (2015); «B-A-C-H. Neue Essays zu Werk und Wirkung» (2016); im Metzler Verlag: «Beethoven-Bilder: Was Kunst- und Musikgeschichte (sich) zu erzählen haben» (2019, mit Werner Busch).
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2013
Copyright © 1996, 2001 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung -> noch zu klären
Coverabbildung Bildarchiv der Österr. Nationalbibliothek, Wien
ISBN 978-3-644-49701-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
«Mozart’s Geist aus Haydens Händen»
Jahre des Aufbruchs (1770–1800)
Beethoven ist ein Mythos. Der 1901 vollendete «Beethoven» Max Klingers, heute im Leipziger Gewandhaus thronend, mag zeitverhaftet sein und steht doch für diesen überzeitlichen Mythos.[1] Der Oberkörper des Dargestellten ist entblößt – die Darstellung urmächtiger, jedoch gesammelter Energie. Die Gesichtszüge zeigen konzentriertes Sinnen, der Blick geht nach innen und zugleich in die Weite. Die Fäuste sind als Ausdruck des Willens ineinandergeballt. Um die Figur ist Einsamkeit und Stille. Der zu Füßen des Helden auf nacktem Felsgrund hockende Adler ist als Herr der Lüfte und Gipfel Symbol des Genies, das keine Grenzen kennt, zugleich Sinnbild göttlicher Inspiration, die sich ihren Mann sucht, ohne dass dieser im Letzten darum wüsste.[2] Engelsköpfe, die den gewaltigen Thron zieren, stehen für das Seraphische, das Himmlisch-Leichte, das gleichfalls zur Aura der Beethoven’schen Kunst gehört.
Die Reliefdarstellungen des Thronrückens, die Motive der griechischen Mythologie und der christlichen Heilslehre detailliert aufgreifen, bleiben im Hintergrund und sind doch beziehungsreich: Beethovens Musik ist nicht nur im Sinne der emphatischen Musikanschauung Arthur Schopenhauers Ausdruck des Willens schlechthin; zugleich setzt sie sich mit antikem, christlichem und aufklärerischem Ideengut ausführlich und konkret auseinander. Davon zeugen nicht nur handlungs- oder textgebundene Werke wie das Ballett Die Geschöpfe des Prometheus oder die Missa solemnis: Gerade in der «reinen» Instrumentalmusik ist die Spannung zwischen selbstbezüglichen, musikalischer Eigengesetzlichkeit verpflichteten Momenten und solchen, die nach Deutung und weitergehendem Verstehen verlangen, zum philosophischen und ästhetischen Prinzip erhoben. Namentlich die Sinfonien erschließen sich in wesentlichen Dimensionen nur, wenn sie als Dialog mit spezifischen Traditionen, Themen und Symbolen abendländischen Denkens verstanden werden.
Max Klingers «Beethoven» zieht das Fazit eines Jahrhunderts, das den Komponisten von Anbeginn mythisiert hat. Schon ein Gemälde von Joseph Willibrord Mähler aus dem Jahre 1804 zeigt ihn in klassizistischer Manier als Kunstheros seines Zeitalters – es ist das Zeitalter Napoleons, der seinerseits schon zu Lebzeiten zum Mythos wird. Doch Napoleon ist immerhin Inbegriff des Staatskünstlers, diktiert Verfassungen, bewegt Heere und versetzt ganze Nationen in Aufruhr. Beethoven ist «nur» Musiker und dennoch früh mit der Aura einer Größe umgeben, welche gelegentlich diejenige von Goethe und Schiller zu übertreffen scheint. Man mag das damit begründen, dass sich die musikalische Kunst in ihrer Dialektik von Sammlung und Flüchtigkeit, abstrakter Ferne und sinnlicher Nähe zur Mystifizierung besser eigne als alle anderen Künste, sollte jedoch nicht übersehen, dass der Komponist Beethoven in entscheidenden Dimensionen diese Vorstellung von Musik selbst geschaffen hat.
Wird Bach als Urvater der Musik vom 19. Jahrhundert erst entdeckt, so ist Beethoven von Anfang an sein Heros. Joseph Daniel Danhausers berühmtes Tableau von 1840, «Liszt am Flügel», das den gefeierten Virtuosen in der Gesellschaft von Alexandre Dumas, George Sand, Marie d’Agoult, Victor Hugo, Niccolò Paganini und Gioacchino Rossini am Klavier zeigt, könnte ebenso gut «Erinnerung an Beethoven» heißen, denn der fantasierende Liszt blickt wie verzückt zu einer Büste Beethovens auf, die vor einem romantisch bewölkten Himmel weit größer und mächtiger erscheint als die Gestalt seines Verehrers.
Kein Geringerer als Richard Wagner hat dazu beigetragen, dass im Mythos Beethoven Texturen aus Werk und Leben unentwirrbar ineinander verwoben worden sind. «Nicht also das Werk Beethoven’s, sondern jene in ihm enthaltene unerhörte künstlerische That haben wir hier als den Höhepunkt der Entfaltung seines Genius’ festzuhalten», schreibt er in seiner emphatischen Beethoven-Schrift des Jahres 1870.[3] Hier erübrigt sich die Trennung von empirischem Leben und künstlerischem Werk angesichts eines gemeinsamen Dritten, das mit Wagner als «Tat», mit anderen Beethoven-Deutern als «Ethos» zu bezeichnen ist.
Vor diesem Horizont setzen sich auch die schmuckloseste Biographie und die nüchternste Werkbeschreibung dem Verdacht aus, ihrerseits am Mythos Beethoven zu weben – denn welchen Sinn könnte es haben, über Beethoven zu schreiben, ohne die Bedeutsamkeit seiner Tat und seines Ethos im Sinne eines Mythos vorauszusetzen? Kein Autor kommt umhin, Zusammenhänge zu konstruieren und Deutungen von Fakten vorzunehmen, die bei einer weniger wichtigen Person nicht mit Emphase arrangiert, sondern längst dem Vergessen überantwortet worden wären.
Gewiss ist es Aufgabe der Forschung, Legendäres und Anekdotisches von Authentischem zu trennen. Doch was ist in einem höheren Sinne authentisch? Sind es beispielsweise die aus den letzten Lebensjahren des Komponisten erhaltenen Konversationshefte, von denen um die einhundertachtzig erhalten sind? Ungeachtet mancher Lücken scheinen sie vordergründig gut geeignet, um Tagesablauf und persönlichen Umgang des ertaubten Meisters kontinuierlich zu dokumentieren. Bereichert es aber unser Wissen über den Beethoven der Neunten und der späten Quartette, wenn wir seine Klagen über eine liederliche Köchin registrieren oder seine Probleme mit einfachen Rechenoperationen nachvollziehen?
Der Vorsatz, sich lieber ganz auf das Werk und dessen immanente Struktur zu konzentrieren, führt zu einer nicht weniger nachhaltigen Begegnung mit dem Mythos Beethoven. Zum einen fließt in jede Werkbetrachtung zumindest untergründig ein, was über das Leben und über die jeweiligen kompositorischen Absichten des Komponisten bekannt ist; sonst gäbe es zum Beispiel keine respektvolle Rede vom «Spätwerk». Zum anderen geschieht rein «strukturelles» Analysieren keineswegs voraussetzungslos, sondern geradezu als Dienst am Mythos von der absoluten Musik und ihrem Priester Beethoven: dass Musik, der man emphatisch Werkcharakter zuspricht, an sich stimmig sei und für sich lebe, ist eine stimulierende, niemals aber objektivierbare Denkkonstruktion.
Den skizzierten Problemen muss sich auch der Autor dieser Monographie stellen: Dank der Hilfe des Beethovenarchivs kann er zwar Daten und Fakten nach dem neuesten Stand der Forschung mitteilen. Indessen stellt bereits die Auswahl der besprochenen Quellen, Sachverhalte und Kompositionen eine Wertung dar – schon gar deren Deutung. Und vor allem dort, wo das im weitesten Sinne des Wortes «biographische» Material in die Auseinandersetzung mit dem musikalischen Schaffen einfließt, ist der Grat zwischen produktiver Werkerschließung und interpretatorischem Übereifer schmal.
Freilich ist dieser Sachverhalt zugleich eine spannende Herausforderung: Dass Leben, Denken und Schaffen eng wie bei keinem anderen großen Komponisten ineinander verwoben und die aus ihnen erwachsenen Werke gleichermaßen abgeschlossen wie interpretationsbedürftig sind, nötigt zu immer neuen Denkanstrengungen, das Phänomen Musik in seiner Subjekt-Objekt-Spannung zu verstehen. Der Autor gesteht, in diesem Sinne nirgendwo mehr gelernt zu haben als bei Beethoven.
Ludwig van Beethoven wurde im Dezember 1770 in eine Musikerfamilie hineingeboren, deren unbestrittenes Haupt der Großvater Ludwig d.Ä. war. Dieser kam 1712 als Sohn eines Bäckermeisters im flämischen Mecheln zur Welt, besuchte schon mit fünf Jahren eine Chorschule und schlug früh die Laufbahn eines Sängers und Chorleiters ein. Als solcher wirkte er zunächst in Löwen und Lüttich; 1733 ging er als Mitglied der kurkölnischen Kapelle nach Bonn. Dort stieg er schließlich zum Hofkapellmeister auf, dem die Kirchen-, Bühnen- und Tanzmusik unterstand. Nebenbei betätigte er sich im Weinhandel und Geldverleih. Er starb am Heiligen Abend des Jahres 1773 – zu einem Zeitpunkt, als sein Enkel Ludwig immerhin drei Jahre alt und somit in der Lage war, in seinem Gedächtnis frühe Eindrücke vom Großvater zu bewahren, dem er seinen Namen verdankte. Mit seiner Frau Maria Josepha Poll hatte Ludwig drei Kinder, von denen nur eines am Leben blieb: Johann. Dieser, Beethovens späterer Vater, wurde 1739 oder 1740 in Bonn geboren und heiratete 1767 die aus der Nähe von Koblenz stammende Maria Magdalena Keverich, die bereits mit 21 Jahren verwitwete Tochter eines Kochs.
Das Eheglück dürfte nicht ungetrübt gewesen sein; jedenfalls wird Beethovens Mutter mit der Äußerung zitiert: «Was ist Heyrahten, ein wenig freud, aber nachher, eine Kette, von Leiden.»[4] Im Blick auf die ersten Ehejahre mögen solche Einschätzungen aus ihrem offenbar zur Schwermut neigenden Naturell begründet werden. In späterer Zeit hatte Magdalena auch äußeren Grund zu Klagen: Johann van Beethoven, der bereits mit zwölf Jahren in den kurfürstlichen Chor aufgenommen und nach dem Stimmbruch als Tenorist in der Bonner Hofkapelle eingestellt worden war, kam zwar zunächst beruflich voran, wurde jedoch bereits 1784 in einem amtlichen Bericht wegen seiner Armut und «ganz abständigen Stimm»[5] abschätzig beurteilt. Vermutlich schon zu diesem Zeitpunkt vom Alkohol abhängig und außerdem eines Betrugsversuches bezichtigt, war er dazu prädestiniert, in ein anonymes Verzeichnis «guter Spürhunde, welche anjetzt dienstlos und um billigen Preis zu vermieten sind», aufgenommen zu werden.[6]
Das genaue Geburtsdatum Beethovens steht nicht fest. Vermutlich ist es der 16. Dezember 1770. Beethoven selbst hielt hartnäckig an der Vorstellung fest, sein Taufschein sei in Wahrheit der seines älteren Bruders Ludwig Maria. Die meiste Zeit seines Lebens glaubte er, im Dezember 1772 geboren zu sein. Im «Heiligenstädter Testament» machte er sich sogar drei bis fünf Jahre jünger, als er war.
Als er 1792 starb, war seine Frau Maria Magdalena schon fünf Jahre tot. Sie hatte ihm sieben Kinder geboren, von denen nur die drei Söhne Ludwig (1770–1827), Kaspar Karl (1774–1815) und Nikolaus Johann (1776–1848) das Erwachsenenalter erreichten. Ludwig, im elterlichen Haus in der Bonngasse geboren und am 17. Dezember 1770 in der St.-Remigius-Kirche getauft, kam als zweites Kind auf die Welt. Da der erstgeborene Ludwig Maria nur wenige Tage alt geworden war, wuchs der zweite Ludwig in der Rolle des Ältesten und Vormundes seiner Brüder heran.
Ab etwa 1775 wohnte die Familie für rund zehn Jahre im Haus des Bäckermeisters Fischer in der Rheingasse; das 1944 zerstörte Haus lag direkt am Rhein, an der Stelle, wo heute das Hotel «Beethoven» steht. Vom Besuch der Elementarschule des Herrn Ruppert hielt Vater Johann nach den Erinnerungen Gottfried Fischers, Sohn des Bäckermeisters und nebst seiner Schwester Cäcilie Jugendgenosse Beethovens, wenig; statt den Ältesten in die Schule zu schicken, habe er ihn «frühe an das Klavier gesetzt und ihn stränng angehalten». Zum Klavierspiel musste Ludwig «auf einem kleine Bännkgen» stehen; außerdem erlernte er das Violin-, später auch das Orgelspiel. Der Vater scheint mit dem Sohn nicht gerade schonend verfahren zu sein, sofern er nicht systematisch studierte, sondern auf seinem Instrument «Dummes Zeüg durcheinanderkratzte», das heißt probierte und improvisierte.[7]
Der Knabe muss sich mit der Erfahrung auseinandersetzen, dass der Zugang zu den Glücks- und Machtgefühlen, die das Ausüben von Musik bereiten kann, mit endlosen Anstrengungen, Aufregungen, Versagungen und Angriffen auf die eigene Person verknüpft ist. Ein unter solchen Vorzeichen aufgewachsener Künstler mag es als seine Lebensaufgabe ansehen, der Menschheit zu dienen. Weshalb auch immer – viele Äußerungen des späteren Beethoven handeln jedenfalls von Verzicht und Verantwortung, etwa das Bekenntnis im Brief an Joseph von Varena vom Dezember 1811: Nie von meiner ersten Kindheit an ließ sich mein Eifer der armen leidenden Menschheit wo mit meiner Kunst zu dienen mit etwas anderm Abfinden[8], oder die Niederschrift in den Konversationsheften von 1823: Wenn ich hätte meine Lebenskraft mit dem Leben so hingeben wollen, was wäre für das edle, bessere geblieben?[9]
Von geregeltem Schulbesuch kann bei Beethoven noch weniger die Rede sein als bei anderen Kindern, die früh zur Ausbildung von besonderen Fertigkeiten angehalten werden. Innerhalb der Grundrechenarten hat er kaum die Hürde der Addition genommen. In den musikalischen Skizzen des erwachsenen Künstlers finden sich Rechenversuche simpelster Art; analog zeigen sich Probleme bei der Taktzählung und -notierung. Amüsant und zugleich bewegend zu lesen ist der Nachhilfeunterricht, den der Neffe Karl seinem Onkel wenige Monate vor dessen Tod erteilt, indem er ihn via Konversationsheft das kleine Einmaleins von vorwärts und rückwärts abfragt und dann bemerkt: «Die Multiplikation ist nur eine vereinfachte Addition. Die Rechnung geschieht also auf dieselbe Art. Man schreibt jedes Theilprodukt unter seine Stelle, besteht es aus 2 Ziffern, so wird die linke zum Theilprodukt der nächsten Stelle addirt. Ein kleines Beyspiel: 2348 ist mit 2 zu multipliziren […].»[10]
Die «ehmahlichen Stattur» seines um zehn Jahre älteren Hausgenossen nennt Gottfried Fischer – in rheinischem Dialekt und eigenwilliger Orthographie – «kurz getrungen, breit in die Schulter, kurz von Halz, dicker Kopf, runde Naß [Nase], schwarzbraune Gesichts Farb, er ginng immer was vor übergebükt»[11]. Der auffälligen Gesichtsfarbe wegen wird der Junge «Spangol», das heißt Spagnuolo (Spanier), genannt. Fischer erzählt von Lausbubenstreichen und vergnüglichen Szenen im Leben des kleinen Ludwig, den man sich gleichwohl als Einzelgänger vorstellen darf. Eines Morgens soll er sinnend aus dem Schlafzimmerfenster geschaut und seine Abwesenheit mit den Worten entschuldigt haben: Ich war da, in einem so schöne, tiefe Gedanken beschäftig, da konnt ich mich gar nicht stören laße.[12] Geradezu Symbolwert hat die Erinnerung an den Knaben, der auf den Speicher klettert, um durchs Fernrohr auf das Siebengebirge zu schauen.
Ob Beethoven zu solcher Muße oft Gelegenheit gehabt hat, sei freilich dahingestellt, denn Pflichten gab es genug. Früh beginnt die Karriere eines Wunderkindes: Schon als Siebenjähriger, in den Ankündigungen des Vaters noch um ein Jahr jünger gemacht, trat er im benachbarten Köln innerhalb einer musikalischen Akademie laut Programmzettel «mit verschiedenen Clavier-Concerten und Trios»[13] auf. Elfjährig wirkte der junge Ludwig als unbesoldeter Vertreter des neuberufenen Organisten Christian Gottlob Neefe in der Bonner Hofkapelle mit; mit dreizehn Jahren wurde er nach anfänglich erfolgloser Fürsprache des Obristhofmeisters und Hofmusikintendanten Graf zu Salm und Reifferscheid regulärer zweiter Hoforganist. Bald darauf folgte die Suspendierung des Vaters vom Hofdienst.
Oberster Dienstherr war der von 1761 bis 1784 regierende Maximilian Friedrich von Königsegg, Kurfürst und Erzbischof von Köln, zugleich Fürstbischof von Münster. In Kaspar Risbecks «Briefen eines reisenden Franzosen in Deutschland» findet sich im Jahr 1780 das Lob: «Die jetzige Regierung des Erzbisthums Köln und des Bisthums Münster ist ohne Vergleich die aufgeklärteste und thätigste unter allen geistlichen Regierungen Deutschlands. Die ausgesuchtesten Männer bilden das Ministerium des Hofes von Bonn.»[14]
Über die Stadt und die kurfürstliche Residenz heißt es in einem anderen Bericht aus demselben Jahr: «Bonn ist eine hübsche, reinlich gebaute Stadt, und seine Straßen leidlich gut gepflastert, alle mit schwarzer Lava. Es ist in einer Ebene am Flusse gelegen. Das Schloß des Kurfürsten von Köln begrenzt den südlichen Eingang. Es bietet keine Schönheiten in der Architektur, und ist durchaus einfach weiß, ohne irgendwelche Ansprüche.»[15] Obwohl sich der Kurfürst nach seinem Amtsantritt zur Sparsamkeit genötigt sah, blieb er ein Liebhaber und Förderer der Künste. Gleich in seinem ersten Regierungsjahr wies er Ludwig van Beethoven d.Ä. in die freigewordene Kapellmeisterstelle ein.
Die Bonner Hofmusiker waren gemäß ihren zeitüblichen Pflichten in drei Bereichen tätig: Kirche, Kammer, Theater. In der konzertanten Kirchenmusik herrschte der traditionelle italienische Stil vor; die vor allem im prächtigen Akademiesaal des Schlosses anberaumten Konzerte, welche zu Beethovens Zeiten bereits die vor- und frühklassische Sinfonik ins Programm nahmen, wurden von Zeitgenossen gerühmt. Im «Bönnischen Intelligenzblatt» hieß es angesichts der Feierlichkeiten zur Einweihung der Universitätsbibliothek im Jahre 1786: «Mittags wird bey Hofe an verschiedenen Tafeln gespeist, und Abends um halb 6 Uhr auf dem großen Akademiesaal ein großes musicalisches Concert gehalten, wobey nebst dem hohen Adel und sämmtlichen Kurfürstl. Räthen mit ihren Ehefrauen, auch erwachsenen Söhnen und Töchtern, die Geistlichkeit, die Officire, die Glieder der Universität, fast alle Fremde von Distinction erscheinen können.»[16]
Kurfürst Maximilian Friedrich, um den Aufbau eines Nationalschauspiels bemüht, unterhielt zwar keine eigene Theatertruppe, übernahm aber die Kosten für angesehene Privatgesellschaften, zuletzt für diejenige des Ehepaars Großmann. Im «Comödienhaus», einem Teil des Schlosses, wurden – zuletzt unentgeltlich – Schauspiele, vor allem aber Singspiele, Operetten und gelegentlich auch anspruchsvollere Opern gegeben, wobei im Stehparterre auch das bürgerliche Publikum Zutritt hatte.
Der junge Beethoven nahm an alledem als Organist, Cembalist und – den Besoldungslisten zufolge – auch als Bratschist teil, zunächst als Helfer Neefes, dann zunehmend mit selbständigen Aufgaben. Er hatte somit einschlägige Anregungen in Fülle und bei allem das Glück, wichtige Bereiche der höfischen Musikkultur als unmittelbar Beteiligter miterleben zu können. Freilich musste er früh das Leben eines Erwachsenen führen und gegebenenfalls bis in die Nacht hinein zur Verfügung stehen. Seine Galauniform beschreibt Gottfried Fischer mit den Worten: «See grüne Frackrock, grüne, kurze Hoß mit Schnalle, weiße Seite oder schwarze Seide Strümpf, Schuhe mit schwarze Schlöpp, weiße Seide geblümde West mit Klapptaschen, mit Shappoe, das West mit ächte Goldene Kort umsetz, Fisirt mit Locken und Hahrzopp, Klackhud, unterem linken Arm sein Dägen an der linke seite mit einer Silberne Koppel.»[17]
Schon in jungen Jahren mussten die Söhne «Johann den Läufer», wie ihn der Großvater spöttisch getauft hatte[18], aus dem Wirtshaus holen und – mit den Worten Fischers – «auf die feinste art, um das es nur kein Aufwannt gab, im stille nach Hauß … begleiten»[19]. Spätestens seit dem Tod der Mutter im Jahre 1787 war Ludwig das eigentliche Familienoberhaupt; Ende 1789 ersuchte er den Kurfürsten, die Hälfte des Gehalts, das dem nicht mehr dienstfähigen Vater zustand, ihm selbst zur Ernährung der Familie zufließen zu lassen. Dass der Vater inständig bat, die peinliche Angelegenheit geheim zu halten, dokumentierte zwar Ludwigs Machtstellung in der mutterlosen Familie, musste aber zugleich Gefühle der Verachtung auslösen. In der Tat ist nicht Vater Johann, sondern Großvater Ludwig Vorbild und Idol Beethovens gewesen; des Letzteren Bildnis ließ er 1801 nach Wien schaffen, um es in seiner Wohnung an bevorzugter Stelle aufzuhängen.
Dennoch sollte man die Bedeutung des Vaters vor allem für den künstlerischen Werdegang Ludwigs nicht gering einschätzen. Johann sorgte dafür, dass Standespersonen ins Haus kamen, die das Talent, ja das Genie des Knaben zu schätzen wussten und ihn ermunterten, in der Komposition fortzufahren. Außerdem unternahm er mit seinem Sohn allerlei Reisen in die Umgebung, welche seinen Bildungshorizont erweiterten.
Von noch größerer Bedeutung dürfte freilich die Aufnahme gewesen sein, die Beethoven in der Bonner Adelsfamilie Breuning fand, deren Mitglieder er in späteren Jahren seine damaligen Schutzengel genannt haben soll.[20] In der Hofrätin Helene von Breuning hatte er eine mütterliche Vertraute, in ihrer Tochter Eleonore eine altersgleiche Jugendfreundin und in ihrem Sohn Stephan, der 1801 als Jurist nach Wien ging, einen lebenslangen Freund. Ein solcher war auch Eleonore von Breunings späterer Mann, der Arzt Franz Gerhard Wegeler, welcher sich 1838 erinnerte: «Beethoven wurde bald als Kind des Hauses behandelt; er brachte nicht nur den größten Theil des Tages, sondern selbst manche Nacht dort zu. Hier fühlte er sich frei, hier bewegte er sich mit Leichtigkeit, Alles wirkte zusammen, um ihn heiter zu stimmen und seinen Geist zu entwickeln.»[21]
Wer von Beethovens ersten, zum Teil nur noch dem Namen nach bekannten Musiklehrern nachhaltigen Einfluss auf seinen Werdegang ausgeübt hat, lässt sich kaum mehr rekonstruieren. Festzuhalten ist, dass in Neefe zur rechten Zeit ein fähiger, vielseitig gebildeter Lehrmeister zur Verfügung stand. Der 1748 in Chemnitz geborene Komponist verbrachte entscheidende Jahre seiner Ausbildung in Leipzig, wo er einerseits mit dem Werk Johann Sebastian Bachs konfrontiert, andererseits von Johann Adam Hiller zur Komposition von komischen Opern und Singspielen animiert wurde. Angeregt vom Kurfürsten, der ein Verehrer Mozarts war, fertigte er Übersetzungen und Klavierauszüge von dessen Opern an. Auch als Komponist beachtlicher Sololieder und dem Sturm und Drang nahestehender Klavierkompositionen war er durchaus in der Lage, Beethoven zu fördern.
Von dessen Genie früh überzeugt, unterrichtete Neefe seinen Schüler in der Tradition des Generalbasses und auf der Grundlage des «Wohltemperierten Klaviers»; zugleich machte er ihn mit dem vor- und frühklassischen Stil Carl Philipp Emanuel Bachs, Haydns und Mozarts bekannt. Unzweifelhaft weckte oder förderte er auch Beethovens aufklärerischen und humanistischen Sinn. Das Credo seiner Autobiographie von 1782: «Die Großen der Erde lieb’ ich, wenn sie gute Menschen sind […]. Schlimme Fürsten hass’ ich mehr als Banditen»[22] wirkt in Sätzen fort, die Beethoven 1793 im Geiste Schillers der Nürnbergerin Johanna Theodora Vocke ins Stammbuch schrieb: Freyheit über alles lieben, Wahrheit nie, (auch sogar am Throne nicht) verlaügnen.[23] Die Vorstellung, dass auch und gerade Musik den höheren Zielen der Menschheit zu dienen habe, konnte Beethoven aus den Anschauungen Neefes unmittelbar übernehmen.
Letzterer war nicht nur Aufklärer, sondern auch Freimaurer. In seinem Gesuch um Aufnahme in den Illuminatenorden, eine auch in Bonn tätige Nachfolge- und Tarnorganisation der unter Verfolgung leidenden Freimaurerlogen, in welcher er es zum Lokaloberen bringt, nennt er als seine Ideale: «Handhabung der Rechte der Menschheit […] Duldung der Schwachheit, Unterricht dem Unwissenden, Aufklärung dem Irrthum» usw.[24] Ende 1787 gründeten Illuminatenkreise eine vom Kurfürsten geförderte, dem allgemeinen Fortschritt in Kunst, Wissenschaft und Volkserziehung verpflichtete «Lesegesellschaft», welcher viele Personen aus Beethovens Bekanntenkreis angehörten, unter ihnen neben Neefe die Hofmusiker Nikolaus Simrock, Franz Anton Ries und Anton Reicha.[25]
Christian Gottlieb Neefe sorgte nicht nur 1782 für Beethovens erste Veröffentlichung in Gestalt von neun Klaviervariationen über einen Marsch von Ernst Christoph Dressler, sondern verfasste auch ein Jahr später die erste publizierte Nachricht über das junge Genie: «Louis van Betthoven spielt sehr fertig und mit Kraft das Clavier, ließt sehr gut vom Blatt, und um alles in einem zu sagen: Er spielt größtentheils das wohltemperirte Clavier von Sebastian Bach.»[26]
In seiner Schule zeigte Beethoven alsbald kompositorische Leistungen, die im allgemeinen Bewusstsein nur deshalb nicht neben denen des jungen Wolfgang Amadeus Mozart stehen, weil sie im einschlägigen Werkverzeichnis von Kinsky/Halm nur am Ende unter den «Werken ohne Opuszahl» (WoO) geführt werden. Namentlich die drei «Kurfürstensonaten» für Klavier WoO 47 von 1782/83 und vielleicht noch mehr die drei Klavierquartette WoO 36 von 1785 sind Ausdruck früher Könnerschaft. Die Klavierquartette – vermutlich auf Anregung des Lehrers nach dem Vorbild der Mozart’schen Violinsonaten KV 296, 379 und 380 geschrieben – sind in puncto Zielstrebigkeit, Eigenwilligkeit und Leidenschaft gleichwohl eigengeprägt.
Nach 1785 scheint Beethovens kompositorische Produktivität vorübergehend zurückgegangen zu sein. Ein im Frühjahr 1787 begonnener Studienaufenthalt in Wien, der wegen des nahenden Todes der Mutter abgebrochen werden musste, bleibt ohne nachweisliche künstlerische Folgen, obwohl möglicherweise eine Begegnung mit Mozart zustande gekommen ist. Es ist denkbar, dass Beethoven in diesen Jahren – neben fortlaufendem Hofdienst – bevorzugt an seiner allgemeinen Bildung gearbeitet hat. Jedenfalls schrieb er sich am 14. Mai 1789 in die Matrikel der Bonner Universität ein.
Diese war drei Jahre zuvor vom neuen, von 1784 bis 1794 regierenden Kurfürsten Maximilian Franz, dem jüngsten Sohn der österreichischen Kaiserin Maria Theresia, mit dem Auftrag gegründet worden, die Menschen denken zu lehren – also im Zeichen der Aufklärung, die im Erzbistum Köln spürbarer herrschte als in den meisten weltlichen Reichsstaaten deutscher Sprache. Speziell von der Residenzstadt Bonn bemerkte Wilhelm von Humboldt 1788, man könne in der Hofbibliothek und selbst im «Lesekabinett auf dem Markte die besten periodischen Schriften sowohl als gelehrte und politische Zeitungen und Bücher» finden.[27] Beethoven dürfte kaum kontinuierlich Kollegs besucht oder Bücher studiert, sich vielmehr – wie auch in seinem weiteren Leben – jeweils ad hoc angeeignet haben, was ihm fehlte und was ihm entgegenkam.
Anders als Haydn und Mozart, die das Musikhandwerk zwar gleichfalls von der Pike auf gelernt, jedoch keine Gelegenheit zum Erwerb von politischer und philosophischer Bildung gehabt hatten, sah sich Beethoven augenscheinlich schon früh nicht nur als angehender Tonsetzer, sondern auch als kritischer Zeitgenosse, der am allgemeinen Bildungsdiskurs der Zeit teilzunehmen entschlossen war. Zu seiner Philosophie in Tönen, wie sie aus vielen seiner Werke spricht, ist er nicht unvorbereitet gekommen: Kaum einer hat bereits in jungen Jahren ähnlich bewusst und bildungshungrig aus den geistigen Quellen seiner Zeit geschöpft.
Mozart hat auf seinen Reisen mit wachen Sinnen aufgenommen, was Land und Leute an Anregungen zu bieten hatten. Beethoven, ihm darin gewiss unterlegen, war demgegenüber ein Geistesmensch. Als solcher konnte er im Jahre 1809 mit einigem Recht gegenüber den Verlegern Breitkopf & Härtel von sich behaupten: Es gibt keine Abhandlung die sobald zu gelehrt für mich wäre ohne auch im mindesten Anspruch auf eigentliche Gelehrsamkeit zu machen, habe ich mich doch bestrebt von Kindheit an, den Sinn der bessern und weisen jedes Zeitalters zu fassen.[28]
Im Blick auf zwei Zeitgenossen – Friedrich Schiller und Eulogius Schneider – lässt sich Beethovens Drang, auf der Höhe der Zeit zu sein, exemplarisch verdeutlichen. Schillers Dramen gehörten zum Repertoire der Großmann’schen Truppe; die vielerorts – übrigens auch in Wien – durch Zensur unterdrückten «Räuber» waren in Bonn schon in der Saison 1782/83, bald nach der Mannheimer Uraufführung, zu sehen.[29] An der Universität führte der als Freigeist geltende Elias van der Schüren in die Philosophie des von Schiller so verehrten Aufklärers Immanuel Kant ein, welcher in der damals etwa 11000 Einwohner zählenen Residenzstadt bei den Gebildeten große Beachtung fand.
Schillers Freund Bartholomäus Ludwig Fischenich lehrte an der Bonner Universität seit 1792 griechische Literatur sowie Natur- und Menschenrecht; er pflegte innerhalb seiner Vorlesungen zum «größten Entzücken seiner Zuhörer» gelegentlich Schillers Gedichte vorzutragen.[30] Eine Mitteilung Fischenichs an Charlotte von Schiller aus dem Jahre 1793, Beethoven wolle die «Ode an die Freude» – «und zwar jede Strophe» – bearbeiten, interessiert nicht nur im Blick auf die Vorgeschichte der Neunten Sinfonie, verdeutlicht vielmehr den hohen Stellenwert, den Schillers Idealismus bereits damals für Beethoven hatte.
Mit dem erläuternden Zusatz, Beethoven sei nämlich «ganz für das Große und Erhabene»[31], lässt Fischenich ahnen, dass mehr als eine strophisch-schlichte Liedvertonung zur Disposition stand, nämlich die der griechischen Antike nachempfundene Vorstellung eines dichterisch-musikalischen Gesamtkunstwerks von idealem, gemeinschaftsstiftendem Wert. Nicht von ungefähr haben spätere Generationen im nachfolgenden sinfonischen Stil Beethovens die mitreißende Kraft der Pindar’schen Ode wiederzufinden gemeint, welche der zeitgenössischen Ästhetik als Inbegriff des Erhabenen galt.[32]