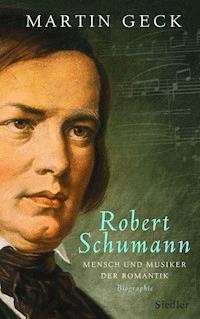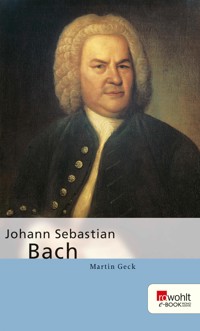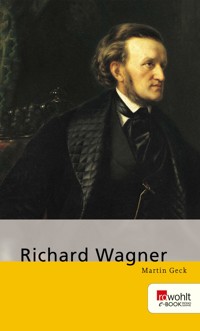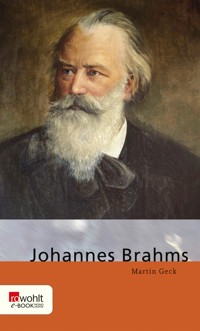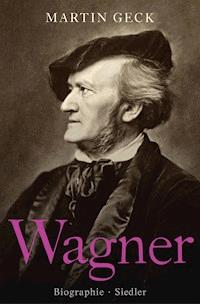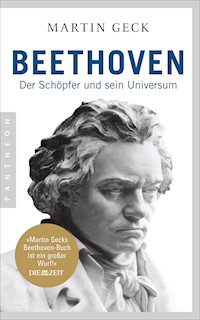
15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Martin Gecks großes Werk über Beethoven – den bis heute meistgespielten Komponisten unserer Zeit
Um 1800 ereignet sich eine musikalische Revolution: Ludwig van Beethoven erschafft mit der Eroica, dem Fidelio oder der 9. Sinfonie die Welt ein zweites Mal. Martin Geck, einer der besten Beethoven-Kenner, zeigt in seinem Werk das Universum dieses Jahrhundertgenies auf unkonventionelle Weise: Welches Verhältnis pflegte Beethoven zu Goethe, Napoleon und Schubert? Und wie wichtig war Beethoven seinerseits für Richard Wagner, Glenn Gould oder Aldous Huxley? In charmanten wie kenntnisreichen Porträts erschließt Geck die Leitbilder Beethovens, seine Zeitgenossen und Nachfahren – und erklärt so seine ungebrochene Strahlkraft.
Mit zahlreichen Abbildungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 652
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Zum Buch
Um 1800 ereignet sich nicht weniger als eine musikalische Revolution: Ludwig van Beethoven erschafft mit der Eroica, dem Fidelio oder der 9. Sinfonie die Welt ein zweites Mal. Martin Geck, »Doyen der Musikwissenschaft« (Frankfurter Allgemeine Zeitung) und einer der besten Kenner des Komponisten, vermisst in seinem Werk das Universum dieses Jahrhundertgenies auf unkonventionelle Weise.
Zum Autor
Martin Geck war Professor für Musikwissenschaft an der Universität Dortmund. Seine Bücher zur Musikgeschichte und seine Biographien großer Komponisten (u.a. über Mozart, Bach und Wagner) wurden von der Kritik hoch gelobt und in ein Dutzend Sprachen übersetzt. Für sein Buch über Johann Sebastian Bach wurde er mit dem Gleim-Literaturpreis ausgezeichnet. Er starb 2019.
MARTIN GECK
BEETHOVEN
Der Schöpfer und sein Universum
Siedler
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2017 by Siedler Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv: Ludwig van Beethoven, Büste von Hugo Hagen, ca. 1892 © Pictures from History / Bridgeman Images
Lektorat: Fritz Jensch, München
Satz: Ditta Ahmadi, Berlin
Notensatz: Georg Allescher, München
Reproduktionen: Aigner, Berlin
ISBN 978-3-641-19436-9V004
www.siedler-verlag.de
Inhalt
Vorwort
TITANISMUS
Napoleon Bonaparte
Wilhelm Furtwängler
Lydia Goehr
»FESTIGKEIT«
Johann Sebastian Bach
Aldous Huxley
Glenn Gould
NATUR
Jean-Jacques Rousseau
Leonard Bernstein
Tintoretto
TOLLHEITEN IM UMFELD DER EROICA
Fürst Franz Joseph Maximilian von Lobkowitz
Wolfgang Robert Griepenkerl
Hans von Bülow
LEBENSKRISEN, GOTTERGEBENHEIT, KUNSTFRÖMMIGKEIT
Johann Michael Sailer
Karl van Beethoven
Die »unsterbliche Geliebte«
PHANTASTIK
William Shakespeare
Robert Schumann
Jean Paul
TRANSZENDENZ
Friedrich Hölderlin
Caspar David Friedrich
Paul Nizon
STRUKTUR UND GEHALT
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Theodor W. Adorno
Paul Bekker
UTOPIEN
Richard Wagner
Thomas Mann
Hanns Eisler
KOMPONIEREN IM SCHATTEN BEETHOVENS
Franz Schubert
Felix Mendelssohn Bartholdy
Franz Liszt
VIRTUOSES KLAVIERSPIEL IM ZEICHEN BEETHOVENS
Clara Schumann
Artur Schnabel
Elly Ney
BEETHOVEN EN FRANCE
Romain Rolland
Igor Strawinsky
Gilles Deleuze
Epilog: Und wo bleibt Goethe?
ANHANG
Anmerkungen
Bibliographie
Werkregister
Personenregister
Vorwort
Universum – diese Metapher sollte man zwar vor ausuferndem Gebrauch schützen, jedoch einem künstlerischen Werk zubilligen, das im Lauf von zwei Jahrhunderten Weltgeltung erlangt hat und dank neuer Medien inzwischen nahezu erdumspannend präsent ist: Ein Klick am Computer genügt, um mit der Fünften oder der Pathétique in unmittelbaren Kontakt zu treten.
Solche Allgegenwart braucht ernsthafte Musikologen oder Kulturhistoriker freilich nicht zu stromlinienförmigen Darstellungen zu animieren, die noch dem Letzten die Bedeutung des großen Komponisten einzuhämmern versuchen. Vielmehr ist weiterhin ein Blick angesagt, der von Liebe, zugleich aber von Genauigkeit gelenkt ist.
Genauigkeit kann jedoch ganz unterschiedlichen Vorhaben zugutekommen: einer vielbändigen, detailverliebten Lebensbeschreibung, einer Sammlung eingehender Werkanalysen oder einer umfänglichen Darstellung der Rezeptions- und Wirkungsgeschichte. Doch wer schreibt noch solche »erschöpfenden« Bücher – und wer liest sie? Besser gleich ein ganzes Universum – mit dem Mut zur Lücke. Da kann man sich – trotz planvoller Kapitelanordnung – an beliebiger Stelle einlesen: Weil in einem Universum alles mit allem zusammenhängt, wäre es von vornherein hoffnungslos, die Erscheinung Beethoven entlang eines geradlinigen Zeitstrahls erfassen zu wollen.
Bei aller Ausdehnung hat das Beethoven-Universum ein Zentrum, nämlich die Werke; deren Kernbestand wird auf den folgenden Seiten aus unterschiedlichsten Richtungen angeleuchtet. Die ersichtliche Konzentration auf Kompositionen, die im aktuellen Musikleben präsent sind, ist nicht einer Bequemlichkeit des Autors, sondern der Sache selbst geschuldet: Vor allem die musikalischen Laien unter den nachfolgend auftretenden Künstlern und Denkern haben sich stets mit zentralen Kompositionen Beethovens beschäftigt – also mit Werken, die auch heutige Musikliebhaber vielleicht nicht vollständig im Kopf, jedoch meist in guter Erinnerung haben. Auf musikalisch Bekanntes zu stoßen mag Leserinnen und Leser dafür entschädigen, dass gleich um die Ecke Überraschungsgäste wie Caspar David Friedrich oder Gilles Deleuze lauern.
Was hat mich als Autor zu dieser besonderen Darstellungsform bewogen? Ich wollte dem Prinzip treu bleiben, jeder meiner Komponistenbiographien ein unverwechselbares Profil zu geben. Diesmal schien es mir überfällig, über einen großen Komponisten nicht länger als Fachmann ex cathedra zu schreiben, sondern als ein Sänger im Chor der vielen Stimmen, die sich originell zu Beethoven geäußert haben oder bis in die Gegenwart hinein durch ihr eigenes künstlerisches Werk Licht auf das seine zu werfen vermögen.
Zudem wollte ich die »große Erzählung« verabschieden, der zufolge Beethoven zur Gegenwart hin immer besser verstanden worden ist – eine hybride Vorstellung angesichts der wohl zweifelsfreien Wahrnehmung, dass der Beethoven-Diskurs in allen seinen Phasen und Facetten eine enge Allianz von Aufgewecktheit und geistiger Armut hat ertragen müssen. Beide Momente sind in den folgenden Spiegelungen Beethovenscher Musik gegenwärtig, natürlich vor allem Erstere.
Meine zwölf themenzentrierten Expeditionen ins Beethoven-Universum starte ich nicht mit dem Anspruch, die Musik erklären zu wollen. Vielmehr stehen sie für das Motto »exempla docent« – Beispiele lehren. Was andere „ihrem“ Beethoven abgewonnen haben, muss man nicht als sekundären Diskurs abtun; vielmehr ist hier genuine Kunstkritik mit im Spiel. Diese hat nach Walter Benjamin keineswegs die Aufgabe, ein Werk oder ein Oeuvre auf traditionelle Weise „einzuordnen“. Kunstliebhaber sollen das Kunstwerk vielmehr in romantischer Tradition als ein Werdendes betrachten, es weiterentwickeln und immer neu vollenden.
Das ist nicht im Sinne eines Zeitstrahls gemeint, demzufolge das Ältere kein Recht hätte, das Jüngere zu interpretieren: Sehr wohl darf Beethoven auch von Shakespeare her gesehen werden. Denn in der inneren Wahrnehmung des engagierten Kunstkritikers verschwimmen nicht nur die Gattungen, sondern auch die Zeiten: Eins wirft Licht und Schatten auf das Andere.
Wer sich in diesem Sinne einem umfassenden Beethoven-Diskurs anvertraut, wird zugleich seiner eigenen Gefühls- und Gedankenströme als Beethoven-Hörer inne: Woher komme ich? Was bin ich? Wohin gehe ich?
Nach der Lektüre eines astronomischen Buches überraschte Robert Schumann seinen Gesprächspartner Felix Mendelssohn Bartholdy mit der Vorstellung, »höheren Sonnenbewohnern« müssten wir Erdenkinder, durchs Fernrohr betrachtet, »wie Milben auf einem Käse erscheinen«. – »Ja«, erwiderte der Freund, »aber das wohltemperirte Clavier würde jenen doch wohl einigen Respect einflößen.«1 Mir gefällt die Selbstverständlichkeit, mit welcher der Komponist eine exemplarische musikalische Schöpfung zum Nabel der Welt erklärt. Ich will es ihm nachtun und auf den folgenden Seiten Beethovens Musik zum Nabel der Welt machen – nicht weil man sie gleich derjenigen Bachs als ein Abbild höherer Schöpfungsordnung ansehen könnte. Sondern weil es um eine zutiefst menschliche Schöpfung geht – mit all ihren Höhenflügen und Verzagtheiten, Kampfesgesten und Friedensbotschaften.
Noch sitzt Beethoven entspannt im Café. Doch bald schon werden um die drei Dutzend Größen aus Politik, Kunst und Wissenschaft an seinen Tisch treten … (Skizze von Eduard Klosson aus dem Jahr 1823).
© Beethoven-Haus Bonn: Beethoven im Café, 1823 – Fotografie einer Zeichnung von Eduard Klosson
TITANISMUS
»Malen Sie mich ruhig auf einem wilden Pferde sitzend«, soll Napoleon Bonaparte zu Jacques-Louis David gesagt haben. Der Beethoven-Dirigent Wilhelm Furtwängler konnte mit solchem Titanismus gut umgehen. Lydia Goehr (*1960), Autorin von »The Beethoven Paradigm«, reagierte hingegen eher skeptisch.
© Getty Images: oben (Photo Josse/Lemage); © Lydia Goehr: Mitte; © ullstein bild: unten (Lebrecht Music & Arts)
Napoleon Bonaparte
Drei bedeutende Köpfe des deutschen Idealismus – Hegel, Hölderlin und Beethoven – rücken nicht nur durch ihr Geburtsjahr 1770 an den um nur ein Jahr älteren Napoleon heran, sondern auch als seine entschiedenen Verehrer. Hölderlin preist den Korsen in seiner Hymne Friedensfeier als »Fürst des Fests«, ohne ihn direkt beim Namen zu nennen; Hegel meint der »Weltseele« zu Pferde zu begegnen, als er Napoleon 1807 nach der Schlacht bei Jena und Auerstedt durch die Straßen Jenas reiten sieht. Und Beethoven will seine Sinfonia eroica nach Napoleon benennen oder ihm widmen.
Patrioten und Fachwissenschaftler deutscher Zunge waren über Generationen hinweg von dieser Napoleon-Begeisterung wenig angetan: Ob Philosoph, Dichter oder Komponist – keiner Geistesgröße steht es an, einem französischen Feldherrn und Usurpator zu huldigen! In diesem Sinne hat man sich gelegentlich auf die Position zurückgezogen, Hölderlins »Fürst des Fests« sei eine Phantasiefigur, Hegel habe das napoleonische System bestenfalls als Durchgangsstation auf dem Weg zu seinem »Vernunftstaat« betrachtet und Beethoven das Widmungsblatt der Eroica angesichts der Nachricht, Napoleon habe sich selbstherrlich zum Kaiser gekrönt, alsbald zerrissen. Doch was richtet das gegen den Mythos Napoleon aus: Der Korse ist bei seinem Staatsstreich des 18. Brumaire mit dreißig Jahren ein vergleichsweise junger Mann; und die Generation der Hölderlin, Hegel und Beethoven, viele junge Adelige eingeschlossen, sieht in ihm die große Hoffnung. Napoleon gilt ihnen als Pragmatiker und Heilsbringer in einem. Wie selbstverständlich verschmäht der dreißigjährige Beethoven die Perücke, um das »pechschwarze Haar« stattdessen nach dem Vorbild Napoleons »à la Titus« zu tragen;1 und noch im Januar 1820 wird man in Beethovens Konversationsheften über ihn lesen: Er sei zwar durch seine Hybris gescheitert, hatte aber »Sinn für Kunst und Wissenschaft und haßte die Finsterniß. Er hätte die Deutschen mehr schätzen und ihre Rechte schützen sollen. […] Doch stürzte er überall das Feudal System. und war Beschützer des Rechtes und der Gesetze.«2 Dass sich in Napoleon der Legalismus des Code civil mit schonungsloser Machtausübung verbindet, wird da zwar nicht übersehen, jedoch um des Prinzips Hoffnung willen hintangestellt.
Beethovens Bewunderung für den Korsen beruht nicht zuletzt darauf, dass dieser sich nicht infolge erblicher Privilegien, sondern aufgrund seiner strategischen Fähigkeiten zum Herrscher Europas hat aufschwingen können und sich dabei für grundlegende gesellschaftliche Umwälzungen eingesetzt hat. Der Schlüsselbegriff ist der des Genies; und was an dem napoleonischen Genie fasziniert, ist weniger in den Kategorien von Ethos und Moral zu fassen als vor dem Horizont dessen, was der Franzose »gloire« nennt und im Deutschen mit »Ruhm und Verdienst« zu übersetzen wäre: Die Bewunderung gilt einem Menschen, der durch sein Genie Taten vollbringt, die der Allgemeinheit zum Muster dienen und zugleich dem Individuum zu bleibendem Ruhm verhelfen.3 Das erinnert an die antiken Helden à la Alexander den Großen, mit denen sich Beethoven identifiziert, und bedeutet ein beständiges Stimulans, sich mit außerordentlichen Taten im Reich der Künste seinerseits ähnlichen Ruhm zu erwerben. Wie weit Beethovens Identifizierung mit Persönlichkeiten der Antike gehen kann, zeigt exemplarisch seine Haltung im Streit um die Vormundschaft über den Neffen Karl: In einer gerichtlichen Eingabe aus dem Jahr 1818 führt er an, auch Philipp von Mazedonien habe die Erziehung seines Sohnes Alexander (des Großen) selbst geleitet; das gleiche Recht nehme er nunmehr hinsichtlich seines Neffen für sich in Anspruch.
Der Topos der »gloire« ist deshalb so wichtig für den Komponisten und speziell für den Sinfoniker Beethoven, weil er weit mehr Sinnlichkeit ausstrahlt als alle ethischen Begriffe zusammen und sich daher zur Umsetzung in klangliche Vorstellungen anbietet: Beethoven kann hier an diverse Traditionen vokal-instrumentaler Staatsmusiken bis hin zur offiziellen Musik der Französischen Revolution anknüpfen und zugleich Neues schaffen.
Am 26. Januar 1793 schreibt Beethovens Freund Bartholomäus Fischenich aus Bonn an Schillers Gattin Charlotte über die künstlerischen Pläne des 22-jährigen Beethoven: »Er wird auch Schillers Freude und zwar jede Strophe bearbeiten. Ich erwarte etwas vollkommenes, denn soviel ich ihn kenne, ist er ganz für das Große und Erhabene.«4
Ob Beethoven ein genuiner Anhänger der Französischen Revolution gewesen ist, wissen wir nicht; man darf jedoch vermuten, dass er mit ihr zumindest von fern sympathisiert hat. Der Wahlspruch seines Bonner Kompositionslehrers Christian Gottlob Neefe lautete: »Die Großen der Erde lieb’ ich sehr, wenn sie gute Menschen sind. […] Schlimme Fürsten hass’ ich mehr als Banditen.«5 Beethoven selbst schreibt 1793 – in seinem ersten Wiener Jahr – der Nürnbergerin Theodora Vocke ins Stammbuch: »Freyheit über alles lieben; Wahrheit nie, (auch sogar am Throne nicht) verläugnen.«6
Noch 1812 findet sich unter den ersten Skizzen zur späteren neunten Sinfonie der Eintrag: »abgerissene sätze wie Fürsten sind Bettler«,7 womit Beethoven die Phrase »Bettler werden Fürstenbrüder« aus der Erstfassung von Schillers Ode an die Freude radikalisiert.8 Das spricht nicht gerade dafür, dass er damals die Ideale der Französischen Revolution – wohlgemerkt: deren Ideale – bereits dem Vergessen anheimgegeben hätte.
Jedenfalls beginnt mit den rasanten Erfolgen Napoleon Bonapartes, der mit dem Staatsstreich von 1799 zum Ersten Konsul und damit auf zehn Jahre zum Alleinherrscher Frankreichs aufsteigt, in Beethovens politischer Biographie ein neues Kapitel. Doch nicht nur ihm erscheint der Korse wie der sprichwörtliche Phönix, der sich aus der Asche der Französischen Revolution erhebt: Als solcher wird Napoleon vielmehr allenthalben bildlich und literarisch dargestellt. In dieser Rolle bewundert ihn selbst Goethe, der im Gegensatz zu Schiller ein Feind der Französischen Revolution gewesen war, in Napoleon aber jenen Prometheus findet, den er schon in dem Prometheus-Gedicht seiner Sturm-und-Drang-Jahre gefeiert hatte. Kein Geringerer als Friedrich Nietzsche schreibt in der Götzendämmerung: »Goethe hatte kein größeres Erlebnis als jenes ens realissimum, das Napoleon heißt.« Weiterhin postuliert er: »Das Ereignis, um dessentwillen er seinen Faust, ja das ganze Problem ›Mensch‹ umgedacht hat, war das Erscheinen Napoléons.«9
Es duldet kaum Zweifel, dass noch Beethovens Bekenntnis von 1819, für Erzherzog Rudolph bestimmt, im Geist der napoleonischen Ära geschrieben ist: »allein Freyheit, und weiter gehn ist in der Kunstwelt, wie in der ganzen großen schöpfung, zweck«.10
Offensichtlich ändert die Enttäuschung, die er im Jahrzehnt zuvor gegenüber Napoleons Usurpationsgelüsten empfunden hat, nichts an dem grundsätzlichen Wunsch, mit dem großen Korsen wie Goethe gleichsam auf Augenhöhe zu verkehren. In diesem Sinne charakteristisch ist der Ausspruch, den Beethoven nach Napoleons Sieg bei Jena und Auerstedt gegenüber dem Geiger Krumpholz getan haben soll: »Schade! daß ich die Kriegskunst nicht so verstehe wie die Tonkunst, ich würde ihn doch besiegen!«11
Auf eine einfache Formel gebracht, erblickt Beethoven in der sogenannten heroischen Periode seines Schaffens in Napoleon den Staatskünstler, der gut daran täte, ihn selbst zu seinem Staatskünstler zu machen. Mit solchen Vorstellungen nimmt er – darin Hölderlin nicht unähnlich – das idealisierte Bild einer Antike auf, in der Staatsmänner zugleich Künstler und Philosophen sind oder sich von solchen zu höheren Zielen leiten lassen.
In diesem Sinne betrachtet Beethoven nicht den Tagespolitiker Napoleon als Lichtgestalt, wohl aber den genialen Zeitgenossen, der als Lenker des Volks und der Völker zu prometheischen Taten ermuntert. Im Bereich der Kunst will es Beethoven dem großen Bruder gleichtun. Nicht nur er selbst sieht sich in diesem Sinne als einen Napoleon der Musik. Wäre Ähnliches nicht auch von anderen gesehen worden, so gäbe es wohl kaum die in den Konversationsheften notierte Frage eines Besuchers: »Heißt das nicht Handeln bey Ihnen: Componiren?«12 Beethoven, so sieht es der unbekannte Gast, verwirklicht im Bereich der Musik dasjenige, was in der Zeit angesagt ist, nämlich »Freiheit« und »Weitergehn«.
Für Beethovens Werk, vor allem für seine Sinfonik, bedeutet dies zweierlei. Zum einen ist es voller Momente, welche die Zeitgenossen gar nicht anders hören konnten denn als Widerhall der französischen und napoleonischen Revolutionsmusik, die zu Anfang des 19. Jahrhunderts in Teilmomenten freilich den Zeitgeschmack spiegelte und nicht nur als Beethovens Individualstil verstanden werden musste. Zum anderen spricht, allgemeiner gesehen, aus Teilen der Orchestermusik Beethovens ein »Titanismus«, der zwar ganz und gar ihm selbst – in gewissem Maß sogar nur ihm selbst – eigen ist, der jedoch zugleich als Ausdruck einer Aufbruchstimmung zu verstehen ist, die in der napoleonischen Ära herrscht.
Was das erste Moment, den unmittelbar hörbaren Widerhall der französischen Revolutionsmusik, betrifft, so ist dieser schon in den beiden ersten, zwischen 1799 und 1802 komponierten Sinfonien zu vernehmen. So erinnert das Hauptthema des Kopfsatzes der Ersten deutlich an das Thema einer Ouvertüre, die Rodolphe Kreutzer, Professor am neu gegründeten Pariser Conservatoire, anlässlich des Marathontages komponiert hat, durch dessen Feier die Kampfbegeisterung der Pariser während des Ersten Koalititonskriegs geschürt werden sollte.
Die Überlegung, dass Beethoven damit bloß einer Pariser Mode huldige, relativiert sich schnell, wenn man das zwischen erster und zweiter Sinfonie aufgeführte Ballett Die Geschöpfe des Prometheus op. 43 ins Auge fasst. Beethoven verantwortet diese Produktion des Wiener Hofburgtheaters, die es auf über 20 Aufführungen bringt, gemeinsam mit dem Ballettmeister Salvatore Viganò. Grundlage der Handlungsskizze des »heroisch-allegorischen Balletts« ist das mythologische Epos Il Prometeo, dessen ersten Gesang der italienische Dichter Vincenzo Monti 1797 unter dem Eindruck der militärischen und politischen Taten Napoleons verfasst hat; und über die Parallele von Prometheus und Napoleon kann schon deshalb kein Zweifel herrschen, weil Monti eine solche in seiner Widmung an Napoleon ausdrücklich herstellt. Zumal Beethovens Musik deutliche Anklänge an die offizielle Hymne des französischen Konsulats, »Veillons au salut de l’Empire«, zeigt, resümiert Peter Schleuning als Kenner der Materie vielleicht nicht zu Unrecht: »Man wird in dem Ballett eine Huldigung an Bonaparte als den zeitgenössischen Vollender mythischer Menschheitserziehung sehen müssen, wahrscheinlich aber auch einen mythologisch formulierten Aufruf an den französischen Konsul, auch die anderen europäischen, immer noch unter feudalistischer Herrschaft schmachtenden Völker zu befreien, eine Hoffnung, die zu jener Zeit alle fortschrittlichern Geister hegten.«13
In seiner Eroica greift Beethoven das zuvor im Ballett behandelte Thema Prometheus/Napoleon im Bereich der Sinfonik auf: Ein Thema aus dem Finale der Ballettmusik ist identisch mit dem satzbeherrschenden Kontretanzthema des Eroica-Finales. Und mehr als das: Indem Beethoven das Eingangsmotiv der Sinfonie als rudimentäre Vorform ebendieses Kontretanzthemas gestaltet, steuert er von Anbeginn auf dieses Finale zu.
Dass die Parallelität nicht inhaltsneutral, vielmehr an das ursprüngliche Prometheus-Sujet geknüpft ist, belegt die Tatsache, dass Beethoven diese seine dritte Sinfonie anfänglich nach Napoleon benennen oder ihm widmen will. Das Titelblatt einer Abschrift des Werks vom August 1804 lässt noch die vom Komponisten ausradierte Zeile »intitolata Bonaparte« und seinen eigenen handschriftlichen Bleistiftvermerk »Geschrieben auf Bonaparte« erkennen.
Auf die Nachricht hin, dass sich der Bewunderte am 2. Dezember 1804 in Paris selbst zum Kaiser gekrönt habe, soll Beethoven – wie erwähnt – das Titelblatt der inzwischen verschollenen Originalpartitur mit entsprechender Widmung zerrissen und ausgerufen haben: »Ist der auch nichts anders, wie ein gewöhnlicher Mensch! Nun wird er auch alle Menschenrechte mit Füßen treten, nur seinem Ehrgeiz fröhnen.«14
Das ist der Sache nach glaubhaft. Vielleicht ist alles jedoch viel prosaischer. Da Beethoven die Eroica für 700 Gulden seinem fürstlichen Gönner Lobkowitz – und damit einem Vertreter des österreichischen Hochadels – verkauft und ihm für weitere 80 Golddukaten gewidmet hat, verbietet sich jeder öffentliche Hinweis auf Napoleon schon von daher. Doch selbst wenn Beethoven die Kaiserkrönung zum Anlass genommen haben sollte, um von Napoleon mit Aplomb abzurücken, würde das nicht unbedingt bedeuten, dass damit das Thema Napoleon für ihn erledigt gewesen wäre.
Denn natürlich entgeht ihm nicht, dass seine Musik damals gerade in Paris hoch geschätzt wird. Und die im Jahr 1804 mehrfach mit Entschiedenheit geäußerten Pläne, dorthin zu ziehen und die später Fidelio genannte Oper Leonore mitzunehmen, liegen weiterhin auf dem Tisch. So fragt er im Jahr 1809 – also nicht lange nach Goethes Zusammentreffen mit Napoleon – seinen französischen Besucher Baron de Trémont, ob der Kaiser ihn wohl empfangen werde, falls er Paris besuche. Damals spielt er außerdem ernsthaft mit dem Gedanken, eine Kapellmeisterstellung am Kasseler Hof von König Jérôme, einem Bruder Napoleons, anzunehmen. Und wenig später überlegt er, ob er Napoleon seine C-Dur-Messe widmen solle. Auch sein weiteres Schaffen zeugt von einer Emphase, die sich gut mit dem herrschenden Napoleonkult verbinden lässt: Sie spricht nicht nur aus den drei ersten Sinfonien, sondern auch aus vielen Partien der Oper Fidelio, aus dem Violinkonzert, aus der Egmont- und aus der Coriolan-Ouvertüre sowie aus der fünften Sinfonie. Deren Finale gleicht einem »éclat triomphal«. Der Ausdruck stammt aus der französischen »Schreckensoper« dieser Jahre und steht, mit den Worten Karl H. Wörners, für den »heroisch-leidenschaftlichen Gestus, die vorwärtsstürmende Intensität, die atemlose Steigerung und den triumphierenden Zug als neue Qualitäten der Musik im ›revolutionären‹ Zeitalter«.15
In der Fünften zerschlägt Beethoven auf eine auch für ihn selbst einzigartige Weise den gordischen Knoten: Gegen die Macht des Schicksals vermag sich das einzelne Subjekt nicht durchzusetzen; es kann sich nur den großen Bewegungen der Zeit anschließen und das Bad in einer jubelnden Menge suchen. Und die besteht in diesem Fall aus dem – in seiner Rolle idealisierten – Volk der Französischen Revolution. Deren Schlachtruf »la liberté«, der sich mühelos der herausgehobenen Tonfolge c-h-c-d (T. 303f.) des Finales unterlegen lässt, könnte Beethoven der Hymne dithyrambique von Rouget de l’Isle, dem Komponisten der Marseillaise, entnommen haben.16 Auch sonst lässt die Französische Revolution grüßen: Eigens für den sieghaften Schlusssatz lässt Beethoven Piccoloflöte, Kontrafagott und drei Posaunen »aufmarschieren«. Es sind also speziell zur Militärmusik zählende Instrumente, deren Klang den sieghaften Gestus grundiert. Kaum bedarf es da noch der Erwähnung, dass sich das c-Moll des Kopfsatzes zu C-Dur aufhellt – mit aller damit verbundenen Metaphorik.
Man kann bezweifeln, dass der Weg von der bündigen motivisch-thematischen Arbeit des ersten Satzes zum Theatercoup des Finales, der Schritt vom Kampf zum Sieg, von der individuellen Bedrängnis zur kollektiven Befreiung mit letzter kompositorischer und philosophischer Stringenz erfolgt – ja dass dergleichen überhaupt möglich sei. Gleichwohl war das damalige Publikum von dem fast märchenhaften Befreiungsschlag ebenso fasziniert, wie es das heutige ist. Das sieghafte Finale soll nach dem Bericht des russischen Beethoven-Biographen Alexander Oulibicheff einen alten Grenadier anlässlich einer Pariser Aufführung kurz nach dem Tode Beethovens so mitgerissen haben, dass er »C’est l’Empereur, vive l’Empereur« rief und mit dieser spontanen Assoziation seinem alten Kaiser huldigte.17
Andere haben das heroische Moment der Fünften jeweils in ihrem Sinne gedeutet. So berichtet Richard Wagner über ein von ihm im Revolutionsjahr 1848 geleitetes Dresdner Hofkonzert: »König und Hof waren trübe gestimmt; auf dem ganzen Publikum lastete der düstere Druck einer Ahnung von nahen Gefahren und Umwälzungen. […] Da raunte mir der Geiger Lipinski zu: ›Warten Sie nur – beim ersten Strich der C-Moll ist alles fort!‹ Und richtig: die Symphonie beginnt, welches Aufjauchzen, welche Begeisterung!«18
Hier genügt schon der aufrüttelnde Beginn des Werks, um das Publikum von seiner depressiven Stimmung zu befreien. Spätestens mit dem Finale – das die Hörer vielleicht bereits am Anfang im Ohr haben – ist es dann so weit: Es reiht eine Siegesgeste an die andere. Den Schlusspunkt setzt die Apotheose des leitenden Finalthemas; sie mündet zum Zeichen höchster und allgemeiner Begeisterung in eine reine C-Dur-Klangfläche. Dass man den Satz gleichwohl als Sonatensatz verstehen könnte, geht darüber unter. Kein Wunder, dass Teile der Beethoven-Forschung von »Gemeinplätzen der Militärmusik« und »bedenklicher Volkstümlichkeit« sprachen.19 Auch für den Beethoven-Verehrer Richard Wagner gab es Anlass, sich über das Werk zu wundern. Seine Gattin notierte unter dem 14. Juli 1880 in ihrem Tagebuch: »Richard spricht beim Frühstück von der c-Moll-Symphonie, sagt, er habe viel über sie nachgedacht, es sei ihm, als ob da Beethoven plötzlich alles vom Musiker hätte ablegen wollen und wie ein großer Volkredner auftreten; in großen Zügen hätte er da gesprochen, gleichsam al fresco gemalt, alles musikalische Detail ausgelassen, was noch z. B. im Finale der Eroica so reich vorhanden wäre.«20
Das Finale der 1813 uraufgeführten Siebten hat Wagner als »Apotheose des Tanzes« bezeichnet21 – eine milde Formulierung angesichts des aufreizend Monomanen, das der Satz an sich hat: Das Hauptmotiv konfrontiert den Hörer mit einem wilden Taumel, der jedoch alsbald von den daraus abgeleiteten Marschrhythmen mit militärischer Straffheit diszipliniert wird. Ein Hinweis darauf, dass diese Marschrhythmen an eine Episode in François Joseph Gossecs Revolutionsmarsch Le triomphe de la République erinnern,22 erscheint zwar nicht überflüssig, da die Konzerte der Jahreswende 1813/14, in denen die umjubelte Siebte erstmals erklang, ganz im Zeichen der jüngsten militärischen Siege standen, die das Ende der napoleonischen Ära einläuteten. Jedoch wäre es nicht angebracht, diese Bezüge überzubetonen, da der Satz Momente von totaler Unterwerfung des Subjekts unter die andringenden Gewalten freisetzt, die aus dem Werk Beethovens generell – also weit über die zeitgeschichtliche Situation hinaus – nicht wegzudiskutieren sind. Wagner meinte im Gespräch mit Engelbert Humperdinck, man könne das Finale zwar lieb haben, müsse aber doch »in einem gewissen Sinne davon sagen: das ist nicht mehr Musik. Aber nur Er konnte es machen!«23
Wagners Hinweis auf die Einmaligkeit Beethovens erweitert den Gedankenhorizont: Pathos und Heldentum, charakteristisch für das europäische Lebensgefühl zwischen 1789 und 1814, zwischen Französischer Revolution und Wiener Kongress, strahlt Beethovens Sinfonik nicht nur dadurch aus, dass sie Elemente französischer Revolutionsmusik in sich aufsaugt und verarbeitet. Vielmehr geht es um Darstellung von Größe, von Schöpferkraft und Raumeroberung schlechthin. Diese Momente Beethovenscher Sinfonik kommen in traditioneller Musikanalyse oft zu kurz, weil man dort vor allem die Vorstellung eines Beethoven pflegt, der als Erster die Prozesshaftigkeit des Komponierens zu dem großen Thema gemacht habe. Indessen lässt sich auch im Rahmen von Klavier- und Kammermusik oder selbst innerhalb der Gattung Oper prozesshaft komponieren. Im Bereich von Sinfonie und Ouvertüre geht es um mehr, nämlich um den Gestus von Macht.
Dieser Prozess ist eng an ein Neuverständnis von Orchester und Orchesterklang gebunden. Während die Sinfonik vor Beethoven – idealtypyisch gesehen – in der Vorstellung verharrte, dass der Komponist zunächst einen musikalischen Satz schaffe, den er danach instrumentiere, ist dies spätestens seit Eroica und fünfter Sinfonie nur noch eine Wahrheit, der eine andere, komplementäre, gegenübersteht: Der Orchesterapparat treibt bestimmte musikalische Entwicklungen aus sich heraus. Das gilt für Steigerungen, Klangflächen, lapidare Wiederholungen usw., die ohne die Gewalt des Orchesterklanges keinen Sinn und keine Wirkung hätten.
Zwar kennt schon die Orchestermusik des 18. Jahrhunderts Machtgesten; diese finden sich jedoch meistenteils standardisiert in C-Dur- oder D-Dur-Sinfonien, wo die Gruppe der Trompeter und Pauker für festliche Atmosphäre und die Anmutung von Herrscherglanz sorgt. Das ist jedoch nicht mit den Orchesterschlägen zu vergleichen, die Beethoven im wahrsten Sinne des Wortes austeilt. »Zwei Hiebe schwerer Kavallerie, die ein Orchester spalten wie eine Rübe« – so beschreibt Wilhelm von Lenz die beiden Orchesterschläge zu Beginn der Eroica;24 und wenngleich einem angesichts der militaristischen Sprache das Lachen im Halse stecken bleibt, so zeigt die Metapher des um die Mitte des 19. Jahrhunderts durchaus angesehenen Beethoven-Biographen, wie man damals in weiten Kreisen des Bildungsbürgertums Beethovens Sinfonik hörte. In der Tat sind ja innerhalb seines ohnehin vielfach aggressiven Orchesterklangs abgerissene Tuttiakkorde keine Seltenheit; und im Falle des knappen Eroica-Prologs sind sie nicht bloße Geste, haben vielmehr geradezu »motivisch-thematischen Rang«.25 Dasselbe gilt für einzelne Partien der Pauke, deren explosive Kraft besonders in der Siebten,Achten und Neunten zu spüren ist, aber auch in der Gewitter-und-Sturm-Szene der Pastorale: Auf durchaus originelle Weise setzt Beethoven die Pauke um der besonderen Wirkung willen innerhalb der ganzen sechsten Sinfonie nur in dieser charakteristischen Szene ein.
Ganz zu schweigen von dem exzessiven Gebrauch, den Beethoven von dynamischen Vorschriften wie forte oder sforzato (gleich »sehr betont«) macht. Wer einen Blick in die Noten wirft, wird feststellen, dass sich entsprechende Hinweise auch dort befinden, wo sie sich eigentlich von selbst verstehen: Sie sind gleichsam als dreifache Ausrufzeichen für den Dirigenten und die ausführenden Musiker gedacht. Besonders auffällig ist Beethovens Sforzato, wo es innerhalb eines raschen Wechsels von Forte und Piano, in Verbindung mit einer Synkope oder auf unbetontem Taktteil ausgeführt werden soll. Es geht somit bei Beethoven alles andere als konform marschmäßig zu; vielmehr stehen seine spezifischen Akzentsetzungen für Willensäußerungen, die sich einerseits als spontane individuelle Kraftakte deuten lassen, die jedoch andererseits einer jeweils überlegten, weitgefassten Gesamtkonzeption verpflichtet sind. Wenn sich Beethoven in seiner Rolle als Komponist tatsächlich mit dem Feldherrn Napoleon verglichen haben sollte, so gibt es hier in der Tat einleuchtende Parallelen – nämlich im Sinne einer taktischen Unberechenbarkeit, der jedoch eine schlüssige Gesamtstrategie zugrunde liegt.
Man kann darüber streiten, ob Beethoven mit dem Akt der Selbstüberbietung, den die Komposition der Neunten und ihre Uraufführung im Jahr 1824 darstellen, kompositorisch das Nonplusultra gelungen ist; man mag auch fragen, ob hinter all dem Jubel nicht bereits etwas von der Verzweiflung zu ahnen ist, die in den nachfolgenden letzten Quartetten auskomponiert ist. Seinem Selbstverständnis nach sieht er sich jedoch noch einmal als Lichtbringer, auch wenn das Chorfinale deutlich macht, dass es nunmehr – wenige Jahre nach dem Tod Napoleons auf St. Helena – nicht länger darum gehen kann, einem staunenden Publikum mit genialisch erfundener sinfonischer Größe zu imponieren: Das »Große und Erhabene«, von dem schon der junge Beethoven im Kontext von Schillers Ode an die Freude geträumt hatte, lässt sich vielmehr nur durch einen Rundgesang verwirklichen, der – so die dahinterstehende Idee – die Grenzen zwischen Musikern und Hörern aufhebt und alle Beteiligten gemäß Schillers enthusiastischen Versen zu »Freunden« und »Brüdern« macht. Man mag das als Abgesang auf die Verherrlichung des großen Einzelnen deuten; doch zugleich ist es – insofern weiterhin »napoleonisch« – ein letzter Versuch, sich einem politisch dumpfen Zeitgeist entgegenzustemmen, der die hehren Ziele von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zugunsten von Restauration und Reaktion verabschiedet hat.
Wilhelm Furtwängler
Vom jungen Furtwängler, der als 25-jähriger Kapellmeister in Lübeck alsbald mit der Eroica Furore macht, berichtet seine dortige Gönnerin Ida Boy-Ed, er schwöre auf Beethoven als einen »sinfonischen Jupiter«, der »Höhepunkte der Höhepunkte« komponiert habe.26 Zwar neigt die zu ihrer Zeit populäre Schriftstellerin und Salonière zu Übertreibungen; dass jedoch Beethoven schon dem jungen Furtwängler über alles geht, will man ihr gern glauben: Ohne Beethoven hätte Furtwängler – zugespitzt formuliert – niemals in die Rolle eines Stardirigenten schlüpfen können, da sie erst durch Beethovens Musik denkbar geworden war.
Da ist zunächst das Orchester: Bis ins 19. Jahrhundert wird dieses in der Regel vom Konzertmeisterpult und/oder vom Tasteninstrument aus geleitet. Dass sich in dieser Hinsicht namentlich im Blick auf Beethovens Sinfonik etwas ändert, belegt die Bemerkung E. T. A. Hoffmanns, die Fünfte ließe sich kaum noch vom Violinpult aus zusammenhalten. Primäre Ursache ist weniger der nur allmählich sich vergrößernde Orchesterapparat als vielmehr der neuartige Umgang Beethovens mit diesem. Zum einen macht die Emanzipation der einzelnen Blasinstrumente und tiefen Streicher vom Gesamtklang in einem solchen Maß Fortschritte, dass ein Dirigat unumgänglich wird, welches von Fall zu Fall einzelnen Instrumenten oder Gruppen spezielle Aufmerksamkeit schenkt. Dasselbe gilt zum Zweiten für Kompositionsverfahren wie »obligates Accompagnement« und »durchbrochene Arbeit«, die zwar keine Alleinstellungsmerkmale Beethovens sind, jedoch von ihm besonders gepflegt werden. Zum Dritten geht es um die für Beethovens Musik charakteristischen Irregularitäten, die von einem Dirigenten koordiniert werden müssen: unerwartete Takt- und Akzentverschiebungen, Orchesterschläge auf unbetontem Taktteil, vermeintlich falsche Repriseneinsätze und vieles mehr. Im Falle Beethovens steht ein eigenwilliges Komponistensubjekt einem Orchesterkollektiv gegenüber, das der »Führung« durch einen Vertreter dieses Komponistensubjekts bedarf. Dieser Vertreter aber ist der Dirigent, der – über Beethoven hinausgeblickt – nunmehr oft in Personalunion mit dem Komponisten in Erscheinung tritt.
Dazu kommt die Vorstellung, dass Beethovens Musik – speziell seine Sinfonik – eine Ideenmusik darstelle, deren Schwingungen nur erwählte Geister an das Publikum zu vermitteln vermöchten. Furtwängler hat sich zeitlebens als ein Dirigent gesehen, welcher der von ihm aufgeführten Musik – bevorzugt derjenigen Beethovens – in jeder Aufführung ihre Seele neu einzuhauchen habe; folgerichtig dirigiert er nach eigenem Verständnis nicht nur Musik, sondern als Vertreter Beethovens auch die Seelen seiner Zuhörer. Wenn in seinen Schriften und Reden beständig von »der Seele des Musikers Beethoven« und vom »seelisch-geistigen« Erleben der Musik entgegen »einer Welt unfruchtbarer intellektueller Illusionen« die Rede ist,27 so schlägt sich darin eine Tradition nieder, die im Kult um die »deutsche Seele« eine von ihm durchaus gebilligte Zuspitzung findet. Diesem Kult huldigen spätestens seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts viele Künstler und Intellektuelle, indem sie im Zeichen der später so genannten »konservativen Revolution« eine Kultur des Geistes und der »deutschen Innerlichkeit« gegen den Ungeist bloßen Zivilisationsgehabes verteidigen zu müssen glauben. Auch der elf Jahre vor Furtwängler geborene Beethoven-Verehrer Thomas Mann steht dieser Strömung zunächst durchaus nahe. 1914 heißt es in seinen Gedanken im Kriege: »Die deutsche Seele ist zu tief, als daß Zivilisation ihr ein Hochbegriff oder etwa der höchste gar sein könnte.«28
Doch während sich Thomas Mann im Laufe der Jahre von solchem Irrationalismus weitgehend distanziert, im Doktor Faustus die eigene Haltung reflektiert und – politisch gesehen – zu einem entschiedenen Gegner des Naziregimes wird, bleibt Furtwängler, der von Mann schon in einer Tagebuchnotiz von 1933 als »Lakai« des neuen Regimes kritisiert wird,29 seinem Weltbild treu, ohne deshalb zum erklärten Nationalsozialisten zu werden: Ihm geht es um die Sache der (deutschen) Kunst; und vor diesem Hintergrund lässt sich seine Haltung dem Regime gegenüber besser nachvollziehen, als wenn man Furtwängler nackten Opportunismus unterstellt.
Metaphysik, Irrationalismus, Gemütstiefe, deutsche Seele, Ethos der Musik und speziell derjenigen Beethovens – all das sind Kategorien, die nicht nur Furtwängler in seinem geistigen Gepäck mit sich herumträgt, die vielmehr als Bestandteile deutsch-bildungsbürgerlicher Wertvorstellungen gern von der nationalsozialistischen Ideologie aufgegriffen werden, in Teilen kaum von ihr zu unterscheiden sind. Noch 1942, also mitten im »totalen Krieg«, der solchen Wertvorstellungen de facto Hohn spricht, kann man in der gelenkten Presse über ein Werkpausenkonzert lesen, das Furtwängler mit den Berliner Philharmonikern in den Fabrikhallen der Berliner AEG gibt: »Die deutsche Seele, die aus den Werken unserer Großen spricht, läßt auch die Saiten im Herzen schaffender deutscher Menschen mitschwingen und wer sich selbst täglich und stündlich um ehrliche Leistung bemüht, der hat auch das Gefühl für die Leistung der Kunst«, die hier »von einem unserer größten Dirigenten« dargeboten werde.30
Da zeigt sich ein diffuses Gemenge von Wertvorstellungen ganz unterschiedlicher Herkunft; und Furtwängler, der seine – freilich seltenen – Auftritte in Fabrikhallen als nationale Pflicht betrachtet, mag ein solcher Bericht zur Selbstrechtfertigung gedient haben. Womöglich fehlte ihm generell ein Sensorium dafür, wie politisch er als vermeintlich unpolitischer Kunstjünger hier agierte. Doch kaum ein Deutscher, der nicht über den Blick des ins Exil Getriebenen verfügte, mag das anders gesehen haben – damals und über den Zweiten Weltkrieg hinaus: Wenn etwas der nationalsozialistischen Ideologie unverdächtig erschien, so waren es der Hang zum Irrationalismus und das Credo von der deutschen Innerlichkeit. Ganz in diesem Sinne konnte man am 31. Oktober 1946 in der Berliner Täglichen Rundschau über eine Eroica-Aufführung unter Sergiu Celibidache, dem Nachfolger Furtwänglers als Leiter der Berliner Philharmoniker, lesen: »Er gibt in Vollendung alles, was die Noten sagen. Die Zucht seines Musizierens ist großartig. Die Tempi überzeugen. Das Wuchtige und Zarte wird wohl ausgewogen. So vermag er das Gehäuse makellos hinzustellen wie kaum einer seiner Generation. Es fehlt nur noch etwas von dem, was hinter den Noten liegt, das Geistige, Ethische, die Enthüllung der Idee, also dessen, was nicht mit Worten zu sagen ist, was aber in den Hörern zu letzten Tiefen dringt. Das ist es, was seine Darstellung von der Furtwänglers noch so weit trennt.«31
Dieser Furtwängler hat damals wegen des noch schwebenden Entnazifizierungsverfahrens in Deutschland Berufsverbot, wird aber seinen Posten eines Chefdirigenten der Berliner Philharmoniker einige Jahre später wieder antreten – diesmal auf Lebenszeit. Die Rolle, die er zuvor eingenommen hat, will er auch zu diesem Zeitpunkt nicht begreifen: Gleich Millionen anderer Deutscher, die ihr schweres Kriegsschicksal beklagen, sieht er sich angesichts des untergegangenen totalitären Systems vor allem als Opfer, nicht als Täter.
Man kann das mit Thomas Mann verurteilen oder, wie gesagt, nachvollziehen, ohne es deshalb billigen zu müssen: Auch willensstarke Persönlichkeiten neigen gegenüber ihrer Umgebung umso mehr zur Bestechlichkeit, je ersichtlicher man ihre künstlerische Tätigkeit nicht nur akzeptiert, sondern geradezu in den Himmel hebt. Furtwängler ist kein Thomas Mann, der aus Deutschland weichen muss, weil er mit einer Jüdin verheiratet ist, als Kulturbolschewist gilt und – wenige Jahre nach der Verleihung des Nobelpreises für Literatur – die rituelle Verbrennung seiner Bücher erleben muss. Nein, Furtwängler wird als ein Hohepriester deutscher Musikkultur und als Verwalter eines spezifisch Beethovenschen Erbes von den neuen Machthabern verehrt. Hitler, Himmler, Goebbels – sie alle sind nicht nur begeisterte Beethoven-Hörer, wollen vielmehr bevorzugt Furtwänglers Eroica oder Fünfte hören. Hitler verfügt mehrfach, dass Furtwängler eine ihm politisch wichtige Beethoven-Aufführung leiten solle; und Goebbels scheint in einem fast schwärmerischen Sinne auf Furtwängler als Kunstheros fixiert gewesen zu sein.32
So darf sich der Dirigent gleichsam auf Augenhöhe mit den Machthabern wähnen, zu denen er in der Tat persönlichen Zugang hat; auch ist er subjektiv der Überzeugung, nur Gutes zu tun, wenn er sich nicht nur beständig für jüdische Musikerkollegen, sondern für Hindemiths neue Oper Mathis der Maler einsetzt, die er im Gegensatz zu den Machthabern als hundertmal wertvoller einschätzt als die offiziell geförderte, jedoch von ihm meistenteils verachtete Musik von Regimeanhängern. Gelegentlich überschätzt er seinen Einfluss: Das öffentliche Eintreten für Hindemiths Weltanschauungswerk vermag ein Aufführungsverbot nicht zu verhindern – worauf Furtwängler auf Druck Hitlers, der ihm seine öffentlichen Quertreibereien nicht verzeiht, von seinen Ämtern zurücktritt. Vom Publikum wird er freilich alsbald auf das Höchste vermisst. Über ein Konzert der Berliner Philharmoniker in Breslau, das Eugen Jochum an seiner Stelle leitet, heißt es in der Presse: »Es fehlte das wesentliche Merkmal aller großen, deutschen Orchesterkunst: das Übersinnliche, Jenseitige, Unfaßbare im Klang, das uns die Berliner Philharmoniker wie ein Geschenk des heiligen Grals sonst in so reichem Maße zu bringen pflegten.«33 Kein Wunder, dass Furtwängler schon ein Jahr später seine künstlerischen Funktionen in vollem Umfang wieder aufnehmen und sogar auf den folgenden Reichsparteitagen dirigieren »darf« – eine Auszeichnung, von der er wegen seiner Distanz zum Parteiapparat freilich nur sehr dosiert Gebrauch macht.
Von dem Auftrag befeuert, von der Größe deutscher Kunst künden zu sollen, von naiver oder gewollter Blindheit gegenüber den generellen und speziellen Unmenschlichkeiten des totalitären Systems geschlagen und von dem Wunsch nach einem politisch-gesellschaftlichen Mithalten-Wollen beherrscht – so ließe sich der Furtwängler der Jahre 1933 bis 1945 charakterisieren. Ihn über diese nicht gerade charakterfeste Rolle hinaus zu verurteilen ist zwar das unbedingte Recht der ins Exil getriebenen oder vom Regime verfemten Künstler und dasjenige einer im Krieg verheizten Generation gewesen. Nachgeborene hingegen sollten sich differenziert äußern: Nicht nur dieser Künstler hat unter Realitätsverlust gelitten, als er phantasierte, mit »seiner« guten, in der Tat auch objektiv nicht verwerflichen Sache zugleich dem großen Ganzen zu dienen. Zudem ist es für einen Musiker, der sowohl von der Masse der Musikliebhaber als auch von der Riege der Herrschenden als Künstler fast einhellig bewundert wird, generell eine besondere Herausforderung, in einem totalitären System den aufrechten Gang zu praktizieren.
Doch welcher Platz kommt Furtwänglers Engagement im Beethoven-Universum zu? Es geht um das Politische im Unpolitischen und um das Unpolitische im Politischen in der Musik Beethovens, speziell in seiner Sinfonik und im Fidelio. Schon die Kunstmusik vor Beethoven hat eine politische Dimension: In einer Vielzahl von Facetten trägt sie zum Herrscherlob und zur Stabilisierung der herrschenden politischen Ordnung bei – im geistlichen wie im weltlichen Bereich, auf der Bühne wie im Konzert. Selbst wo die Oper von der Bestrafung des grausamen Tyrannen handelt, dient dies indirekt dazu, das Gottesgnadentum des »weisen« und »gerechten« Herrschers umso deutlicher herauszustellen. Doch wird diese Affirmation bestehender Ordnung kaum als solche wahrgenommen: Sie erscheint als zweite Natur der Musik.
Ein Paradigmenwechsel bereitet sich am Vorabend der Französischen Revolution vor – ablesbar am Libretto zu Mozarts Hochzeit des Figaro. Doch erst die im Zeichen der Französischen Revolution florierenden sogenannten Schreckens- oder Rettungsopern, insbesondere Luigi Cherubinis Der Wasserträger, befestigen diesen Wandel: Es geht nun nicht mehr um die Verherrlichung von Gott und König, sondern um die Verkündigung des neuen Humanitätsideals über soziale Grenzen hinweg. Schaut man speziell auf die Musiken anlässlich der Pariser Revolutionsfeste, so fallen ein vielfach marschartiger Charakter, ein straff punktierter Rhythmus und eine bevorzugte Stellung der Blechbläser ins Auge: Während die Musik im Absolutismus als solche für den Herrscher gesprochen hatte, dient sie nunmehr ersichtlich der Beeinflussung der Massen.
Beethoven hat das neue Humanitätsideal in seiner Oper Fidelio, deren Textbuch nicht von ungefähr auf den Librettisten des Wasserträgers zurückgeht, und fast zwei Jahrzehnte später noch einmal expressis verbis im Finale der Neunten thematisiert; darüber hinaus greifen seine Sinfonien die agitatorischen Momente der französischen Revolutionsmusik auf – am merklichsten die Finali der Fünften und der Siebten. Indessen lassen sich die entsprechenden Züge zwar mit den zeitgeschichtlichen Ereignissen erklären, jedoch nicht mit Beethovens Musik zur Deckung bringen: Was es in ihr an »Agitation«, »Gewalt«, »Entschlossenheit«, »Kämpfertum«, »Titanismus« und »Heroismus« – um gängige Schlagworte der Rezeption aufzugreifen – gibt, ist vielfältig deutbar. Vertreter des für Freiheit und Demokratie kämpfenden Vormärzes wie Griepenkerl haben diese Züge anders gedeutet als die Angehörigen des der Märzrevolution bang entgegensehenden Dresdner Hofes. Und es gibt auf der einen Seite den grotesk deutschnational argumentierenden Stardirigenten Hans von Bülow, auf der anderen den sozialdemokratischen Kunstkritiker Heinrich Wiegand, der einen Beethoven preist, »der keinen Kampf vermied; das tiefste Leid schaffend überwand; von keinem an Energie übertroffen wird, die letzten Dinge der Menschheit wie die akuten politischen und gesellschaftlichen Ereignisse gleichermaßen heftig in seinem Herzen bewegte«.34 Und während jenseits des Rheins mit Romain Rolland ein – bei seinen Landsleuten nicht unumstrittener – französischsprachiger Wortführer für ein heroisches Beethoven-Bild eintritt, begeistert sich in Deutschland der Nationalsozialist Joseph Goebbels schon 1927 anlässlich des 100. Todestages Beethovens für die Vorstellung, »heute in der Eroica des deutschen Volkes« zu leben.35 Schließlich noch einmal Wilhelm Furtwängler – mit einem Zitat aus seinem Geleitwort zu Walter Riezlers Beethoven-Buch von 1936: »Durch Niemanden wird Gewalt und Größe deutschen Empfindens und Wesens eindringlicher zum Ausdruck gebracht.«36
Furtwängler geht es nicht um militärische oder auch nur physische Gewalt: Er propagiert die geistige Macht deutscher Innerlichkeit. Vor diesem Horizont wird er nach dem sogenannten Zusammenbruch von 1945 für sich in Anspruch nehmen, stets nur für echte Werte eingetreten zu sein, und dabei übersehen, dass die Nationalsozialisten ja gern mit dieser deutschen Innerlichkeit paktiert und sie zynisch in ihrem Sinne umgedeutet haben.
Deutsche Innerlichkeit aber stand und steht, wie angedeutet, für das Ethische, das nicht allein im Klang Greifbare der Musik – für ihre irrationalen Momente. Für deren Darstellung hat Furtwängler ein ingeniöses Alleinstellungsmerkmal entwickelt: seine Dirigiertechnik, vor allem die diffus wirkenden, von den Musikern gefürchteten Einsätze. Diese signalisieren, wie allseits beobachtet, »nicht etwa mit einem einhelligen Taktschlag kommandohaft den Beginn der Musik«, sondern erzeugen im Sinne von Einschwingvorgängen einen »vormusikalischen Spannungszustand«,37 dessen Entladung nicht vom Dirigenten gesteuert, sondern – pathetisch gesprochen – von einer höheren Macht ausgelöst wird. Das hat etwas vom Zittern des Schamanen vor einer kultischen Handlung und steht in schroffem Gegensatz zu den trockenen, sachlichen Schlägen des Antipoden und erklärten Antifaschisten Arturo Toscanini. Was Letzterer »fertig kriegte«, so Sergiu Celibidache, »war sofort wahrnehmbar, und es ging nicht um geistige Dimensionen. Das war so eine gewisse Ordnung im Material – was er auch konnte. Aber von etwas Geistigem habe ich nie etwas bei Toscanini bemerkt.«38
Auch wenn krasse Gegenüberstellungen in die Irre führen, lässt sich doch noch heute an Schallplattenaufnahmen feststellen, dass Furtwängler, ganz in diesem Sinne, die für ihn wesentlichen Momente einer Beethoven-Sinfonie durch Accelerandi, dynamische Steigerungen, lebendige Tempomodifikationen und entsprechende Phrasierungen vom übrigen Geschehen abhob, während Toscanini – darin eher unsentimental – sich meistenteils streng an die Partitur und deren Vorschriften hielt und im Blick auf den Kopfsatz der Eroica trocken bemerkte: »To some it is Napoleon, to some it is Alexander the Great, to some it is philosophical struggle; to me it is Allegro con brio.«39 Da fehlt jegliche Neigung, mit Goethes Faust zum Augenblick zu sagen: »Verweile doch, du bist so schön«, oder auch: »Das Schaudern ist der Menschheit bestes Teil.«
Von Toscanini her gesehen, hat Furtwängler den vital-körperlichen Gestus, der dem Komponisten selbst sicherlich (auch) vorschwebte, ins »Geistige« oder »Seelische« heruntergebrochen, um mit den Worten seiner Bewunderer zu sprechen. Tut er der Musik damit unrecht, oder bringt er einen »authentischen« Beethoven zum Vorschein – etwa einen Komponisten, der geistige Prozesse und seelische Erschütterungen in einer zeitübergreifenden »großen Erzählung« präsentiert?
Das sind vage Formulierungen; doch sie korrespondieren mit der vielfach vagen Dirigierweise Furtwänglers, die sich ihrerseits auf Momente in der Musik Beethovens berufen kann: Entsprechen die genannten »vormusikalischen Spannungszustände«, die mit Furtwänglers Einsätzen einhergehen, nicht exakt den numinosen »Einschwingvorgängen« zu Beginn der Neunten? Und signalisieren die Achtelpausen und Fermaten, welche die Eingangsmotti von Fünfter und Sechster umschließen, nicht Vergleichbares – ebenso das wolkige Arpeggio am Anfang der Sturm-Sonate op. 31,2?
Solche Beobachtungen lassen sich verallgemeinern: Für jeden, der Beethovens Musik nicht gegen den Strich bürsten will, besitzt sie Bekenntnischarakter – worin sie im Medium der Sinfonie eine Tradition begründet, die über Brahms und Bruckner zu Mahler führt. Freilich entspricht es der Persönlichkeit Beethovens, auf dieser Ebene mit Widersprüchen zu arbeiten: Der Hörer soll ahnen, dass sich in dieser Musik Großes und Existenzielles abspielt; er soll die jeweilige Botschaft jedoch nicht rational zu ergründen versuchen, sondern sie dem Hohepriester der musikalischen Ideenkunst im Sinn emotionaler Identifikation von den Lippen ablesen. Nur so fühlt sich der Einsame und Unverstandene als Künstler angenommen. Furtwängler sieht sich hier als ein Medium, durch das der Komponist spricht, während sich ein Dirigent wie Toscanini eher als Interpreten der Partitur versteht.
Weder Furtwänglers noch Toscaninis Deutungen unterstellen Beethovens Musik Züge, die nicht in ihr angelegt wären; vielmehr legen sie jeweils vorhandene Tendenzen offen: Mit Bachs oder Mozarts Musik ließe sich dergleichen nicht machen. In diesem Sinne ist Beethovens Musik politisch anfällig: Sie ist es als Ideenkunst, die ihre Hörer nicht nur auf hohem Niveau unterhalten, sondern erklärtermaßen für »das edle, bessere« gewinnen will40 und solches durch das ihr eigene Pathos und Ethos auch unmittelbar fühlbar macht. Da es sich im Wesentlichen um wortlose Instrumentalmusik handelt, bleibt der entsprechende Aufforderungscharakter so vage, dass er von höchst unterschiedlichen Weltanschauungen und politischen Strömungen aufgegriffen und womöglich missbraucht werden kann. Speziell nationalsozialistische Beethoven-Deuter haben gewusst, warum sie detaillierte Deutungen Beethovenscher Instrumentalwerke von vornherein ablehnten: Nicht die dem zeitgeschichtlichen Kontext verhafteten Erklärungsmodelle – also etwa die Berufung auf den Geist des napoleonischen Zeitalters – fielen ins Gewicht; vielmehr bedurfte es gerade der vermeintlich oder tatsächlich irrationalen Momente der Musik, um sie anschlussfähig gegenüber einer Ideologie zu machen, die ungeachtet aller realen Gewaltanwendung vor Irrationalitäten nur so strotzte und sich trotz aller Zynismen auf eine so zweifelhafte Kategorie wie die »Vorsehung« berief.
Unpolitisch ist Beethovens Musik, weil sich ihre autonomen Züge politischer Inanspruchnahme letztlich entziehen: Dass Musik ihr Leben – immer – in gesellschaftlichen Kontexten entfaltet, heißt ja nicht, dass sie in ihnen aufginge. Und so darf man ganz konkret fragen, ob Furtwängler, dessen Beethoven-Deutung ja lange vor 1933 die Runde machte, den Durchhalteparolen des Regimes zuarbeitete, wenn er im zerbombten Berlin mit seinen Philharmonikern die Fünfte aufführte, oder ob er einfach nur Trost spendete. Auch das London Philharmonic Orchestra spielte in Kriegszeiten die Fünfte – zunächst noch in der Queen’s Hall, nach deren Zerstörung durch deutsche Bombenangriffe in anderen Sälen. Was ist da – sei es in Berlin, sei es in London – politically correct oder incorrect gewesen? Es bleibt freilich die Frage nach dem Martialischen im Werk Beethovens schlechthin – unabhängig vom Typus des Dirigenten, er heiße Furtwängler oder Toscanini.
Lydia Goehr
Mit ihrem Buch The Imaginary Museum of Musical Works erregte die US-Philosophin Lydia Goehr im Jahr 1992 einiges Aufsehen – speziell wegen des Kapitels »The Beethoven Paradigm«. Dessen Überschrift ist bei Insidern inzwischen zu einem Schlagwort geworden: Sofern man ihn mit Kritik auflädt, passt der Slogan zu einer Musik- und Musikologenszene in den USA, die sich der Bevormundung durch Europa definitiv entziehen möchte. Wie über Musik gedacht und geschrieben wird, sollen nicht länger ins Exil getriebene deutsche Musikgelehrte und ihre Schüler oder Enkelschüler bestimmen; es soll vielmehr unter Einschluss der Themen »gender«, »race« und »minorities« neu darüber nachgedacht werden. In diesem Kontext stößt der »Imperialismus« von Beethovens Musik auf große Skepsis.
Lydia Goehr selbst freilich liegt eine solche Generalkritik fern: In Richard Taruskins Vorwort zur revidierten Auflage ihres Buches heißt es unmissverständlich, dessen Gegenstand seien nicht die Anfänge des »work concept« – also der Werkkonzeption bei Beethoven –, sondern »the origin of the solemn, socially regressive nonsense that people have been spouting about classical music for the last hundred years«.41 Es geht um die generationenübergreifende Anbetung einer Opusmusik, die im Notenbild bis ins Einzelne fixiert und entsprechend werkgetreu aufzuführen sei: Kritisiert wird der Gedanke, dass sowohl das Genie des Künstlers als auch die vermeintliche Heiligkeit seiner Partituren die strikte Unterwerfung unter eine Werkidee verlangten, in deren Zentrum die Vorstellung einer immanenten Logik der motivisch-thematischen Prozesse zu stehen habe.
Für den entsprechenden Trend ist laut Goehr vor allem die Verbannung improvisatorischer Momente aus der jeweiligen Aufführung verantwortlich. An diesem Punkt ist Beethoven in der Tat der Erste, der einer willkürlichen Veränderung seiner Kompositionen durch die Interpreten mit allen ihm verfügbaren Mitteln entgegenzuwirken versucht: Er schreibt die Kadenzen zu seinen Solokonzerten aus, notiert Vortrags- und Artikulationsbezeichnungen möglichst genau und fordert zudem, dass man sich an seine Metronomangaben hält. Nicht zu vergessen, dass Beethoven als erster Musiker die konsequente Zählung seiner Werke anstrebt und bis auf wenige Ausnahmen auch öffentlich durchsetzt: Es ist kein Zufall, dass viele Musikliebhaber zwar nicht die KV-Nummer einer von ihnen geschätzten Mozart-Sonate im Kopf haben, wohl aber wissen, dass Beethovens späte As-Dur-Klaviersonate die Opuszahl 110 trägt. Und es lässt aufhorchen, dass die Opuszählung nicht nur in Literatur und bildender Kunst generell unbekannt ist, sondern auch von nichtdeutschen Komponisten nicht unbesehen übernommen wurde. Claude Debussy etwa, der dem auch in Frankreich anzutreffenden Beethoven-Kult mehr als skeptisch gegenüberstand und – so der Gegenwartskomponist Wolfgang Rihm – »stets auf der Suche nach dem unanalysierbaren Kunstwerk« war,42 gab seinen Werken charakteristische, wenn nicht geradezu poetische Titel, anstatt sie zu zählen. In der Tat verstärkt die nackte Opuszählung, auch wenn sie von Beethoven nicht zuletzt aus Gründen des Urheberschutzes eingeführt wurde, die Vorstellung einer abstrakten Größe des musikalischen Kunstwerks: An der »Klaviersonate op. 27,2« vergreift man sich, wie auch immer, instinktiv nicht so leicht wie an der Mondscheinsonate.
Kein Zweifel: Es gibt das »Beethoven Paradigm«, und seine Folgen vor allem für die deutsch-österreichische Musikgeschichte nach Beethoven sind unübersehbar – bis hin zur Schönberg-Schule und zur seriellen Musik, die alle musikalischen Parameter (auch im Schriftbild) genau festlegte und die ausübenden Musiker in besonderem Maß zu Befehlsempfängern degradierte. (Der Umschwung in Richtung Aleatorik oder Improvisation ließ dann ja auch nicht auf sich warten.)
Markant, wenngleich leicht verspätet, wirkte das »Beethoven Paradigm« auch auf die Musikanalyse ein, indem sich diese im 20. Jahrhundert bevorzugt auf die Untersuchung motivisch-thematischer Zusammenhänge stürzte. Zudem wirkt bis heute die von Theodor W. Adorno vor allem an der Musik Beethovens entwickelte Vorstellung eines »integralen« Kunstwerks nach, in dem jedes Teil seine Funktion im Verhältnis zum Ganzen zu erfüllen hat. In diesem Sinne sind die Strukturanalytiker unter den Musikologen vor allem am Auffinden der diesbezüglichen kompositorischen Strategien interessiert, während diejenigen Momente am musikalischen Prozess, die sich gegen eine rein strukturelle Analyse sperren, als zweitrangig betrachtet oder ganz übersehen werden. Das betrifft nicht nur die Vernachlässigung der von Goehr ins Feld geführten Momente improvisatorischer Freigelassenheit, wie sie sich auch – das Rousseau-Kapitel wird es verdeutlichen – in Beethovens Musik entdecken lassen, sondern um das Gestische schlechthin und das Wechselspiel von Form und Gehalt.
Nicht zu Unrecht schließt Lydia Goehr das »Beethoven Paradigm« mit der Idee der »absoluten Musik« kurz;43 denn auch die Vorstellung vom selbstbezüglichen, alle Fremdreferenzen absorbierenden Musikwerk legt die Vorstellung nahe, dass es sich jeweils um ein geschlossenes System handle, das sich nur bezüglich seiner Struktur untersuchen ließe. Indem Goehr nicht Beethovens Musik selbst, sondern nur ihre einseitige Vereinnahmung in den Blick nimmt, treibt sie die Diskussion über die Wege, die Musikpraxis und -reflexion nach Beethoven gegangen sind, in sinnvoller Weise voran. Problematisch ist hingegen die Tendenz, ihr »Beethoven Paradigm« als Ausgangspunkt für eine harsche Kritik an Beethovens »Imperialismus« zu wählen. Konkret gefragt: Ist Männlichkeitswahn eine Konstante in Beethovens Schaffen?
Es gibt vor allem in Beethovens Sinfonik Momente, die man als Gesten von Macht oder als Ausbrüche von Gewalt nicht nur metaphorisch deuten, sondern geradezu sinnlich erfahren kann. Nun kann man zwar die Werke selbst nicht – oder nur im Sinne experimenteller Kunst – umkomponieren; wohl aber kann man ihreRezeptionsgeschichte reflektieren und dabei immer wieder bestätigt finden, dass sie von männlichen Vorstellungen bestimmt ist – deutlich erkennbar an der Art und Weise, in der man über sie redet und schreibt.
Ist Männlichkeitswahn darüber hinaus ein Merkmal der Beethovenschen Musik an sich? Streng genommen gibt es kein solches An-sich, weil jedes Werk mit seiner Rezeption in einem solchen Maße verschmilzt, dass eine Trennung beider Momente fast unmöglich erscheint. Doch immerhin lassen sich Vergleiche anstellen – sowohl zwischen Beethoven und seinen Zeitgenossen als auch innerhalb des Beethovenschen Œuvres selbst. Vor diesem Horizont ist unleugbar, dass Beethoven nicht nur in seiner Sinfonik, sondern auch in den Klaviersonaten weit mehr Machtgesten kennt als etwa Schubert. Letzterer vermochte zu dem gelösten Gestus seiner großen C-Dur-Sinfonie überhaupt erst zu finden, nachdem er in der zuvor komponierten, unvollendet gebliebenen h-Moll-Sinfonie am heroischen Beethovenschen Ideal nach eigener Einschätzung (produktiv) gescheitert war.44
Was Beethoven selbst betrifft, so wird allerdings leicht übersehen, dass die im weitesten Sinne »titanischen« Momente nur einen Teil einer weit umfassenderen Ausdruckspalette ausmachen. Ein Vergleich, wie viel Raum die »heroischen« Passagen einerseits, diejenigen anderen Charakters andererseits einnehmen, würde vermutlich zu überraschenden Ergebnissen führen. Man macht es sich zu einfach, wenn man dem Œuvre mit Susan McClary lediglich einzelne »feminine zones« zugesteht, zu denen etwa das Adagioder Neunten im Sinne einer »important exception« gehöre.45 Und wenn dieselbe Autorin vom Repriseneinsatz im ersten Satz der Neunten schreibt, es handele sich um »one of the most horrifying moments in music, as the carefully prepared cadence is frustrated, damming up energy which finally explodes in the throttling murderous rage of a rapist incapable of attaining release«,46 so mag sie die Stelle gemäß ihrer persönlichen Wahrnehmung authentisch beschreiben, jedoch schwerlich erweisen können, damit eine typische »masculine zone« charakterisiert zu haben: Beethovens hochdifferenzierte Musik lässt sich nicht einseitig auf genderspezifische Merkmale festlegen. Was freilich nicht ausschließt, dass man sich die Meinung Walter Benjamins zu eigen macht, der einstens resümierte: Was ein distanzierter Betrachter an »Kulturgütern« überblicke, sei ihm »samt und sonders von einer Abkunft, die er nicht ohne Grauen bedenken« könne.47 Über Benjamin hinausgedacht: Wo Musik ihre Herkunft aus dem Mythos zu erkennen gibt – und das gilt nicht zuletzt für die »titanischen« Momente in Beethovens Sinfonik –, geht es niemals ohne ein Grauen ab, das dem Mythos generell eingeschrieben ist. Zugleich kennt das Subjekt dieser Sinfonik immer neue Mittel, um solchem Grauen seine eigene Zuversicht entgegenzusetzen. Nicht allein das Adagio der Neunten, sondern bereits viele Episoden ihres Kopfsatzes zeugen davon.
Auch in der Fünften gibt es eine Dialektik zwischen Gesten der Gewalt und solchen der inneren Einkehr. Zwar herrscht im Kopfsatz der Machtgestus vor; indessen erhebt – wie Seite 43 beschrieben – das Subjekt in Gestalt des kleinen Oboensolos zwischen Durchführung und Reprise markant und unüberhörbar Einspruch gegen diese Gewalt. Übrigens ist unlängst plausibel dargelegt worden, dass Beethoven den von seinem Schüler Anton Schindler überlieferten Ausspruch »So pocht das Schicksal an die Pforte« tatsächlich getan, ihn jedoch in erster Linie als drastischen Hinweis auf die von ihm intendierte Art der Ausführung verstanden hat. Demzufolge habe Beethoven dazu auffordern wollen, das von Fermaten begrenzte Klopfmotiv zu Anfang und an einschlägigen weiteren Stellen betont langsam zu nehmen und damit vom übrigen Geschehen deutlich abzuheben.48 Solches würde dafür sprechen, dass dem Komponisten die Déjà-vu-Erfahrung des Klopfens, die der Hörer machen sollte, über die Vorstellung eines sich autonom entwickelnden motivisch-thematischen Prozesses ging.
Freilich ist es denkbar, die Assoziation des Klopfens gänzlich beiseitezulassen und sich stattdessen einer weiter gefassten Kategorie zu erinnern, die Karl Heinz Bohrer – unter anderem angeregt vom Denken Gilles Deleuzes – ins Zentrum seines literaturkritischen und ästhetischen Denkens gerückt hat: derjenigen des Jetzt, des Plötzlichen, der Epiphanie, des Schreckens. Entscheidend ist nicht, was geschieht, sondern dass es geschieht – im Sinne eines Ereignisses, das einen mit der Historie nicht mehr identischen Augenblick darstellt.49 Eines von Bohrers Beispielen ist der unvermutete Auftritt Napoleons vor seinen Generälen, als diese über die Strategie der bevorstehenden Schlacht parlieren. Der Korse habe nur die Worte »Du pain, des olives et du silence« gesprochen, mit der Linken die vor ihm ausgebreitete Landkarte in die passende Richtung geschoben und mit der Rechten auf den Punkt gedeutet, wo der Angriff zu beginnen habe. Damit sei die Sache entschieden gewesen; und in diesem »erhabenen«, von keiner Logik einzufangenden Moment des selbstreferentiell Phantastischen erlebt Bohrer die Größe der Geschichte.50
Man kann diesen Gedanken mühelos auf die Musik, speziell auf den Anfang von Beethovens Fünfter, übertragen. Ohne der Bewunderung des Komponisten für Napoleon oder seines mutmaßlichen Ausspruchs »So klopft das Schicksal an die Pforte« gedenken zu müssen, nimmt der Hörer eine feldherrnhafte Geste wahr, die Beethovens Vorgängern noch nicht zur Verfügung gestanden hätte: Während die unkonventionellen Anfänge selbst einer Haydn-Sinfonie alsbald in traditionelleres Fahrwasser geraten, setzt Beethoven das mit der Historie nicht mehr identische, vielmehr einzig von ihm selbst herbeigeführte Jetzt in Szene – im Sinne einer letztendlich unerklärten, der Erklärung aber auch nicht bedürftigen Herrschergeste. So aufschlussreich es sein mag, den weiteren Weg des Eingangsmotivs mit den Augen des Strukturanalytikers zu verfolgen und damit der motivisch-thematischen Arbeit des Komponisten die nötige Reverenz zu erweisen, so produktiv könnte es sein, das selbstreferentiell phantastische Moment dieses Beginns als pures Zeichen auf sich wirken zu lassen, anstatt es so rasch wie möglich einzugemeinden.
Solches hat, wie Seite 371 dargestellt, bereits Felix Mendelssohn Bartholdy mit Worten beschrieben, welche die literaturästhetische und romantischem Denken verpflichtete Terminologie Karl Heinz Bohrers vorwegnehmen. Angesichts des Adagio-Themas aus Beethovens Streichquartett op. 74 spricht der Komponist begeistert von »gewissen musikalischen Wendungen«, die sich allein mit »einem Blick oder einer Erscheinung vergleichen« ließen. Natürlich weiß Mendelssohn auch die durchdachte Struktur dieser Musik zu würdigen. Hier aber geht es um die Geste des Augenblicks, um Bohrers Seite 41 näher beschriebene »Epiphanien«, die ein unerklärliches »Jetzt« vorstellen und als solches vom Komponisten freiweg auf der Straße herausgesungen werden.
Zugespitzt gesagt: Aus dekonstruktivistischer Sicht könnte man den Beginn der Fünften geradezu als einen abgründigen Witz im Sinne Jean Pauls verstehen, also als einen künstlerischen Einfall, welcher wie der Blitz einschlagen, jedoch keinesfalls »erklärt« werden solle. Solches würde sich gegen den tierischen Ernst richten, mit dem Hegel zeitgleich seine Vorstellung vom Weltgeist vortrug; und es wäre eine Warnung an diejenigen, die beim Raptus der Fünften von vornherein an einen Napoleon dächten, der dem großen Denker aus Berlin bekanntlich als »Weltgeist zu Pferde« vor Augen stand.
Dass ich Beethovens Musik meinerseits nicht vorschnell von der idealistischen Idee des »großen Ganzen« vereinnahmt wissen will, verdeutlicht dieses Buch bereits durch seinen Aufriss: Er spiegelt die Intention, die Werke zwar aus den unterschiedlichsten Richtungen anzuleuchten, jedoch niemals mit dem Anspruch, das Œuvre als abstraktes System oder auch nur als Erfüllung eines geschichtsphilosophischen Auftrags à la Hegel zu deuten. Stattdessen thematisieren die Kapitel bevorzugt die phantastischen Augenblicke, die zu nicht kalkulierbarer Zeit über das Hier und Jetzt des jeweiligen Hörers hereinbrechen: Der Gesamtzusammenhang ist nicht objektiv gegeben, muss vielmehr von Fall zu Fall neu gedacht oder auch infrage gestellt werden.
Auch das seinerseits von Fermaten umschlossene Oboensolo ist nur zu verstehen, wenn man es – gleich dem Klopfmotiv – als ein exterritoriales Wahrzeichen versteht, das vom Hörer auch als solches gedeutet werden soll: Der einsam-klagende Ton der Oboe steht für einen menschlichen Seufzer und erinnert darin an das eigene Ich. So gesehen, korrespondiert das Oboensolo mit dem Klopfmotiv, indem es eine – wenn auch nur schwache – Reaktion auf die vom Klopfmotiv entfesselten Gewalten darstellt und bei aller Knappheit unüberhörbar Einspruch gegen die Zwangsläufigkeit erhebt, mit der sich das »Schicksal« seine Bahn zu brechen anmaßt.
Und wenngleich sich das leidende Subjekt im ersten Satz nicht durchsetzen kann, so mag es sich doch immerhin an dem glänzenden Sieg beteiligt wissen, den das Finale darstellt: Dessen Triumphgesten sind ja zumindest doppeldeutig, indem man sie nicht nur als Sieg der anfänglich das Feld beherrschenden Schicksalsmacht verstehen kann, sondern auch als Sieg über sie.
»Pouvoir«, das französische Wort für »Macht«, »Gewalt«, »Können« usw., ist ja nicht von vornherein negativ konnotiert, steht vielmehr auch für Potenzen positiver Art. In diesem Sinne ist angesichts der Machtgesten der Eroica nicht nur an Wilhelm von Lenz und andere martialische Eroica-Auffassungen zu denken. Man könnte sich auch an Carson McCullers’ 1940 erschienenen Roman Das Herz ist ein einsamer Jäger erinnern – speziell an die Rolle, welche Beethovens dritte Sinfonie dort spielt. Die mit »ihren« Südstaaten-Underdogs sympathisierende Autorin vermag die revolutionäre Devise von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zwar nur als trauriges Beispiel einer gescheiterten Hoffnung ins Spiel zu bringen; jedoch erfindet sie in Gestalt von Mick Kelly eine Kind-Mädchen-Figur, welche die Eroica bei vollkommener Unwissenheit über den historischen Kontext und über den musiktheoretischen Horizont als die große Offenbarung hört. Eines Abends einsam durch die Straßen ihres Heimatstädtchens wandernd, wird sie zufällig mit Eroica-Klängen aus dem Radio konfrontiert: »Das war sie, Mick Kelly, wie sie tagsüber oder nachts mutterseelenallein herumging. In der heißen Sonne und in der Dunkelheit mit all ihren Plänen und Gefühlen. Diese Musik war sie – ganz einfach und richtig sie.«51
McCullers nennt das Leitmotiv ihres Romans »man’s revolt against his own inner isolation and his urge to express himself as fully as possible«.52 Mick revoltiert gegen Einsamkeit und Mangel an erfüllter Kommunikation auf ihre Weise: Ohne auch nur den Namen Beethovens zu kennen, nimmt sie via Musik an seiner habituellen Einsamkeit teil – aber auch an seiner Kraft, sie schaffend zu überwinden. Im ersten Satz der Eroica