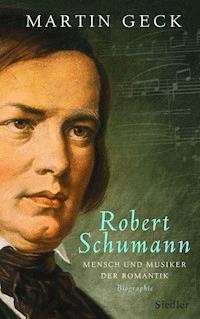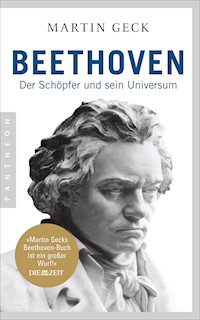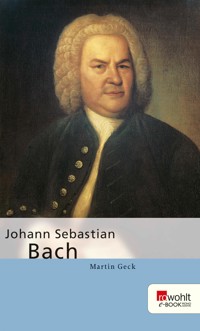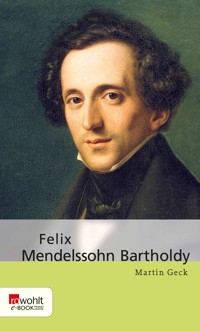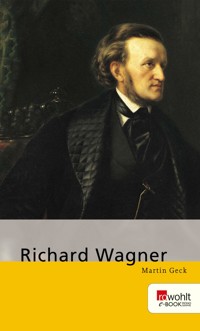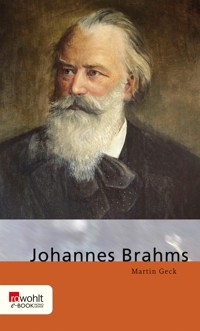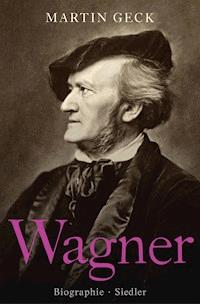15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Martin Geck erzählt humorvoll und anschaulich mehrere Tausend Jahre Musikgeschichte. Dabei verbindet er Anekdoten mit einem treffenden Blick für die entscheidenden Entwicklungen und Strömungen – von den musikalischen Bräuchen afrikanischer Naturvölker oder im China zur Zeit von Konfuzius, über die Oper, Kirchenmusik und Sinfonik bis hin zu Rock 'n' Roll und Hip-Hop. Wer Geck bei seiner Konzentration aufs Wesentliche folgt, bekommt eine wunderbare Vorstellung davon, was Musik in ihrer jeweiligen Zeit und ihrem Umfeld ausmacht. Eine unterhaltsamere und souveränere Musikgeschichte ist in den letzten Jahrzehnten nicht geschrieben worden. »Kann man die Geschichte der Musik auf 200 Seiten erzählen? … Man kann.« (DIE ZEIT) »Wer sich von Martin Geck nicht für Musik begeistern lässt, dem ist nicht zu helfen.« (DIE WOCHE)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Martin Geck
Die kürzeste Geschichte der Musik
Reclam
Das Buch wurde erstmals 2006 unter dem Titel Wenn Papageno für Elise einen Feuervogel fängt im Rowohlt Berlin Verlag veröffentlicht.
2020 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Coverentwurf: Kuzin & Kolling, Büro für Gestaltung
Coverabbildung: shutterstock / Babich Alexander
Made in Germany 2020
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-961752-7
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011289-2
www.reclam.de
Inhalt
Vorwort
Kann es das geben – eine Geschichte der Musik auf weniger als zweihundert Seiten, von der Urgesellschaft bis zum Hip-Hop?
Man hat mich manchmal gefragt, ob ich mein geballtes Wissen nicht in einer »großen« Musikgeschichte mit enzyklopädischem Anspruch versammeln wolle. Doch davor hat mir immer gegraust, denn selbst tausend Seiten hätten nicht ausgereicht, um aus den unendlich vielen Informationen, die es da zu verarbeiten gäbe, ein schön geschriebenes Buch zu machen.
Da will ich mich lieber gleich an den Bildern einer Ausstellung orientieren: Modest Mussorgski hat in seinem so bezeichneten Klavierzyklus nicht alle Bilder in Musik gesetzt, die er in der Ausstellung seines Maler-Freundes Viktor Hartmann kennenlernte, sondern nur eine Auswahl. Beliebig wirkt die Folge der zehn Tonbilder gleichwohl nicht; denn als Brücke zwischen den einzelnen Nummern gibt es die Promenade: Sie ist aus der Sicht eines Betrachters komponiert, der in der Ausstellung umhergeht und dabei einmal in diese, einmal in jene Stimmung gerät.
In ähnlichem Sinne mag man die 19 Kapitel meiner kleinen Geschichte der Musik als eine Auswahl von Bildern aus jener großen Ausstellung sehen, als die sich Musik über die Jahrtausende hinweg darstellt. Und auch eine »Promenade« fehlt nicht: Jedes Kapitel schließt mit einem Abschnitt, in dem noch einmal ausdrücklich der Autor spricht – Position beziehend und Fragen aufwerfend, für die er auch seine Leserinnen und Leser interessieren möchte.
Natürlich soll das Buch möglichst vielseitig sein. Dass jedoch von den alten Reichen nicht Indien, sondern China behandelt wird, dass zwar von Clara Schumann, nicht aber Fanny Hensel die Rede ist, dass Debussy den Vorzug vor Ravel erhält, dass häufiger von Klavier und Geige als von Trompete und Flöte die Rede ist – dergleichen beruht auf einer subjektiven Entscheidung des Autors. Dass dieser Themen bevorzugt, in denen er sich besonders zu Hause fühlt, dürfte nicht zum Schaden des Buches sein: Wer vom Fach ist und genau liest, wird jedenfalls auf die eine oder andere Textpassage stoßen, die aus neuester Forschungsperspektive geschrieben ist.
Doch soll weniger die Wissenschaft als die Poesie der Musik im Mittelpunkt dieses Buches stehen; und der Autor wünscht sich Leserinnen und Leser, denen seine kleine Geschichte der Musik Lust macht, diese Poesie neu zu entdecken.
Ganz ohne Fachausdrücke kann und soll es nicht zugehen – doch die kann man nachschlagen oder dann und wann auch großzügig überlesen. Generell herrscht Mozarts Devise: »In meiner Oper ist Musik für aller Gattung Leute – ausgenommen für lange Ohren nicht!«
Von der mythischen Macht der Musik… und den Stimmen der Naturvölker
Kann man sich eine Welt ohne Musik vorstellen? Ohne Gesang, Tanz, Hausmusik, Konzert? Ohne die Nationalhymnen oder die Schlachtrufe der Fußballfans? Ohne Musik in der Diskothek, im Radio, im Fernsehen, im Kino? Ohne Schallplatte, CD, DVD und was es sonst alles gibt?
Manche Menschen dürften Schwierigkeiten haben, nur einen einzigen Tag ohne Musik auszukommen! Was mich betrifft, so würde ich zwar lieber ohne Musik leben als verhungern. Wenn ich aber zu entscheiden hätte, ob die Menschheit – in einer weltweiten Fastenaktion – auf den Verzehr von Fleisch oder auf den Genuss von Bachs, Mozarts und Beethovens Kompositionen verzichten sollte, so würde ich mit Sicherheit das Fleisch vom Speisezettel absetzen und die Musik behalten.
Für Menschen, die in einer Wohlstandsgesellschaft aufgewachsen sind, mag dieses Beispiel reichlich seltsam klingen; ein Angehöriger eines Naturvolks jedoch würde mich sofort verstehen.
Inzwischen gibt es nur noch wenige Naturvölker, also Lebensgemeinschaften, die seit Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden weitab von jeder Zivilisation an ihren traditionellen Riten festhalten und uns auf diese Weise eine Ahnung davon vermitteln, wie früher einmal die ganze Menschheit gelebt haben könnte. Ein Naturvolk, von dem sich zumindest kleine Gruppen bis heute erhalten haben, ist der westafrikanische Stamm der Dan. Dort bekam der deutsche Ethnologe Hans Himmelheber vor ein paar Jahrzehnten zu hören: »Die Musik ist sehr wichtig für uns. Ohne sie würden wir uns einfach hinsetzen und sterben. Denkt doch an die schwere Arbeit: ein Mann, der den Busch für eine Pflanzung niederschlägt; die Frauen, die den Reis stampfen! Deshalb sind Arbeitsgruppen, die von Musikern unterstützt werden, so wichtig. Wir haben keine Maschinen, die uns helfen. Aber dafür haben wir die Musik.«
Von einem anderen afrikanischen Stamm heißt es: »Bei den Woloff ist die Bedeutung des Trommelns für die gemeinschaftliche Arbeit so groß, dass sich die Arbeitsgruppe des Dorfes Njau während einiger Monate zur Untätigkeit verurteilt sah, als ihr bester Trommler infolge Trauer um einen nahen Verwandten ausfiel.« Musik dient hier nicht – wie bei uns – vor allem der Unterhaltung, Ablenkung und Entspannung. Es wäre allerdings auch falsch, in ihr eine Art Aufputschdroge zu sehen. Für die alten Kulturen ist sie vielmehr ein unverzichtbarer Kraftstoff: Während die zivilisierten Menschen ihre Maschinen mit Benzin betreiben, »tanken« die Dan Musik: Sie erst gibt ihnen die Kraft, über den Tag hinauszusehen und die schwere Arbeit des Buschrodens zu tun, die erst Wochen oder Monate später Früchte tragen wird. Allgemein könnte man sagen: Musik lässt sie ihre Existenz als sinnvoll erleben. Sie sind nicht allein mit der Natur, mit der schweren Tätigkeit und mit der bangen Frage, ob und wie es morgen weitergeht; in der Musik haben sie eine Begleiterin. Deren pulsierender Rhythmus macht deutlich, dass wir Menschen nicht in der Unendlichkeit der Zeit versinken: Wir werden von einer Ordnung gehalten – ebenjener Ordnung, die die Musik vorgibt.
Da ist die Vorstellung einsichtig, dass die Menschen die Musik nicht selbst erfunden, sondern von den Göttern als Geschenk erhalten haben – als eine Gabe, die sie in ihrer Schwachheit immer wieder stark macht. »Erst die Götter, dann die Musik, dann die Menschen.« So heißt es jedenfalls in vielen Sagen.
Hazrad Inayat Khan, ein indischer Weiser, überliefert folgende Legende: Während der Erschaffung der Welt konnte man die Seele sehen, wie sie frei herumflog und alles interessiert betrachtete – das Werden des Klangs, Tag und Nacht, Wasser und Erde, Pflanzen und Tiere. Und je reicher die Welt wurde, desto spannender fand die Seele alles, was um sie herum passierte. Am sechsten Tag schaute sie zu, wie der Schöpfer einen Körper aus Lehm formte. Sie erschrak fürchterlich, als sie ihn sagen hörte: »Deine Aufgabe ist es, in diesem Körper zu wohnen!« Die Seele protestierte lauthals: »Niemals! Ich bin frei, und meiner Natur entspricht es, unbeschränkt zu sein; wie soll ich mich da in ein Gefängnis begeben?« Da ließ der Schöpfer die Engel musizieren, und durch deren Musik wurde die Seele von einer nie gekannten Sehnsucht ergriffen. Diese Sehnsucht war es, die sie dazu brachte, den Körper neu zu sehen und schließlich darin zu wohnen.
Die griechische Sage erzählt vom Sänger Orpheus, der mit seinem Gesang wilde Tiere zähmt und sogar seine Gattin Eurydike dem Totenreich vorübergehend entreißen kann. Und in der 29. Rune des finnischen Nationalepos Kalevala zaubert der muntere Held Lemminkäinen durch lange Lieder und schönen Gesang in eine karge Insellandschaft Wälder, Seen, Quellen, Blumen und Geschmeide – die Jungfrauen, die ihn umschwärmen, sind begeistert.
Da ist sie wieder, die mythische Macht der Musik. Der alttestamentliche Prophet Elisa vermag dem dürstenden Volk eine Wasserader aufzutun, indem er von einem Musiker, der ihm vorspielt, seherische Kraft erhält. Sprichwörtlich sind die »Posaunen von Jericho«, von denen das biblische Buch Josua erzählt: Sieben Priester ziehen an sieben Tagen um die belagerte Stadt und blasen auf sieben Widderhörnern; am siebten Tag stürzen Jerichos Stadtmauern ein.
Wo in den alten Mythen und den Bräuchen der Naturvölker von der Macht der Musik die Rede ist, geht es natürlich nicht nur um kriegerische Anlässe. So gab es bei den Ammassalik-Eskimos auf Ostgrönland noch vor hundert Jahren regelmäßig Singwettstreite, die handgreifliche Auseinandersetzungen geradezu überflüssig machen sollten. Das sah so aus: Im Sommer trafen sich die zerstrittenen Parteien bei den gemeinsamen Fangplätzen, um sich in hellen Sommernächten »anzusingen«. Nächtelang dauerten die mit gegenseitigen Anschuldigungen und Schmähungen gespickten »Verhandlungen«, bis eine der beiden Parteien, zermürbt oder beschämt, abzog.
Fast ebenso alt wie der menschliche Gesang sind einfache Musikinstrumente. Auch sie haben ganz unterschiedliche Funktionen. Das Hauptinstrument der Ureinwohner von Ozeanien etwa ist das Schwirrholz – ein dünnes, meist ovales Holzbrettchen, das an einer Schnur herumgewirbelt wird. In seinem Heulen glaubt man die Stimme der Ahnen zu hören. Auf Kriegszügen verleiht das mitgeführte Schwirrholz dem Träger die Kraft und den Mut seiner Vorfahren. Frauen und Kinder dürfen es bei strenger Strafe nicht sehen.
Von den Bambuti-Pygmäen, einem Zwergvolk in Afrika, wird berichtet: »War eine Frau ihrem Manne gegenüber unbotmäßig, zänkisch oder hat sie ihn gar gebissen, dann surrt zur Nachtzeit das Schwirrholz in der Nähe ihrer Hütte. Sie weiß, dass ihr das gilt; schleunigst begibt sie sich zu ihrem Klan und erbittet ein Geschenk, um damit ihre Schuld zu sühnen.«
Die Musikkapellen der nordwestafrikanischen Haussa werden nach einer festen Rangordnung zusammengestellt: Holztrompeten sind einzig und allein dem König vorbehalten. Doppelglocken stehen bedeutenden Vasallen zu; hölzerne Hörner und Oboen dürfen nur zu Ehren von Beamten im Rang eines Distrikthäuptlings erklingen.
Besonders interessante Funktionen haben Sprechtrommeln, wie sie in fast allen Naturvolkkulturen der Nachrichtenübermittlung dienen. Auf Malekula, einer den Neuen Hebriden zugehörigen Insel, hat man für jeden wichtigen Gegenstand und jedes typische Alltagsereignis ein eigenes Trommelmotiv. Sucht ein Mann zum Beispiel sein Nitavu-Schwein, so trommelt er das Signal: »Wo ist mein Nitavu-Schwein?« Hat ein anderer das Schwein gesehen, antwortet er mit dem Signal »sumpsumpndew«, das heißt: »Ich bringe dir dein Schwein zurück!« Oder er teilt ihm den genauen Aufenthaltsort des Tieres mit oder nennt den Klan eines Mannes, von dem er weiß, dass er das Tier gefunden hat.
Solche Trommelmotive sind keineswegs nur rhythmische Abfolgen von Schlägen nach der Art »kurz-lang-lang«, »lang-kurz-kurz«. Vielmehr versucht der Trommler, die Klangschattierungen der menschlichen Stimme nachzuahmen, sein Instrument also wirklich zum »Sprechen« zu bringen. Dazu braucht er im wahrsten Sinne des Wortes Fingerspitzengefühl; und die Empfänger seiner Botschaften müssen feine und geübte Ohren haben.
Die Mazateco-Indianer aus der Provinz Oaxaca in Mexiko verwenden anstatt der Trommel eine Pfeifsprache. Will ein Mazateco die Aufmerksamkeit eines anderen erwecken, pfeift er dessen Namen. Dann stellt er ihm pfeifend eine Frage, warnt ihn vor einem Fremden oder Ähnliches. Sechs-, siebenmal kann der Dialog hin- und hergehen.
In weit größerem Maße als bei uns ist die Musik der Naturvölker körperzentriert. Beim Singen legt man gern eine Hand an Schläfe, Ohr, Wange oder Hals, um den Klang der Stimme zu verändern oder ihr Vibrieren zu unterstützen. Und natürlich betrachtet man den Körper als ein ideales Rhythmusinstrument. Klatschen, mit den Fingern schnipsen, auf die Brust trommeln, mit den Füßen stampfen – all das ist Musik, die jeder schnell erlernen kann und die doch großen Spaß macht.
Freilich gibt es auch bei Naturvölkern musikalische Tätigkeiten, die Spezialisten vorbehalten sind. Das sind zum einen Berufsmusiker, die ihre Instrumente virtuos beherrschen. Zum anderen handelt es sich um Schamanen und Medizinmänner, die bei ihren rituellen Handlungen mit Musik arbeiten. Bei den Blackfoot-Indianern etwa glaubt der Medizinmann, dass seine Macht untrennbar mit ein oder zwei Gesängen verbunden ist. Er spürt, dass er sie durch übernatürliche Vermittlung empfangen hat, deshalb darf sie niemand außer ihm verwenden. Und wenn jemand vom Stamm der Iglulik-Eskimos den Beruf des Schamanen erlernt, so muss er zum Abschluss seiner Ausbildung magische Formeln und Gesänge beherrschen, die Krankheiten heilen, gutes Wetter oder Jagderfolg bewirken.
Bei den südostaustralischen Kurnai fällt einer bestimmten Gruppe von Berufssängern, die man Bunjil-venjin nennt, die Aufgabe zu, Liebeslieder zu komponieren und vorzutragen, wenn ein verliebter junger Mann sie darum bittet. Alle im Dorf können das Lied hören, und eine Freundin teilt dem angeschwärmten Mädchen mit: »Dieses Lied wird zu deinen Ehren gesungen!« Dann fällt es ihm schwer, sich dem Liebeszauber zu entziehen.
Die Maori auf Neuseeland wiederum singen ihre »oriori« – Lehrgedichte mit oftmals kompliziertem Inhalt – bereits Säuglingen vor. Die können natürlich noch nicht verstehen, was man ihnen da über Ereignisse der Stammesgeschichte oder über alte Mythen erzählt. Doch schon früh bekommen sie das Gefühl: »Ich gehöre zu meinem Volk und bin ein Teil seiner Geschichte.«
Übrigens kennt kaum ein Naturvolk ein Wort, das unserem Begriff von Musik entspricht. Zwar unterscheidet man bestimmte Lieder oder Tänze nach den Ritualen, zu denen sie gehören, und man benennt auch diverse Instrumente und die Arten, sie zu spielen. Unbekannt ist hingegen »Musik« als eine abstrakte Größe. Und natürlich gibt es auch keine Notenschrift. Denn einerseits ist das, was wir »Musik« nennen, für die Naturvölker sehr wichtig; andererseits ist diese Musik nur »vorhanden«, wenn sie sich einem bestimmten Gesang, einem speziellen Fest usw. zuordnen lässt.
Wir Heutigen finden es zwar seltsam, wenn wir ein Morgenlied am Abend singen. Aber es hindert uns niemand daran. Und wenn dieses Morgenlied in der Klavierschule steht, üben wir es selbstverständlich auch am Nachmittag. Ein Mazateco-Indianer oder ein Ammassalik-Eskimo fände das verrückt. Er würde sagen: »Dann hat die Musik keine Kraft.« Oder gar: »Das ist verboten. Damit verstoßen wir gegen den Willen der Götter.«
IN PUNCTO TECHNIK hat es unsere Gegenwart weiter gebracht, als sich unsere Vorfahren je hätten träumen lassen. Das gilt auch für die Musik. Unsere Musikinstrumente sind höherentwickelt als diejenigen der Naturvölker, und viele Kompositionen sind komplizierter als ehedem. Überdies können wir uns Musik bequem vom Tonträger vorspielen lassen – zu jeder Stunde und in allen Lebenslagen. Wir haben also Musik im Überfluss; oft ist sie geradezu eine Wegwerfware. Ein paradiesischer Zustand?
Ich denke Folgendes darüber: Ich lehre Musikgeschichte an einer Universität. Da finde ich es praktisch, dass ich zum Beispiel in einer Vorlesung über Beethovens Fünfte Sinfonie an den passenden Stellen Ausschnitte von einer CD abspielen kann. Denn ein Sinfonieorchester könnte ich natürlich nicht engagieren. Überhaupt freue ich mich an dem schönen Klang eines solchen Sinfonieorchesters und noch mehr an den phantastischen Einfällen des Komponisten, die ohne ein modernes Orchester nicht zum Klingen gebracht werden könnten. Doch zugleich habe ich höchsten Respekt vor den Naturvölkern: Während wir weiter in der Technik sind, waren sie näher an der Musik; diese erschien ihnen so notwendig wie die Luft zum Atmen und so direkt wie eine zärtliche Berührung oder ein heftiger Schlag.
Diese hohe Wertschätzung der Musik drücken auch die Mythen aus: »Ohne Musik läuft nichts in der Welt und bei den Menschen«, lautet ihre Botschaft. Und oft erscheint in ihnen Musik als der Atem, mit dem die Götter dem Menschen das Leben einhauchen.
Jeder, der musikalisch ist und Musik liebt, spürt etwas von dem göttlichen Atem in sich, der ihm das Gefühl gibt: »Ich bin nicht umsonst und nicht allein auf der Welt. Ich gehöre zu einem großen Ganzen.« Nennen wir es ruhig Musik!
Musik in den alten Reichen… zum Beispiel in China
Die jahrtausendelange Geschichte der chinesischen Musik ist gut geeignet, um den Übergang von den Bräuchen eines Naturvolks zu einer facettenreichen Hochkultur zu demonstrieren. Wir beginnen mit einer alten Legende über den Musikmeister Wen aus Zheng. Er begleitete den großen Gelehrten Xiang auf dessen Reisen und spielte drei Jahre lang die Zither, ohne eine vernünftige Melodie zustande zu bringen. »Geh lieber nach Hause«, sprach daraufhin Xiang. Meister Wen legte sein Instrument nieder und seufzte: »Es ist nicht so, dass ich keine Melodie hervorbringen könnte. Was mich hindert, hat nichts mit der Technik des Zitherspiels zu tun; und wonach ich strebe, sind keine Töne. Ich muss erst etwas in meinem Herzen erlebt haben, um mich auf meinem Instrument ausdrücken zu können. Noch wage ich nicht, meine Hand zu bewegen und die Saiten zu berühren. Gedulde dich noch ein wenig und prüfe mich dann!«
Nach einiger Zeit erschien er wieder vor Xiang: »Jetzt habe ich es geschafft. Höre mein Spiel!« Es war Frühling; doch als Wen die Shang-Saite zupfte und den achten Halbton zur Begleitung anschlug, kam ein Wind auf, und die Sträucher und Bäume begannen Früchte zu tragen. Als er die Jue-Saite zupfte, die er mit dem zweiten Halbton begleitete, erhob sich eine leichte Brise, und die Bäume und Sträucher entfalteten ihre ganze Pracht. Als er in der Sommerhitze die Yu-Saite zupfte und sie mit dem elften Halbton begleitete, senkten sich Raureif und Schnee hernieder, und die Gewässer froren zu. Als er im strengen Winter die Zhi-Saite zupfte und mit dem fünften Halbton beantwortete, begann die Sonne zu sengen, und das Eis taute im Nu. Schließlich spielte er die Gong-Saite und vereinte ihren Klang mit dem der anderen vier Saiten; da säuselten liebliche Winde, Wolken des Glücks zogen herauf, süßer Tau fiel, und Quellen sprudelten kraftvoll hervor.
Die Legende vom Musikmeister Wen klingt zunächst wie eine der vielen Erzählungen der Naturvölker über die Macht der Musik. Hört man jedoch genauer hin, erfährt man, dass nicht der Klang der Musik als solcher die Kraft besitzt, die Natur zu beeinflussen; es muss vielmehr der menschliche Wille dazukommen, eine bedeutende Tat zu vollbringen. Ist er da, kann der Mensch sogar die Natur auf den Kopf stellen: Dann wird es durch sein Spiel auf der Zither im Sommer plötzlich ganz kalt und im Winter ganz heiß.
Ist der Mensch erst einmal davon überzeugt, dass er selbst derart große Wirkungen erzielen kann, so will er auch wissen, wie ihm das gelingt – und er entwickelt Theorien, mit deren Hilfe er die Regeln und Funktionsweise von Musik erforscht.
Auch die Legende von Wen kommt nicht ohne Musiktheorie aus. Da ist von fünf Saiten die Rede, die nach bestimmten Regeln gestimmt sind und die Namen Shang, Jue, Yu, Zhi und Gong tragen. Ferner wird angedeutet, dass es ein Tonsystem mit einer aus zwölf Halbtönen bestehenden Skala gibt.
Gong – Shang – Jue – Zhi – Yu: Diese Reihe entspricht unseren Tonsilben do – re – mi – sol – la oder: c – d – e – g – a. Wir reden von »halbtonloser Pentatonik« und gewinnen die entsprechende Skala, indem wir von einem Grundton aus eine Quint aufwärts, eine Quart abwärts, wieder eine Quint aufwärts gehen, und so weiter. Also zum Beispiel: c / g \ d / a \ e .
Das ist auch uns Europäern vertraut. Wir kennen es aus Kinderliedern wie Backe, backe Kuchen. Und eine Skala von zwölf Halbtönen ist uns ebenfalls nicht unbekannt: Wenn wir auf dem Klavier der Reihe nach alle Tasten anschlagen, die zwischen einer Oktave liegen, bekommen wir sie klanglich vorgeführt. Zwar trifft nicht zu, was man früher gern behauptet hat, dass nämlich die zwölf Töne der chinesischen Skala genau mit unseren zwölf chromatischen Halbtönen identisch sind. Aber zumindest gibt es große Ähnlichkeiten.
Grob gesagt, benutzt die chinesische Musik die fünf Töne do – re – mi – sol – la als Grundlage des Musizierens. Die Saiteninstrumente sind meist entsprechend der pentatonischen Skala gestimmt. Der größere Vorrat von zwölf Halbtönen ist freilich nicht überflüssig: Er erlaubt es, die Skala zu transponieren, also mit einem anderen Grundton, zum Beispiel cis, anfangen zu lassen: cis – dis – eis – gis – ais. Und außerdem dienen die chromatischen Stufen dazu, den Gesang durch Abweichungen von der Pentatonik interessanter zu machen.
Die chinesische Musiktheorie nimmt manche moderne Überlegung vorweg, hat aber vor allem Züge, die für die sehr alten Kulturvölker typisch sind: Jene Gesetze, welche die chinesischen Gelehrten über Musik aufgestellt haben, verstehen sich als Teil eines universellen Regelwerks, das den ganzen Kosmos beherrscht. Danach wurzeln alle Ordnungen, die wir kennen, im »großen Einen«, also in einer universellen Idee, die man zur Gänze weder wahrnehmen noch begrifflich fassen, jedoch in vielen unterschiedlichen Ausprägungen erleben kann. Die folgende Tabelle zeigt, wie man sich das Netzwerk kosmologischer Bedeutungen und Entsprechungen vorzustellen hat:
Töne
gong
shang
jue
zhi
yu
Himmelsrichtungen
Norden
Osten
Zentrum
Westen
Süden
Planeten
Merkur
Jupiter
Saturn
Venus
Mars
Elemente
Holz
Wasser
Erde
Metall
Feuer
Farben
schwarz
violett
gelb
weiß
rot
Konfuzius, der große chinesische Weise, ließ sechs Wissenschaften gelten: das Ritual, das Bogenschießen, das Wagenlenken, die Schreibkunst, die Astrologie und die Musik. Bei ihnen allen kommt es auf ein Höchstmaß an Disziplin und Ordnung an. Und das war in China besonders wichtig: Das riesige Reich konnte nur zusammengehalten und einheitlich regiert werden, wenn es strenge, überall gültige Maße und Regeln gab, an denen niemand zu rütteln wagte.
Heerscharen von kaiserlichen Beamten waren für die allgemeine Ordnung verantwortlich. Unter ihnen gab es auch spezielle Musikbeamte, die man als musikalische Eichmeister bezeichnen könnte. Schon der legendäre Kaiser Shun, der um 2285 vor unserer Zeitrechnung an die Macht kam, befahl seinem Hauptmusiker Kui, das Musikwesen des Reiches zu ordnen und dafür zu sorgen, dass die Instrumente überall gleich gestimmt waren, die Blasinstrumente die vorgeschriebene Länge und den richtigen Rohrdurchmesser hatten usw. Wollte sich der Kaiser vergewissern, dass er seine Regierungsgeschäfte richtig und zum Wohl des Reiches durchführte, so lauschte er aufmerksam den fünf Tönen der pentatonischen Skala und den acht Arten der Musikinstrumente. Und er ließ sich die Oden des Hofes sowie die Lieder aus den Dörfern vorspielen, um festzustellen, ob sie der vorgeschriebenen Tonordnung entsprachen.
Dieser »staatstragenden« Funktion der Musik gemäß kam deren praktischer Ausübung an den Kaiserhöfen eine große Bedeutung zu. Kaiser Ming Huang (707–756) unterhielt eine Kapelle aus 1346 Musikern: eine Vorhut von 890 Gong-, Zimbel-, Trommel- und Blasinstrumentenspielern, einen Chor von 48 Sängern und eine Nachhut von weiteren 408 Musikern. Für die höfischen Tanzensembles gab es das Amt des Tanzmeisters Wushi und das Amt des Verantwortlichen für die Rinderschwänze – ein wichtiges Utensil für die zentralen Hofriten.
Vor ein paar Jahrzehnten hat man ein Gemälde gefunden, das den weiblichen Teil des Hoforchesters zeigt. Die Frauen musizieren auf Harfe, Laute, Zither, Flöte, Oboe, Mundorgel, Klapper, Sanduhrtrommel und großer Trommel. Ming Huang komponierte sogar selbst; und das Bild stellt möglicherweise die Aufführung des Liedes Der Duft der Li Dschu dar, das er für seine Lieblingsfrau Yang Gue-fe geschrieben haben soll.
Chinesische Hofmusiker lebten in relativem Wohlstand, aber auch gefährlich. Immer wieder hatten sie ihrem toten Herrn in die Grabstätte zu folgen. In einem um 433 vor unserer Zeitrechnung angelegten Grab des Provinzherrn Yi aus Hubei finden sich neben dem Verstorbenen die Überreste von jungen Frauen und von Musikern mit ihren Instrumenten.
Nicht alle Menschen waren mit dem Luxus, der am kaiserlichen Hof und von anderen Repräsentanten des Staates getrieben wurde, einverstanden. Schon im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung setzte sich zum Beispiel Mo-dsi, Begründer der Philosophenschule der Mohisten, für ein bescheidenes Leben ein. Die Verschwendungssucht der Vornehmen mache die Steuerlast der Armen noch drückender. Und durch Musik, so meinte Modsi, »werden die Hungrigen nicht satt, die Frierenden nicht gekleidet, die Müden nicht gekräftigt«. Von seiner Kritik ist freilich die Volksmusik ausgenommen, die weniger aufwendig und kompliziert gewesen ist, den Beteiligten jedoch mehr Spaß gemacht haben dürfte als die streng reglementierte Hofmusik.
Viele der chinesischen Musikinstrumente haben in Europa Nachfolger gefunden. Eine Besonderheit stellt jedoch die Mundorgel Sheng dar. Sie besteht aus dreizehn und mehr Bambusrohren, die in einem gemeinsamen »Windbehälter« enden. In die Rohre sind durchschlagende Metallzungen eingelassen. Bläst der Spieler Luft in den Windbehälter oder saugt er Luft aus ihm heraus, geraten die Zungen in Schwingung und erzeugen Töne.
Allerdings ist der Vorgang nicht so einfach wie das Blasen auf einer Mundharmonika. Der Spieler muss nämlich, um das gewünschte Bambusrohr zum Klingen zu bringen, ein Loch abdecken, das an dem Rohrteil außerhalb des Windbehälters angebracht ist. Und bis heute wird von Akustikern darüber diskutiert, warum nur dann ein Ton erklingt, wenn dieses Loch abgedeckt wird. Natürlich kann man auf der Mundorgel Sheng auch mehrstimmig spielen – etwa eine pentatonische Melodie mit ostinater, das heißt gleichbleibender Begleitung.
CHINA IST NUR EIN BEISPIEL dafür, dass es schon lange vor dem europäischen Mittelalter Hochkulturen mit fundierter Musiktheorie und hochorganisierter musikalischer Praxis gibt. Dass die chinesische Hofkunst – von der traditionellen Volksmusik wissen wir recht wenig – in unseren Ohren gemessen und distanziert klingt, hängt mit der Bedeutung zusammen, die sie im Staatswesen hatte: Ohne geordnete Musik kein geordnetes Gemeinwesen. Für einen pulsierenden Rhythmus, für individuelles Musikantentum ist da kein Platz: Alles ist vorgeschrieben, und dem Einzelnen bleibt kaum Bewegungsfreiheit.
Trotz alledem lässt sich von der chinesischen Musik viel lernen. Wer etwa Gitarre spielt, nennt deren sechs Saiten mit den Tonbuchstaben e – a – d – g – h – e. Und das klingt ziemlich trocken. Wie wäre es, wenn man mit den Saiten die Vorstellung von Farben verbinden würde: Schwarz, Blau, Violett, Gelb, Weiß, Rot? Oder von Himmelsrichtungen: Osten, Südosten, Süden, Südwesten, Westen, Nordwesten. Oder aber von Feuer, Erde, Wasser, Stein, Licht und Luft?
Dergleichen scheint heute höchstens etwas für kleine Kinder zu sein, denen man rote oder blaue Punkte auf das Griffbrett klebt, damit sie auf anschauliche Weise Gitarrespielen lernen. Doch in Wahrheit steckt viel mehr dahinter: Wer mit einer Gitarrensaite die Vorstellung »Rot«, »Venus«, »Frühling«, »Feuer« verbindet, kommt schnell von der Auffassung weg, Musik sei bloßer nichtssagender Klang, und wird daran erinnert, dass Musikmachen bedeutet, Teil des Universums mit seinen unendlich vielen Erscheinungen zu sein. Dann kann man sich vorstellen, man bringe mit seiner eigenen Musik ein Stückchen Ordnung in die große Unordnung, die wir Menschen in der Welt immer wieder anrichten.
Auf anderen Feldern ist man da schon weiter. So hat sich inzwischen auch im Westen das »Qi-Gong« durchgesetzt, eine Art meditativer Selbsterfahrung mit körperlichen Übungen und Musik. Da finden auch Erwachsene nichts dabei, wenn solche Übungen »Reiten des wilden Pferdes« oder »Der doppelte Drachen springt aus dem Meer« heißen, fühlen sich vielmehr an ganzheitliche leib-seelische Erfahrungen angeschlossen.
Manche europäischen Komponisten haben sich einen Sinn bewahrt für die kosmologischen Zusammenhänge, von denen hier die Rede war. Antonio Vivaldi schrieb einen Zyklus von vier Violinkonzerten, der seinen Hörern die Vorstellung von Frühling, Sommer, Herbst und Winter in Tönen nahebringen soll. Von Dietrich Buxtehude, einem Lehrer Johann Sebastian Bachs, stammen sieben Klaviersuiten mit dem Titel Die Natur oder die Eigenschaft der Planeten. Und Alexander Skrjabin komponierte Musik für ein Farbenklavier. Bis zu seinem Tod im Jahr 2007 war Karlheinz Stockhausen, ein ebenso interessanter wie umstrittener Komponist, damit beschäftigt, die letzten Teile eines gewaltigen musikdramatischen Zyklus mit dem Titel Licht. Die sieben Tage der Woche zu vollenden.
Von Mönchen und SpielleutenDie Musik im europäischen Mittelalter
Vieles aus der Musik der Naturvölker und der alten Reiche lebt im europäischen Mittelalter fort. Auch dieses kennt Sagen von der Macht der Musik. So ist in dem aus dem 13. Jahrhundert stammenden Kudrun