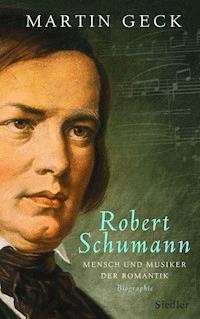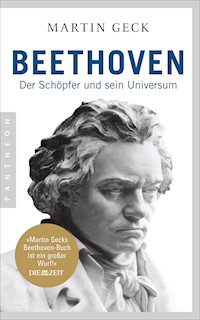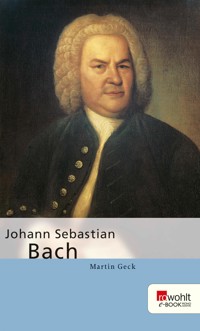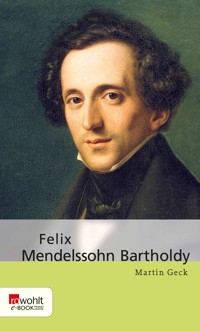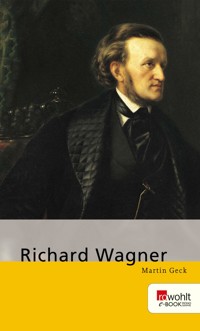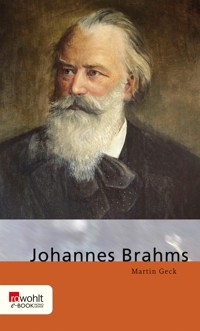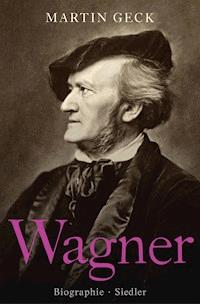
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Richard Wagner - Ein Leben als Gesamtkunstwerk
Wagner und seine Musik werden gefürchtet, verachtet oder vergöttert. Martin Geck hat eine grundlegend neue und fesselnde Biographie eines der bedeutendsten und zugleich umstrittensten Komponisten der letzten Jahrhunderte geschrieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 659
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Bild 1
Bronzemedaille des Wiener Medailleurs Anton Scharff, dem Wagner im Anschluss an die Grundsteinlegung des Bayreuther Festspielhauses im Frühsommer 1872 auf Schloss Fantaisie Modell saß.
Inhaltsverzeichnis
Wagner auf die Schliche kommen?
Mehr als 2500 Seiten umfasst die zweibändige Dünndruckausgabe der Tagebücher von Cosima Wagner; das sind fast eine Million Wörter. Die erste Eintragung stammt vom 1. Januar 1869, die letzte vom 12. Februar 1883. Kaum ein Tag ist ausgelassen; zudem hat Wagner, um dessen Person sich die Aufzeichnungen vor allem drehen, diese immer wieder »kontrolliert« – davon zeugen seine eigenen Eintragungen. Zumindest das letzte Fünftel von Wagners Leben und Schaffen ist somit auf den ersten Blick so lückenlos dokumentiert, dass es keiner großen Anstrengungen zu bedürfen scheint, um Wagner definitiv auf die Schliche zu kommen.
Doch was heißt hier »dokumentiert«? Selbstverständlich teilen die Tagebuchblätter viele unstrittige Fakten mit; doch wie groß ist die Zahl der tendenziös dargestellten oder ganz unterschlagenen Begebenheiten? Die Problematik beginnt damit, dass Cosima das Tagebuch ihren Kindern widmet: »Jede Stunde sollt ihr von mir kennen, damit ihr mich dereinst erkennen könnt«!1 Allerdings schreibt sie dies in einem Augenblick, in dem sie gerade mit ihren von Wagner gezeugten Töchtern Isolde und Eva nach Tribschen am Vierwaldstätter See übergesiedelt ist, um mit Wagner in »wilder Ehe« zusammenzuleben.
Die Töchter sind zu klein, um davon etwas mitzubekommen; aber auch das Tagebuch darf von einer intimen Beziehung Cosima von Bülows mit Richard Wagner nichts spüren lassen. So figuriert dort auch die kleine Isolde, genannt Loldi, unausgesprochen als Tochter Hans von Bülows. Noch 1914, als sie auf Drängen ihres geltungssüchtigen Mannes in puncto Vaterschaft gegen ihre Mutter vor Gericht zieht, gewinnt diese zwar – dem damaligen Eherecht entsprechend – den Prozess, muss jedoch unter Eid offenlegen, während der Empfängniszeit mit Wagner verkehrt zu haben. Nach dieser Bloßstellung darf der Name Isoldes in Cosimas Gegenwart nicht mehr ausgesprochen werden. Wie passt allein dieses eine Detail zu der zitierten Stelle: »Jede Stunde sollt ihr von mir kennen...«?
Doch sind nicht die vielen Tausend Äußerungen, die Wagner selbst seit 1869 über sein Leben, sein Werk, über Kunst, Politik, Religion, die »Judenfrage«, die Vivisektion – mit anderen Worten: über Gott und die Welt – getan hat, eine wahre Fundgrube? Ja, sie sind eine Fund – und zugleich eine Fallgrube: Wir kennen diese Statements, soweit sie im privaten Kreis getan wurden, fast nur durch Cosimas Niederschriften. Diese erfolgten offenbar in Intervallen von mehreren Tagen, wobei sie sich auf Vermerke aus einem kleinen Notizbuch stützte. Doch wie zuverlässig war das alles? Und welche Äußerungen hat sie ohne erklärende Kontexte mitgeteilt, welche unterschlagen, welche in ihrem Sinne verändert?
Wie erwähnt, hat Wagner ihre Aufzeichnungen zumindest von Zeit zu Zeit gelesen, jedoch kein einziges Mal korrigierend eingegriffen. Das soll allerdings nicht heißen, dass er sich über die Jahre hinweg niemals missverstanden gefühlt hätte – solches anzunehmen wäre weltfremd. Vielmehr hat er der Gattin offensichtlich nicht ins Handwerk pfuschen wollen, ihr auch in diesem Punkt ihre Welt gelassen. Man muss das nicht auf die Formel mancher Cosima-Biographen bringen, er habe unter ihrer Fuchtel gestanden: So einfach lassen sich eheliche Verhältnisse kaum jemals beschreiben. Jedoch darf man getrost von einer Parallelwelt Cosimas zu der Welt Wagners sprechen; und diese beiden Welten sind nicht einfach mit dem Argument zur Deckung zu bringen, Cosima habe sich als Sprachrohr Wagners verstanden.
Verspricht da die neue Gesamtausgabe der über 9000 Briefe von der Hand Richard Wagners, die inzwischen bis Band 22 und damit bis zum Jahr 1870 gediehen ist, mehr Authentizität? Und wie steht es um die Wahrheit in MeinLeben – jener über 800 Druckseiten umfassenden Autobiographie, in der Wagner den allergrößten Teil seines Lebens – die Jahre 1813 bis 1864 – rekapituliert? Allein die Tatsache, dass er sie Cosima in die Feder diktiert und vor allem als Lektüre für König Ludwig II. angelegt hat, lässt vermuten, dass er es mit dieser »Wahrheit« nicht allzeit genau genommen hat. Deshalb muss man ihm nicht sogleich einen Hang zur Schönfärberei unterstellen; eine größere Rolle dürften – von schlichten Erinnerungslücken und -fehlern abgesehen – bewusste oder unwillkürliche Selbstmystifikationen gespielt haben.
Auch hier lauern diverse Fallen. Selbst ein so intelligenter und verdienstvoller Wagner-Biograph wie Martin Gregor-Dellin ist immer wieder wie die Fliege in den Mus-Topf gestürzt: berauscht von all dem süßen Zeug und zu guter Letzt in ihm ertrinkend und versinkend. Bei aller vorgeblichen Skepsis gegenüber Wagners Lebensdarstellung identifiziert sich dieser Autor streckenweise so intensiv mit ihr, als wäre er Zeuge der von ihm geschilderten Begebenheiten gewesen. Und wo Wagner oder Cosima einsilbig bleiben, wird er zum Hellseher: »Er widerstand nicht dem Reiz ihrer wohlgeformten Brüste. Er sank an ihr hin und bedeckte ihren Mund mit heißen Küssen.«2 So berichtet Gregor-Dellin über Wagners späte Schwärmerei für Judith Gautier, deren Modus bestenfalls für Mutmaßungen gut ist.
Ja, der über Sechzigjährige ließ der schönen und gebildeten Französin durch den Bayreuther Bader Bernhard Schnappauf Liebesbrieflein zukommen, nachdem sie ihm anlässlich der Festspiele von 1876 ihre Aufwartung gemacht hatte. Und in den Folgejahren bestellte Wagner bei der inzwischen von ihm Angebeteten aus Paris feine Stoffe, Kosmetika und Parfüm, bis Cosima dahinterkam und mit einem gewaltigen Auftritt dafür sorgte, dass die Korrespondenz künftig nur noch über sie lief. Solches darf der Historiker mit leidlich gutem Gewissen zu Papier bringen, obwohl er schon dabei die Cosima-Tagebücher zu Hilfe nehmen muss. Fast alles andere an der »Affaire« ist Spekulation – eine Spekulation, die allerdings längst Bestandteil des Wagner-Mythos geworden ist. Hat es einen Sinn, dagegen anzuschreiben, zu »entmythologisieren«? Lohnt es im Fall der Mathilde Wesendonk, der Cosima so wenig wohlgesinnt war, dass sie Wagners Briefe an seine Muse der Tristan-Jahre noch zu einem Zeitpunkt verbrannte, zu dem sie schon veröffentlicht waren – dies allerdings in zensierter Form, sodass man wohl niemals die »Wahrheit« erfahren wird? »Wahn, Wahn, überall Wahn!«, möchte man mit Hans Sachs ausrufen ...
Die ersten Sporen als angehender Wagner-Forscher verdiente ich mir mit der Edition des Parsifal im Rahmen der Richard-Wagner-Gesamtausgabe. Das war zu einer Zeit, als es bereits eine lebhafte Auseinandersetzung um Werk und Wirkung Wagners und um das »Neue Bayreuth« gab, jedoch noch keine nennenswerte historisch-kritische Wagner-Forschung. Ich war deshalb ein wenig stolz darauf, zusammen mit meinem Mitherausgeber Egon Voss eine Selbstmystifikation Wagners in Sachen Parsifal aufdecken zu können: Die erste Prosaskizze zum Bühnenweihfestspiel wurde nicht etwa, wie es in Mein Leben heißt, nach dem Einzug ins »grüne Asyl« bei »vollem Sonnenschein« symbolträchtig an einem Karfreitag skizziert, sondern erst einige Wochen später. Hätte ich für die 1970 erschienene Parsifal-Edition die damals noch sekretierten Cosima-Tagebücher einsehen können, so wäre ich unter dem 22. April 1879 auf den Eintrag gestoßen: »R. gedachte heute des Eindruckes, welcher ihm den Karfreitags-Zauber eingegeben; er lacht, und ›eigentlich alles bei den Haaren herbeigezogen wie meine Liebschaften, denn es war kein Karfreitag, nichts, nur eine hübsche Stimmung in der Natur, von welcher ich mir sagte: So müßte es sein am Karfreitag‹, habe er gedacht.«3
Daraus muss kein Zynismus sprechen. Vielleicht wollte Wagner sagen: »Ich kenne meine eigenen Mystifikationen.« Dann könnte der Satz weitergehen: »... und ich brauche sie.« Auch dafür ein Beispiel: Wagner hat gern betont, dass er oftmals in einem »wahnsinnigen somnambulen Zustand« komponiere.4 Und in Mein Leben erinnert er sich ganz konkret, das Orchestervorspiel zum Rheingold sei ihm – nach vorangegangenen Phasen des Suchens – »aufgegangen«, als er im September 1853 im norditalienischen La Spezia nach einer anstrengenden Wanderung auf ein Ruhebett gesunken und in einen »somnambulen Zustand« verfallen sei – mit der »Empfindung, als ob ich in ein stark fließendes Wasser versänke«.5
Das ist, wie Wagner-Spezialisten inzwischen wissen, eine nachträgliche Mystifikation; denn der zwei Monate nach dem Besuch in La Spezia niedergeschriebene erste Entwurf des Rheingold-Vorspiels ist unspezifischer, als er nach Wagners Beschreibung seines Déjà-vus hätte sein dürfen. Doch der Komponist bedurfte einer Mystifizierung des Kompositionsvorgangs,6 um mögliche Selbstzweifel an seinem Kompositionsverfahren zu beseitigen: Immerhin würde einiger Mut dazu gehören, dem Publikum demnächst 136 Takte reines Es-Dur als sinnvollen Auftakt für vier Abende Ring schmackhaft zu machen! Übrigens mag die Lektüre von Schopenhauers Essay Versuch über das Geistersehn und was damit zusammenhängt als Anregung für Wagners Mystifikation gedient haben: Dort spricht der Philosoph von Somnambulismus und »Visionen aller Art«, die jenseits der Gesetze von Zeit und Raum und womöglich entgegen physikalischer Kausalität in einem überindividuellen Raum wirksam würden.7
Wagner, der sich als Vorkämpfer für eine neue Mythologie erlebte, kamen solche Gedankengänge entgegen – nicht nur in diesem speziellen Fall, vielmehr im Blick auf sein gesamtes Leben, Wirken und Schaffen. Es wäre ebenso blauäugig, seine Äußerungen immer für bare Münze zu nehmen, wie es vermessen erschiene, ihn systematisch der Lüge überführen zu wollen. Und so viel Kredit ich einer Wagner-Forschung einräume, die durch fortdauernde Sichtung des verfügbaren Materials zu immer »sachgerechteren« Urteilen gelangen möchte, so wenig verspreche ich mir davon – und dies aus einem allgemeinen und einem speziellen Grund.
Allgemein ist es mit unserem Gedächtnis nicht zum Besten bestellt. DerSchleier der Erinnerung heißt ein Buch des Mediävisten Johannes Fried, in dem es um die notorische Unzuverlässigkeit des Erinnerungsvermögens geht. Fried verweist nicht nur auf die Vagheit mittelalterlicher Quellen, sondern auch auf frappante Gedächtnislücken von Personen unserer Zeitgeschichte. Erstaunlich unterschiedlich sind beispielsweise die Versionen, welche die Atomphysiker Niels Bohr und Werner Heisenberg von ihren Gesprächen über die mögliche Entwicklung von Atomwaffen in Deutschland und den USA verbreitet haben: Schon wenige Jahre nach ihrem Zusammentreffen im Herbst 1941 waren sie sich nicht nur über den Inhalt ihres Gedankenaustauschs, sondern auch über dessen Ort und Zeitpunkt weitgehend uneins, ohne dass man ihnen deshalb böse Absichten unterstellen müsste.8
Speziell auf die Wagner-Forschung übertragen, bedeutet das: Weil die bedeutsamen Mitteilungen zur Lebens – und Schaffensgeschichte fast immer auf individuellen Erinnerungen, persönlichen Einschätzungen usw. beruhen, ist es unmöglich, auf ihrer Basis ein objektives und zugleich aussagekräftiges Wagner-Bild erstellen zu wollen. Dies ist umso aussichtsloser, als Wagner selbst nicht willens gewesen ist, zwischen Wirklichkeit und Phantasie zu trennen. Man verfehlt ihn geradezu, wenn man besserwisserisch auf einer solchen Trennung beharrt.
Das führt zu einem Dritten: Wagner weigert sich beharrlich, zwischen »Leben« und »Werk« zu trennen. Es gibt für ihn nur eine Wahrheit, und das ist diejenige seiner Sendung. Vor diesem Horizont deutet Wagner Leben und Schaffen als ein »Gesamtkunstwerk«, das die Darstellung peinlicher und katastrophischer Begebenheiten zwar nicht ausklammert, jedoch den höheren Sinn dieser Sendung nicht infrage stellt. Es ist daher reichlich problematisch, mit Gregor-Dellin zwischen »Alltagswelt« und »Kunst« sowie »Charakter« und »Werk« zu unterscheiden.9 Udo Bermbach lässt Wagner in Schriften wie DieKunst und die Revolution die »Perspektive einer das Leben anleitenden neuen Kunst, seiner Kunst« entwerfen.10 Auch nach Meinung Christian Kadens hängt der Mythos, wie ihn zum Beispiel der Ring des Nibelungen entfaltet, keinen lebensfernen Illusionen nach, handelt vielmehr von »Gefährdung des Scheinhaften, Destabilisierung der Illusion« und bleibt darin »der Wirklichkeit treu«.11
Trotz solcher Interpretationen lässt sich die Spannung zwischen Leben und Werk allerdings nicht auflösen. Peter Wapnewski plädiert einerseits dafür, das Werk Wagners als »eine monumentale Bewältigung von Schuld und Lüge« und als »einen großen Erlösungs-Anruf« zu verstehen. Andererseits warnt er zu Recht davor, die verschlungenen Wege von Leben und Werk übereinanderzulegen: »Wotans versehrtes Bewußtsein ist nicht das eines Wagner, der sich vergeht an seinem Bayern-Gott, ist nicht das des Verräters an Wesendonks Großmut oder an Minnas, Mathildes Liebe.«12
Wagner selbst ist sich solcher Ambivalenzen bewusst gewesen. Einmal betont er, man müsse nicht alles selbst erlitten haben, was man erdichte. So habe Goethe schon in jungen Jahren genug »Weisheit« gehabt, um den ersten Teil des Faust zu schreiben: »da sieht man, wie töricht es ist, von den Dichtern anzunehmen, sie müßten erst ihre Dichtungen erleben«.13 Ein anderes Mal äußert er angesichts seiner Arbeit am Parsifal fast Gegenteiliges: »Ich bin dazu bestimmt gewesen, immer in Prosa (im Leben) auszuführen, was ich dichtete; die Scene mit dem Schwan, man wird glauben, sie sei aus meiner Ansicht über die Vivisektion entstanden.«14
Natürlich kann man als Musikologe der Diskussion über die Probleme der Wagner-Biographik dadurch aus dem Weg gehen, dass man sich aufdie Noten konzentriert und beispielsweise über Spezifika der Wagnerschen Harmonik forscht. Solches Tun gilt dann freilich einem Teilmoment der neuzeitlichen Kompositionsgeschichte, nicht aber dem »Phänomen Wagner«. Denn auch bei dem trockensten Musiktheoretiker dürfte sich herumgesprochen haben, dass Wagners Musik sich nicht allein aufgrund der Noten deuten lässt: Selbst bei musikimmanenter Betrachtungsweise sind viele kompositorische Entscheidungen nur von der Szene her zu verstehen. (Während Theodor W. Adorno sich mit diesem Phänomen schwertat, war Robert Schumann gleich bereit, seinen zwiespältigen Eindruck von der Partitur des Tannhäuser ins Positive zu wenden, nachdem er einer Aufführung der Oper beigewohnt hatte.)
Müßig ist die Frage, ob nicht die Bach – oder die Mozart-Forschung vor ähnlichen Problemen stünden: Während wir über den biographischen und zeitgeschichtlichen Kontext der Kunst der Fuge oder der Jupiter-Sinfonie kaum informiert sind, füllt das Wagner-Wissen nun einmal viele reale und imaginäre Bände. Postmodern formuliert: Wagner hat sein Leben und Schaffen schon zu Lebzeiten ganz bewusst »ins Internet gestellt«. Hinter seine imaginären Webseiten kommen wir vielleicht in einigen Details, nicht aber generell zurück; wir können nur versuchen, sinnvollen Gebrauch von diesen Webseiten zu machen.
Damit bin ich bei meinem Buch. Nachdem ich über viele Jahre hinweg Wagner-Philologie betrieben und unter anderem die Grundlagen zu dem dickleibigen Wagner-Werk-Verzeichnis (WWV) gelegt habe, gelüstete es mich nicht länger, Wagner auf die Schliche zu kommen. Mit den weiterhin üppig sprudelnden Wagner-Quellen sinnvoll umzugehen heißt für mich nunmehr, eine Brücke zu schlagen zwischen einstigen und gegenwärtigen Wagner-Diskursen, wobei nach meiner Überzeugung die historisch gewordenen Diskurse allerdings nur insoweit erleb-und beschreibbar sind, wie sie sich in den gegenwärtigen spiegeln: Als normale Sterbliche können wir bekanntlich weder in den gleichen Fluss springen noch vom Ufer aus verfolgen, wo die Wellen des Ozeans entstehen; wir können nur zuschauen, wie sie sich am Strand brechen.
Bild 2
Titelseite des Erstdruckes von Wagners Autobiographie Mein Leben mit dem Geier als Wappentier. Den Druck des ersten von vier Bänden, der die Lebensjahre von 1813 bis 1842 umfasst, ließ Wagner, der sich damals in der Schweiz aufhielt, von dem Baseler Drucker G. A. Bonfantini im Laufe des Jahres 1870 herstellen und von Friedrich Nietzsche überwachen. Als Vorlage diente die von Wagner korrigierte Diktatniederschrift seiner Gattin Cosima. Der Band sollte in einer Auflage von 15 Exemplaren in die Hände des Gönners König Ludwig II. und treuer Freunde gelangen. Fast alle diese Exemplare erbat sich Cosima nach dem Tod Wagners zurück, um sie, sofern sie damit Erfolg hatte, alsbald zu vernichten. Da der Drucker jedoch heimlich ein weiteres Exemplar hergestellt hatte, das dann in die Hände der Wagner-Biographin Mary Burrell gelangte, gab es schon früh Spekulationen über den Inhalt der Autobiographie, die inzwischen in authentischer Ausgabe vorliegt.
Diskurse sind Sprachspiele zu bestimmten Themen – interessegeleitet, unabgeschlossen. Und das Wort »Sprachspiel« besagt: Es hat keinen Sinn, zwischen Wahrheit oder Lüge, Recht oder Unrecht, Richtig oder Falsch unterscheiden zu wollen. Natürlich hat der Autor das Recht, angesichts bestimmter Vorgänge Beifall zu klatschen oder den Kopf zu schütteln. Doch im Wesentlichen wird er sich darauf beschränken, das Regelwerk und die Praxis eines Sprachspiels zu betrachten und daraufhin zu reflektieren, was ihm das jeweilige Spiel bedeutet. Dabei wird es nicht nur um Diskurse über Wagner und seine Bühnenwerke gehen; auch das Schaffen selbst ist ein Sprachspiel – sogar eines der sinnlichsten aller nur denkbaren.
Damit die Beschäftigung mit Sprachspielen, die das Etikett »Wagner« tragen, nicht im Vagen landet, schicke ich mein Autoren-Ethos vor. Ich will nicht Wagner auf die Schliche kommen, sondern mir selbst und meiner Zeit: Was fasziniert bis heute an Tristan und Isolde oder am Ring des Nibelungen? Welche Ideen und Ideologien transportieren Kunst und Künstler? Beschädigt Wagners Antisemitismus sein Werk? Gibt es zentrale Botschaften zu reflektieren, mit denen sich der postmodernen Beliebigkeit eines »anything goes« beim Thema Wagner begegnen ließe? Anders gefragt: Was treibt uns, wenn wir Wagner nahekommen oder uns von ihm abwenden? Welche Werte und Unwerte nehmen wir im Medium seiner Opern und musikalischen Dramen wachen Sinnes in uns auf, welche werden uns via Musiktheater im wahrsten Sinne des Wortes untergejubelt?
Wie gesagt: Es geht um Werte und Unwerte. Walter Benjamin hat geraunt, was ein distanzierter Betrachter »an Kulturgütern überblickt, das ist ihm samt und sonders von einer Herkunft, die er nicht ohne Grauen bedenken kann«.15 Und Joachim Kaiser, Doyen der deutschsprachigen Musikkritik, beginnt sein Buch Leben mit Wagner mit dem Satz: »Unsere Wagner-Liebe krankt an einer Amfortas-Wunde.«16 Gehe ich, was Wagner betrifft, von meiner eigenen Wahrnehmung aus, so erlebe ich Faszination und Grauen in einem empfindlichen Gleichgewicht. Ich gestehe zugleich, dass meine Schreibweise eher von Teilnahme à la Thomas Mann als von Zorn im Sinne der enttäuschten Liebhaber Nietzsche und Adorno geleitet ist: Ich kann nur über die Kunst schreiben, die mich bei all ihrer Widersprüchlichkeit letztendlich fasziniert.
Dass die vorliegende Darstellung musiktheoretische, musikästhetische, philosophische, kulturgeschichtliche und lebensgeschichtliche Sichtweisen zu verbinden trachtet, macht aus ihr kein Gesamtkunstwerk, verdeutlicht aber meine kunstkritischen Bedenken, komplexe Vorgänge so lange zu filtern, bis sie im schwarzen Loch der Abstraktion verschwinden. Solches entspräche weder Wagners Kunstvorstellung noch unserer eigenen Kunsterfahrung.
Für die mitgeteilten Fakten bürge ich mit der Seriosität des Wagner-Forschers. Das Übrige versteht sich als jene »Dichtung«, welche der amerikanische Historiker Hayden White in seinem Buch Auch Klio dichtet oder Die Fiktion des Faktischen beschwört; dort wird mit Klio eine heute gern übersehene Muse zu neuen Ehren gebracht: die Muse der Geschichtsschreibung. Abgesehen von dem Faktengerüst, in dem der Historiker herumklettert, ist auch er in den Augen Whites nichts als ein Interpret – und damit ein Dolmetscher. Klio gebe, dass ich zwischen Wagner und meinem Lesepublikum leidlich zu dolmetschen vermag.
Bild 3
Scherenschnitt eines unbekannten Künstlers vom Spätherbst 1835. Das erste bekannte Bildnis Richard Wagners war ein Geschenk an seine spätere Gattin Minna Planer, um die er damals – während er Das Liebesverbot komponierte – warb.
KAPITEL 1
Die theatralische Urszene: VonLeubaldzu denFeen
»Wildeste Anarchie« · Unklarheiten der Vaterschaft · Frühkindliche Trennungserlebnisse · Erste Theaterleidenschaft · Die »zarteren Garderobengegenstände« der schwestern und Marcel Prousts Madeleine-Biskuits · Das Pennälerdrama »Leubald« · »Hero und Leander« als Wagners theatralische Urszene · Kompositionsübungen, »um Leubald und Adelaide zu komponieren« · Beethovens »Egmont«-Musik als Vorbild · Erste Sonaten, Ouvertüren und eine C-Dur-Sinfonie fürs Leipziger Gewandhaus · Eine »Hochzeit«, die Schwester Rosalie missfällt · »Die Feen«: Ein respektabler Einstand des Zwanzigjährigen · Wagners Entdeckung: Musik als Inbegriff erlösender Liebe · Ausblick auf Nietzsches »Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik« · Ein Vorgriff: »Erlösung durch Untergang« als künftiges künstlerisches Leitmotiv · Kongruenz von Leben und Werk?
Richard Wagners Kindheitserinnerungen drehen sich beständig um zwei Stichworte: Chaos und Theater. »Ich bin in der wildesten Anarchie aufgewachsen«, bemerkt er im Juli 1871 zu Cosima.17 Und in Mein Leben erzählt er von einer Mutter, deren »sorgenvoll aufregender Umgang mit einer zahlreichen Familie« keine Behaglichkeit oder gar »Familienzärtlichkeit« habe aufkommen lassen: »ich entsinne mich kaum je von ihr geliebkost worden zu sein, wie überhaupt zärtliche Ergießungen in unsrer Familie nicht stattfanden; wogegen sich ein gewisses hastiges, fast heftiges, lautes Wesen sehr natürlich geltend machte.«18
Vater Friedrich stirbt ein halbes Jahr nach Richard Wagners Geburt; die Mutter heiratet schon neun Monate später den Hausfreund Ludwig Geyer und siedelt mit ihm nebst ihrer Familie von Leipzig nach Dresden über. Der kleine Richard wird bis zu seinem 15. Lebensjahr den Namen Geyer tragen und im Alter nicht völlig ausschließen, Geyers leiblicher Sohn zu sein. Immerhin wählt Wagner für die erste Textseite des seit 1870 erscheinenden Privatdrucks von Mein Leben den Geier als Wappentier. Und eine Bayreuther Familienzeremonie aus Anlass seines 66. Geburtstags schildert er König Ludwig II. mit den Worten: »Vor einem neuen Bild meiner Frau von Lenbach [...] stand mein Sohn Siegfried, in schwarzem Sammet und blondgelocktem Haar (dem Jugendportrait Van Dycks durchaus ähnlich); dieser sollte – in bedeutungsvoller Wiedergeburt- meinen Vater Ludwig Geyer vorstellen.«19
Der wirkliche Geyer scheint zwar ein guter, jedoch strenger Ersatzvater gewesen zu sein. Im August 1873 erzählt Wagner bei Tisch »von seiner Kindheit. Wie er mit der Peitsche, die er mit gestohlenem Gelde gekauft, von Vater Geyer geprügelt worden sei und wie seine Schwestern vor der Türe dabei geheult hätten.«20 Als Siebenjähriger wird Wagner, den man wegen seiner Empfindsamkeit »Amtmann Rührei« nennt,21 zum Pastor Christian Ephraim Wetzel nach Possendorf bei Dresden in Pension gegeben. Als ein Jahr später Ludwig Geyer stirbt, erhält der kleine Richard für dreizehn Monate Kost und Logis bei Geyers jüngerem Bruder Karl in Eisleben. Danach wird er für kurze Zeit bei seinem Onkel Adolf in Leipzig untergebracht, muss jedoch in einem Prachtzimmer schlafen, das mit gespenstisch wirkenden Bildnissen von »vornehmen Damen im Reifrock mit jugendlichen Gesichtern und weißen (gepuderten) Haaren« ausgestattet ist. Daher »verging nie eine Nacht«, so heißt es in MeinLeben, »ohne daß ich in Angstschweiß gebadet den schrecklichsten Gespenster-Visionen ausgesetzt war«.22
Da Onkel Adolf für Richards Erziehung keine weitreichende Verantwortung übernehmen will, kehrt der Junge Ende 1822 nach Dresden in den Schoß der Familie zurück, um die Kreuzschule zu besuchen. Als die Mutter 1826 nach Prag übersiedelt, wird der Dreizehnjährige Logiergast der Familie eines Dr. Rudolf Böhme, dort freilich – laut Mein Leben – »nicht sonderlich wählsam geleitet«.23 Ende 1827 geht es definitiv nach Leipzig, wo die Mutter mit ihren Töchtern nach dem böhmischen Intermezzo gelandet ist. Richard bezieht das Nikolaigymnasium und schreibt – vierzehn – bis fünfzehnjährig – das »große Trauerspiel« Leubald.
»O Gott, mein Engel, ich habe im Ganzen bittre Jugend verlebt«, wird er ein Jahrzehnt später seiner Braut Minna Planer klagen.24 Diese Jugend mag vielleicht nicht härter als die manch anderer Jungen aus seinem Milieu gewesen sein, jedenfalls aber ist sie »anarchisch« und in hohem Maße verunsichernd: »Wer ist mein Vater?«, »Liebt mich meine Mutter?«, »Wo bin ich zu Hause?«, »Was sind meine Vorbilder?« – solche Fragen wird sich der junge Richard Wagner vermutlich öfter als die meisten seiner Altersgenossen gestellt haben. Und sofern es ihm nicht genügt, im Strom des alltäglichen Lebens »irgendwie« mitzuschwimmen, muss er seinem Dasein selbst Perspektiven geben!
Die zaubert man nicht aus dem Hut, gewinnt sie vielmehr aus dem eigenen Umfeld. Damit kommt das zweite Stichwort, das aus Wagners Jugenderinnerungen heraussticht, ins Spiel: das Theater. Man sollte Hölderlins Zeilen »Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch« nicht überstrapazieren: Doch was Wagner angeht, so hat ihm das Theater im weitesten Sinne des Wortes in der Tat das Leben gerettet, speziell in jungen Jahren. Die »Anarchie« seines Milieus korrespondiert nämlich von Anfang an mit dessen Neigung nicht nur zur Theatralik und Selbstinszenierung, sondern auch ganz konkret zur Bühne. Die Mutter warnt zwar alle Kinder vor dem gottlosen Theaterwesen-jedoch mit so wenig Überzeugungskraft, dass vier der sechs älteren Geschwister Richards eine Bühnenlaufbahn einschlagen. Rosalie wird einmal das Gretchen in der ersten Leipziger Aufführung des Faust geben, Clara als erst Sechzehnjährige die Hauptrolle in Rossinis Cenerentola singen, Rosalie mit siebzehn Jahren diejenige in Webers Preciosa. Der ältere Bruder Albert hat gleichfalls am Leipziger Stadttheater Erfolg, unter anderem in den Mozart-Rollen Tamino und Belmonte.
Der früh verstorbene Vater hatte zwar den Beruf eines Polizeiaktuars ausgeübt, stammte aber aus einer Familie von Künstlern und Wissenschaftlern, war studierter Jurist und Mitglied eines Liebhabertheaters. Obwohl er Goethe, Schiller und E. T. A. Hoffmann aus der Nähe kannte, vermochte er es allerdings nicht seinem Bruder Adolf gleichzutun: Dieses in Leipzig stadtbekannte Original ist Doktor der Philosophie, Übersetzer des Sophokles und stolzer Besitzer eines silbernen Bechers, den ihm Goethe als Dank für die Widmung einer Sammlung italienischer Gedichte geschenkt hat. Der junge Richard lauscht, wie es in Mein Leben heißt, den Ergüssen seines Onkels mit Begeisterung; auch lässt er sich auf ausgedehnten Spaziergängen Shakespeare rezitieren.
Ersatzvater Geyer ist Bohemien par excellence; und der kleine Richard kann im Detail verfolgen, wie dieser erfolgreiche Bühnenautor, Schauspieler und Porträtmaler die älteren Geschwister routiniert auf ihre Künstlerkarrieren vorbereitet. Wie selbstverständlich sieht er sich in deren Spuren. Als erwachsener Mann wird Wagner sich in Gegenwart Cosimas erinnern, dass »er mit 5 Jahren den Piccolo-Flöten-Triller des Kaspar, da er nicht singen konnte, mit Perrbip nachgemacht habe, auf einen Stuhl gestiegen sei, als Samiel herübergeguckt habe über ein imaginäres Gebüsch und ›Perrbip, Perrbip‹ gesagt« habe.25 Zwar kann der Freischütz realiter erst dem etwa Siebenjährigen begegnet sein; doch sicherlich ist Wagner mit Größen wie Weber schon früh in Berührung gekommen. »Ja wenn ich die Eindrücke der Weber’schen Sache nicht gehabt hätte, ich glaube, ich wäre nie Musiker geworden«, meint er im Oktober 1873.26
Zunächst überwiegt die Lust am Theater schlechthin. »Was mich [...] beim Besuch des Theaters, worunter ich auch die Bühne, die Räume hinter den Kulissen und die Garderobe verstehe, lebhaft anzog, war weniger die Sucht nach Unterhaltung und Zerstreuung, wie beim heutigen Theaterpublikum, sondern das aufreizende Behagen am Umgang mit einem Elemente, welches den Eindrücken des gewöhnlichen Lebens gegenüber eine durchaus andere, rein phantastische, oft bis zum Grauenhaften anziehende Welt darstellte. So war mir eine Theaterdekoration, ja nur eine – etwa ein Gebüsch darstellende-Kulisse, oder ein Theaterkostüm und selbst nur ein charakteristisches Stück desselben, als aus einer andern Welt stammend, in einem gewissen Sinne gespenstisch interessant, und die Berührung damit mochte mir als der Hebel gelten, auf dem ich mich aus der gleichmütigen Realität der täglichen Gewohnheit in jenes reizende Dämonium hinüberschwang.«27
Bald macht er eigene Bühnenerfahrungen: »Nachdem mich ›Die Waise und der Mörder‹, ›Die beiden Galeerensklaven‹, und ähnliche Schauerstücke, in welchen ich meinen Vater [Geyer] die Rollen der Bösewichter spielen sah, mit Entsetzen erfüllt hatten, mußte ich selbst einige Male mit Komödie spielen. [...] Ich entsinne mich, bei einem lebenden Bilde als Engel ganz in Trikots eingenäht, mit Flügeln auf dem Rücken, in schwierig eingelernter graziöser Stellung figuriert zu haben.«28 Zwölfjährig liest er nach seiner Erinnerung der »gebildeten« Gattin seines Paten Adolf Träger Schillers Jungfrau von Orleans vor. Dass ihm dieser Pate einen hechtgrauen Frack mit imponierendem Seidenfutter und eine rote türkische Weste vererbt,29 mag zum Verschwimmen der Horizonte von »Theater« und »Leben« beigetragen haben.
Doch was ist das gegen die Intimität im geschwisterlichen Boudoir! Dort übten, so weiß Wagner später zu erzählen, »die zarteren Garderobengegenstände meiner Schwestern, mit deren Herrichtung ich die Familie häufig beschäftigt sah, einen fein erregenden Reiz auf meine Phantasie aus; das Berühren derselben konnte mich bis zu bangem, heftigem Herzschlag aufregen. Trotzdem daß, wie ich erwähnte, in unserem Familienverkehr keine, namentlich in Liebkosungen sich ergehende Zärtlichkeit herrschte, mußte doch die stets nur weibliche Umgebung in der Entwicklung meines Empfindungswesens mich stark beeinflussen.«30
Wer will, mag in diesem Kontext Wagners Vorliebe für erlesene Seidenstoffe und exquisite Gerüche als feminin oder gar abnorm abtun und damit einer einschlägigen Tradition folgen. Sinnvoller ist es jedoch, einem Statement nachzugehen, das der Komponist gegenüber dem Musikkritiker Karl Gaillard zur Zeit des Tannhäuser abgegeben hat: »Ehe ich daran gehe, einen Vers zu machen, ja eine Scene zu entwerfen, bin ich bereits in dem musikalischen Dufte meiner Schöpfung berauscht.«31 Er weiß um seinen »Narren am Luxus«,32 braucht ihn jedoch zum Durchhalten: »Ich kann«, heißt es etwa zur Tristan-Zeit, »nicht wie ein Hund leben, ich kann mich nicht auf Stroh betten und mich in Fusel erquicken: meine stark gereizte, feine, ungeheuer begehrliche, aber ungemein zarte und zärtliche Sinnlichkeit, muß irgendwie sich geschmeichelt fühlen.«33
Ja-wir sind noch bei der Grundfrage des jungen Wagner: »Welche Perspektiven habe ich in anarchischem Milieu?« Denn es geht hier nicht um biographische Pikanterien, sondern um Impulse, die Wagner als Künstler stimulieren. Als Kronzeugen können Marcel Proust und Charles Baudelaire dienen: Ersterer spricht an einer berühmten Stelle seiner Recherche du temps perdu vom Genuss eines in Tee getauchten Madeleine-Biskuits, der seine »mémoire involontaire« aktiviert, also einen Akt spontanen Erinnerns eingeleitet habe. Und Proust fährt fort: »Bei Baudelaire [...] sind diese Reminiszenzen noch zahlreicher; man sieht sie auch: was sie bei ihm heraufführt ist nicht der Zufall, und dadurch sind sie meines Erachtens entscheidend. Es gibt keinen wie ihn, der von langer Hand, wählerisch und doch lässig, im Geruch einer Frau zum Beispiel, im Duft ihres Haares und ihrer Brüste, den beziehungsvollen Korrespondenzen nachginge, die ihm dann ›den Azur des ungeheuren, gewölbten Himmels‹ oder ›einen Hafen, der voller Flammen und Masten steht‹ eintragen.«34
Was Proust über Baudelaire schreibt, hätte er auch über dessen zeitweiliges Idol Wagner sagen können: Dass sich Wagner in Mein Leben der sinnlichen Reize erinnert, die das Berühren der »zarteren Garderobengegenstände« seiner Schwestern bei ihm auslösten, ist mehr als eine bloße Reminiszenz an Kindheit und Pubertät – nämlich zugleich eine ästhetische Reflexion des Tannhäuser –, Lohengrin – und Tristan-Komponisten über das synästhetische Potenzial dieser Werke. »Von langer Hand« und »wählerisch«, so bemerkt Proust, habe Baudelaire seine ausufernden Sprachbilder vorbereitet. In diesem Sinne sollte man auch die zitierte Passage aus Mein Leben wahrnehmen – einem Erinnerungswerk, das ja keineswegs für ein sensationslüsternes Massenpublikum bestimmt war: Es ging um Selbstvergewisserung und den Wunsch, das »Leben« mit dem »Werk« stimmig zu machen und umgekehrt. Wenn es seine jugendliche Sinnenlust an den zarteren Garderobengegenständen der Schwestern nicht gegeben hätte, so hätte er sie – oder Vergleichbares – vermutlich erfunden, um deutlich zu machen: Die Einheit von Leben und Werk ist kein Zufall, sondern Schicksal; es musste alles so kommen, wie es gekommen ist.
Man mag das hybrid finden, kommt aber nicht umhin, die Konsequenz zu bewundern, mit der schon der Jugendliche Wagner sein »Lebenswerk« angeht. Der Gymnasiast schwärmt nämlich nicht nur für die Bühne als einzig sinnvolle Lebensperspektive – das haben auch andere vor und nach ihm getan; vielmehr will er seine Stücke selbst schreiben und sich dadurch eine eigene Theaterwelt nicht nur mimetisch, sondern auch gedanklich schaffen. Demgemäß ist er nicht damit zufrieden, Hamlets Monolog »Sein oder Nichtsein« vom Katheder des Klassenraums zu rezitieren; vielmehr vervollkommnet er sich im Griechischen, um den Sophokles lesen und Teile der Odyssee übersetzen zu können. Und wenn die Darstellung in Mein Leben nicht übertrieben ist, schreibt der Zwölf – bis Vierzehnjährige, obwohl ein eher schlechter Schüler, ein großes episches Gedicht »Die Schlacht am Parnassos«.
Während wir von solchen Ruhmestaten nur aus Wagners eigenen Berichten wissen, können wir Leubald. Trauerspiel in fünf Akten im Einzelnen studieren, wohingegen Wagner selbst in erwachsenen Jahren keinen Zugang zu dem als verschollen geglaubten Manuskript seines »opus 1« hatte. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass er sich in Mein Leben eher spöttisch über sein jugendliches »Verbrechen« geäußert hat, zu dem Shakespeare hauptsächlich durch Hamlet, Macbeth und König Lear, Goethe durch Götz von Berlichingen beigetragen habe.35Leubald ist nicht das naive Pennälerdrama, als welches es in der Literatur dargestellt wird, sondern ein ausgedehntes Stück von schätzungsweise sechs Stunden Aufführungsdauer. Wie reflektiert der etwa vierzehnjährige Wagner vorgeht, lässt sich unter anderem daran ablesen, dass er mit großer Konsequenz drei Stilebenen durchhält: Für den hohen Stil, der den Personen der feudalen Gesellschaftsschicht zugedacht ist, bevorzugt er in der Tradition Shakespeares den Blankvers, also fünfhebige Jamben; das niedere Volk lässt er, gleichfalls nach dem Muster Shakespeares, in derber Prosa sprechen; dazwischen gibt es einen mittleren Stil für die Angehörigen des Geisterreichs, die sich in Reimen und Gesängen äußern.
Zwar gibt es in Leubald neben Pfiffigem auch Ungereimtes, Weitschweifiges und sprachlich Ungeschicktes. Und obwohl Wagner nicht, wie er sich in seiner Autobiographischen Skizze zu erinnern glaubte, 42 Menschen zu Tode kommen lässt, sondern nur 14, strotzt das Stück vor Gewalttätigkeiten und Derbheiten aller Art. Doch Plagiat hin, Unreife her: Wagner gelingt es auf atemberaubende Weise, in Leubald seine Urszene unterzubringen und gleichsam ein für alle Mal zu fixieren. Leubald – das ist des langen Dramas kurzer Sinn – hat sich in Adelaide verliebt, ohne zu wissen, dass deren Vater Roderich Leubalds Vater heimlich vergiftet hat. Leubald ist daraufhin von seines Vaters Geist zur Blutrache an Roderich und dessen ganzem Clan verpflichtet worden und führt alsbald aus, was ihm der Geist des Vaters geheißen: Er mordet Roderich nebst Familie. Allein Adelaide, die seit einer vorausgegangenen flüchtigen Begegnung rettungslos in Leubald verliebt ist, kann sich in Sicherheit bringen; dass ihr der Vater sterbend mitteilt, es sei Leubald gewesen, welcher die Sippe so schrecklich heimgesucht habe, vermag sie in ihrer Liebe nicht irrezumachen.
Bei Leubald hingegen bricht zunehmend Geistesverwirrung aus, als er erfährt, dass er in Adelaide ein Mitglied der Familie umwirbt, der er Blutrache geschworen hat. Von den Rachemahnungen aus dem Jenseits bis zum Wahnsinn gequält, besucht er eine Hexe, um den Geist des Vaters bannen zu lassen. Im Zauberspiegel erblickt er jedoch sich selbst als Toten im Schoß der toten Geliebten, worauf er die Hexe erschlägt. Daraufhin wird er von einer Geisterschar verfolgt, die außer dem Blut Adelaides auch sein eigenes verlangt. Im Wahn verwundet er Adelaide tödlich und stirbt anschließend in ihrem Schoß.36
Dieses Handlungsgerüst, das ebenso auf das alte griechische Sagenmotiv von Hero und Leander wie auf Shakespeares Romeo und Julia verweist, spiegelt vor allem Wagners eigene theatralische Urszene: Liebe ist stets mit Tragik verknüpft; eine definitive Vereinigung ist erst im Tod möglich. Vor dem Hintergrund dieser Urszene ist auch Wagners Jugenddrama zu sehen: Zwei schicksalhaft einander Liebende scheitern an der Gegnerschaft ihrer jeweiligen Familien. Dieses »strukturelle« Hindernis, das der junge Wagner im Falle Leubalds aus Romeo und Julia übernimmt, wird in den künftigen Bühnenwerken zwar seine Gestalt ändern, als solches jedoch immer präsent sein. Indessen wird sich der Akzent verschieben: Neben die Tragik, die in der Verhinderung von Liebesglück liegt, tritt zunehmend das Unheil, welches die Liebe an sich in sich birgt. So meint Wagner vom Ring, dass man dort »die einzig beseligende Liebe [...] im Verlaufe des Mythos eigentlich doch als recht gründlich verheerend auftreten« sehe.37 Und Parsifal spricht im Prosaentwurf der Dichtung den Satz: »Stark ist der Zauber des Begehrenden, doch stärker der des Entsagenden.«38
Es wäre reichlich naiv, wollte man Wagners künstlerische Urszene umstandslos mit den Andeutungen über seine eigene Kindheit kurzschließen: »wildeste Anarchie«, unbefriedigende Mutterbindung, Mangel an »Familienzärtlichkeit«, unklares Vaterbild. Denn auf der einen Seite gibt es genug phantasievolle Menschen, die eine ähnliche Lebensgeschichte hinter sich haben, ohne dass es sie deshalb zur Abfassung passender Dramen gedrängt hätte. Und auf der anderen Seite ist Wagner nicht auf das eigene Leben angewiesen, um Vorbilder für seine Urszene zu finden: Das Motiv von Hero und Leander etwa findet sich nicht nur bei den von ihm geliebten und studierten »Klassikern« von Sophokles über Shakespeare zu Schiller, sondern auch in vielen Schauerromanen und Schicksalsdramen der Zeitgenossen. Gleichwohl ist die Kraft des jungen Künstlers zur Selbstdarstellung, ja Selbststrukturierung imponierend. Und die Bewunderung wächst, wenn man beobachtet, wie konsequent es mit seinem Vorhaben, den persönlichen Mythos zu einem allgemeinen zu erheben, weitergehen wird ...
Was zunächst noch fehlt, ist die Musik. Doch schon während der jahrelangen Arbeit am Leubald dämmert es dem jungen Wagner, dass es mit einem Sprechdrama nicht getan ist: Ein solches vermag die Anarchie und das Unheil des Lebens zwar zu bannen, jedoch nicht davon zu erlösen. Es ist mehr als ein Scherz, wenn er viel später, nämlich zur Zeit der Götterdämmerung, aufseufzend bemerkt: »Ach! ich bin kein Komponist, nur so viel wollt ich erlernen, um ›Leubald und Adelaide‹ zu komponieren.«39 Hier wie damals braucht er die Musik, um das Drama dem Mythos zu öffnen, der in seinen Augen allein fähig ist, die Weichen in Richtung »Erlösung« zu stellen.
In denselben Tribschener Jahren, in denen er sich des Leubalds erinnert, erklärt er dem Besucher Nietzsche mit Blick auf Die Hochzeit des Figaro: »Man muß nur das übrigens ausgezeichnete Stück von Beaumarchais mit den Opern Mozart’s vergleichen, dort sind es schlaue witzige, berechnende Menschen, die geistvoll miteinander handeln und reden, bei Mozart sind es verklärte, leidende, klagende Wesen.«40 Monate zuvor hatte er, mit der Vertonung einer düsteren Passage aus dem dritten Akt des Siegfried beschäftigt, gegenüber Cosima geäußert, »die Musik verkläre alles; bis zum Gräßlichen des Wortes lasse sie es nie kommen, selbst beim furchtbarsten Gegenstand«.41
Auch der Fünfzehnjährige, dessen musikhandwerkliche Fähigkeiten zu einer Vertonung des Leubald nicht im Entferntesten ausreichen, ahnt bereits, dass sein künftiges Schaffen auf das musikalische Drama hinauslaufen wird. Er ist kein Komponist katexochen; vielmehr wird seine musikalische Produktivität – fast darf man sagen: nur – über die Szene geweckt. In Oper und Drama bezeichnet er die Musik ausdrücklich als »Weib«, das zwar des Dichters als »Erzeugers« bedürfe, letztendlich aber die »Gebärerin« des musikalischen Dramas sei.42
Vor diesem Horizont ist auch seine nähere Begegnung mit der Musik Beethovens in dessen Todesjahr 1827 zu sehen. Falls Wagner damals schon konkretere Vorstellungen von einer Leubald-Musik gehabt haben sollte, so mag er sich an Beethovens Schauspielmusik zu Goethes Egmont orientiert haben. Diese lässt schon früh die Ahnung in ihm aufsteigen, Musik und Drama ließen sich zu einer neuen, einzigartigen Gesamtkunst vereinen.
Um einer solchen Idee näherzutreten, braucht er allerdings eine praktikable Textgrundlage: Ein Schauerstück à la Leubald, in welchem dem definitiven Liebestod der Protagonisten eine Fülle von Morden, sexuelle Gewalt, Rüpel-und Geisterszenen vorausgehen, ist dazu objektiv höchst ungeeignet. Zum anderen bedarf es musikalischer Kenntnisse. In der Tat ist Wagner damals bemüht, sich die Grundlagen der Komposition anzueignen – zunächst autodidaktisch und dann nolens volens auch im privaten Unterricht. Auf dieser Basis erblicken zwischen 1829 und 1832 erste Lieder, Sonaten und Ouvertüren das Licht der Welt. Während diese frühen Versuche meistenteils verschollen sind, liegt mit der Sinfonie in C-Dur (WWV 29) ein Opus vor, das es damals immerhin zu einer Aufführung im Leipziger Gewandhaus bringt und Wagner noch im Alter »so stark interessirt«,43 dass er wenige Wochen vor seinem Tod in Venedig eine Aufführung im Teatro La Fenice als Geburtstagsgeschenk für Cosima arrangiert und dirigiert.
Nach dem erfolgreichen sinfonischen Debüt fühlt er sich für eine erste Oper gewappnet: Als Neunzehnjähriger geht er an die Hochzeit und vertont damit ein Sujet, das von dem Buch Ritterzeit und Ritterwesen des Germanisten und Volkskundlers Johann Gustav Gottlieb Büsching angeregt ist: Ada soll im Sinne einer konventionellen Ehe mit Arindal vermählt werden, entgeht aber vor der Hochzeitsnacht nur knapp einer Vergewaltigung durch einen Hochzeitsgast namens Kadolt. Es gelingt ihr, den Wüstling auf den Balkon abzudrängen und über die Brüstung stürzen zu lassen. Bei der Totenfeier für Kadolt sinkt sie jedoch neben dessen Leichnam entseelt zu Boden.
Da Wagners – freilich lückenhaftes – Resümee des später von ihm vernichteten Textbuchs nahelegt, dass Ada sich durch den Tod mit demjenigen vereinigt, dem sie zuvor insgeheim verfallen war, nämlich mit Kadolt,44 folgt auch die Handlung der Hochzeit in frappanter Weise einer Urszene, der zufolge Liebesverlangen mit Tragik verbunden und Liebesvereinigung erst im Tod möglich ist. Die Lieblingsschwester Rosalie findet das deutlich ehefeindliche Sujet allerdings so degoutant, dass Wagner das Projekt alsbald aufgibt: Ohne die Fürsprache der am Leipziger Theater beliebten Rosalie, die zudem Ernährerin und Wortführerin der Familie ist, hat die Oper eines unerfahrenen Zwanzigjährigen kaum Chancen, von einer Bühne angenommen zu werden.
Doch erstaunlicherweise verwendet Wagner nicht nur die Namen Ada und Arindal für seine nächste Oper mit dem Titel Die Feen; er bleibt auch seiner Urszene treu. Zwar will er es Schwester und Familie nunmehr recht machen, seiner Sendung aber keinesfalls untreu werden. Diesmal drängt sich kein Nebenbuhler in ein legitimes Verhältnis; vielmehr geht es um den Widerspruch zwischen Feen – und Menschenreich. Der König der Feen betrachtet argwöhnisch, dass die Fee Ada in glücklicher Ehe mit einem Sterblichen lebt: mit Arindal, König von Tramond. Er will Ada nur unter der Bedingung ins Menschenreich entlassen, dass ihr Gatte eine Reihe von Prüfungen besteht. Diese sind jedoch so grausam, dass Arindal versagt, worauf Ada zu Stein erstarrt. Das Machtwort, das zum Happy End führt, spricht die Musik: Arindals zauberischer Gesang lässt Ada zu neuem Leben erwachen. Der durch seine Tat nobilitierte Gatte darf ihr nun für alle Ewigkeit angehören, denn als neuer Herrscher des Feenreiches genießt er Unsterblichkeit. »Ein hohes Loos hat er errungen, dem Erdenstaub ist er entrückt! Drum sei’s in Ewigkeit besungen, wie hoch die Liebe ihn beglückt!«, lautet der Schlussjubel.
Doch besteht wirklich Anlass zum Triumph? Mit der Schlusspointe entfernt sich Wagners Libretto jedenfalls radikal von seiner Vorlage, Carlo Gozzis La donna serpente. Während die Protagonistin dieses tragikomischen Theatermärchens in ein volles menschliches Leben an der Seite ihres Gatten eintritt, entschwebt Wagners Arindal, nachdem er in seinem irdischen Königreich eher glücklos agiert hat, in das augenscheinlich höherwertige Feenreich. Moral: Für den Sterblichen gibt es das definitive Glück der Liebe nur im Jenseits.
Das ist die versöhnliche Variante von Wagners Urszene: Zwar kennt auch die Handlung der Feen kein diesseitiges Liebesglück, jedoch die Aussicht auf eine höhere Welt. Und »natürlich« ist es kein anderes Medium als die Musik, die diesen versöhnlichen Schluss ermöglicht, indem sie Arindal den Zugang dorthin verschafft.
In den Feen ist »Erlösung durch Musik« vor allem ein dramaturgisches Moment: Die erlösende Funktion der Töne rein musikalisch vorzustellen gelingt Wagner naturgemäß noch nicht so zwingend wie später im Holländer, in Tristan und Isolde oder am Schluss der Götterdämmerung. Gleichwohl verbietet sich Gönnerhaftigkeit gegenüber einem Frühwerk, das sich zwar ersichtlich in den Spuren eines Spohr, Weber oder Marschner bewegt, von Carl Dahlhaus jedoch immerhin als »typisches Produkt eines komponierenden Kapellmeisters« gewertet wird.45 Auch andere Vertreter der jungen Gattung der deutschsprachigen »großen romantischen Oper«, wie Wagner sein Werk nennt, tun sich damals mit Werken schwer, die dem Anspruch des gemütvollen deutschen Singspiels in der Tradition von Zauberflöte und Freischütz nachspüren, ohne auf die Verve verzichten zu wollen, die dem Publikum an den Opern Bellinis und Aubers gefällt.
In dieser Situation schlägt sich der Zwanzigjährige recht gut; und in der Darstellung mystischer Vorgänge mittels »zauberformelhafter Akkordverbindungen«46 stößt er geradezu auf sein spezifisches »Begabungsfundament«.47 Die »Zauberformel« des Ouvertürenbeginns erinnert nicht nur an die Zauberflöte, sondern auch an den Anfang von Mendelssohns genialer Ouvertüre zum Sommernachtstraum, die Wagner damals vermutlich schon bekannt war. Er selbst hat sich in späteren Jahren von seinem Jugendwerk distanziert, jedoch am Beispiel der Feen den »heiligen Ernst« seines »ursprünglichen Empfindungswesens« hervorgehoben.48
Und nicht von ungefähr lag ihm an der Feststellung, erst auf dem Weg über die Musik zu dem versöhnlichen Schluss der Feen gefunden zu haben.49 Tatsächlich glückt ihm in den Feen ein für das künftige Schaffen entscheidender Schritt: Der pessimistische Gedanke seiner Urszene, dass es in einer sinnlosen Welt keine sinnerfüllte Liebe geben könne, wird durch die Vorstellung kontrapunktiert, dass es doch etwas gibt, das über den Tod hinausreicht: die Musik. Zwar wird es im weiteren Œuvre keinen Arindal mehr geben, der durch Gesang und Harfenspiel in persona das Tor zum Jenseits öffnet; doch es genügt, die vielen Werke wahrzunehmen, die unter Harfenklängen enden, um eine Ahnung von dieser Transzendenz zu bekommen: Holländer, Tannhäuser, Rheingold, Walküre, Siegfried, Götterdämmerung, Tristan und Isolde, Parsifal.
Indem Wagner sein Drama zum musikalischen Drama macht, sorgt er dafür, dass die strukturell schlechte Welt, mit der es die Menschheit zu tun hat, transzendiert, also mit dem Ziel der Erlösung überschritten wird. Von dem Pessimisten Schopenhauer herkommend, hat Friedrich Nietzsche diesen Gedanken in seinem Erstlingswerk, Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, mit persönlicher Begeisterung herausgearbeitet; und Wagner liest es mit Hochgefühl: »er ist glücklich, dies erlebt zu haben«, heißt es Anfang 1872 im Cosima-Tagebuch.50 Das überrascht nicht: Wagners jugendlicher Bewunderer verschafft dessen Vorstellungen vom antiken Gesamtkunstwerk aus dem Geist der Musik die hochwillkommene historische und philosophische Beglaubigung. Und mehr als das: Nietzsches Buch liefert eine Weltbeschreibung, die auf frappierende Weise Wagners eigener Urszene entspricht und von Peter Sloterdijk mit den Worten charakterisiert wird: »Das gewöhnliche individuelle Leben ist eine Hölle aus Leid, Brutalität, Niedrigkeit und Verstrickung. [...] Erträglich wird dieses Leben nur durch den Rausch und durch den Traum – durch diesen zweifachen Weg der Ekstase, der den Individuen zu ihrer Selbsterlösung offensteht.«51
In diesem Sinne wird Nietzsche wenig später in seinen Unzeitgemäßen Betrachtungen von Tristan und Isolde als dem »eigentlichen opus metaphysicum aller Kunst« sprechen52 und damit andeuten, dass Liebe und Liebestod ihre innerweltliche Trivialität nur so weit transzendieren können, wie sie von der Woge der Musik emporgehoben werden. Wagners Statement aus seiner Mittheilung an meine Freunde: »Ich kann den Geist der Musik nicht anders fassen als in der Liebe«53 lässt sich mühelos umkehren: Wahre Liebe ist nur im Geist der Musik zu fassen. Mehr als das: Da Wagners Verständnis von Liebe zwischen rein und unrein, begehrend und entsagend, narzisstisch und gesellig, tyrannisch und sanft, animalisch und sublim changiert, sich weder festlegen noch definitorisch fassen lässt, ist die Musik die einzige »Definition« von Liebe, die der Künstler ans Gefühl zu bringen vermag.
Das klingt unscharf, ist aber in sich stimmig: Wagner hat zeitlebens – selbst in der Phase seines Engagements für die bürgerliche Revolution von 1848/49 – an nichts anderes geglaubt als an seine Kunst. Er war Realist genug, um zu sehen, dass er der schlechten Welt nichts Innerweltliches entgegenzusetzen hätte. Darin folgte er Nietzsches Diktum: »Wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zu Grunde gehn«,54 jedoch auf spezifische Weise: Selbst im Modus der Kunst ist allein die Musik fähig, dem Hörer anstatt fruchtloser intellektueller oder rationaler Erklärungen unmittelbar erfahrbare Sinnangebote zu machen. Und obgleich Wagner diese Fähigkeiten kunstmetaphysisch überhöht, geht er doch von leib-seelischen Realitäten aus: In allen Kulturen verkörpert Musik in erster Linie das von Wagner »Liebe« genannte Prinzip der Weltversöhnung.
Natürlich wandelt sich das Musikerleben mit den Zeitläuften: Namentlich in der Kunstmusik der Neuzeit wird das menschliche Harmoniebedürfnis auf harte Proben gestellt – nicht zuletzt von Wagner selbst. Gleichwohl steht Musik wie keine zweite Kunst nicht nur für die Sehnsucht des Menschen nach einer intakten Welt, sondern auch für die Erfüllung dieser Sehnsucht im Augenblick des Erklingens. In Wagners Bühnenwerken treffen somit zwei Realitäten aufeinander: Die Handlung verkörpert die gesellschaftliche Realität der hoffnungslos schlechten Welt, die Musik die psychologisch-anthropologische Realität eines sinnlich erfahrbaren »Prinzips Hoffnung«. Diese Ambivalenz erklärt ein Teilmoment jener Faszination, die bis heute von Wagner ausgeht.
Vor diesem Hintergrund lässt sich aus Wagners Urszene – »Sie konnten zusammen nicht kommen, das Wasser war viel zu tief« – ein »Leitmotiv« ableiten, welches das gesamte Bühnenschaffen durchzieht: »Erlösung durch Untergang«. Adriano und Irene, Holländer und Senta, Tannhäuser und Elisabeth, Lohengrin und Elsa, Tristan und Isolde, Siegfried und Brünnhilde, Parsifal und Kundry sind allesamt »Liebes« – Paare, die erst im Tod oder durch Entrückung in ein anderes Dasein zur Ruhe kommen. Die Musik hat dabei Sorge zu tragen, dass aus dem »entseelten« Dahinsinken, von dem in den Regiebemerkungen so oft die Rede ist, jene »milde Versöhnung« wird, in der Isolde ihren beispielhaften Liebestod stirbt.
Ich spreche von »Erlösung durch Untergang« als einem Leitmotiv, weil es sich nicht um eine starre Formel handelt, aus der sich Wagners Denken bruchlos ableiten ließe, sondern um eine leitende Idee, die unterschiedliche Gestalt annimmt und vieles, aber nicht alles erklärt. Immerhin erscheint eine Variante dieses Leitmotivs selbst dort, wo man sie am wenigsten erwarten würde, nämlich in den Meistersingern. Wenn dort Hans Sachs am Ende verkündet: »zerging’ in Dunst das heil’ge röm’sche Reich: uns bliebe gleich die heil’ge deutsche Kunst!«, so ist damit ein Untergang gesellschaftlicher Wirklichkeit phantasiert, dem nur die »heil’ge Kunst« das Moment der Versöhnung einzuschreiben vermag – wobei Wagner gewiss nicht zuletzt an seine eigene Kunst denkt.
Allerdings berührt der Hinweis auf die Meistersinger nur ein Randphänomen. Ernst wird es in den übrigen, samt und sonders tödlich ausgehenden Werken, die ja Wagners Urszene zu einem zentralen Thema machen. Dass es sich dort um Untergangsszenarien handelt, liegt auf der Hand. Und dass dieser Untergang zugleich die Erlösung bedeutet, hat Nietzsche beobachtet: »Wagner hat über Nichts so tief wie über die Erlösung nachgedacht: seine Oper ist die Oper der Erlösung.«55 Einer Erlösung, die freilich nur im Tannhäuser auf göttlicher Gnade beruht, während sie ansonsten mit »Schweiß, Noth, Ängsten« erkauft und nur um den Preis der »Selbstvernichtung« zu haben ist.56
Die zuletzt genannten Termini entstammen Wagners Pamphlet Das Judenthum in der Musik. Hier soll uns nur eine spezielle Facette dieser Schrift interessieren: Wagner empfiehlt »Erlösung« durch »Selbstvernichtung« und »Untergang« nicht nur den Juden, wie viele Autoren nach – möglicherweise bewusst – flüchtiger Lektüre behaupten. Zwar haben die Juden Erlösung durch Untergang besonders nötig, weil sie es sind, die den »Lebensorganismus« der modernen Gesellschaft »zersetzt« haben; weil jedoch dieser Organismus nicht mehr zu retten ist, sind alle Mitglieder der Gesellschaft zum Untergang verurteilt.
Der Ring zeigt deutlich genug, dass dies auch für die tragische Gestalt des Wotan gilt: »Wodan [sic] schwingt sich bis zu der tragischen Höhe, seinen Untergang – zu wollen. Diess ist Alles, was wir aus der Geschichte der Menschheit zu lernen haben: das Nothwendige zu wollen und selbst zu vollbringen. [...] sieh Dir ihn recht an! er gleicht uns auf’s Haar; er ist die Summe der Intelligenz der Gegenwart, wogegen Siegfried der von uns gewünschte, gewollte Mensch der Zukunft ist, der aber nicht durch uns gemacht werden kann, und der sich selbst schaffen muss durch unsre Vernichtung«, heißt es in einem Brief an August Röckel vom Januar 1854.57
Über sich selbst schreibt Wagner in der handschriftlichen Erstfassung der Mittheilung an meine Freunde von 1851: »ich bin weder Republikaner, noch Demokrat, noch Sozialist, noch Kommunist, sondern – künstlerischer Mensch, und als solcher überall, wohin mein Blick, mein Wunsch und mein Wille sich erstreckt, durch und durch Revolutionär, Zerstörer des Alten im Schaffen des Neuen!«58 Kurz zuvor hatte er, in der Rolle des Dresdner Revolutionärs, immer wieder von der Notwendigkeit zur »Vernichtung des Kapitals« und zum »Untergang des Staates« gesprochen.59
Da dominiert das Leitmotiv »Erlösung durch Untergang« auch Wagners theoretische Äußerungen, die hier freilich düsterer als die Botschaft seiner musikalischen Dramen klingen, weil die Musik fehlt: Nur sie hätte die Macht, das Moment der Erlösung wirklich ans Gefühl zu bringen und dadurch dem Pessimismus der Selbstvernichtung Töne des Glücks beizumischen.
Was Wagner in seinen Bühnenwerken an »Untergang« und »Selbstvernichtung« vorstellt, denkt er sich so real wie sein ganzes Musiktheater: Dort wird nicht nur metaphorisch gestorben, sondern im Sinne einer höheren Wirklichkeit. Was sein irdisches Leben angeht, hält er es vermutlich mit Luther, der betont, dass der alte Adam täglich ersäuft werden müsse, ohne deshalb mit dem Gedanken zu spielen, Hand an sich selbst zu legen. In diesem Sinne wäre es auch hinsichtlich dieses Leitmotivs kurzschlüssig, Leben und Werk einfach übereinanderzulegen. Jedoch kann kein Zweifel darüber herrschen, dass Wagner beides immer wieder in eins setzt. So betont – wie schon erwähnt – Christian Kaden, dass der Mythos, wie ihn zum Beispiel Der Ring des Nibelungen entfaltet, von »Gefährdung des Scheinhaften, Destabilisierung der Illusion« handele und darin »der Wirklichkeit treu« bleibe, wie sie Wagner immer wieder real erlebt habe.60
Bild 4
Die Feen, dritter Akt. Emilio Sagis Inszenierung für das Pariser Théâtre du Châtelet stammt aus dem Jahr 2009 und versteht sich als eine Art Märchenrevue.
In diesem Sinne identifiziert Wagner sich in der Mittheilung an meine Freunde mit seiner Bühnenfigur des Holländers, »der mir aus den Sümpfen und Fluthen meines Lebens so wiederholt und mit so unwiderstehlicher Anziehungskraft auftauchte«; und er schwärmt von Senta als dem »noch unvorhandenen, ersehnten, geahnten, unendlich weiblichen Weib«, das allein den Holländer in ihm erlösen könne.61
Bevor man dies rein metaphorisch verstanden wissen will, erinnere man sich eines Briefes an Franz Liszt aus der Tristan-Zeit: »Da ich nun aber doch im Leben nie das eigentliche Glück der Liebe genossen habe, so will ich diesem schönsten aller Träume noch ein Denkmal setzen, in dem vom Anfang bis zum Ende diese Liebe sich einmal so recht sättigen soll: ich habe im Kopfe einen Tristan und Isolte entworfen, die einfachste, aber vollblutigste musikalische Conception; mit der ›schwarzen Flagge‹, die am Ende weht, will ich mich dann zudecken um – zu sterben.«62 Dass es sich in den Münchner Jahren nicht anders verhält, dokumentieren die vielen düsteren, oft todtraurigen Notizen im sogenannten Braunen Buch, das doch »eigentlich« von seiner Leidenschaft für Cosima geprägt ist. Auch die Äußerungen der Bayreuther Zeit stehen im Zeichen des Verfalls und der Vergänglichkeit.
Wie verträgt sich diese Selbststilisierung zum Holländer, ja zum wandelnden Ahasver – einer Figur, die nach Dieter Borchmeyer geradezu einen »Existenzmythos des Künstlers Wagner« verkörpert –, mit wachsenden künstlerischen Erfolgen,63 mit Wagners Aufstieg zu einer herausragenden Persönlichkeit der Zeitgeschichte, mit dem gründerzeitlichen Wohlstand in der Villa Wahnfried, mit zwei Ehen und vielen Liebschaften? Die Antwort lautet: Urszenen und Leitmotive stehen für eine innere Realität, die von der äußeren nicht einzuholen ist. Man kann zwar in beiden Realitäten zu Hause sein, das innere Erleben wird jedoch stets die Deutungshoheit haben.
In dem Essay Das Bühnenweihfestspiel in Bayreuth 1882 hat sich der Komponist am Ende seines Lebens selbst zu diesem Thema geäußert: »Wer kann ein Leben lang mit offenen Sinnen und freiem Herzen in diese Welt des durch Lug, Trug und Heuchelei organisirten und legalisirten Mordes und Raubes blicken, ohne zu Zeiten mit schaudervollem Ekel sich von ihr abwenden zu müssen? Wohin trifft dann sein Blick? Gar oft wohl in die Tiefe des Todes. Dem anders Berufenen und hierfür durch das Schicksal Abgesonderten erscheint dann aber wohl das wahrhaftigste Abbild der Welt selbst als Erlösung weissagende Mahnung ihrer innersten Seele. Über diesem wahrtraumhaften Abbilde die wirkliche Welt des Truges selbst vergessen zu dürfen, dünkt dann der Lohn für die leidenvolle Wahrhaftigkeit, mit welcher sie eben als jammervoll von ihm erkannt worden war.«64
Ganz in der Tradition der griechischen Antike erhofft sich Wagner vom musikalischen Drama kathartische, also reinigende Wirkung: Indem der Künstler die böse Welt in ihren Tiefen durchschaut, um sie dann in seiner Kunst »wahrtraumhaft« abzubilden, lässt er sie seine Hörergemeinde vergessen; dabei spricht er für die »innerste Seele« der Welt, die »Erlösung« anmahnt und weissagt.
À PROPOS ...
Bild 5
Man mag es kaum glauben: Wagner sah sich gegenüber FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY in der Rolle des Underdogs. Ein jüdisches Glückskind namens Felix erschien vor seinem inneren Auge: Bankierssohn, ideales Elternhaus, Hauslehrer von feinster Bildung, der Segen des alten Goethe. Ganz zu schweigen von der künstlerischen Karriere: Der Elfjährige erhält als Geburtstagsgeschenk eine Aufführung seines Singspiels Soldatenliebschaft mit Mitgliedern der königlichen Kapelle frei Haus. Der Siebzehnjährige ist mit der genialen Ouvertüre zu Shakespeares Sommernachtstraum in aller Munde; und anlässlich der epochalen Wiederaufführung der Matthäuspassion erweist dem gerade Zwanzigjährigen halb Berlin seine Reverenz.
Und so wird es für längere Zeit bleiben. Mendelssohn darf nach einigen Semestern Universität eine fast dreijährige Kavalierstour antreten. Der Weg führt unter anderem nach England, Italien und Frankreich; und überall hat der junge Künstler Gelegenheit, mit bekannten Persönlichkeiten zusammenzutreffen, seine Werke vorzustellen und vielerlei Musik kennenzulernen. Nicht zuletzt in Paris. Dort stößt ihn Meyerbeers Robert der Teufel ab: ein reines Effektstück – »kalt und herzlos«; speziell der Musik fehlen »die Wärme und die Wahrheit«.65
Wagner, der zeitlebens die »Pauvretät« seines Elternhauses beklagen wird,66 gelangt einige Jahre nach Mendelssohn nach Paris – jedoch nicht auf geebneten Wegen, sondern auf der Flucht vor seinen Gläubigern. Und selbst nach seiner Ernennung zum Dresdner Kapellmeister könnte Igel Mendelssohn dem Hasen Wagner sein »Ick bün all hier!« zurufen; denn längst ist der vier Jahre Ältere nicht nur Chef der Gewandhauskonzerte, sondern seit Juni 1841 auch Kapellmeister am Dresdner Hof ohne ständige Verpflichtungen. Was wäre aus Wagner geworden, wenn Mendelssohn sich damals für ein volles Amt in Dresden entschieden hätte?
Zu Lebzeiten kommen sich die beiden jedoch nirgendwo in die Quere. Im Gegenteil: Wagner rühmt 1843 eine Dresdner Aufführung des Paulus; Mendelssohn äußert sich anerkennend über die Berliner Erstaufführung des Fliegenden Holländer und dirigiert 1846 im Gewandhaus die Tannhäuser-Ouvertüre. Kunstpolitisch ist man ohnehin nahe beieinander: Man ersehnt einträchtig eine seriöse deutsche Oper, reibt sich an Meyerbeer, propagiert anspruchsvolle Konzertprogramme, hat keine Angst vor Beethovens Neunter, fordert tüchtige und leidenschaftliche Berufsmusiker und setzt sich vice versa für berufsständische Reformen ein.
Als Mendelssohn 1847 stirbt, beginnt eine unerfreuliche Nachgeschichte: In seiner Schrift Das Judenthum in der Musik führt Wagner den Kollegen als Musterbeispiel dafür an, »daß ein Jude von reichster spezifischer Talentfülle sein, die feinste und mannigfaltigste Bildung, das gesteigertste, zartempfindende Ehrgefühl besitzen kann, ohne [...] es je ermöglichen zu können, auch nur ein einziges Mal die tiefe, Herz und Seele ergreifende Wirkung auf uns hervorzubringen, welche wir von der Kunst erwarten«.67 In seiner Bayreuther Zeit vergleicht er – allerdings niemals um derbe Bilder verlegen – Mendelssohn mit »den Affen, welche in der Jugend so begabt seien, dann mit wachsender Kraft dumm würden«.68 Immerhin rühmt er weiterhin die Konzertouvertüren als feinziselierte Genrebilder: In der Hebriden-Ouvertüre sei manches »enorm schön, geisterhaft«.69 Und es ist nicht nur Ironie, wenn er Cosima im Jahre 1871 wissen lässt: »Was ich für ein Stümper bin, glaubt kein Mensch, ich kann gar nicht transponieren. [...] Mendelssohn würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen«.70
Wegen seiner komplizierten Stellung im Musikbetrieb verdiene Mendelssohn sogar eine gewisse Teilnahme. Schlimmer seien überdies »unsere heutigen Musikbanquier’s, wie sie aus der Schule Mendelssohn’s hervorgegangen sind, oder durch dessen Protektion der Welt empfohlen wurden«. Trotz aller »eleganten Bildung«71 seien dies Dirigenten, die allein auf das glänzende Äußere der Musik und damit in letzter Konsequenz nur auf ihren eigenen Erfolg setzen. Gleich wirklichen Bankiers würden sie keine Werte produzieren, vielmehr lediglich die Zirkulation der Ware Musik in Gang halten. Diese werde zum bloßen Tauschwert – jenseits der unangenehmen antisemitischen Konnotationen ein wunder Punkt jeglichen kommerziellen Konzertbetriebs.
Dazu der Kontrapunkt – eine kritische Äußerung Mendelssohns über die Sopranistin in der umjubelten Uraufführung seines Elias: »Alles war daran so niedlich, so gefällig, so elegant, so unrein, so seelenlos und kopflos dazu, und die Musik bekam eine Art von liebenswürdigem Ausdruck, über den ich noch heute toll werden möchte, wenn ich daran denke.«72
Bild 6
Die Groteskzeichnung des Pariser Freundes Ernst Kietz von 1840/41 nimmt die wesentlichen Topoi künftiger Wagner-Karikaturen vorweg: Herrscherattitüde, die Frau in der Dulderrolle, Geldnot, materielle Gewalt der Musik, Phantastik des Gesamtkunstwerks. Ein von Dämonen gehaltener Theaterzettel prophezeit die 3790. Aufführung seiner Werke für das Jahr 1950 – eine inzwischen von der Wirklichkeit längst eingeholte Utopie.
KAPITEL 2
Die Verlockungen der »großen Oper«:Das Liebesverbot und Rienzi
Wagner dirigiert »leichtgelenkige französische Modeopern« · »Das Liebesverbot« · Spätere Distanzierung von diesem Jugendwerk · Eine »frivole« Handlung im Geist des Jungen Deutschland · Die spätere Gattin Minna Planer · »Politische« Kompositionen · Begeisterung für »dämonische Volkswutanfälle« im Vormärz · Die tragische Urszene und das heitere »Liebesverbot« · Die missglückte Premiere im März 1836 · Eheschließung in Königsberg Minnas Flucht · Bulwer-Lyttons Roman »Rienzi« · Aussöhnung der Ehepartner · Kapellmeister in Riga Schulden · Flucht über die Ostsee · Rienzi, ein charismatischer Volkstribun · Hitlers Bewunderung für diese Rolle · »Politisierendes Indianerspiel« · Wagners Charakterisierung der Titelfigur · Seine Abneigung gegen singende »Dummköpfe« · Sein Sänger-Idol Schröder-Devrient · Seine Auffassung vom Schauspieler und Sänger · Meyerbeer und die Grand Opéra · »Die Hugenotten« als »Ideendrama« · Die missglückte »Cosima-Fassung« des »Rienzi« · Papo pfeift ein »Rienzi«-Thema · Rienzis »Gebet« · Adrianos Bravourarie · Adriano – eine Hosenrolle
Dem »heiligen Ernst« der Feen folgt alsbald die »Frivolität« des Liebesverbots –