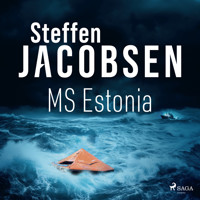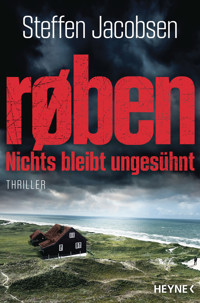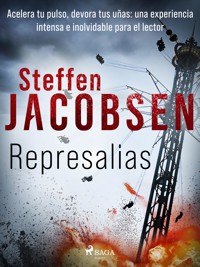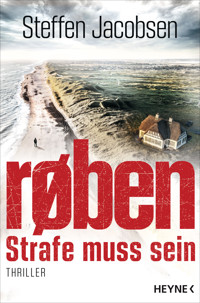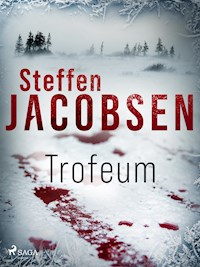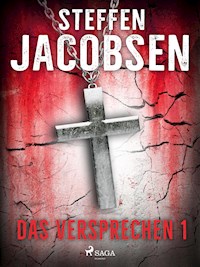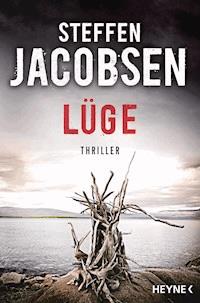
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ein Fall für Lene Jensen und Michael Sander
- Sprache: Deutsch
Hochspannend und beklemmend aktuell - ein neuer Fall für Lene Jensen und Michael Sander
Die dänische Gesellschaft Nobel Oil kennt keine Skrupel, sich die gigantischen Rohstoffvorkommen in der grönländischen Diskobucht zu sichern. Die Einwohner sind alarmiert, Umweltaktivisten agieren zunehmend rabiat. Als der Chef-Geologe des Bohrungsgeländes tot aufgefunden wird und ein USB-Stick mit brisanten Informationen verschwindet, werden Kommissarin Lene Jensen und Ermittler Michael Sander angeheuert, den Fall aufzuklären. Alle Spuren verweisen auf einen Täter aus der militanten Umweltaktivisten-Szene. Doch scheinen diese Hinweise fingiert zu sein, und Jensen und Sander beginnen, auf eigene Faust zu ermitteln. Bis sie erkennen, dass sie nur Bauernopfer sind in einem unerbittlichen Kampf um Geld, Prestige und Macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
Die dänische Gesellschaft Nobel Oil kennt keine Skrupel, um sich die gigantischen Rohstoffvorkommen in der grönländischen Diskobucht zu sichern. Die Einwohner sind alarmiert, Umweltaktivisten agieren zunehmend rabiat. Als der Chef-Geologe des Bohrungsgeländes tot aufgefunden wird und ein USB-Stick mit brisanten Informationen verschwindet, werden Kommissarin Lene Jensen und Ermittler Michael Sander angeheuert, den Fall aufzuklären. Alle Spuren verweisen auf einen Täter aus der militanten Umweltaktivisten-Szene. Doch scheinen diese Hinweise fingiert zu sein, und Jensen und Sander beginnen, auf eigene Faust zu ermitteln. Bis sie erkennen, dass sie nur Bauernopfer sind in einem unerbittlichen Kampf um Geld, Prestige und Macht.
Der Autor
Steffen Jacobsen, 1956 geboren, ist Chirurg und Autor. Seine Bücher sind unter anderem in den USA, England und Italien erschienen. Er ist verheiratet, hat fünf Kinder und lebt in Kopenhagen.
STEFFEN JACOBSEN
LÜGE
THRILLER
Aus dem Dänischenvon Maike Dörries
Der Hirsch sagte: »Nun hat der Mensch alles, was er braucht. Er muss nicht länger betrübt sein.« Aber die Eule antwortete: »Nein. Ich habe ein bodenloses Loch im Menschen gesehen, wie ein Hunger, der nie gestillt werden kann. Darum ist der Mensch betrübt, darum wünscht er sich immer mehr. Sie nehmen und nehmen, bis die Welt eines Tages sagt: ›Ich bin nicht mehr, und ich habe dir nicht mehr zu geben.‹«
Maya-Mythos
TEIL I
Peter Holm war Nobel Oils erfahrenster Geologe, aber von diesem Phänomen hatte er noch nie etwas gehört, und er bezweifelte, dass es jemals von irgendwem beschrieben worden war. Was er allerdings ohne jeden Zweifel wusste, war, dass der Prozess in diesem Moment vonstattenging, zweitausend Meter unter der Feldstation am Fuß des abschmelzenden grönländischen Eisschildes.
So wie er wusste, dass sich der Prozess nicht aufhalten lassen würde.
Befreit vom erdrückenden Gewicht des Inlandeises war der Berg aus seinem achtzehn Millionen Jahre währenden Winterschlaf erwacht. Er erhob sich, befreite, streckte – und veränderte sich.
Nach geologischem Verständnis unsäglich rasant. Schnell, viel zu schnell.
Peter Holm mangelte es durchaus nicht an lebhafter Fantasie, und nun bildete er sich ein, die Veränderungen tief unten im Urgestein zu hören, wenn er ganz still im Labor saß und lauschte.
Er fuhr sich über die Bartstoppeln und betrachtete die Reihe leerer blauer Stühle vor den summenden und blinkenden elektronischen Arbeitseinheiten. Von einer bösen Vorahnung beschlichen, hatte er seine engsten Mitarbeiter aufgefordert, sich den Tag freizunehmen. Die chemische Analyse der letzten und tiefsten Bohrproben wollte er allein vornehmen. Selbst seiner unbeirrbaren rechten Hand, Bao Tseung, ein immer gut gelaunter und gesprächiger chinesischer Geophysiker, hatte er brüsk ans Herz gelegt, in dem Barackendorf bei der Raffinerie zu bleiben. Tseung hatte natürlich gehorcht, gekränkt und schweigend. So barsch war der dänische Chefgeologe ihn noch nie angegangen.
Peter Holm warf seine Kippe in den halb vollen Kaffeebecher, klappte seinen Laptop zu und strich nachdenklich über den Deckel. Dann löschte er die Analyseergebnisse vom Hauptcomputer, zog den Reißverschluss des Parkas bis unters Kinn zu und hängte sich seine Taschen über die Schulter.
Ehe er das Licht löschte, blieb er noch einen Moment in der Tür des fensterlosen Containers stehen und warf einen letzten Blick auf die stummen Spektrografen, die soeben ihn und das gesamte einzigartige Förderprojekt verraten hatten.
Es war vorbei, und es war seine Pflicht, dem absoluten Herrscher der Ölgesellschaft, Axel Nobel, das unabwendbare Ende mitzuteilen.
Er freute sich nicht darauf.
Er schloss die Tür ab und setzte die Sonnenbrille auf gegen das gnadenlose, senkrecht einfallende Sonnenlicht. Die geophysische Siedlung bestand aus einer Handvoll oranger Container auf einer Felskuppe, wenige Hundert Meter vor der schmutzigen, zurückweichenden Wand des Inlandeises. Radio- und Satellitenantennen waren mit Stahlseilen im Felsen verankert, in denen beständig und traurig der Wind pfiff. Die Sonne sprühte Funken über der Diskobucht, und weiter draußen, vor der Bucht und einzelnen treibenden Eisbergen, lag das endlose Eismeer.
Die breite Ebene zwischen Feldcamp und Küste war von Zelten in allen Größen und Farben übersät; lange, weiße Küchen- und Kantinenzelte und Podien, auf denen Demonstranten sich die letzten Monate in destruktive Rage hochgepusht hatten. Von dem eingezäunten Forschungscamp aus betrachtet, sah das Zeltdorf aus wie ein Musikfestival, das nie zu Ende gehen würde. Selbst aus der Entfernung konnte Peter Holm problemlos die flatternden Banner lesen: NOBEL OIL VERGEWALTIGT UNSER LAND, NOBEL OIL STIEHLT GRÖNLANDS ZUKUNFT. Auf vereinzelten Bannern und Plakaten war ein großer Dreizack zu sehen, das Symbol für Poseidons Krieger – eine Aktivistengruppe, die permanent Nobel Oils Anlagen an Land und zu Wasser sabotierte, wobei niemand wusste, wer dahintersteckte und wer ihre Mitglieder waren.
Der letzte Sabotageakt von Poseidons Kriegern hatte den Satellitenverbindungen zum Hauptquartier in Kopenhagen gegolten, und bislang hatte noch niemand den Fehler gefunden oder finden wollen. Selbst die firmeninternen Teletechniker hatten sich von den Umweltaktivisten in ihren Bann ziehen lassen.
Auf dem Schotterweg unterhalb des Höhenzuges hielt ein Landrover mit laufendem Motor. Peter Holm sah eine winkende Hand hinter der geschlossenen Seitenscheibe. Vorsichtig schlitterte er über den Weg, der höllisch glatt war vom Schmelzwasser.
Er stellte die Taschen auf den Rücksitz und nahm neben dem Fahrer Platz, der ihn zur Begrüßung anlächelte. Der junge Mann war schwarzhaarig, schlank und sah aus wie ein Model. Peter Holm ließ seinen Blick über die Oberschenkel in der eng sitzenden Jeans gleiten und bei den braun gebrannten Händen verweilen. Der Landrover pflügte sich durch eine Reifenspur, die mehr ein Vorschlag als ein wirklicher Weg war, während der Geologe auf das weißblaue, glitzernde Meer und die Zelte der Demonstranten starrte.
»Die ziehen ab, wenn der Schnee kommt«, murmelte er. »Das hier wünschen sich doch alle. Ich meine, das sollten sie wenigstens. Arbeitsplätze, Geld, das größte Schieferöl- und Gasvorkommen auf unserem Planeten. Sicherheit. Eine Zukunft.«
»Offenbar nicht alle«, sagte der Fahrer.
Er streckte Holm die Hand entgegen. »Rasmus Nordstrand.«
»Peter Holm. Nein, aber alle, die etwas zu sagen haben. Leute, die im einundzwanzigsten Jahrhundert leben.«
Gelbe Schwimmsperren schlängelten sich quer über die Bucht, dahinter behandelten etwa ein Dutzend Umweltschiffe den Ölaustritt aus einer sabotierten Pipeline, die von der Raffinerie zu einer Tiefwasseranlage führte, wo Supertanker Schieferöl für eine nimmersatte Welt aufnahmen.
Poseidons Krieger hatten vor drei Wochen die Ölleitung mit Nobel Oils eigenem Dynamit in die Luft gesprengt, entwendet aus einem Lager, das eigentlich als absolut einbruchsicher galt.
Das hatte den sonst so reservierten und in sich ruhenden Vorstandsvorsitzenden Axel Nobel in berserkerartigen Zorn versetzt. Wenige Stunden nach dem Sabotageakt war er in seinem Privatjet aus Dänemark eingetroffen, um die zivilisierte, aber inkompetente britische Sicherheitsfirma gegen eine zweifelhafte chinesisch-amerikanische Organisation auszutauschen, die dafür bekannt war, ehemalige Spezialeinheiten und Veteranen aus den Balkankriegen als »Berater« einzustellen. Der Vorstandsvorsitzende hatte persönlich die Beseitigung des Rohöls organisiert, das in die jungfräuliche Bucht ausgetreten war.
Dieser Ölunfall zog natürlich unangenehme Fragen vonseiten der Weltpresse nach sich, der grönländischen Selbstverwaltung, des amerikanischen Kongresses und des dänischen Parlaments, da unschöne Erinnerungen an die Deepwater-Horizon-Katastrophe im Golf von Mexiko wachgerufen wurden.
»Wieso tun sie das?«, murmelte Peter Holm verbittert. »Wieso verwandeln Umweltaktivisten – ausgerechnet Umweltaktivisten – den Nordatlantik in ein einziges großes Salatdressing?«
»Um zu zeigen, dass es möglich ist«, sagte der junge Mann. »Um zu zeigen, dass die Anlagen nicht sicher genug sind und die Natur hier draußen extrem ist, auch wenn das Eis sich zurückzieht. Ganz davon abgesehen haben die hier lebenden Menschen keine Lust, eines Morgens beim Aufwachen festzustellen, dass sie ab jetzt Untertanen der chinesischen Volksrepublik sind. Sie möchten gerne selbst über sich bestimmen, schlagen sich schon genug mit den Dänen rum.«
Peter Holm nahm ihn genauer in Augenschein.
»Kommen Sie von hier? Sie sehen aus wie …«
»Mein Vater ist aus Nuuk und meine Mutter aus Dänemark«, klärte Rasmus Nordstrand seinen Fahrgast auf. »Ich arbeite als Meeresbiologe fürs Hauptquartier in Ilulissat. Sie wollen sicherstellen, dass Sie den Helikopter mit heiler Haut erreichen. Ich spreche die Sprache und kenne die Leute hier oben.«
»Mit heiler Haut?«
»Sie rechnen damit, dass die Situation eskaliert.«
Und damit haben sie mehr recht, als sie ahnen, dachte Peter Holm.
Ein Fahrzeug näherte sich der Küste. GREENPEACE stand in meterhohen grünen Lettern an der weißen Bordwand. Das Schiff stellte sich gegen den Wind, der Buganker rasselte herunter, und ein Kran ließ ein Gummiboot mit Aktivisten in gelben Rettungswesten zu Wasser.
»Wunderbar. Mehr Solidarität«, murmelte der Fahrer und hielt vor einem Wachhaus an. Ein drei Meter hoher Zaun mit Stacheldrahtspirale erstreckte sich zu beiden Seiten. Durch schusssicheres Glas musterte der chinesische Torwächter sie mit ausdrucksloser Miene. An der Wand hinter ihm hing ein Gestell mit Pfeffersprays, Tränengasgranaten und Maschinenpistolen. Auch was Neues, dachte Peter Holm.
Die Schranke ging hoch, und sie fuhren in Schlangenlinien zwischen Stahlhindernissen und Betonblöcken Richtung Küstenstraße. Hinter dem Gebäude spielte ein Wächter mit zwei bedrohlich aussehenden Dobermannpinschern.
Die aufgebrachten Stimmen aus den Megafonen klangen sehr nah. Peter Holm erkannte deutlich die Gesichter der Demonstranten, ihre aufgerissenen, rufenden Münder.
Die Reifenspuren schlängelten sich zwischen haushohen Felsblöcken hindurch. Der Fahrer zeigte auf das schwarze Vorgebirge, das das Tal dominierte und steil himmelwärts ragte; es war Teil einer unter dem Inlandeis begrabenen Bergkette, die Millionen und Abermillionen Kubikmeter Schieferöl und nahezu unerschöpfliche Gasreserven barg.
»Der Berg ist also ein Segen?«, rief er über den dröhnenden Motorlärm hinweg.
Der Geologe zuckte mit den Schultern und legte die Hand um den Griff über seinem Kopf.
»Nicht generell, aber was heißt das schon. Tatsächlich ist dieser Berg verräterisch … oder … Ach, vergessen Sie es einfach, okay? Dieses Projekt könnte der notwendige kräftige, befreiende Tritt in Putins Arsch sein. Unter anderem. Damit wäre Westeuropa in Bezug auf fossile Brennstoffe autark bis zum Jüngsten Tag. Norwegens Festlandsockel ist nichts im Vergleich mit dem hier. Wenn das Projekt hier ernsthaft in Gang käme, könnten alle Dänen von den Transferleistungen leben. Zumindest die Hälfte, die das nicht ohnehin schon tut, meine ich. Wie in Norwegen. Oder den Emiraten.«
»Was meinen Sie mit ›verräterisch‹ …?«
»Gar nichts … nein … nichts.«
Das Nobel-Oil-Logo auf dem Landrover wirkte wie ein rotes Tuch auf die Demonstranten. Mehrere Menschen lösten sich in Trauben von den langen Kantinenzelten und liefen zu der Umzäunung und den wie immer in hoffnungsloser Minderzahl anwesenden dänischen Polizisten.
Der Fahrer schaltete auf Vierradantrieb um. Das Schmelzwasser hatte den Weg unterspült, und der Wagen rumpelte durch tiefe Löcher. Direkt vor ihnen war der Maschendrahtzaun heruntergedrückt und die Pfosten aus der Erde gerissen worden. Tagsüber reparierten chinesische Arbeiter den Zaun entlang der Straße, nachts rissen die Aktivisten ihn wieder um. Drei junge Polizistinnen standen mit verschränkten Armen und heruntergeklappten Visieren vor dem Loch im Zaun. Eine fummelte nervös an ihrem Pfefferspray am Gürtel.
Der Fahrer deutete auf eine formierte Gruppe Demonstranten – Frauen und Männer, Alte und Junge, die sich der Zaunlücke näherten.
»Dann haben sie vielleicht doch recht?«
»Natürlich haben sie nicht recht«, rief Peter Holm.
Die Knöchel der Hand, die den Haltegriff umklammerte, waren weiß. Der Lärm der Megafone war unbeschreiblich. Brutal, erschreckend. So etwas hatte er noch nicht erlebt, dabei hatte er schon einiges gesehen.
Er machte gerade den Mund auf, um sich zu erklären, als ein Stein aus dem Nichts angeflogen kam und die Scheibe neben seinem Gesicht traf. Das Glas splitterte, wurde weiß und bröckelte aus dem Rahmen.
»Verdammt, bringen Sie uns hier raus.«
Der Geologe hob die Hand und betrachtete seine blutenden Finger. Der Landrover holperte halsbrecherisch über den steinigen, rutschigen Weg und wurde von weiteren Felsbrocken getroffen. Die Heckscheibe zerfiel zu einem Scherbenschauer, und der Wagen bäumte sich mit einem Ruck vor einem Felsbrocken auf. Peters Kopf wurde gegen den Türrahmen geschleudert. Er hätte den Arm ausstrecken und die Leute berühren können, so nahe waren sie ihnen inzwischen auf die Pelle gerückt.
Der Fahrer fluchte und kämpfte mit dem störrischen Lenkrad.
Da fiel Peter Holms Blick auf eine einsame Gestalt auf einem Felsvorsprung direkt neben dem Weg, wie auf einer Naturkanzel drapiert. Eine große, statuenhafte junge Frau, ganz in Schwarz gekleidet. Sie starrte mit kaltem, anklagendem Blick auf ihn herunter. Am Fuß des Felsens stand ein Mädchen, acht oder neun Jahre vielleicht, genauso todernst wie die Frau. Der Blick ihrer himmelblauen Augen war außergewöhnlich direkt und weise für so einen jungen Menschen.
Der Landrover beschleunigte auf dem eigentlich unbefahrbaren Weg. Direkt vor ihnen wurde eine Polizistin in ihre Spur gedrängt, und nur die blitzschnelle Reaktion des Fahrers bewahrte sie vor dem Tod. Die Karosserie wurde unaufhörlich mit Felsbrocken bombardiert. Ein Seitenspiegel brach ab. Endlich erreichten sie eine schmale, unzugängliche Klamm, und der Steinregen ließ nach.
Peter Holm drehte sich auf dem Sitz um und erhaschte einen letzten Blick auf die Frau auf dem Felsen.
»Wer zum Teufel ist das?«
»Wer?«
»Die Frau auf dem Felsen!«
»Wer?«
»Haben Sie sie nicht gesehen?! Die müssen Sie doch gesehen haben?! Jesus …«
Er lehnte sich zurück und schaute wieder seine blutigen Finger an. Dann entfernte er einen Glassplitter hinter dem rechten Ohr, sah ihn an und warf ihn weg.
Sie fuhren aus dem tiefen Schatten der Schlucht in die strahlende Sonne. Peter Holm seufzte erleichtert, als er einen Kilometer vor sich den Hubschrauberlandeplatz erblickte. Hier gab es keine Demonstranten; der Landeplatz wurde von Axel Nobels privatem Sicherheitskorps bewacht, einer im Gegensatz zu den dänischen Beamten auf der Ebene bis an die Zähne bewaffneten Truppe.
Im Westen spiegelte sich die Sonne in den turmhohen Tanks und Silos, Pumpstationen und den kilometerlangen weißen und roten Pipelines der Raffinerie. Die ewige Flamme des Überschussgases war fast unsichtbar in der klaren Luft. Die Anlage war eine eigentlich technische Unmöglichkeit an dieser elementaren, nackten und windgepeitschten Küste. Die religiöse Vision eines einzelnen Menschen: Axel Nobels Traum vom Wiederaufbau des Westens in einer in Aberglaube, religiösem Fanatismus und Korruption versunkenen Welt.
Der Fahrer hielt am Rand des Landeplatzes. Er lächelte, aber Peter sah auch ihm den Schrecken deutlich an.
»Ich habe ja gesagt, dass ich Sie mit heiler Haut da rausbringe«, sagte Rasmus Nordstrand etwas zu lässig. »Und wer bezahlt mir den Schrotthaufen, den ich heute Morgen neu und glänzend in Empfang genommen habe?«
»Ich werde dafür sorgen, dass Sie einen neuen bekommen. Welche Farbe hätten Sie denn gern? Grün oder grün?«
Peter Holm lachte erleichtert und betrachtete den großen, orangefarbenen Helikopter auf dem Platz. Die Rotorblätter begannen sich zu drehen. In der Kabine saßen bereits Techniker und Arbeiter, die sich darauf freuten wegzukommen. Er selbst hatte es plötzlich gar nicht mehr so eilig. Sein Adrenalinpegel sank.
Er verabschiedete sich formell mit Handschlag, der etwas länger dauerte als unbedingt notwendig. Dabei streifte sein Blick wieder die strammen Oberschenkel des Fahrers, den muskulösen, braun gebrannten Hals im Ausschnitt des T-Shirts.
Als er die Hand losließ, sah er die Tätowierung am Handgelenk des Mannes: eine schuppige Schlange, die sich zweimal darum wand und ihren eigenen Schwanz verschlang. Er berührte sie vorsichtig mit einer Fingerkuppe. Der Fahrer hatte offensichtlich nichts dagegen.
»Ein eskimoisches Symbol? Was bedeutet es?«
»Nichts. Ich hab mich mit Freunden in Hamburg besinnungslos betrunken und bin am nächsten Morgen mit der Schlange am Handgelenk aufgewacht. Das hat also überhaupt keine tiefere Bedeutung.«
Im Inneren des Helikopters wurde gewinkt, der Pilot tippte auf seine Armbanduhr. Holm winkte unbekümmert zurück.
»Was ist mit Ihnen? Fliegen Sie mit?«, fragte er und sah seinem Gegenüber tief in die Augen. »Ich weiß nicht, was ich ohne Sie gemacht hätte, Rasmus. Wirklich. Die hätten mich gelyncht.«
»Ich nehme den nächsten«, sagte der Fahrer und zeigte an den Himmel, wo ein Helikopter seine Kreise zog und darauf wartete, dass der Landeplatz frei wurde. »Ich will meine Mutter in Kopenhagen besuchen.«
»Wenn Sie Zeit und Lust haben, können wir uns ja vielleicht treffen? Ich bin Ihnen wirklich verflixt dankbar.«
Die Hand des Fahrers lag auf der Gangschaltung zwischen ihnen. Er lächelte. Seine Wimpern waren schwarz und dicht. Die hohen Wangenknochen, das glänzende schwarze Haar und die blauen Augen waren außergewöhnlich, dachte Peter Holm. Er stellte sich die Augen vor, in Ekstase halb geschlossen.
Er zog eine Visitenkarte aus der Brieftasche. Der junge Mann schob sie in die Brusttasche seines Hemdes und klopfte mit der Hand darauf. Und wieder sah er den Geologen unverwandt an, der sich seiner Sache nun fast sicher war.
»Also, rufen Sie mich an. Wir könnten was trinken gehen … was auch immer«, sagte er.
Der Fahrer lächelte.
»Klar. Einen Drink … Was auch immer. Abgemacht!«
Der Helikopter hob ab. Peter Holm warf einen letzten Blick auf den zerbeulten Landrover. Der Fahrer hatte eine Hand über die Augen gelegt und winkte mit der anderen. Peter drückte das Gesicht an die Scheibe, bis Mann und Wagen nicht mehr zu sehen waren, nur noch die Ebene mit den Demonstranten und Zelten. Und der schwarze, innerlich zerfallende Berg.
Allen Denkmalschützern und zartbesaiteten Schöngeistern der Stadt zum Trotz hatte Axel Nobel den Bau einer vierzig Meter hohen und hundert Meter langen Stahl- und Glaskonstruktion über dem an sich schon markanten und sechs Stockwerke hohen Sandsteinkomplex durchgesetzt, der seit dreihundert Jahren die Einfahrt in den Hafen von Kopenhagen dominierte. Für das eine Ende der modernen Konstruktion hatte er sogar die Zulassung für einen Helikopterlandeplatz erhalten; den einzigen seiner Art in Kopenhagen, abgesehen vom Traumaportal des Rigshospitals.
Die elliptische Glaskuppel mit den grünen Fensterplatten, die sich zu einem ovalen Schild wölbten, hatte ein berühmter amerikanischer Architekt entworfen. Wegen der frappierenden Ähnlichkeit mit dem Panzertier war sie schnell auf den Namen Schildkröte getauft worden. Der Anbau war als Tempel für die irdischen Geschäfte des Nobel-Oil-Chefs gedacht, was bei jedem anderen Menschen als ungesunder Ausdruck von Größenwahn abgestempelt worden wäre. Nicht so bei Axel Nobel, dem reichsten Mann des Landes. Er war einzigartig, einer der einflussreichsten Söhne der Nation.
Und an der Aussicht über den Hafen und den Sund war wahrlich nichts auszusetzen, dachte Peter Holm gähnend und leerte die Kaffeetasse.
Der Chef verabschiedete sich gerade von schwer beeindruckten und exaltierten Abgeordneten der grönländischen Selbstverwaltung, Beamten der chinesischen Entwicklungsbank und einfachen dänischen Folketing-Abgeordneten, die zu einer wortkargen Orientierungsveranstaltung über die Zukunft der Diskobucht eingeladen gewesen waren, die selbstredend auch die Zukunft der Realunion an sich war. Eine sehr vielversprechende Zukunft.
Hübsche junge Servicekräfte mit hochgesteckten Haaren und knöchellangen schwarzen Schürzen hatten Kaffee, Wasser und Delikatessen serviert, während die Direktionssekretärinnen dafür sorgten, dass alle sich wohl und wichtig fühlten, gehört und verstanden.
Geishas und Schafe, dachte der Geologe müde, als Axel Nobel den letzten Gast zur Tür begleitete. Seine engsten Berater hatten einsilbig und düster gewirkt. Vielleicht waren ja Gerüchte zu ihnen durchgedrungen, obgleich er sich nicht vorstellen konnte, wie das möglich sein sollte. Soweit er wusste, war er der Einzige, der den Gesamtüberblick hatte. Außer Nobel, natürlich.
Peter Holm hob den Blick und betrachtete ohne größeres Interesse die schwerelos unter den Stahlträgern des Daches schwebende Aluminiumgondel. NOBEL II stand mit großen, teils abgeblätterten, orangefarbenen Lettern auf dem eindrucksvollen Fahrzeug, das mit Axel Nobel und einer internationalen Besatzung alle Langstreckenrekorde in der Geschichte der Ballonfahrt gebrochen hatte. Im hinteren Bereich der Halle hatten Ingenieure und Handwerker ein dreißig Meter langes Halbmodell von Axel Nobels America’s-Cup-Herausforderer, Holger Danske, montiert.
In der Mitte des großen Raumes stand ein kunstvolles Modell des Diskobucht-Projektes: Raffinerie, Supertanker, Tiefwasseranlage, die Containersiedlungen der Arbeiter und die gigantischen Förderplattformen und Pumpstationen.
Axel Nobel schloss die Tür hinter dem letzten Sitzungsteilnehmer, streckte sich und lockerte seinen Schlips. Ohne Holm anzusehen, umrundete der große dunkelhaarige Mann langsam das Modell. Er rückte einen Kran hier zurecht, einen Supertanker dort, ehe er beide Arme wie zu einer segnenden Geste ausbreitete. Eine Abschiedsgeste? Peter schob ein paar Croissantkrümel auf seinem Teller hin und her und unterdrückte ein neues Gähnen. Mit einem angenehmen Ziehen im Bauch dachte er an seinen jungen Chauffeur, der ihn mit heiler Haut durch das Spießrutenlaufen der Demonstranten gebracht hatte. Rasmus …?
Wie war noch der Nachname … Nordstrand, genau.
Der Vorstandsvorsitzende hängte seine Jacke über die Rückenlehne und setzte sich hinter den Schreibtisch. Er krempelte die Ärmel seines Hemdes über die tätowierten Unterarme hoch, die eine andere Geschichte erzählten als die den meisten bekannte: Axel Nobel hatte eine Vergangenheit als Offizier in den militärischen Spezialeinheiten zweier Nationen.
Der Augenblick, dem Peter seit Verlassen der geologischen Feldstation in der Diskobucht mit Unbehagen entgegensah, war gekommen.
Zehn Minuten später war er am Ende seines Berichtes angelangt und spürte den Blick des Nobel-Oil-Chefs auf sich.
»Das heißt, alles für die Katz?«, fragte Nobel und schob mit gedämpfter und irritierend ruhiger Stimme hinterher: »Fünf Milliarden Kronen im Klo runtergespült? Und jetzt packen wir Kamele, Ziegen, Frauen und Zelte zusammen und ziehen weiter, um es an einer anderen Oase zu probieren? Willst du das damit sagen? Abgesehen davon, dass wir gezwungen sind, die verfickten Kamele zu verkaufen, um wenigstens bis morgen zu überleben?«
Der Geologe hielt dem bohrend kalten Blick seines Gegenübers stand. Er wusste, wie sehr Axel Nobel devote Menschen verachtete.
»Tut mir leid, ja«, sagte er. »Wirklich.«
Der Vorstandsvorsitzende schob den Stuhl zurück. Von einem Porträt hinter ihm starrte mit wässrig gierigem Blick ein entfernter Unternehmensgründer auf ihn herunter.
»Mir auch, das kannst du mir glauben. Aber wieso haben wir nichts davon gewusst? Wir haben schließlich eine Million Löcher in den versteinerten Misthaufen da drüben gebohrt!«
Peter Holm breitete die Arme aus.
»Vergiss nicht, dass die Bergkette bei den ersten Probebohrungen vor rund zwanzig Jahren noch unter einer dreißig Meter dicken Eisschicht lag. Wir wussten, dass dort unten gigantische Schieferöl- und Gasreserven lagen, aber auch, dass sie unerreichbar waren. Falls es jemals gelingen sollte, das Öl aus dem Felsen und an die Küste zu befördern, hätte man es nicht weitertransportieren können, weil Westgrönland ein halbes Jahr vom Packeis eingeschlossen war. Es brauchte schon ein Wunder, und das hast du bekommen: Das Inlandeis zieht sich zurück, und zwar schneller, als irgendein Mensch es für möglich gehalten hätte. Damit ist die Nordwestpassage offen für Supertanker in den Pazifik und zu den Märkten Asiens. Das ist perfekt.«
»Das war perfekt. Deswegen hat uns ja die chinesische Entwicklungsbank überhaupt erst mit drei Milliarden Dollar unterstützt und unsere eigene Regierung wie bekloppt gepusht. Das Wort Nein schien plötzlich aus dem politischen Wortschatz gestrichen zu sein, weil wir uns nämlich im Wahljahr befinden, Peter.«
»Ich weiß sehr wohl, dass Wahljahr ist, aber was soll ich deiner Meinung nach tun? Wir haben keine Computerprogramme, die das vorhersagen konnten …«
»Ich dachte, ihr hättet Programme, die alles vorhersagen! Ich dachte, deswegen zahle ich dir anderthalb Millionen im Jahr. Damit wir nicht irgendwann bis zum Hals in der Scheiße versinken«, rief Nobel und schickte seine Selbstbeherrschung in den Wind.
»Das letzte Mal, dass sich das Inlandeis zurückgezogen hat, liegt achtzehn Millionen Jahre zurück«, sagte der Geologe nachdrücklich. »Damals gab es weder Labore noch Supercomputer. Noch nicht einmal ein Rechenbrett. Niemand konnte das vorhersehen. Niemand. Was sich da gerade abspielt, ist einzigartig. Komplett einzigartig.«
Der Vorstandsvorsitzende wandte seinen inquisitorischen Blick von Peter Holm ab.
»Einzigartig … Na, wunderbar. Du kriegst den Nobelpreis für Geophysik, und die Chinesen lynchen mich. Alle glauben, die würden in Jahrhunderten und langfristig rechnen, aber das tun sie nicht. Das sind genau solche Haie wie wir alle, die wollen, dass ihre Investitionen Gewinn abwerfen. Am besten gestern. Sie begreifen beispielsweise nicht, wieso wir die Grönländer nicht längst nach Island deportiert haben. Genauso wenig, wieso die Anführer der Demonstranten nicht längst festgenommen und liquidiert wurden. Und am allerwenigsten begreifen sie, wieso wir über Jahrhunderte Milliarden Kronen Sozialhilfe an die 56000 Einwohner Grönlands gezahlt haben, um unser schlechtes Gewissen zu beruhigen, dass wir ihnen Durchfall, Alkohol und die Bibel gebracht haben, um ihnen schließlich die Schürfrechte zu überlassen, wenn die Insel endlich in der Lage ist, einen Teil ihrer Schulden zurückzuzahlen. Unabhängigkeit, demokratische Beteiligung und Umweltbewusstsein sind irrelevante Begriffe in Peking. Warst du schon mal dort? Man kann die Luft schneiden und in den Flüssen Filme entwickeln, so hoch ist die Belastung mit Schwermetallen.«
Axel Nobel lehnte sich in seinem flexiblen, lederbezogenen Chefsessel zurück, ehe er abrupt aufsprang und rastlos hin und her lief.
Peter Holm hielt eigentlich große Stücke auf den Chef. Das hatte er in den zwanzig Jahren, die er für das Unternehmen arbeitete, gelernt. Es war nicht immer einfach zwischen ihnen gewesen, da Nobel extrem reserviert war und absolut kompromisslos. Aber er hatte großen Respekt vor Professionalität und Fachwissen. Er war fair gegenüber seinen Lieferanten, und er hatte einen milliardenstarken Wohltätigkeitsfonds gegründet, der alle möglichen guten und vernünftigen Projekte unterstützte. Er hasste es, der Überbringer schlechter Nachrichten zu sein. Besonders in einem Wahljahr. Das war schlicht und ergreifend schlechtes Timing.
Axel Nobel stand in Gedanken versunken mitten im Raum, während der Geologe nach einer Kaffeekanne Ausschau hielt.
»Da ist ein Greenpeace-Schiff aufgetaucht, als ich die Diskobucht verlassen habe«, murmelte er. »Wenn die von der Sache Wind bekommen, laufen die Amok. Genau wie die Einwohner. Das Meer ist heiliger und lebensspendender Teil ihrer Mythologie.«
Er sah den Nobel-Oil-Chef vielsagend an.
»Es sei denn, du kannst …«
Axel Nobel ließ den Blick auf dem Porträt seines Vorfahren ruhen, der das Imperium gegründet hatte, als hätte er nicht übel Lust, es mit einem Brieföffner aufzuschlitzen.
»Die Zeiten, in denen man die kommunale Selbstverwaltung mit Vorstandsposten, Nutten, Wodka und einem Rentenkonto auf den Cayman Islands bestechen konnte, sind auch vorbei«, sagte er. »Das wäre das ganz große Ding für die da oben gewesen, Peter. Die neue Verwaltung ist die inkompetenteste außerhalb Zimbabwes, das sagen alle, und da sind sie noch idealistisch. Dann kommt unsere eigene Regierung. Und danach die Ausschüsse. Die haben die Sache einstimmig durchgeboxt, ohne nach hinten zu schauen. Weil sie ihre Chance erkannt haben … Geschichte zu machen. Unsterblich zu werden. Zumindest wiedergewählt.«
Er schob die Hände in die Taschen. Die Tätowierungen auf den Unterarmen verdrehten sich.
»Und dann wären da noch die Chinesen«, murmelte er. »Unsere unentbehrlichen imperialistischen Partner. Letztendlich kann sich nur Peking ein Projekt dieser Größenordnung leisten. China steht im Begriff, Afrika umzubauen. Sie kaufen sich einfach einen weiteren Kontinent, als ob einer nicht reichte. Ein Handwerkerboom, aber in zehn Jahren wird man keinen Unterschied mehr zwischen Shanghai und Mombasa erkennen.«
»Vermutlich nicht.«
»Du hast mit niemandem darüber gesprochen, oder?«, fragte der Vorstandsvorsitzende unvermittelt. »Wenn das ans Licht kommt, werden unsere Aktienkurse auf der Stelle kollabieren. Börsengerüchte können unsere Firma ruinieren, Peter. Selbst die Nobel Group. In weniger als einem Tag.«
»Selbstverständlich habe ich mit niemandem darüber gesprochen«, sagte Peter. »Ich habe dafür gesorgt, dass ich bei der Analyse der letzten Bohrproben alleine bin. Danach habe ich alle Daten vom Hauptcomputer gelöscht. Ich habe geahnt, dass es Probleme gibt, aber nicht in dieser Größenordnung. Die Zahlen sind einzig und allein hier gespeichert«, sagte er und tippte sich an die Schläfe. »Und auf meinem Laptop, und der ist mit der besten Software der Welt verschlüsselt.«
»Wo ist er?«
»In meinem Tresor.«
»Bei dir zu Hause? Ist das sicher? Wann kannst du die Analyseergebnisse vorlegen?«
Peter Holm wollte gerade einwenden, dass er todmüde sei und gerne erst einmal alle zugängliche Literatur zu diesem einzigartigen geologischen Phänomen sichten wolle, wenn es denn welche gab. Aber er wusste auch, dass Alex Nobel von ihm erwartete, dass er stets rund um die Uhr arbeitete.
»Den Rest kann ich zu Hause erledigen, Kurven und Prognosen. Wenn ich die zusammenfassende Auswertung geschrieben habe, kannst du meinen Laptop im Meer versenken.«
Der Chef lächelte müde.
»Genau das werde ich vermutlich tun.«
»Was auch nichts an der Sache ändert.«
»Vier, fünf Jahre? Ist das die Zeit, die uns noch bleibt?«
»Schätze ich. Vielleicht auch nur drei. Schwer zu sagen. Mir ist so was, wie gesagt, noch nie untergekommen.«
»Immerhin ein bisschen Zeit. Wir werden uns was einfallen lassen. Wie letztendlich immer.«
Der Chef schien selbst nicht zu glauben, was er sagte. Er setzte sich wieder. Kippte den Stuhl auf die Hinterbeine. Sein Blick löste sich von Peter Holms Gesicht und stellte auf halbe Distanz.
»Kannst du morgen fertig sein?«, fragte er abwesend.
»Ich denke schon. Die sind da oben übrigens allmählich ziemlich verzweifelt. Ich sage es nicht gern, aber die Polizei hat keine Chance. Die Demonstranten haben den Landrover zerstört, der mich zum Heli gefahren hat. Wenn der Fahrer nicht gewesen wäre, hätten die mich gesteinigt.«
Er lächelte bei dem Gedanken an Rasmus.
Nobel musterte ihn skeptisch.
»Wer war denn der Fahrer?«, fragte er.
»Ein junger Kerl. Rasmus … Rasmus Nordstrand. Sehr kompetent. Ein Meeresbiologe aus Ilulissat. Halber Grönländer.«
Der Vorstandsvorsitzende nickte schwach.
»Fantastisch. Man sollte ihm irgendeine Form von Belohnung zukommen lassen.«
»Auf alle Fälle. Er ist übrigens auch gerade in Kopenhagen, um seine Mutter zu besuchen. Wir haben uns auf einen Drink verabredet oder was auch immer.«
»Grüß ihn von mir, wenn ihr euch trefft«, nuschelte der Nobel-Oil-Chef und rieb sich die Augen.
Er erhob sich, für Peter Holm das Signal, dass die Audienz beendet war.
»Wieso denn eigentlich diese Eile?«, fragte er. »Ich hätte gerne ein bisschen mehr Zeit gehabt, meine Daten zu verarbeiten.«
Der Chef legte ihm eine Hand auf die Schulter. Er zögerte, und Peter Holm registrierte zum ersten Mal überhaupt so etwas wie erschöpfte Resignation in den Augen des anderen.
»Unsere Daten, Peter. Du hast schon genug um die Ohren, aber da wäre noch etwas.« Die Hand drückte die Schulter. »Die Firma hat Todesdrohungen gegen die Besten unserer Leute erhalten. Vorstand, Reeder, ich und meine Familie, natürlich, und die wichtigsten Bereichsleiter.«
Peter Holm tippte sich gegen die Brust, und Nobel nickte.
»Du auch. Ganz oben auf der Liste. Wir nehmen das natürlich sehr ernst, die Drohbriefe sind sehr direkt und detailliert. Autokennzeichen, wo die Kinder der Betroffenen zur Schule gehen, Personenkennzahlen, Arbeitsplätze der Ehepartner und so weiter.«
Er zog ein Kärtchen von der Größe einer Visitenkarte aus der Brusttasche und reichte sie Peter.
»Wenn du irgendetwas Außergewöhnliches bemerken solltest, rufst du diese Nummer an. Tag und Nacht.«
»Was sollte das sein?«
»Alles. Wenn du das Gefühl hast, dass dir jemand folgt. Wenn dich irgendwer unvermittelt anspricht. Du Anrufe erhältst und am anderen Ende aufgelegt wird, sobald du dich meldest. Solche Dinge. Wir nehmen das, wie gesagt, sehr ernst. Das sind nicht die gewöhnlichen Walschützer und Ökofanatiker. Sie sind sehr professionell und effizient. Sie haben das Unternehmen infiltriert und wissen im Großen und Ganzen alles über alle.«
Peter sah sich die Visitenkarte an. »Eine neue Sicherheitsfirma? Was ist mit der Polizei?«
»Die kommen, wenn es die erste Leiche gibt, nicht eine Sekunde eher«, sagte Nobel. »Müssen sie auch nicht, die wären den Profis nur im Weg.«
»Wer hat …«
Es klopfte an der Tür, und Nobel bat seine persönliche Assistentin herein. Sie lächelte entschuldigend.
»Der Minister ist auf der Treppe, Herr Nobel. Mit seinem Sonderberater.«
Sie sah den Chef vielsagend an.
»Andersson?«
»Himself.«
Axel Nobel nickte. Der Minister war nicht das Problem. Er war jung und ohne nennenswerte Berufserfahrung. Seine Spindoctors und der Sonderberater, Tom Andersson, der von der Organisation erdölexportierender Länder kam, hielt die Fäden des Ministers in der Hand. Andersson hatte die wesentlichen Zuständigkeitsbereiche übernommen und übte die Tätigkeiten gemeinsam mit dem Staatssekretär aus, während der Minister lernte. Andersson war es, vor dem man sich in Acht nehmen musste. Er verwaltete die Daumenschrauben der Regierung und würde nicht zögern, sie in vollem Umfang einzusetzen.
Peter Holm stand da wie am Boden festgeklebt.
»Also, ich wollte gerade fragen: Wissen Sie, von wem die Drohungen kommen?«
Der Chef hielt drei ausgestreckte Finger hoch. Das reichte. Der Dreizack. Poseidons Krieger.
Axel Nobel schaute seinem Chefgeologen nach, als er durch die Doppeltür Richtung teppichbelegter Marmortreppe entschwand. Peter Holm nahm grundsätzlich nie den Aufzug. Dann bemerkte er den forschenden Blick seiner Assistentin.
»Alles in Ordnung mit Ihnen, Herr Nobel? Soll ich Ihre Frau anrufen?«
Er schüttelte den Kopf.
»Nein! Um Himmels willen. Es geht mir gut, Heidi. Schicken Sie den Minister und Tom Andersson zu mir rein, sobald sie oben angekommen sind. Der Tag kann unmöglich noch schlimmer werden.«
»Selbstverständlich.«
Er ging zu seinem Schreibtisch und stieß gegen den Tisch mit dem Diskobucht-Modell. Ein Kran kippte um, er richtete ihn wieder auf und dachte an fanatische Umweltaktivisten, Minister, unbestechliche Sonderberater, chinesische Bankdirektoren und verliebte Chefgeologen.
Nordstrand? Rasmus?
Axel Nobel hatte einen unauffälligen Skoda mit getönten Scheiben gemietet und parkte vor dem Eingang des Ørstedsparkes. Wie auf Bestellung kam ein schlanker, durchschnittlich großer Mann durch das offene Tor geschlendert, warf ein halb gerauchtes Zigarillo auf den Boden, öffnete die Beifahrertür und nahm Platz. Er stellte eine braune Papiertüte zwischen seine glänzend schwarzen Schuhe und lächelte den Vorstandsvorsitzenden emotionslos an. Der Spezialist war wie ein erfolgreicher Geschäftsmann gekleidet, was er im Grunde ja auch war. Dirk Straat, Sicherheitsexperte und Problemlöser der Wohlhabenden. Der Holländer war Mitte vierzig, blond und gut aussehend auf farblose, weltferne Weise. Er bewegte sich wie ein Athlet und war sehr effektiv.
Der Skoda fädelte sich in den langsamen Nachmittagsverkehr auf der Nørre Farimagsgade ein.
Nobel warf einen Seitenblick auf die Papiertüte zwischen Straats Füßen.
»Was ist in der Tüte, Dirk?«
»Brot für die Enten, Mr. Nobel.«
»Haben Sie Enten gefüttert?«
Straat faltete die Hände im Schoß. Sie waren groß und sehr ruhig.
»Das ist korrekt.«
Nobel kontrollierte den Seitenspiegel und überreichte dem Experten einen dicken Umschlag.
»Das sind alle zugänglichen Informationen über Peter Holm. Er ist einer meiner engsten Mitarbeiter, Dirk. Ein guter Mann. Ein guter Freund.«
Er schaute den Holländer von der Seite an, um sicherzugehen, dass der auch wirklich verstanden hatte, dass es um einen Freund ging.
»Ein guter Mann«, murmelte Straat.
»Genau. Wir müssen ein wenig auf ihn aufpassen, während er seine Arbeit macht. Peter scheint momentan gewisse private Probleme zu haben. Er ist schwul und sehr gesellig, wenn er zu Hause ist, was man ihm wahrlich nicht vorwerfen kann nach neun Monaten in total öder Wildnis, in denen er ausschließlich von Mineralproben und Nerds umgeben ist.«
»Wahrlich nicht«, bestätigte Straat mit einem großzügigen Nicken.
»Es zieht ihn besonders zu jüngeren Männern, und in diesem Fall sollte er zu seinem eigenen Besten überwacht werden. Mobiltelefon, Wohnung, das volle Programm. Ich will wissen, was er denkt, mit wem er spricht, wen er trifft, ob er von der Konkurrenz observiert wird. Alles. Rund um die Uhr. Okay?«
»Denken Sie den Umgang betreffend an jemand Bestimmten?«
Das Englisch des Holländers war nahezu akzentfrei, und seine Stimme war genauso leise und beherrscht wie alles Übrige an ihm.
Nobel fluchte wegen eines Fahrradkuriers, der ihn vor der Kühlerhaube schnitt.
»Er hat mir ganz enthusiastisch von einem jungen Mann erzählt, den er kurz vor seinem Abflug aus Grönland getroffen hat. Rasmus Nordstrand, Meeresbiologe aus Ilulissat und bei Nobel Oil angestellt. Er hält sich momentan in Kopenhagen auf. Peter erwähnte, dass sie sich unverbindlich verabredet haben.«
Er hupte den Fahrradkurier wütend an. »Das Merkwürdige daran ist …«
»Ja?«
»Rasmus Nordstrand hat vor drei Jahren eine Freelance-Journalistin geheiratet. Die beiden haben eine neunjährige Tochter.«
»Eine Heiratsurkunde ist kein Röntgenbild der männlichen Seele, Mr. Nobel«, bemerkte der Holländer. »Meine Erfahrung. Man findet … überall abweichende Verhaltensweisen. Oft dort, wo man es am wenigsten erwartet.«
Dirk Straat bereitete Axel Nobel wie gewohnt Unwohlsein. Der Mann strahlte so etwas Erloschenes aus, als hätte er zu früh im Leben zu viel gesehen und akzeptiert, dass keine Illusionen mehr übrig waren und ihm die Fähigkeit, von irgendetwas überrascht zu werden, abhandengekommen war. Eine versteinerte, tote Kälte.
»Ich denke an die Drohungen gegen unsere leitenden Mitarbeiter, Dirk.«
»Natürlich, Mr. Nobel. Poseidons Krieger. Wir sind an der Sache dran und versuchen, die Mitglieder zu identifizieren, aber die sind geschickt. Sie scheinen ein paar kluge Köpfe in ihren Reihen zu haben. Wie lange wünschen Sie die Observierung von Mr. Holm durch mich und meine Mitarbeiter?«
»Eine Woche. Bis er wieder zurück nach Grönland fliegt.«
Axel Nobel sah auf seine verschrammte alte Rolex.
»Eine knappe Woche.«
Er fand einen Parkplatz an der Esplanade. Die grüne Glaskuppel auf der anderen Seite der Hafeneinfahrt reflektierte die Sonne.
Dirk Straat schob den Umschlag mit den Informationen über Peter Holm in die Innentasche und stieg aus. Axel Nobel ließ das Seitenfenster herunter.
»Vergessen Sie die Enten nicht, Dirk.«
Der Holländer sah ihn ausdruckslos an.
»Entschuldigung?«
Nobel wedelte mit der Papiertüte.
»Enten. Brot.«
Straat nahm die Tüte.
»Danke, Minheer.«
»Ich danke Ihnen. Verraten Sie mir, Dirk, wieso nennt man Sie eigentlich Tiger Woods?«
Zum ersten Mal glitt ein echtes Lächeln über das blasse Gesicht des Holländers. Seine Augen wirkten fast lebendig.
»Ich liebe Golf, Mr. Nobel. Besonders gut beherrsche ich das lange Spiel mit dem Driver. Spielen Sie auch?«
»Leider nein.«
Dirk Straat sah den Skoda bei der Amaliengade um die Ecke biegen. Er schob eine Hand in die Papiertüte und nahm ein kleines digitales Tonbandgerät heraus, spulte zurück und vergewisserte sich, dass die Tonqualität zufriedenstellend war. Es gab keinen zwingenden Grund für dieses Unterfangen, aber er hatte vor langer Zeit gelernt, dass es niemals schaden konnte, kompromittierendes Material von seinen Arbeitgebern zu besitzen. Wie Nobels Fingerabdrücke auf dem Umschlag, beispielsweise. Ganz besonders, wenn es sich um die Überwachung eines Mitarbeiters handelte. Normalerweise würde Axel Nobel sich bei einem Routineauftrag wie diesem niemals dazu herablassen, persönlich die Informationen zu überbringen.
Was nur bedeuten konnte, dass die Überwachung des äußerst geselligen Peter Holm alles andere als ein Routineauftrag war.
TEIL II
Michael Sander hatte das Ehepaar Palmer und deren Tochter Daphne eine Stunde zuvor am Flughafen Kastrup abgeholt, jetzt saßen sie schweigend in seinem Mercedes im Stadtzentrum; in einer schmalen Gasse mit den höchsten Wohnmieten der Stadt und schmuck renovierten Fassaden aus dem 18. Jahrhundert.
Mr. Palmer, der auf dem Beifahrersitz neben Michael saß, war Ende fünfzig, Mrs. Palmer auf der Rückbank etwas jünger; gepflegt, ausdrucksvolle Augen und eine noch eindrucksvollere Oberweite. Ihre Tochter Daphne war um die dreißig, langes, blondes Haar mit Schildpattspangen, weiche Gesichtszüge, eine etwas zu mädchenhafte Frisur, Burberry-Mantel, und eine Gucci-Tasche auf dem Schoß, die sie nervös umklammerte. Sie wirkte verstört, als sie einen Lippenstift und einen kleinen Spiegel aus der Tasche nahm, um ihre Lippen nachzuziehen, wobei ihr der Stift auf den cognacfarbenen Lederbezug fiel. Michael, der ihr Manöver im Rückspiegel verfolgt hatte, zuckte innerlich zusammen. Das Auto war sein ganzer Stolz, der einzige geldwerte Gegenstand, den seine Exfrau Sara und ihr Raubtieranwalt ihm nach der grauenvollen Scheidung gelassen hatten.
Daphne legte eine Hand auf seine Schulter.
»Ich will ja nicht undankbar sein, Mr. Sander, ganz und gar nicht. Aber was um alles in der Welt hat Julian hier verloren? War er die ganze Zeit in Kopenhagen?«
Michael fühlte sich unwohl. Das Ganze war so gnadenlos banal, klischeehaft, wie das Leben nun einmal war. Das Ehepaar Palmer gehörte nicht zu seiner üblichen, steinreichen Klientel, und er hatte den Auftrag nur angenommen, weil Jimmy, ein Freund und Kollege aus Zeiten Michaels langjähriger Anstellung bei der namhaften britischen Sicherheitsfirma Shepherd & Wilkins, ihn darum gebeten hatte. Mr. Palmer war Jimmys Onkel, Professor für Linguistik und leider gar nicht wohlhabend. Jimmy erwartete, dass Michael den Auftrag zu einem gemäßigten Honorar ausführte. Einen getürmten Ehemann aufzuspüren dürfte für den Dänen ja wohl ein Kinderspiel sein.
Daphnes Hand hinterließ eine schwache Wärme.
»Er ist vor sechs Monaten aus Berlin nach Kopenhagen gekommen«, sagte Michael sachlich. »Er teilt sich eine Wohnung in Østerbro mit einem Freund.«
»Einem Freund? Einem …«
»Einem männlichen Freund. Einem Tänzer.«
»Und wieso sitzen wir dann hier?«, fragte Mr. Palmer. »Meine Tochter hat ihren Mann über ein Jahr nicht mehr gesehen, und Julian hat es noch nicht einmal für nötig befunden anzurufen, einen Brief oder eine SMS zu schreiben. Nichts. Noch nicht einmal zu Nicholas, ihrem vierjährigen Sohn, hat er Kontakt aufgenommen. Geht es ihm gut? Ist er gesund?«
»Er besucht dreimal die Woche ein Fitnessstudio«, sagte Michael und wechselte über den Rückspiegel einen Blick mit Mrs. Palmer. Ihm war schnell klar gewesen, dass sie von den dreien noch die Realistischste war. Sie wandte sich an ihre Tochter.
»Das ist neu, Schatz. Vielleicht ist er ja auch Veganer geworden, genau wie du.«
»Mama …«
Mr. Palmer meldete sich wieder zu Wort. »Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet, Michael. Worauf warten wir?«
Auf der anderen Straßenseite erleuchtete eine drei Meter lange, halb geschälte Neon-Banane die Hausfassade. Vor dem Nachtklub stand ein Dutzend junge Männer um einen gusseisernen Aschenbecher. Sie plauderten, rauchten, tranken und lachten. Gut gekleidet, ausdrucksvolle Frisuren. Die Szene erinnerte an eine Armani-Werbung. Musik schwappte auf die Straße, jedes Mal, wenn die Tür zum Nachtklub aufging und hinter den Glastüren ein glatzköpfiger schwarzer Riese am Tresen zu sehen war.
Michael ließ die Seitenscheibe herunter, fand eine Flasche Mineralwasser zwischen den Sitzen und trank sie halb leer.
»Julian arbeitet im Banana-Club gleich da drüben«, sagte er.
»Arbeitet? Wie meinen Sie das?«
»Damit meine ich, dass er dort fast täglich vereinbarte Aufgaben ausführt, für die er laut abgeschlossenem Vertrag eine Vergütung bekommt, auch Lohn, Honorar oder Gehalt genannt. Eine Arbeit. Ein Job.«
»Aber Julian ist Schönheitschirurg, verdammt noch mal!«
»Er hat eine florierende Praxis in der Brook Street und im London Stanmore Hospital, Mr. Sander«, zwitscherte Daphne.
Michael nickte stumm.
»In diesem Fall hat er eine neue Berufung als Barkeeper gefunden.«
»Sind Sie auch ganz sicher, dass Sie sich nicht fürchterlich irren, Michael?«, fragte Professor Palmer. »Dass Sie ihn nicht mit einem anderen verwechseln? Dass … Ich begreife einfach nicht, wie …«
»Julian Trevanian? Fünfunddreißig Jahre, eins fünfundachtzig groß, einundachtzig Kilo, sichelförmige Narbe über der rechten Augenbraue, braunes Haar? Er hat inzwischen einen Pferdeschwanz.«
»Oh, mein Gott!«, platzte Daphne heraus.
Mrs. Palmer legte einen beschützenden Arm um die Schulter ihrer Tochter und drückte sie an sich. Sie erwiderte ruhig Michaels Blick im Rückspiegel, aber ihr Gesichtsausdruck war schwer zu deuten. Vermutlich hat sie nie besonders viel für den Schwiegersohn übrig gehabt, dachte er.
Professor Palmers Lippen bewegten sich stumm, als versuchte er, das Unbegreifliche zu begreifen. Dann fand er die Sprache wieder. »Er arbeitet also in einer Bar hier in Kopenhagen, und es geht ihm gut. Ist das korrekt?«
»Ist es.«
»Also gut. Ich denke, ich spreche im Namen aller Anwesenden, wenn ich sage, dass wir diese Angelegenheit so schnell wie möglich und zivilisiert abschließen wollen.«
Das Mobiltelefon in Michaels Innentasche vibrierte. Er las die kurze Nachricht seiner Exfrau, die ihm mitteilte, dass die Kinder am nächsten Wochenende nicht kommen würden. Es ginge ihnen nicht gut. Kein Gruß.
Die übliche, wohldosierte Rache, obschon die Scheidung jetzt ein Jahr zurücklag. Sie torpedierte seine Beziehung zu den Kindern, isolierte sie von ihm, und dafür hasste Michael sie mit einer Intensität, von der er niemals geglaubt hatte, sie je für einen Menschen aufbringen zu können.
Er schob das Handy zurück in die Innentasche und sah den Professor an, der noch immer mit ihm redete.
»Wie bitte?«
Palmer zog den Kopf zurück, als hätte Michael ihm einen Schlag verpasst.
»Ich habe nur gefragt, ob wir Julian jetzt sehen können. Es ist spät, Daphne ist erschöpft und …«
»In einer halben Stunde hat er Feierabend«, sagte Michael. »Ich würde empfehlen, hier zu warten, bis er rauskommt.«
Mrs. Palmer beugte sich vor, ihr Parfüm streifte seinen Nasenflügel. Trésor? Sie berührte ihn nicht, aber er spürte ihren warmen Atem in seinem Nacken. Sie strahlte eine starke Sinnlichkeit aus, und er fragte sich, wie sie damit als Professorengattin in einer mittelenglischen Universitätsstadt umging. Michael konnte sich lebhaft vorstellen, dass Mrs. Palmer in vielen Studentenzimmern durch die nächtlichen Fantasien ihrer Bewohner geisterte.
»Ich könnte jetzt gut einen Drink vertragen«, sagte sie mit ihrer heiseren, tiefen Stimme. »Und das ist doch ein Nachtklub, oder? Ich sehe wahrlich nicht ein, dass wir hier draußen am Dienstboteneingang warten sollen. Immerhin geht es hier um meinen Schwiegersohn. Daphnes Mann und Nicholas’ Vater.«
Michael schickte ihr einen warnenden Blick, der an ihr abperlte. Sie hatte einen unversöhnlichen Zug um den Mund. Sie weiß ganz genau, was sie tut, dachte er. Als Einzige der drei war sie sich absolut im Klaren darüber, was geschehen würde. Und wahrscheinlich hatte sie recht, dass es höchste Zeit war, die Tochter mit der Realität zu konfrontieren, die früher oder später sowieso ans Licht käme.
Er machte die Tür auf.
»Dann folgen Sie mir. Ich kenne den Türsteher«, sagte er.
Der Banana-Club war in den Räumlichkeiten eines alten Kinos untergebracht, in dem Michael in seiner Jugend viele Late-Night-Vorstellungen mit Film-Doppelpacks verbracht hatte: Blade Runner gefolgt von Mad Max in the Thunderdome, zum Beispiel.
Den Balkon gab es noch immer. Und den Projektorraum, von wo der Besitzer und die Überwachungskameras einen Überblick über den Klub hatten. Die dichten Reihen unbequemer roter Plüschklappsessel waren durch runde Tische, eine gigantische hufeisenförmige Mahagoni-Bar, schwarze Bodenfliesen, eine Bühne, eine Tanzfläche, einen Kristalllüster, der wie aus dem Buckingham Palace entwendet aussah, und goldene Tapeten vom Boden bis zur Decke ersetzt worden. Die dominanten Farben waren Schwarz wie die stramm sitzenden Shorts der Kellner und Bananengelb wie die Klublogos auf ihren hautengen T-Shirts. Sie glitten auf Inlinern durch den Raum, gut aussehende junge Männer mit Vollbärten und extravaganten Frisuren. Im Großen und Ganzen waren die Gäste jüngere Exemplare aus der Yuppie- und Hipsterszene. Auf der Bühne kam gerade ein ölig glänzender, fast nackter und sehr muskulöser Poledancer zur Klimax seiner Nummer. Aus den Lautsprechern dröhnte Closer von Nine Inch Nails.
Daphne und ihre Eltern fielen auf wie Amish People auf einer Mailänder Modenshow.
Konfrontiert mit so viel nackter männlicher Haut, schlug Daphne die Augen nieder, während Mrs. Palmer ungeniert den appetitlichen Poledancer betrachtete, der sich gerade – dem Publikum den Rücken zugedreht – seiner Camouflagehose entledigte und an der Stange nach unten glitt, bis die Gäste freien Blick auf seinen dicken Penis, die rasierten Hoden, den lasergebleichten Anus und die Sohlen seiner Kampfstiefel hatten.
Die Musik verstummte. Mrs. Palmer hatte, unbewusst natürlich, die Hüfte gewiegt. Der Bühnenscheinwerfer verlosch, und das Lokal explodierte in begeistertem Applaus. Daphne stand wie versteinert und leichenblass da.
Professor Palmer stieß einen Grunzer aus und drehte sich wutschnaubend zu Michael um. Er packte ihn an der Schulter, Speicheltröpfchen spritzten aus seinem Mund.
»Ist das wirklich nötig, Michael! Ich bin sehr, sehr enttäuscht von Ihnen. Daphne ist ein sensibles Mädchen und …«
Michael befreite sich höflich, aber bestimmt aus dem Griff des Professors und sah ihn gelassen an.
»Ich habe Ihnen angeraten, im Wagen zu warten. Kommen Sie. Begrüßen Sie Julian. Deswegen sind Sie schließlich hier.«
Ihre Blicke folgten der Richtung seines Zeigefingers zu dem Barkeeper am hinteren Ende der Theke. Der junge Mann stand im einvernehmlichen Gespräch mit einem Gast mittleren Alters in einem rosa Hemd und begann zu strahlen, als der Stripper, jetzt in Jeans, Sneakers und weißem Shirt, durch den Raum auf ihn zugelaufen kam. Der Tänzer schlang einen Arm um den Hals des Barkeepers, zog ihn an sich und küsste ihn leidenschaftlich.
»Darf ich vorstellen: Julian Trevanian. Es sieht ganz so aus, als hätte er seinen Platz gefunden.«
Daphne brach schluchzend zusammen, Mr. Palmer fluchte laut, während seine hübsche Frau still und mit verschränkten Armen dastand und ihren Schwiegersohn mit finsterem, vernichtendem Blick anfunkelte.
»JULIAN? JULIAN! Du verdammtes, perverses Arschloch!«, schrie Daphne in einer Lautstärke, die eine Lawine hätte auslösen können.
Michael sah die schmächtige junge Frau überrascht an.
Der Barkeeper löste sich aus der Umarmung des Strippers und drehte sich mit erhobenen Händen um, als wollte er sich ergeben. Sein Gesicht wurde aschfahl, als er seine Familie erkannte.
»Sehr emotional«, sagte Michael ironisch. »Well, ich denke, der Zeitpunkt ist gekommen, mich zu verabschieden. Der Auftrag scheint ja zur Zufriedenheit aller ausgeführt zu sein.«
Mrs. Palmer sah ihn voller Verachtung an.
»Gib dem Mann sein Geld, George«, sagte sie. »Er scheint das Ganze ja ungeheuer amüsant zu finden.«
Mr. Palmer schob die Hand in seine Innentasche, aber Michael hielt sie fest. Julian bewegte sich in Zeitlupe auf seine Frau zu. Der Stripper rief seinen Namen, aber Julian fertigte ihn mit einer resoluten Handbewegung ab.
»Vergessen Sie’s«, sagte Michael. »Das geht aufs Haus.«
Er sah Mrs. Palmer an.
»Es war mir ein Vergnügen. Wiedersehn.«
Er machte auf dem Absatz kehrt und drängte sich durch die parfümierte Ansammlung von Gästen. Hinter ihm schrie Daphne ihrem Gatten überraschend variantenreiche Flüche entgegen.
Auf dem Weg nach draußen fiel Michael ein ungleiches Paar an einem Nischentisch auf. Mit ihrer alltäglichen Kleidung, den unspektakulären Frisuren, der zurückgenommenen Körpersprache und den leisen Stimmen hoben sie sich ab. Der Jüngere war vielleicht Mitte dreißig, mit hübschen, maskulinen Gesichtszügen, hohen Wangenknochen und schwarzen Haaren. Michael vermutete Eskimo- oder grönländische Gene. Der Ältere hatte ein schmales, intelligentes Gesicht, graue Haare und war sicher zehn Jahre älter als sein Begleiter. Er drehte ein halb leeres Glas in den Händen hin und her. Die zwei waren in ein intensives Gespräch vertieft. Der junge Mann hatte eine Hand auf den Unterarm seines Gegenübers gelegt.
Er schaute auf und lächelte Michael an, der zurücklächelte, als er von dem farbigen Türsteherriesen beiseitegeschubst wurde, der auf dem Weg ins Epizentrum des Aufstandes war, wo Daphne noch nicht fertig damit war, ihrem Unmut über das Verhalten ihres Ehemannes Ausdruck zu verleihen.
Zurück in seinem Mercedes zündete Michael sich die letzte Zigarette aus der Schachtel an, zerknüllte sie und stellte sich dabei Saras Gesicht vor. Dann kurbelte er das Seitenfenster herunter und ließ die Verpackung in den Rinnstein fallen. Er warf einen Blick über die Schulter, als er Musik aus dem Banana-Club schallen hörte, und sah das ungleiche Paar herauskommen und die Straße überqueren. Zwanzig Meter weiter zog der junge Mann seinen Begleiter in einen offenen Treppenaufgang und in eine heftige Umarmung.
Michael beobachtete den Auftritt ohne größere Neugier. Er schob eine CD mit den Eurythmics in die Bose-Anlage und wollte gerade den Zündschlüssel drehen, als die beiden Männer sich aus ihrer Umarmung lösten und weitergingen. Der Ältere sah aus, als hätte er es eilig, mit seiner jungen Trophäe nach Hause zu kommen.
Da bemerkte Michael in gleichbleibendem Abstand zu den beiden Männern vor sich eine dritte Person. Breite Schultern, langer grauer Trenchcoat. Glänzende Schuhe. Michael konnte das Gesicht des Verfolgers nicht sehen, aber die Gestalt mit dem federnden Gang kam ihm unangenehm bekannt vor. So unangenehm, dass es ihm Schweißperlen auf Stirn und Rücken trieb.
Sein Unbehagen wurde nicht geringer, als ein dunkelblauer Lieferwagen im Schritttempo an ihm vorbeifuhr und in dieselbe Gasse abbog wie das Trio. Ein professioneller Beschatter mit Verfolgungswagen, falls die ahnungslose Beute auf die Idee kommen sollte, ein Taxi zu nehmen.
Das Paar und der Mann im Trench verschwanden hinter der nächsten Ecke. Michael schüttelte den Kopf über seine detektivische Ader, schnipste die Kippe aus dem Fenster und nahm ein neues Päckchen aus dem Handschuhfach.
Das hatte nichts zu bedeuten. Kopenhagen war eine Großstadt. Voller Fremder, die er niemals wiedersehen würde.
Michael schob ganz langsam den Schlüssel ins Schloss, öffnete die Tür und betete, dass Ida schlief. Es war fast drei Uhr morgens, aber seine Schwester hatte die Fähigkeit verloren, länger als ein paar Stunden am Stück zu schlafen, seit sie vor zwei Jahren ihren zweiundzwanzigjährigen Sohn verloren hatte.
Er sah einen schmalen Lichtstreifen unter ihrer Tür in dem langen Flur, von dem viel zu viele Räume und Zimmer in der Villenetage in Gentofte abgingen. Seine Kinder waren noch nie dort gewesen, obwohl er die Wohnung ihretwegen gekauft hatte. Es gab einen schönen Garten um das große weiße Haus, das seinerzeit ein Kammersänger hatte bauen lassen. Heute war die Villa in drei großzügige Einheiten aufgeteilt, von denen Michael und seine Schwester das Erdgeschoss bewohnten. Das Grundstück grenzte an einen forstbotanischen Garten, der nur spärlich besucht wurde. Das wäre der ideale Ort zum Aufwachsen der Kinder gewesen, wenigstens die halbe Zeit.
Obwohl sie schon vor sechs Monaten dort eingezogen waren, stapelten sich noch immer die Umzugskartons. Michael hatte noch keine Gardinen aufgehängt, und die Einrichtung seines Schlafzimmers bestand aus einer Matratze, einer halb leeren Flasche Famous Grouse, einem Heckenschützengewehr im Lederetui und einem Aschenbecher.
Er passierte hohe Wohnräume, dunkel und still, mit frisch gestrichenen Wänden und geschliffenem Eichenparkett – glatt wie Seide und unbetreten. Die Wohnung wartete auf ihre Bewohner. Alles wartete. Aber ein Zuhause wollte es nicht werden.
Michael hängte seine Jacke über einen Stuhl und machte den Kühlschrank auf. Er konnte sich nicht entscheiden, ob er hungrig war oder nicht. Er schlug die Tür wieder zu und brühte sich einen Becher Nescafé auf. Efeuzweige wischten über die Küchenfenster, im Osten dämmerte es, und das aufziehende Licht machte die Häuser auf der anderen Straßenseite sichtbar. In der Kastanie mitten auf der Rasenfläche gab eine frühe Amsel ihren ersten Morgentriller zum Besten.
Michael nippte an seinem Kaffee und drehte sich um, als er seine Schwester hinter sich hörte. Sie streckte sich und gähnte. Ida war eher der dunkle Typ und dünn, das T-Shirt mit dem fröhlichen Hi from Sharm el-Sheikh-Aufdruck war viel zu groß. Genau wie die schlabberige Yogahose. Ihre schmalen Füße waren nackt, und sie hatte die gleichen Gesichtszüge wie Michael, die gleiche Nuance Blau in den Augen, obwohl ihr Blick ganz anders war. Ihr ursprünglich ebenso schwarzes Haar war von silbergrauen Strähnen durchzogen, dabei war sie drei Jahre jünger als er.
»Habe ich dich geweckt? Das tut mir leid«, sagte er.
»Ich hab gelesen. Du hast mich nicht geweckt.«
Ida hatte seit ihrem achtzehnten Lebensjahr fast ausschließlich Hebräisch gesprochen, was ihrem Dänisch einen rauen, dunklen Ton und einen sehr harten Rhythmus verlieh.
Sie nahm ihm den Becher aus der Hand, trank einen Schluck und verzog das Gesicht.
»Zucker«, sagte sie. »Wie ist es gelaufen? Hat sie ihren Mann gefunden? Daphne? Furchtbarer Name. Da muss ich automatisch an Pferde, Überbiss und Fuchsjagd denken.«
»Er hat sich gehörig verändert, seit er Peter-Rabbit-Land verlassen hat, so viel steht fest. Sie hat ihn als motherfucking son of a bitch beschimpft, als ich ging, und ihm mitgeteilt, dass er seinen Sohn nie wiedersehen würde.«
Er senkte den Blick.
»Wie gewisse andere auch«, murmelte er.
Ida sah ihn mitfühlend an.
»Hat Sara schon wieder abgesagt? Das kann sie doch nicht machen. Kannst du sie nicht vor die Aufsichtsbehörde zerren? Das darf doch nicht erlaubt sein. Du hast ein Recht, deine Kinder zu sehen, Michael.«
»Als Mann hast du keine Chance. Vergiss es. Sie wird das Ganze rauszögern, bis die Kinder mündig sind. Sie hat einen Anwalt aus dem inneren Kreis der Hölle.«
Er zündete sich eine Zigarette an, obwohl sein Hals auch so schon kratzte.
»In gewisser Weise hat Daphne was von Sara«, sagte er nachdenklich. »Das ist eine ganz spezielle Sorte Frau. Sie haben keine Männer, sondern Sponsoren, die sie versorgen, damit sie ihren empfindsamen und kreativen Leidenschaften nachgehen können, und sie verlassen einen Ast erst, wenn sie den nächsten fest zu fassen haben. Wie kleine Äffchen.«
Ida lächelte.
»Schön, dass du nicht zynisch geworden bist«, sagte sie. »Hat Professor Palmer gut bezahlt?«
»Er wollte, aber ich habe sein Geld nicht angenommen. Das Ganze war einfach zu frustrierend.«
»Bist du müde?«
»Todmüde, aber ich kann nicht schlafen.«
»Wie bei mir. Soll ich uns einen Tee kochen? Wie wär’s mit einer Partie Schach?«
»Du bist zu gut zu mir.«
Sie gingen in Idas Zimmer, das mit Möbeln aus ihrem Haus in Haifa eingerichtet war, Regalen, die unter den Büchermengen ächzten, einer Gitarre und ihren Floretts, geschmackvollen Gardinen, einem Globus und einem antiken russischen Samowar. Über dem Regal hing ein Paar authentische französische Degen, nadelspitz und scharf wie Rasierklingen. Im Regal stand das Foto eines flotten jungen Mannes in der Uniform des israelischen Militärs. Barhäuptig in der Wüste. Idas verstorbener Sohn Josiah.
Sie tranken schwarzen russischen Tee, er rauchte zu viel, während sie ihn in drei Partien vom Brett fegte. Irgendwann ertrug Michael keine weitere Niederlage.
»Geh ins Bett«, sagte er und gähnte.
Sie lächelte besorgt.
»Und was ist mit dir, Bruderherz? Hast du niemanden, mit dem du reden kannst?«
»Reden? Wie meinst du das? Wir reden doch.«
»Freunde, Michael. Du weißt schon, jemanden, der dich kennt, dich mag und dir helfen will.«
Er dachte nach.