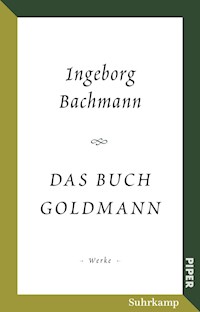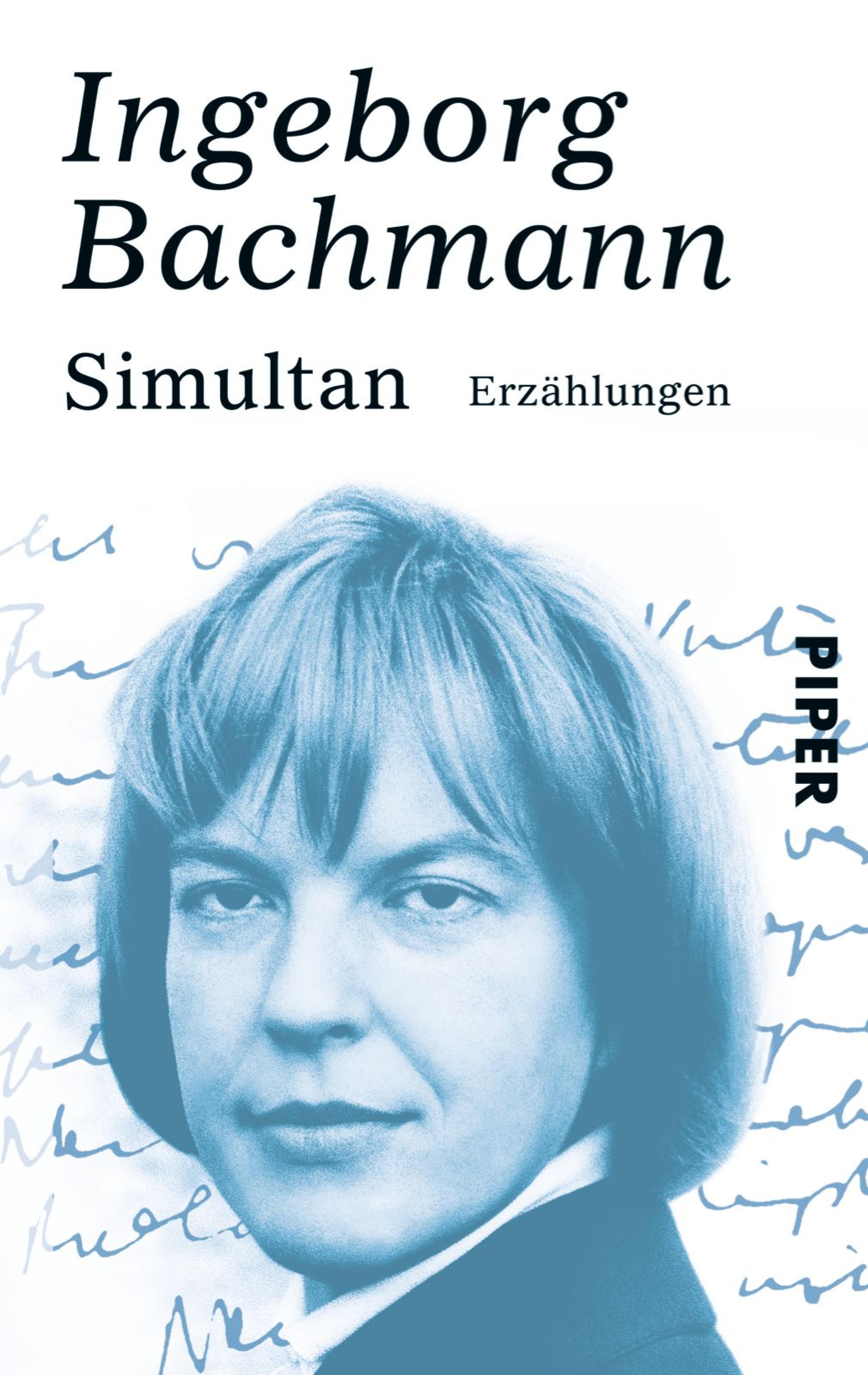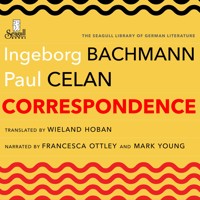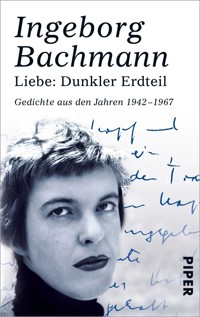11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Malina«, der erste und einzige Roman der Lyrikerin Ingeborg Bachmann, ist das Buch einer Beschwörung, eines Bekenntnisses, einer Leidenschaft. »Malina« ist wohl die denkbar ungewöhnlichste Dreiecksgeschichte: weil zwei der Beteiligten in Wahrheit eine Person sind. Das Buch handelt von nichts anderem als von Liebe, es zeigt die Einsamkeit dessen, der liebt. Ein radikales Buch, das seit seiner Erstveröffentlichung vor vierzig Jahren nichts an seiner Kraft verloren hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Malina, der erste und einzige Roman der Lyrikerin Ingeborg Bachmann, ist das Buch einer Beschwörung, eines Bekenntnisses, einer Leidenschaft. Malina ist wohl die denkbar ungewöhnlichste Dreiecksgeschichte: weil zwei der Beteiligten in Wahrheit eine Person sind. Das Buch handelt von nichts anderem als von Liebe, es zeigt die Einsamkeit dessen, der liebt. Ein radikales Buch, das seit seiner Erstveröffentlichung vor vierzig Jahren nichts an seiner Kraft verloren hat.
Ingeborg Bachmann, 1926 in Klagenfurt geboren, starb 1973 in Rom. Malina ist ihr einziger vollendeter Roman. Zuletzt sind im Suhrkamp Verlag erschienen: Herzzeit. Ingeborg Bachmann – Paul Celan. Der Briefwechsel (st 4115), Kriegstagebuch. Mit Briefen von Jack Hamesh an Ingeborg Bachmann (st 4243) und Die Radiofamilie (st 4361).
Ingeborg Bachmann
Malina
Roman
Mit einem Nachwort von Elfriede Jelinek
Suhrkamp
Die Notenbeispiele auf den Seiten 13 und 437/38 stammen aus Pierrot lunaire (op. 21) von Arnold Schönberg.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2013
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4469
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1971
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlaggestaltung: cornelia niere, münchen
eISBN 978-3-518-73470-4
www.suhrkamp.de
Inhalt
Erstes KapitelGlücklich mit Ivan
Zweites KapitelDer dritte Mann
Drittes KapitelVon letzten Dingen
NachwortElfriede JelinekDer Krieg mit anderen Mitteln
Die Personen:
Ivan geboren 1935 in Ungarn, Pécs (vormals Fünfkirchen). Lebt seit einigen Jahren in Wien und geht einer geregelten Arbeit nach, in einem Gebäude, das am Kärntnerring liegt. Um keine unnötigen Verwicklungen für Ivan und seine Zukunft heraufzubeschwören, soll es als ein Institut für äußerst notwendige Angelegenheiten bezeichnet werden, da es sich mit Geld befaßt. Es ist nicht die Creditanstalt.
Béla,
András die Kinder, 7 und 5 Jahre alt
Malina Alter, dem Aussehen nach, unbestimmbar, heute vierzig Jahre alt geworden, Verfasser eines ›Apokryph‹, das im Buchhandel nicht mehr erhältlich ist und von dem in den späten fünfziger Jahren einige Exemplare verkauft wurden. Aus Gründen der Tarnung Staatsbeamter der Klasse A, angestellt im Österreichischen Heeresmuseum, wo es ihm ein abgeschlossenes Studium der Geschichte (Hauptfach) und Kunstgeschichte (Nebenfach) ermöglichten, unterzukommen und einen günstigen Platz einzunehmen, auf dem er vorrückt, ohne sich zu bewegen, ohne sich je bemerkbar zu machen durch Einmischungen, Ehrgeiz, Forderungen oder unlautere Verbesserungsgedanken an den Prozeduren und schriftlichen Vorgängen zwischen dem Verteidigungsministerium am Franz-Josefs-Kai und dem Museum im Arsenal, das, ohne besonders aufzufallen, zu den merkwürdigsten Einrichtungen unserer Stadt gehört.
Ich Österreichischer Paß, ausgestellt vom Innenministerium. Beglaubigter Staatsbürgerschaftsnachweis. Augen br., Haare bl., geboren in Klagenfurt, es folgen Daten und ein Beruf, zweimal durchgestrichen und überschrieben, Adressen, dreimal durchgestrichen, und in korrekter Schrift ist darüber zu lesen: wohnhaft Ungargasse 6, Wien III.
Zeit Heute
Ort Wien
Nur die Zeitangabe mußte ich mir lange überlegen, denn es ist mir fast unmöglich, ›heute‹ zu sagen, obwohl man jeden Tag ›heute‹ sagt, ja, sagen muß, aber wenn mir etwa Leute mitteilen, was sie heute vorhaben – um von morgen ganz zu schweigen –, bekomme ich nicht, wie man oft meint, einen abwesenden Blick, sondern einen sehr aufmerksamen, vor Verlegenheit, so hoffnungslos ist meine Beziehung zu ›heute‹, denn durch dieses Heute kann ich nur in höchster Angst und fliegender Eile kommen und davon schreiben, oder nur sagen, in dieser höchsten Angst, was sich zuträgt, denn vernichten müßte man es sofort, was über Heute geschrieben wird, wie man die wirklichen Briefe zerreißt, zerknüllt, nicht beendet, nicht abschickt, weil sie von heute sind und weil sie in keinem Heute mehr ankommen werden.
Wer je einen schrecklich flehentlichen Brief geschrieben hat, um ihn dann doch zu zerreißen und zu verwerfen, weiß noch am ehesten, was hier unter ›heute‹ gemeint ist. Und kennt nicht jeder diese beinahe unleserlichen Zettel: ›Kommen Sie, wenn überhaupt, wenn Sie können, wollen, wenn ich Sie darum bitten darf! Um fünf Uhr im Café Landmann!‹ Oder diese Telegramme: ›bitte ruf mich sofort an stop noch heute.‹ Oder: ›heute nicht möglich.‹
Denn Heute ist ein Wort, das nur Selbstmörder verwenden dürften, für alle anderen hat es schlechterdings keinen Sinn, ›heute‹ ist bloß die Bezeichnung eines beliebigen Tages für sie, eben für heute, ihnen ist klar, daß sie wieder nur acht Stunden zu arbeiten haben oder sich freinehmen, ein paar Wege machen werden, etwas einkaufen müssen, eine Morgen- und eine Abendzeitung lesen, einen Kaffee trinken, etwas vergessen haben, verabredet sind, jemand anrufen müssen, ein Tag also, an dem etwas zu geschehen hat oder besser doch nicht zu viel geschieht.
Wenn ich hingegen ›heute‹ sage, fängt mein Atem unregelmäßig zu gehen an, diese Arhythmie setzt ein, die jetzt auch schon auf einem Elektrokardiogramm festzustellen ist, es geht nur nicht hervor aus der Zeichnung, daß die Ursache mein Heute ist, ein immer neues, bedrängendes, aber den Beweis für die Störung kann ich erbringen, im fahrigen Code der Mediziner verfaßt, für etwas, das dem Angstanfall vorausgeht, mich disponiert macht, mich stigmatisiert, heute noch funktionell, so sagen sie, meinen sie, die Beweiskundigen. Nur ich fürchte, es ist ›heute‹, das für mich zu erregend ist, zu maßlos, zu ergreifend, und in dieser pathologischen Erregung wird bis zum letzten Augenblick für mich ›heute‹ sein.
Wenn ich also wenig zufällig, sondern unter einem furchtbaren Zwang zu dieser Einheit der Zeit gekommen bin, so verdanke ich die Einheit des Ortes einem milden Zufall, denn nicht ich habe sie gefunden. In dieser viel unwahrscheinlicheren Einheit bin ich zu mir gekommen, und ich kenne mich aus in ihr, oh, und wie sehr, denn der Ort ist im großen und ganzen Wien, daran ist noch nichts sonderbar, aber eigentlich ist der Ort nur eine Gasse, vielmehr ein kleines Stück von der Ungargasse, und das hat sich daraus ergeben, daß wir alle drei dort wohnen, Ivan, Malina und ich. Wenn man die Welt vom III. Bezirk aus sieht, einen so beschränkten Blickwinkel hat, ist man natürlich geneigt, die Ungargasse herauszustreichen, über sie etwas herauszufinden, sie zu loben und ihr eine gewisse Bedeutung zu verleihen. Man könnte sagen, sie sei eine besondere Gasse, weil sie an einer fast stillen, freundlichen Stelle am Heumarkt beginnt und man von hier aus, wo ich wohne, den Stadtpark sehen kann, aber auch die bedrohliche Großmarkthalle und das Hauptzollamt. Noch sind wir zwischen würdigen, verschlossenen Häusern, und erst kurz nach Ivans Haus, mit der Nummer 9 und den beiden Löwen aus Bronze am Tor, wird sie unruhiger, ungeordneter und planloser, obwohl sie sich dem Diplomatenviertel nähert, es aber rechts liegen läßt und wenig Verwandtschaft mit diesem ›Nobelviertel‹ – wie es vertraulich heißt – von Wien zeigt. Mit kleinen Kaffeehäusern und vielen alten Gasthäusern macht sie sich nützlich, wir gehen zum Alten Heller, dazwischen gibt es eine brauchbare Garage, Automag, die auch sehr brauchbare Neue Apotheke, eine Tabaktrafik auf der Höhe der Neulinggasse, nicht zu vergessen die gute Bäckerei an der Ecke Beatrixgasse und zum Glück die Münzgasse, in der wir unsre Autos parken können, auch wenn sonst nirgends mehr Platz ist. Streckenweise, etwa auf der Höhe des Consolato Italiano, mit dem Istituto Italiano di Cultura kann man ihr ein gewisses Air nicht absprechen, und doch hat sie nicht zuviel davon, denn spätestens beim Heranrollen des O-Wagens oder bei einem Blick auf die ominöse Garage für Postautos, an der zwei Tafeln sich nicht aussprechen und kurz sagen ›Kaiser Franz Joseph I. 1850‹ und ›Kanzlei und Werkstätte‹, vergißt man ihre Anstrengungen, sich zu nobilitieren, und sie erinnert an ihre ferne Jugend, an die alte Hungargasse, in der die aus Ungarn einreisenden Kaufleute, Pferde-, Ochsen- und Heuhändler hier ihre Herbergen hatten, ihre Einkehrwirtshäuser, und so verläuft sie nur, wie es amtlich heißt, ›in großem Bogen Richtung Stadt‹. Im Beschreiben ihres großen Bogens, den ich an manchen Tagen vom Rennweg herunterfahre, hält sie mich auf, mit immer neuen Einzelheiten, beleidigenden Neuerungen, Geschäften, die heißen Modernes Wohnen, die mir aber wichtiger sind als alle über sie triumphierenden Plätze und Straßen der Stadt. Sie ist auch nicht unbekannt zu nennen, denn man kennt sie schon, aber ein Fremder wird sie nie zu Gesicht bekommen, weil es in ihr nichts zu besichtigen gibt und man hier nur wohnen kann. Ein Besichtiger würde am Schwarzenbergplatz oder spätestens am Rennweg, beim Belvedere, umkehren, mit dem wir gemeinsam nur die Ehre haben, den Titel ›III. Bezirk‹ zu führen, und nähern könnte der Fremde sich vielleicht von der anderen Seite, vom Eislaufverein her, wenn er in dem neuen Steinkasten logiert, dem Vienna Intercontinental Hotel, und zu weit in den Stadtpark spaziert. Aber in diesen Stadtpark, über dem für mich ein kalkweißer Pierrot mit überschnappender Stimme angetönt hat, kommen wir höchstens zehnmal im Jahr, weil man ja in fünf Minuten dort sein kann; und Ivan, der prinzipiell nicht zu Fuß geht, trotz meiner Bitten, Schmeicheleien, kennt ihn gar nur vom Vorüberfahren, denn der Park ist einfach zu nah, und zum Luftholen und mit den Kindern fahren wir in den Wienerwald, auf den Kahlenberg, bis zu den Schlössern Laxenburg und Mayerling, bis nach Petronell und Carnuntum ins Burgenland. Zu diesem Stadtpark, zu dem wir nicht fahren müßten, haben wir eine abstinente und unherzliche Beziehung, und ich erinnre mich an nichts mehr aus Märchenzeit. Manchmal bemerke ich noch beklommen den Magnolienbaum mit den ersten Blüten, aber man kann nicht jedesmal ein Aufhebens machen davon; und wenn ich, wie heute, wieder einmal zu Malina einfallslos sage, übrigens, die Magnolien im Stadtpark, hast du gesehen? so wird er mir, weil er höflich ist, antworten und nicken, aber er kennt den Satz mit den Magnolien schon.
Es gibt, und das ist leicht zu erraten, viel schönere Gassen in Wien, aber die kommen in anderen Bezirken vor, und es geht ihnen wie den zu schönen Frauen, die man sofort ansieht mit dem schuldigen Tribut, ohne je daran zu denken, sich mit ihnen einzulassen. Noch nie hat jemand behauptet, die Ungargasse sei schön, oder die Kreuzung Invalidenstraße-Ungargasse habe ihn bezaubert oder sprachlos gemacht. So will ich nicht erst anfangen, über meine Gasse, unsre Gasse unhaltbare Behauptungen aufzustellen, ich sollte vielmehr in mir nach meiner Verklammerung mit der Ungargasse suchen, weil sie nur in mir ihren Bogen macht, bis zu Nummer 9 und Nummer 6, und mich müßte ich fragen, warum ich immer in ihrem Magnetfeld bin, ob ich nun über die Freyung gehe, am Graben einkaufe, zur Nationalbibliothek schlendere, auf dem Lobkowitzplatz stehe und denke, hier, hier müßte man eben wohnen! Oder Am Hof! Selbst wenn ich trödle in der Inneren Stadt und vorgebe, nicht nach Hause zu wollen, mich eine Stunde lang in ein Kaffeehaus setze und in Zeitungen blättere, weil ich insgeheim schon auf dem Weg und zurücksein möchte, und wenn ich einbiege in meinen Bezirk, von der Beatrixgasse her, in der ich früher gewohnt habe, oder vom Heumarkt aus, dann ist es nicht wie mit dem Kranksein an der Zeit, obwohl die Zeit plötzlich mit dem Ort zusammenfällt, aber nach dem Heumarkt steigt mein Blutdruck und zugleich läßt die Spannung nach, der Krampf, der mich in fremden Gegenden befällt, und ich werde, obwohl ich schneller gehe, endlich ganz still und dringlich vor Glück. Nichts ist mir sicherer als dieses Stück der Gasse, bei Tag laufe ich die Stiegen hinauf, in der Nacht stürze ich auf das Haustor zu, mit dem Schlüssel schon in der Hand, und wieder kommt der bedankte Moment, wo der Schlüssel sperrt, das Tor aufgeht, die Tür aufgeht, und dieses Gefühl von Nachhausekommen, das überschwemmt mich in der Gischt des Verkehrs und der Menschen schon in einem Umkreis von hundert, zweihundert Metern, in dem alles mir mein Haus ankündigt, das nicht mein Haus ist, sondern natürlich einer A. G. gehört oder irgendeiner Spekulantenbande, die dieses Haus wiederaufgebaut hat, zusammengeflickt vielmehr, aber darüber weiß ich so gut wie nichts, denn in den Reparaturjahren habe ich zehn Minuten entfernt gewohnt, und die längste Zeit ging ich an der Nummer 26, die lange auch meine Glücksnummer war, bedrückt und schuldbewußt vorüber, wie ein Hund, der seinen Herrn gewechselt hat, seinen alten wiedersieht und nun nicht weiß, wem er mehr Anhänglichkeit schuldet. Aber heute gehe ich an der Beatrixgasse 26 vorbei, als wäre da nie etwas gewesen, beinahe nichts, oder ja, es war einmal an dieser Stelle, ein Duft aus alter Zeit, er ist nicht mehr zu spüren.
Meine Beziehung zu Malina hat jahrelang aus mißlichen Begegnungen, den größten Mißverständnissen und einigen dummen Phantastereien bestanden – ich will damit sagen, aus viel größeren Mißverständnissen als die zu anderen Menschen. Ich war allerdings von Anfang an unter ihn gestellt, und ich muß früh gewußt haben, daß er mir zum Verhängnis werden müsse, daß Malinas Platz schon von Malina besetzt war, ehe er sich in meinem Leben einstellte. Es ist mir nur erspart worden, oder ich habe es mir aufgespart, zu früh mit ihm zusammenzukommen. Denn schon an der Straßenbahnhaltestelle E 2, H 2, am Stadtpark, fehlte nicht viel einmal, und es hätte angefangen. Dort stand Malina mit einer Zeitung in der Hand, und ich tat, als bemerkte ich ihn nicht, und starrte über den Rand meiner Zeitung unentwegt zu ihm hinüber und konnte nicht herausfinden, ob er wirklich in seine Zeitung so vertieft war oder merkte, daß ich ihn fixierte, hypnotisierte, ihn zum Aufschauen zwingen wollte. Ich, und Malina zwingen! Ich dachte mir, wenn der E 2 zuerst kommt, dann wird alles gut, wenn nur, um Himmels willen, nicht der unsympathische H 2 oder gar der seltenere G 2 zuerst kommen, und dann kam wirklich der E 2, aber als ich aufgesprungen war auf den zweiten Wagen, verschwand Malina, aber nicht im ersten Wagen, nicht in meinem, und zurückgeblieben war er auch nicht. Er konnte nur plötzlich in die Stadtbahnstation hineingelaufen sein, als ich mich umdrehen mußte, in Luft aufgelöst haben konnte er sich doch nicht. Weil ich keine Erklärung fand, nach ihm suchte und ausschaute und auch keinen Grund wußte für sein und für mein Verhalten, hatte es der ganze Tag in sich gehabt. Aber das liegt weit zurück in der Vergangenheit, und es ist nicht mehr genug Zeit, darüber heute zu reden. Jahre später ist es mir mit ihm noch einmal so ergangen, in einem Vortragssaal in München. Er stand auf einmal neben mir, ging dann ein paar Schritte vor, zwischen drängelnden Studenten, suchte einen Platz, ging zurück, und ich hörte, vor Aufregung am Ohnmächtigwerden, einen eineinhalbstündigen Vortrag an, ›Die Kunst im Zeitalter der Technik‹, und ich suchte und suchte in dieser zum Stillsitzen und zur Ergriffenheit verurteilten Masse nach Malina. Daß ich mich weder an die Kunst noch an die Technik noch an dieses Zeitalter halten wollte, mich mit keinem der öffentlich abgehandelten Zusammenhänge, Themen, Probleme je beschäftigen würde, wurde mir spätestens an diesem Abend klar, und gewiß war mir, daß ich Malina wollte und daß alles, was ich wissen wollte, von ihm kommen mußte. Am Ende klatschte ich mit den anderen ausgiebig, zwei Leute aus München führten und dirigierten mich nach hinten aus dem Saal hinaus, einer hielt mich am Arm, einer redete klug auf mich ein, Dritte redeten mich an, und ich sah zu Malina hinüber, der auch zum Ausgang nach hinten wollte, aber langsam, und so konnte ich schneller sein, und ich tat das Unmögliche, ich stieß ihn an, als hätte man mich gegen ihn gestoßen, als fiele ich gegen ihn, und ich fiel ja wirklich auf ihn zu. So konnte er nicht anders, er mußte mich bemerken, aber ich bin nicht sicher, daß er mich wirklich gesehen hat, doch damals hörte ich zum erstenmal seine Stimme, ruhig, korrekt, auf einem Ton: Verzeihung.
Darauf fand ich keine Antwort, denn das hatte noch nie jemand zu mir gesagt, und ich war nicht sicher, ob er mich um Verzeihung bat oder mir verzieh, die Tränen kamen so schnell in meine Augen, daß ich ihm nicht mehr nachsehen konnte, sondern, der anderen wegen, zu Boden schaute, ein Taschentuch aus der Tasche herausholte und flüsternd vorgab, jemand hätte mich getreten. Als ich wieder aufsehen konnte, hatte Malina sich in der Menge verloren.
In Wien suchte ich ihn nicht mehr, ich dachte ihn mir im Ausland, und ohne Hoffnung wiederholte ich meinen Weg zum Stadtpark hinunter, weil ich noch kein Auto hatte. Eines Morgens erfuhr ich etwas aus der Zeitung über ihn, aber es handelte sich in dem Bericht gar nicht um ihn, sondern in der Hauptsache ging es um das Begräbnis der Maria Malina, das eindrucksvollste, größte, das die Wiener, freiwillig und natürlich nur einer Schauspielerin wegen, begingen. Unter den Trauergästen habe sich der Bruder der Malina befunden, der hochbegabte, junge, bekannte Schriftsteller, der nicht bekannt war und dem von den Journalisten rasch zu einem eintägigen Ruhm verholfen wurde. Denn die Maria Malina konnte in den Stunden, als Minister und Hausmeister, Kritiker und stehplatzbesuchende Gymnasiasten in einem langen Zug zum Zentralfriedhof zogen, nicht einen Bruder brauchen, der ein Buch geschrieben hatte, das niemand kannte, und der überhaupt ›niemand‹ war. Die drei Worte ›jung und hochbegabt und bekannt‹ waren zu seiner Einkleidung an diesem Volkstrauertag notwendig.
Über diese dritte unappetitliche Berührung durch eine Zeitung, die es auch nur für mich mit ihm gab, haben wir nie gesprochen, als hätte sie nie etwas mit ihm zu tun gehabt, noch weniger mit mir. Denn in der verlorenen Zeit, als wir einander nicht einmal die Namen abfragen konnten, noch weniger unsere Leben, habe ich ihn für mich ›Eugenius‹ genannt, weil ›Prinz Eugen, der edle Ritter‹ das erste Lied war, das ich zu lernen hatte und damit auch den ersten Männernamen, gleich gefiel der Name mir sehr, auch die Stadt ›Belgerad‹, deren Exotik und Bedeutung sich erst verflüchtigte, als sich herausstellte, daß Malina nicht aus Belgrad kommt, sondern nur von der jugoslawischen Grenze, wie ich selber, und manchmal sagen wir noch etwas auf slowenisch oder windisch zueinander, wie in den ersten Tagen: Jaz in ti. In ti in jaz. Sonst haben wir es nicht nötig, von unseren ersten guten Tagen zu reden, weil die Tage immer besser werden, und lachen muß ich über die Zeiten, in denen ich wütend auf Malina war, weil er mich soviel Zeit mit anderen und anderem vergeuden ließ, darum exilierte ich ihn aus Belgrad, nahm ihm seinen Namen, dichtete ihm mysteriöse Geschichten an, bald war er ein Hochstapler, bald ein Philister, bald ein Spion, und wenn ich besser gelaunt war, ließ ich ihn aus der Wirklichkeit verschwinden und brachte ihn unter in einigen Märchen und Sagen, nannte ihn Florizel, Drosselbart, ich ließ ihn aber am liebsten den hl. Georg sein, der den Drachen erschlug, damit Klagenfurt entstehen konnte, aus dem großen Sumpf, in dem nichts gedieh, damit meine erste Stadt daraus werden konnte, und nach vielen müßigen Spielen kehrte ich entmutigt zurück zu der einzig richtigen Vermutung, daß es Malina tatsächlich in Wien gab und daß ich in dieser Stadt, in der ich so viele Möglichkeiten hatte, ihn zu treffen, ihn dennoch immer verpaßte. Ich fing an, über Malina mitzureden, wenn irgendwo über ihn gesprochen wurde, obwohl es nicht häufig vorkam. Eine häßliche Erinnerung ist das, die mir heute nicht mehr weh tut, aber ich hatte das Bedürfnis, so zu tun, als kennte ich ihn auch, als wüßte ich einiges über ihn, und ich war witzig wie die anderen, wenn man die komische infame Geschichte von Malina und Frau Jordan erzählte. Heute weiß ich, daß Malina nie etwas mit dieser Frau Jordan ›gehabt‹ hat, wie man hier sagt, daß nicht einmal Martin Ranner sich heimlich mit ihr auf dem Cobenzl getroffen hat, weil sie ja seine Schwester war, vor allem aber ist Malina in einem Zusammenhang mit anderen Frauen nicht zu denken. Auszuschließen ist es nicht, daß Malina Frauen gekannt hat vor mir, er kennt ja viele Leute, also auch Frauen, aber es ist völlig bedeutungslos, seit wir miteinander leben; nie mehr kommt mir ein Gedanke daran, denn meine Verdächtigungen und Verwirrungen, soweit sie Malina betreffen, sind zunichte geworden in seinem Erstaunen. Auch war die junge Frau Jordan nicht die Frau, von der lange das Gerücht ging, sie habe den berühmten Ausspruch getan ›Ich treibe Jenseitspolitik‹, als ein Assistent ihres Mannes sie auf den Knien, beim Bodenreiben, überraschte und sie ihre ganze Verachtung für ihren Mann zu verstehen gab. Es hat sich anders zugetragen, ist eine andere Geschichte, und alles wird sich einmal richtigstellen lassen. Aus den Gerüchtfiguren werden die wahren Figuren, befreit und groß, hervortreten, wie Malina heute für mich, der nicht mehr das Ergebnis von Gerüchten ist, sondern gelöst neben mir sitzt oder mit mir durch die Stadt geht. Für die anderen Richtigstellungen ist die Zeit noch nicht gekommen, sie sind für später. Sind nicht für heute.
Zu fragen habe ich mich nur mehr, seit alles so geworden ist zwischen uns, wie es eben ist, was wir denn sein können für einander, Malina und ich, da wir einander so unähnlich sind, so verschieden, und das ist nicht eine Frage des Geschlechts, der Art, der Festigkeit seiner Existenz und der Unfestigkeit der meinen. Allerdings hat Malina nie ein so konvulsivisches Leben geführt wie ich, nie hat er seine Zeit verschwendet mit Nichtigkeiten, herumtelefoniert, etwas auf sich zukommen lassen, nie ist er in etwas hineingeraten, noch weniger eine halbe Stunde vor dem Spiegel gestanden, um sich anzustarren, um danach irgendwohin zu hetzen, immer zu spät, Entschuldigungen stotternd, über eine Frage oder um eine Antwort verlegen. Ich denke, daß wir auch heute noch wenig miteinander zu tun haben, einer erduldet den andern, erstaunt über den anderen, aber mein Staunen ist neugierig (staunt Malina denn überhaupt? ich glaube es immer weniger), und unruhig ist es, gerade weil meine Gegenwart ihn nie irritiert, weil er sie wahrnimmt, wenn es ihm gefällt, nicht wahrnimmt, wenn nichts zu sagen ist, als gingen wir nicht ständig aneinander vorbei in der Wohnung, unübersehbar einer für den anderen, unüberhörbar bei den alltäglichen Handlungen. Mir scheint es dann, daß seine Ruhe davon herrührt, weil ich ein zu unwichtiges und bekanntes Ich für ihn bin, als hätte er mich ausgeschieden, einen Abfall, eine überflüssige Menschwerdung, als wäre ich nur aus seiner Rippe gemacht und ihm seit jeher entbehrlich, aber auch eine unvermeidliche dunkle Geschichte, die seine Geschichte begleitet, ergänzen will, die er aber von seiner klaren Geschichte absondert und abgrenzt. Deswegen habe auch nur ich etwas zu klären mit ihm, und mich selber vor allem muß und kann ich nur vor ihm klären. Er hat nichts zu klären, nein, er nicht. Ich mache Ordnung im Vorzimmer, ich möchte in der Nähe der Tür sein, denn er wird gleich kommen, der Schlüssel bewegt sich in der Tür, ich trete ein paar Schritte zurück, damit er nicht gegen mich prallt, er schließt ab, und wir sagen gleichzeitig und liebenswürdig: guten Abend. Und während wir den Korridor entlanggehen, sage ich noch etwas:
Ich muß erzählen. Ich werde erzählen. Es gibt nichts mehr, was mich in meiner Erinnerung stört.
Ja, sagt Malina, ohne Verwunderung. Ich gehe ins Wohnzimmer, er geht weiter, nach hinten, denn das letzte Zimmer ist sein Zimmer.
Ich muß und ich werde, wiederhole ich laut vor mir, denn wenn Malina nicht fragt und nichts weiter wissen will, dann ist es richtig. Ich kann beruhigt sein.
Wenn meine Erinnerung aber nur die gewöhnlichen Erinnerungen meinte, Zurückliegendes, Abgelebtes, Verlassenes, dann bin ich noch weit, sehr weit von der verschwiegenen Erinnerung, in der mich nichts mehr stören darf.
Was soll mich stören, an einer Stadt zum Beispiel, in der ich geboren bin, ohne die Notwendigkeit einzusehen, warum gerade dort und nicht anderswo, aber muß ich mich erinnern daran? Der Fremdenverkehrsverein gibt über das Wichtigste Auskunft, einiges fällt nicht in seine Zuständigkeit, aber auch ich bin nicht kompetent, ich muß dort aber in der Schule erfahren haben, wo ›Mannesmut und Frauentreu‹ sich zusammengetan haben und wo, in unsrer Hymne, ›des Glockners Eisgefilde‹ glänzt. Der größte Sohn unserer Stadt, Thomas Koschat, von dem die Thomas Koschatgasse zeugt, ist der Komponist des Liedes: ›Verlassn, verlassn, verlassn bin i‹, in der Bismarckschule mußte ich das Einmaleins noch einmal lernen, das ich schon konnte, in der Benediktinerschule ging ich zum Religionsunterricht, um dann nicht konfirmiert zu werden, immer am Nachmittag, mit einem Mädchen aus einer anderen Klasse, denn alle anderen, die Katholiken, hatten ihre Religion am Vormittag, und ich war darum immer frei, der junge Vikar soll einen Kopfschuß gehabt haben, der alte Dechant war streng, schnurrbärtig und hielt Fragen für unreif. Das Ursulinengymnasium hat jetzt eine verschlossene Tür, an der ich noch einmal gerüttelt habe. Im Café Musil habe ich vielleicht doch nicht das Stück Torte nach der Aufnahmsprüfung bekommen, aber ich möchte es bekommen haben und sehe mich mit einer kleinen Gabel eine Torte zerteilen. Vielleicht habe ich die Torte erst ein paar Jahre später bekommen. Am Anfang der Seepromenade des Wörthersees, nicht weit von der Dampferstation, bin ich zum erstenmal geküßt worden, aber ich sehe kein Gesicht mehr, das sich meinem nähert, auch der Name von dem Fremden muß im See verschlammt sein, nur von Lebensmittelkarten weiß ich noch etwas, die ich dem Fremden gegeben habe, der nicht mehr zurückgekommen ist zur Dampferstation am nächsten Tag, denn er war eingeladen bei der schönsten Frau der Stadt, die mit einem großen Hut durch die Wienergasse ging und wirklich Wanda hieß; einmal bin ich ihr nachgegangen bis zum Waagplatz, ohne Hut, ohne Parfüm und ohne den sicheren Gang einer Frau von fünfunddreißig Jahren. Der Fremde war vielleicht auf der Flucht oder er wollte Zigaretten für die Marken eintauschen und sie rauchen mit der schönen großen Frau, nur war ich damals schon neunzehn Jahre alt und nicht mehr sechs, mit einer Schultasche auf dem Rücken, als es wirklich passierte. In einer Großaufnahme steht die kleine Glanbrücke da, nicht das abendliche Seeufer, nur diese mittäglich übersonnte Brücke mit den zwei kleinen Buben, die auch ihre Schultaschen auf dem Rücken hatten, und der ältere, mindestens zwei Jahre älter als ich, rief: Du, du da, komm her, ich geb dir etwas! Die Worte sind nicht vergessen, auch nicht das Bubengesicht, der wichtige erste Anruf, nicht meine erste wilde Freude, das Stehenbleiben, Zögern, und auf dieser Brücke der erste Schritt auf einen anderen zu, und gleich darauf das Klatschen einer harten Hand ins Gesicht: Da, du, jetzt hast du es! Es war der erste Schlag in mein Gesicht und das erste Bewußtsein von der tiefen Befriedigung eines anderen, zu schlagen. Die erste Erkenntnis des Schmerzes. Mit den Händen an den Riemen der Schultasche und ohne zu weinen und mit gleichmäßigen Schritten ist jemand, der einmal ich war, den Schulweg nach Hause getrottet, dieses eine Mal ohne die Staketen des Zauns am Wegrand abzuzählen, zum erstenmal unter die Menschen gefallen, und manchmal weiß man also doch, wann es angefangen hat, wie und wo, und welche Tränen zu weinen gewesen wären.
Es war auf der Glanbrücke. Es war nicht die Seepromenade.
Während manche Menschen an Tagen geboren sind, wie dem 1. Juli, an dem gleich vier hochberühmte Leute geboren sind, oder am 5. Mai, an dem sich die Weltverbesserer und Genies drängen und ihre ersten Schreie ausgestoßen haben, konnte ich nie herausfinden, wer die Unvorsichtigkeit begangen hat, sein Leben auch an dem Tag anzufangen, der für mich der erste war. Ich kenne nicht die Befriedigung, mit Alexander dem Großen, mit Leibniz, mit Galileo Galilei oder Karl Marx in eine Sternstunde geraten zu sein, und selbst auf der Reise von New York nach Europa, auf dem Schiff ›Rotterdam‹, auf dem die Geburtstagsliste aller Passagiere, die in diesen Tagen zu feiern waren, in Evidenz gehalten wurde, kam an dem Tag, als die Reihe an mir war, nur durch meine Kabinentür eine gefächerte Glückwunschkarte vom Kapitän, und noch hoffte ich bis mittag, daß unter vielen Hunderten von Passagieren, wie an allen Vortagen, noch einige seien, die an diesem Tag eine Gratistorte auf den Tisch bekamen und mit dem Absingen von ›happy birthday to you‹ überrascht würden. Aber dann war nur ich es, ich sah mich vergeblich um im ganzen Speisesaal, nein, niemand sonst, ich schnitt rasch die Torte an, verteilte sie eilig an drei Holländertische und ich redete und trank und redete, ich vertrüge den Seegang nicht, hätte die ganze Nacht nicht geschlafen, und ich lief zurück in die Kabine und sperrte mich ein.
Es war nicht auf der Glanbrücke, nicht auf der Seepromenade, es war auch nicht auf dem Atlantik in der Nacht. Ich fuhr nur durch diese Nacht, betrunken, der untersten Nacht entgegen.
Erst später kam ich darauf, daß an dem Tag, der mich damals noch interessierte, wenigstens jemand gestorben war. Auf die Gefahr hin, auch der Vulgärastrologie ins Gehege zu kommen, weil ich mir die Zusammenhänge hoch oben über uns einbilden darf, wie ich will, weil mir keine Wissenschaft dabei auf die Finger sehen und draufklopfen kann, hänge ich meinen Anfang mit einem Ende zusammen, denn warum soll nicht jemand zu leben anfangen, wenn der Geist eines Menschen verlischt, aber den Namen dieses Mannes nenne ich nicht, denn wichtiger ist, daß mir dazu gleich das Kino hinter dem Kärntnerring einfiel, in dem ich zwei Stunden lang, in Farben vertan und in viel Dunkelheit, zum erstenmal Venedig gesehen habe, die Schläge der Ruder ins Wasser, auch eine Musik zog mit Lichtern durchs Wasser und ihr dadim, dadam, das mich mitzog, hinüber in die Figuren, die Doppelfiguren und ihre Tanzschritte. So war ich in das Venedig gekommen, das ich nie sehen werde, an einem windigen, klirrenden Wiener Wintertag. Die Musik habe ich oft wiedergehört, improvisiert, variiert, aber nie mehr so und richtig, einmal aus einem Nebenzimmer, wo man sie zerfetzte während einer mehrstimmigen Diskussion über den Zusammenbruch der Monarchie, die Zukunft des Sozialismus, und einer begann zu schreien, weil ein anderer etwas gegen den Existentialismus oder den Strukturalismus gesagt hatte, und ich horchte vorsichtig noch einen Takt heraus, aber da war die Musik schon zugrunde gegangen im Geschrei, und ich ohne mich, weil ich sonst nichts mehr hören wollte. Oft will ich ja nicht hören, und oft kann ich nicht sehen. So wie ich das sterbende Pferd nicht ansehen konnte, das von dem Felsen gestürzt war bei Hermagor, für das ich zwar kilometerweit um Hilfe ging, aber ich ließ es bei dem Hüterbuben zurück, der auch nichts tun konnte, oder wie ich die Große Messe von Mozart nicht hören konnte und nicht die Schüsse auf einem Dorf im Fasching.
Ich will nicht erzählen, es stört mich alles in meiner Erinnerung. Malina kommt ins Zimmer, er sucht nach einer halbleeren Whiskyflasche, gibt mir ein Glas, schenkt sich eines ein und sagt: Noch stört es dich. Noch. Es stört dich aber eine andre Erinnerung.
Erstes KapitelGlücklich mit Ivan
Wieder geraucht und wieder getrunken, die Zigaretten gezählt, die Gläser, und noch zwei Zigaretten zugelassen für heute, weil zwischen heute und Montag drei Tage sind, ohne Ivan. Sechzig Zigaretten später aber ist Ivan zurück in Wien, er wird zuerst die Zeitansage anrufen und seine Uhr kontrollieren, dann den Weckauftrag 00, der gleich zurückruft, danach sofort einschlafen, so rasch wie nur Ivan das kann, aufwachen, vom Weckauftrag gerufen, mit einem Groll, dem er jedesmal einen anderen Ausdruck gibt, mit Gestöhne, Flüchen, Ausbrüchen, Anklagen. Dann hat er all den Groll vergessen und ist mit einem Sprung im Badezimmer, um sich die Zähne zu putzen, dann unter die Dusche zu gehen, dann sich zu rasieren. Er wird den Transistor anstellen und die Frühnachrichten hören. Österreich . . Wir bringen Kurznachrichten: Washington ...
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!