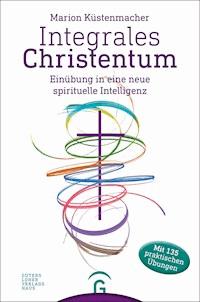12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eigene spirituelle Muster erkennen
In 17 Kapiteln berichtet Marion Küstenmacher von Augenblickserfahrungen, aus denen sich im Verlauf ihres Lebens spirituelle Fäden sponnen, die sich heute fest mit ihrem Bewusstseinsfeld verwoben haben. Jedes Kapitel folgt einem Dreischritt: Die Autorin erzählt von einer besonderen Kindheitserfahrung und fragt dann, wie dieses Basismotiv in der mystisch-theologischen Tradition wahrgenommen und gedeutet wird. In einem dritten Schritt macht sie schließlich deutlich, wie sich das Thema in ihrer Biografie entfaltet hat und wo es sie heute trägt und weiterführt.
Entstanden ist die sehr persönliche Geschichte eines spirituellen Weges, die zugleich eine Einladung ist, die Muster mystischer Spiritualität im eigenen Leben zu entdecken und ihnen nachzugehen.
»Den fliegenden Teppich meines Erwachsenen-Bewusstseins erlebe ich heute als ein fluides, mobiles, immer noch vorläufiges Territorium, ein ›Gefährt‹ des Geistes, auf dem zu reisen ich nicht müde werde.« (Marion Küstenmacher)
- Von der Autorin für integrale Persönlichkeitsentwicklung
- Ihr persönlichstes Buch über den Weg ihrer Spiritualität
- Mit weiterführenden Ideen für eine spirituelle Praxis
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Marion Küstenmacher
Mein
fliegender
Teppich
des
Geistes
Wie sich aus Kindheitserfahrungen einelebendige Spiritualität weben lässt
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
Copyright © 2021 Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
Umschlagmotiv: © ASEF – Adobe Stock.com
ISBN 978-3-641-25953-2V001
www.gtvh.de
Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich.
Psalm 104,2
Jeder Augenblick und jeder Ort sagt:
Webe dieses Muster in deinen Teppich ein.
Dschelaleddin Rumi
Ein Teppich scheinet mir mein Leben,
und immer sticket meine Hand;
an welcher Stell ich auch mag weben,
am obern oder untern Rand;
zuletzt, wo so viel Kleinstes
sich still verband, entstand
ein großes Allgemeinstes.
Friedrich Rückert
Inhalt
Mein fliegender Teppich des Geistes
oder Die verwickelten Fäden des Lebens
Die Postkarte vom Christkind
oder Vorauseilender Segen für alle
Das Evangelium der Feuersalamander
oder Augenblicke der Allverbundenheit
Der Sprung in die Gondel
oder Geborgen im grundlosen Grund
Der vertauschte Schutzengel
oder Das Eigene als das Dahingegebene
Das ewige Licht in der Puppenküche
oder Die persönliche Inszenierung des Heiligen
Die Reise zu den Schallplatteninseln
oder Überbordende Freude zwischen Ich und Du
Die Stöckelschuhe aus Teer
oder Entwicklungschancen des Bewusstseins
Die gestohlene Murmel
oder Räuber und Trickster als Gewissenstrainer
Der heimliche Trumpf im Städtequartett
oder Im Spielraum von Gottes Möglichkeiten
Der Fisch an der Zimmerdecke
oder Die Zugkraft des Paradoxen
Der Geist in der Buchstabensuppe
oder Der süße Geschmack des Einen
Die Scheibenwischertrance
oder Bewusstseinsschulung in Einspitzigkeit
Die Madonna auf dem Holzhaufen
oder Die Schönheit des Fragments
Die unsichtbare Königstasse
oder Der leere Becher des Heils
Die befreite Zeit in der Weihnachtspyramide
oder Göttliche Zeitüberschreitungen
Der Teppich ohne Teppichausbreiter
oder Erzählen, was zählt
Dank
Verzeichnis der Namen
Verzeichnis der Bibelstellen
Anmerkungen
Mein fliegender Teppich des Geistes
oder Die verwickelten Fäden des Lebens
Das Leben lag vor ihr ausgebreitet wie ein verheißungsvoller, bunter Teppich,
dessen Muster entworfen,
aber noch längst nicht festgelegt war.
Lucy Maud Montgomery (1874–1942), kanadische Schriftstellerin
Als ich anfing, über die spirituellen Erfahrungen nachzudenken, die mein Kinder-Ich mit meinem erwachsenen Bewusstsein und Glauben verbinden, kamen mir drei unterschiedliche Teppicherfahrungen in den Sinn. Sie inspirierten mich zur dreiteiligen Struktur, der Sie in den folgenden Kapiteln begegnen werden. Bevor Sie sich also mit mir und meinem fliegenden Teppich des Geistes lesend auf die Reise machen, möchte ich mit Ihnen kurz auf allen drei Teppichen Platz nehmen.
Der bunte Teppich der Kindheit
Der erste Teppich war der große Perser im Wohnzimmer meiner Eltern. Als ich klein war, habe ich auf ihm erst Krabbeln und dann Laufen gelernt. Er war ein großartiger Spielplatz. An seinen Farben, Mustern und Ornamenten konnte ich mich orientieren. Sie ergaben abgegrenzte Felder für das Bauen mit Holzklötzchen. Sie waren Sortier- und Sammelplätze für bunte Knöpfe aus Mamas Knopfschachtel. Sie lieferten bunte Weideflächen, um meine Zootiere einzuhegen. Aus den geraden Linien wurden nachgiebig-weiche Straßen, auf denen Spielzeugautos entlangglitten, oder Bäche und Flüsse, über die man Brücken bauen musste. Der Perserteppich war mal Land, mal Meer, ein immer präsenter Verbündeter meiner kindlichen Fantasie. Er war mein erstes Symbol für die »ganze Welt«, die kindlicher Entdeckerlust zu Füßen liegt.
Dieser erste Teppich steht für besondere Momente oder kleine Szenen, die mir aus der Kinderzeit in Erinnerung geblieben sind. Mit ihnen beginnt jedes Kapitel. Dabei habe ich bewusst darauf verzichtet, auf Fotos oder Erzählungen aus der Familie über mich zurückzugreifen. Stattdessen habe ich nach der subjektiven Innenperspektive meines Kinder-Ichs gesucht. Also Erinnerungen, von denen kein anderer wissen kann. Dazu kam: Ich wollte auch, um ein Wort des Theologen Karl Rahner zu bemühen, »die Mystik des gewöhnlichen Lebens« von seinen frühen Anfängen her besser verstehen. Warum bin ich eigentlich eine spirituelle Sucherin mit einem so hohen Interesse an Mystik geworden? Wo lagen die Anfänge? Vor Jahren habe ich einmal einer Theologieprofessorin nach einem hochgescheiten Mystikvortrag die schlichte Frage gestellt: »Wie wird man eigentlich ein Mystiker?« Ihre verblüffte Antwort lautete: »Darüber habe ich noch nicht nachgedacht.« Das wiederum hat mich verblüfft und bewogen, mich mit Entwicklungspsychologie zu beschäftigen. Inzwischen bin ich überzeugt, dass es bei uns allen kostbare Kindheitsmomente gibt, die an den Beginn der eigenen spirituellen Entwicklung gehören. Sie sind keineswegs immer direkt auf religiöse Erziehung oder kirchliche Prägung zurückzuführen.1 Ich hoffe, dass Sie beim Lesen meiner Kindheitsszenen Lust bekommen, selbst in das Schatzhaus Ihrer persönlichen Erinnerungen hinabzusteigen, um dort die »versunkenen Sensationen« Ihrer Kindheit auszugraben.2 Sie mögen klein sein und Ihnen beim ersten Wiedererinnern fast blass und unbedeutend erscheinen. Aber sie haben sich als frühe Fäden in den Teppich Ihres Lebens eingewebt, um die sich später erkennbare Muster bilden konnten.
Wir, die wir wie Teppiche sind
An dieser Stelle könnten Sie gleich einmal innehalten und sich selbst fragen: Gibt es Erinnerungen aus Ihrer Kinderzeit, die allein aus Ihrem »Kopf« kommen, also nirgends als Foto dokumentiert wurden? Die kein anderer über Sie erzählt oder aufgeschrieben hat? Von denen keiner wissen kann als Sie selbst? Suchen Sie nicht gleich nach einem besonderen spirituellen Erlebnis. Konzentrieren Sie sich erst einmal darauf, einige dieser subjektiven Momentaufnahmen von früher in Ihrem Bewusstsein aufsteigen zu lassen. Für die beiden ersten Lebensjahre werden Sie nichts finden, da herrscht komplette Amnesie. Erst ab dem dritten Lebensjahr haben wir bruchstückhafte Erinnerungen, weil der präfrontale Kortex und der Hippocampus erst eine Weile heranreifen müssen, bis erste Gedächtnisspuren angelegt werden können. Für die erzählbare »Überlebensrate« unserer frühen Erlebnisse im Gedächtnis ist die Verarbeitungstiefe entscheidend. Neben den sinnlichen Eindrücken und Emotionen sind es vor allem die Worte, die uns damals schon zur Verfügung standen.3 Achten Sie auf alle möglichen frühen Erinnerungsschnipsel, die ihr Gedächtnis preisgibt. Nutzen Sie dafür alle Sinne: War es vielleicht etwas, das sich besonders angefühlt hat? Kommt Ihnen ein bestimmtes Geräusch, ein besonderer Geruch oder Geschmack in den Sinn? Taucht ein Ort, ein Mensch, ein Tier auf? Welches Gefühl verbindet sich damit? Bei welchen Erinnerungen fühlen Sie sich am wohlsten? Stoßen Sie sich nicht an den Lücken oder losen Enden solcher Erinnerungsfetzchen. Erforschen Sie einfach, was dieser Moment, die kleine Szene für sich selbst ausstrahlt. Schauen Sie durch Ihre Kinderaugen und nehmen Sie wahr, was sie sahen. Blicken Sie dann freundlich als Erwachsener auf das, was Ihr Gedächtnis freigegeben hat, und schreiben Sie auf, woran Sie sich alles erinnern. Das ist der erste Blick auf Ihren fliegenden Teppich des Geistes.
Der bunt gewebte Teppich unserer Welt
Der zweite Teppich, auf den ich Sie einlade, hat mit gemeinsamem Gestalten zu tun. Als Teenager habe ich einmal selbst zusammen mit meiner Mutter und meiner Schwester einen Shirazteppich aus Smyrnawolle geknüpft. Er war viel simpler und kleiner als der feine Perserteppich, aber doch groß und kompliziert genug, dass wir zu dritt monatelang daran saßen. Es war eine Arbeit, die Ausdauer, Konzentration und Übung verlangte. Mit dem Knüpfhaken mussten wir die vorgeschnittenen Wollfäden in immer gleicher Länge in die feste weiße Stramingrundlage ziehen. Für den ständigen Farbwechsel orientierte man sich an einem Extrablatt mit aufgedrucktem Zählmuster. Es entstanden Knoten für Knoten nested structures, komplexe Muster, die ineinander verschachtelt waren. Reihe um Reihe verwandelte sich so der steife Stramin in einen weichen Teppich.
Die Philosophin Hannah Arendt sprach einmal von unserem vorgegebenen »Lebensgeflecht«. Jeder neue Erdenbürger knüpft seine Fäden »in ein bereits vorgewebtes Muster«. Damit verändert sich das gesamte Gewebe. Gleichzeitig beeinflussen unsere Fäden auch alle anderen »Lebensfäden, mit denen sie innerhalb des Gewebes in Berührung kommen, auf einmalige Weise.«4 Wir sind anknüpfende Wesen, die gemeinsam am Teppich unserer Welt weben. Wir wollen dabei begreifen, was ihn und uns ausmacht: familiäre Herkunft, persönliche Vorlieben, Beziehungen, geteilte Werte, Regeln und Traditionen. Unser individuelles Gedächtnis korrespondiert immer mit unserem kulturellen Gruppengedächtnis. Es taucht in unseren Kindheitserinnerungen auf in Gestalt von Geschichten, Liedern, Bräuchen, Sprichwörtern, heiligen Texten, Orten, Landschaften, Festen, Essen, Tänzen, Filmen, Alltagsgegenständen, Technik, Konsum, Kunst usw. In den Worten des Sufimystikers Dschelaleddin Rumi (1207–1273): »Jeder Augenblick und jeder Ort sagt: webe dieses Muster in deinen Teppich ein.«5 Je dichter und bunter unser intersubjektiver Lebensteppich wird, desto höher und weiter fliegt er. Desto größer wird auch die Welt, die wir überschauen, in die wir uns hineinwagen und mit der wir uns verbunden fühlen können. Dieser zweite Teppich brachte mich dazu, nach allgemeinen Bezügen zu suchen, an die meine Kindheitsmomente anknüpfen. Damit Sie für sich selbst mitsuchen können, finden sich in jedem Kapitel auch Fragen oder Vorschläge für Sie als Leserinnen und Leser.
Der Faden für den Weg des Geistes
Es gibt eine Tradition unter den Frauen der Navajo Indianer. Sie weben in jeden ihrer Teppiche einen speziellen Faden hinein, den sie »den Faden für den Weg des Geistes« nennen. Mein dritter Teppich ist darum immateriell. Er setzt sich aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, theologischem Wissen und mystischen Einsichten zusammen, in denen mir »Geist in Aktion« begegnet ist. Typisch für ihn ist, dass er uns hilft, uns immer wieder selbst zu überschreiten und neue Deutungen zu bilden. So blicke ich heute durch andere Augen auf meinen fliegenden Teppich des Geistes als das kleine Mädchen, das vor über 60 Jahren anfing, ihn zu erkunden. Mein Empfinden, meine Sprachmöglichkeiten, mein Wissen, meine Wertmaßstäbe und Glaubensvorstellungen haben sich im Lauf der Zeit gewandelt und mit ihnen mein Ich. Trotzdem gibt es dahinter eine personale Kontinuität im Selbst, das meinen fliegenden Teppich steuert und auf geheimnisvolle Weise den roten Erzählfaden in der Hand hält. Es ist größer als mein Ichbewusstsein, in dessen Gedächtnisraum eben bestimmte Erinnerungen erhalten blieben. Hunderttausend andere dagegen nicht. Wieder andere Erinnerungen, die ich ausgrub, blieben als lose Fäden hängen und bildeten keine für mich erkennbaren sinnhaften Verknüpfungen.
Wer hat für das eine und das andere gesorgt? Ich denke, dass diese Auswahl der universale Geist getroffen hat, auf dessen fliegendem Teppich unser Bewusstsein seine Lebensreise erleben darf.Dieser alles umfassende Geist ist ein unendlicher, lebendiger Prozess. Er trägt meinen fliegenden Teppich, so wie er den Ihren trägt. Und während er uns immer mehr an Höhe, Weite und Breite offenbart, erforscht er dabei selbst seine eigene mystische Tiefe in uns. Goethe hat einmal gesagt: »Die höchste Wirkung des Geistes ist, den Geist hervorzurufen.« Viele Jahrhunderte vor ihm hat Paulus davon gesprochen, dass »der Geist alle Dinge erforscht, auch die Tiefen der Gottheit«. Diesen Geist haben wir von Gott empfangen, »damit wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist« (1 Kor 2,10–14). Sich begreifen zu können als einzigartige Ausdrucksmöglichkeit des Geistes und zugleich als einen von unzähligen kunstvollen Knoten in dem einen herrlich buntgewebten Teppich dieser Welt, daraus kann man Halt, Demut und Freude schöpfen. Darum schildere ich in jedem Kapitel auch Momente aus meinem Erwachsenenleben, in denen ich offener für den allumfassenden Geist war als sonst.
König Salomos fliegender Teppich
Vielleicht kennen Sie die glanzvolle und zugleich mahnende Geschichte aus Tausend und eine Nacht über König Salomos fliegenden Teppich. Gott selbst hatte ihm den riesigen Teppich geschenkt. In seine grüne Seide waren Goldfäden gewirkt, die Engel darstellten. Salomo bestieg den Teppich mit den Fürsten der Menschen, der Geister, der Tiere und der Vögel samt deren unzähligem Gefolge. Auch sein gesamtes Heer fand darauf Platz. So war er mit Himmel und Erde, Geist und Materie, Schönheit und Kraft, der sichtbaren und unsichtbaren Welt verbunden. Dann gebot Gott dem Wind, den König auf diesem Teppich durch alle Himmel zu tragen, ganz gleich, wohin dieser reisen wolle. Eines Tages aber packte Salomo der Stolz über seine eigene Größe. Er sah den Zusammenhang von allem nicht mehr, nur noch sich selbst. Da schüttelte der Wind heftig den fliegenden Teppich und alles fiel zu Boden.6
Eine so große Allverbundenheit zu erleben ist ein buchstäblich erhebendes Geschenk Gottes. Aber selbst Salomo, der Prototyp eines Weisen, erliegt der Hybris und stürzt ab. Er verlor den Sinn für Allverbundenheit, die alles trägt. Das warf ihn zu Boden. So warnt diese orientalische Legende eindrücklich vor Ego-Inflation, der man im Handumdrehen erliegen kann. Auf einen spirituellen Höhenflug kann schlagartig ein Verlust der Gottesnähe folgen. Ich kenne das. Trotzdem wollte ich nicht ein Buch über seelische Krisen und die dreifache dunkle Nacht der Sinne, der Seele und des Selbst schreiben. Hier möchte ich in kleinen Erlebnissen davon erzählen, wie persönliche spirituelle Erfahrungen einer Christin von heute aussehen können. Nicht alles kann man in Worte fassen. Aber einige Imaginationen habe ich aufgenommen, die aus dem seelischen Bereich kommen, der an das Nichtsagbare grenzt. Hier erzählt die Seele in Bildern, was der Geist der Tiefe ihr bild- und wortlos nahebrachte. Was hier im Buch zusammengedrängt erscheint, erstreckt sich über einen Zeitraum von mehr als sechzig Jahren, und ich kann Ihnen versichern, dass ich mich als normale Zeitgenossin mit viel Bodenhaftung betrachte. Was mir Mut gemacht hat, so offen über meine inneren Erfahrungen zu schreiben, sind die vielen mystischen Zeugnisse aus verschiedenen religiösen Traditionen, die ich studiert und meditiert habe. Sie haben meinen Geist mehr beflügelt als manche abstrakte dogmatische Aussage. Sie haben mir auch geholfen, die Tiefe biblischer und theologischer Texte neu zu erspüren.
Während ich an diesem Buch schrieb, hatte ich immer wieder Psalm 104,2 vor Augen: »Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich.« Irgendwann verstand ich: Das ist keine simple poetische Metapher. Es ist ein wunderbares mystisches Bild für das Reich Gottes, das wir heute neu verstehen lernen. Zum einen ist der »wie ein Teppich ausgebreitete Himmel« ein innerer Bewusstseinszustand, der völlig frei von allen Gedanken und Anhaftungen ist. Hier herrscht himmlische Klarheit in Seele und Geist. Zum anderen stellt das Psalmwort unsere Wahrnehmung auf den Kopf und unsere Füße auf himmlisch-kosmischen Grund. Es gibt kein größeres Gewebe als unser Universum! Mein fliegender Teppich des Geistes ist genau wie Ihr Teppich, liebe Leserinnen und Leser, von Anfang an im realen Kosmos unterwegs, unser aller Heimat. Durch sie reisend machen wir spirituelle Erfahrungen, die es wert sind, erinnert, geteilt und bewahrt zu werden. Dieses Buch möchte Sie dazu inspirieren. Halten wir also Ausschau nach den Augenblicken, Begegnungen und den Orten in unserer spirituellen Biografie, die uns sagten: »Webe dieses Muster in deinen Teppich ein!«
Die Postkarte vom Christkind
oder Vorauseilender Segen für alle
Denn ihr seid unser Brief, in unser Herz geschrieben,
erkannt und gelesen von allen Menschen!
Es ist ja offenbar geworden,
dass ihr ein Brief Christi seid …
geschrieben nicht mit Tinte,
sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes.
Paulus von Tarsus in 2 Kor 3,2
Mach, dass er seine Kindheit wieder weiß,
das Unbewusste und das Wunderbare,
und seiner ahnungsvollen Anfangsjahre
unendlich dunkelreichen Segen.
Rainer Maria Rilke (1875–1926), Dichter
Als ich 26 Jahre alt war, bekam ich mitten im August Post vom Christkind. Meine Mutter war drei Wochen zuvor mit nur 58 Jahren an Brustkrebs gestorben. Da auch unser Vater schon seit neun Jahren tot war, hatten meine beiden jüngeren Geschwister und ich den Haushalt aufzulösen. Wir sortierten und teilten, verschenkten und verkauften und waren unentwegt eingehüllt in eine riesige Wolke aus Erinnerungen, die aus all den vertrauten Dingen in unserem Elternhaus hervorzuquellen schien. Sie waren genauso plötzlich verwaist wie wir selbst und spiegelten die Trauer in unseren Herzen gnadenlos wider. Je mehr wir anfassten und von seinem angestammten Platz entfernten, je leerer die Wohnung wurde, desto größer wurde die in den restlichen Dingen gespeicherte Nähe zu unseren Eltern. Selbst die Sachen, an denen keiner von uns wirklich hing und die wir einmütig loslassen wollten, umhüllte plötzlich Wehmut. Ich spürte den Wunsch, sie zu behalten und damit das Verschwinden unseres Zuhauses noch ein wenig hinauszuzögern. Diese unbeachteten Dinge schienen plötzlich geadelt durch ihr jahrzehntelanges Wohnrecht, das ihnen im Hause unserer Eltern gewährt worden war. Sie waren die stillen Zeugen unserer Kindheit und Jugend gewesen. Sie griffen nun, als sie verschwinden sollten, klagend nach unseren Herzen, die selber verwaist waren.
Wir drei waren gerade Anfang bis Mitte zwanzig und versuchten tapfer, endgültig erwachsen zu sein. Zugleich aber sahen wir, wohin wir auch blickten, in das Depot unserer eigenen Kindheit: Fröhliche und traurige, laute und leise, verspielte und ernste Momente waren hier gespeichert. Es gab auch Erinnerungsanker an die allererste Zeit unseres Erdendaseins, an die wir uns selbst gar nicht erinnern konnten. Kleine Dinge, die unsere Mutter für uns gehütet hatte. Der Beißring mit dem silbernen Glöckchen, ein gelbgestreifter Kissenbezug mit weißer Spitze für den Babykorb, ein winziges, mit Rosen besticktes Mützchen. Es ist nun fast 40 Jahre her, aber ich erinnere mich noch genau, wie ich an einem heißen Augusttag eine Schachtel öffnete, in der meine Mutter Babyfotos von mir aufgehoben hatte. Zwischen den Schwarzweiß-Aufnahmen lag auch die Geburtsanzeige und ein Packen typischer 50er-Jahre-Glückwunschkarten, die meine Eltern zur Geburt ihrer Ältesten erhalten hatten. Und darunter entdeckte ich zu meiner Überraschung die Postkarte vom Christkind. Sie hatte im Briefkasten meiner Kindheit gelegen und geduldig gewartet, bis ich sie nach 26 Jahren endlich in der Hand hielt.
Ein Christkind aus Brabant
Die Vorderseite zeigt eine Fotografie des Mechelner Christkinds. Es ist Jesus als kleiner Junge, der auf einem Sockel mit Schublädchen steht, in das Reliquien gelegt werden konnten. Ein lächelndes Christkind in der Pose des Salvator Mundi, des Retters der Welt. In der einen Hand hält es die goldene Weltkugel, die andere macht das Segenszeichen. Auf dem goldgelockten Kopf sitzt eine fast doppelt so hohe, reich verzierte Silberdrahtkrone mit Flitter. Bekleidet ist es mit einem blauen Mäntelchen aus Granatapfelsamt und weißem Pelzbesatz. Um den Hals trägt es eine viel zu große, bodenlange Gebetskette mit dicken Perlen aus Koralle, Perlmutt und Gold. Solch fein geschnitzte Christkindfiguren kamen um 1500 aus Mechelen in Brabant. Sie wurden unbekleidet von jungen Frauen erworben, die ins Kloster gingen. Das eigene Christkind fein auszustaffieren und voller Liebe und Mitgefühl zu pflegen war eine intensive Form frommer Andacht. Die Konzentration auf die Figur konnte in eine Christkind-Mystik münden, bei der die Erlöserfigur lebendig wurde und Visionen oder Auditionen auslöste. Das Mechelner Christkind wurde vierhundert Jahre lang im Zisterzienserinnenkloster und späteren evangelischen Damenstift in Rostock gehütet. Es kam dann ins Schweriner Museum und verschwand in den Nachkriegswirren 1946 für kurze Zeit. Dann tauchte es im Kunsthandel wieder auf und fand Anfang der 1950er Jahre seinen Platz im Lübecker St.-Annen-Museum. Heute kann man es im Museum Schloss Güstrow bewundern.
Mechelner Christkind, Museum Schloss Güstrow
Der Text auf der Rückseite der Postkarte verriet mir, dass sie zu meiner Taufe am 19. August 1956 geschrieben worden war:
Die älteste Hausgenossin sendet der jüngsten
herzliche Glückwünsche zur feierlichen Taufe.
Das Christkind freut sich! Man sieht es ihm an!
Erna Suadicani
Suadicani, dieser klangvolle Name weckte versunkene Erinnerungen in mir an meine ersten sechs Lebensjahre. Aber ich bekam nur wenig zusammen: eine vage Gestalt im Treppenhaus, die Anrede »Fräulein«, was ich komisch fand für eine ältere Dame. Wer war die Schreiberin der einzigen Glückwunschkarte mit klarem Bezug auf meine Taufe gewesen? Ich wusste es nicht, aber die Postkarte vom Christkind, der freundliche Gruß an mich als frischgebackene kleine Christin rührte mich an. Ich legte sie zu den Fotos von meiner Taufe und bedauerte, dass ich nicht mehr über die Absenderin wusste. Erst jetzt, dank Internetrecherche, fand ich heraus, dass Erna Suadicani (1887–1977) aus einer großbürgerlichen Schleswiger Familie stammte. Ihr Vater war Geheimrat gewesen, ein Vorfahr Leibarzt des dänischen Königs. Sie war Kunsthistorikerin und am Lübecker St.-Annen-Museum als Assistentin des Direktors tätig. 1933 wurde sie wie ihr Chef von den Nazis degradiert und musste als Hilfskraft in der Stadtbibliothek arbeiten. Im März 1942 erlebte sie den verheerenden Bombenangriff auf Lübeck mit und dokumentierte als Erste in einem ausführlichen Bericht die Zerstörung der Stadt und ihrer Kunstschätze. 1946 kehrte sie in den Museumsdienst zurück. Sie hat das Mechelner Christkind also bei seiner Ankunft im St.-Annen-Museum begrüßt. 1953 ging sie in den Ruhestand und zog nach Würzburg, wo ihre Schwester wohnte.7 So war sie unsere Nachbarin geworden, bis wir 1962 in einen anderen Stadtteil zogen und ich sie nie wiedersah.
Dualismen überall
Die Postkarte aber blieb. Das Foto eines vierhundert Jahre alten Artefakts verband mich, das ahnungslose neugeborene Baby in Würzburg, mit der Welt: mit der Freude meiner Eltern über das erste Kind nach siebenjähriger Ehe – und ihrer Trauer um ein zuvor verlorenes Ungeborenes. Mit den Gebeten der katholischen Nonnen und der evangelischen Stiftsdamen in Rostock. Mit der – wie Würzburg – aus Trümmern wiedererstandenen Hansestadt Lübeck, in der das Mechelner Christkind nach dem Krieg seine neue Heimat gefunden hatte. Mit der Diktatur der Nazizeit, die 1933 Erna Suadicani aus dem Museum vertrieb und mir als Deutsche die Pflicht hinterließ, diese böse Unrechtszeit niemals zu vergessen. Die Postkarte vom Christkind wartete auf mich, während ich wie alle Kinder hineinwuchs in eine dualistische Welt voller Gegensätze, die mir nach und nach bewusst wurden: Liebe und Leid, Kunst und Barbarei, Krieg und Frieden, Heimat und Exil, Bewusstes und Unbewusstes, Glaube und Ideologie, Schönheit und Schrecken, Zärtlichkeit und Gewalt, Kindheit und Alter, Zerstörung und Neubeginn, Leben und Tod.
Und natürlich auch der konfessionelle Dualismus katholisch – evangelisch. Bevor ich in die Schule kam, spielte er für mich keine Rolle. In der Familie meines Vaters heiratete man seit 1873 gemischt konfessionell. Meine Eltern waren es auf entspannte Weise und mein Vater sagte manchmal: »Bei uns zu Hause herrscht Religionsfrieden, da schlafen katholisch und evangelisch in einem Bett.« Konsequenterweise schickten mich meine Eltern in die erste katholisch-evangelische Gemeinschaftsklasse Würzburgs. Ich saß glücklich neben Lotte, einem katholischen Mädchen, sie war meine erste Schulfreundin. Bis nach etwa drei Wochen der Religionsunterricht begann und in getrennten Räumen unterrichtet werden musste. Lotte und ich waren längst ein Herz und eine Seele. Wir verstanden nicht, dass wir auseinandergerissen werden sollten, hielten uns an den Händen und weinten. Natürlich half das nichts. Sie trennten uns, um uns dann separat Geschichten von Gott zu erzählen, der alle versöhnt und vereint.
Das große dualistische Weltendrama besteht aus Abermillionen solcher Risse, die unsere Seele zu spalten drohen, je mehr wir davon ertragen müssen. Ich denke, dass in den früheren Jahrhunderten die klösterliche Christkind-Mystik auch eine intuitive Schutzimpfung in Fürsorge und Beziehung war, um dieses Trennungsgefühl aushalten zu können. Die Mystikerinnen haben mit ihren Christkindfiguren ja auch ihre eigenen Kinderseelen wie eine liebe Mutter versorgt. Aus meinen Seminaren weiß ich, wie heilsam das heute noch für uns ist. Wenn Sie möchten, können Sie das auch für sich praktizieren:
Die Kinderseele wiegen
Visualisieren Sie sich als Baby oder Kleinkind, angewiesen auf Schutz, Wärme, Nahrung, Nähe und liebevolle Fürsorge. Öffnen Sie dann Ihr erwachsenes Herz und schauen Sie liebevoll auf das Menschenkind, das Sie einmal waren. Lassen Sie all Ihre Liebe zu ihm hin fließen. Stellen Sie sich genau vor, wie Sie es behutsam in den Arm nehmen. Halten Sie es beruhigend an Ihr Herz, damit es Ihren Herzschlag hören und Ihre Wärme spüren kann. Wiegen Sie es sanft und beruhigend hin und her. Sprechen Sie in leisen Worten mit ihm, geben Sie ihm Kosenamen, während Sie ihm in die Augen schauen. Und dann segnen Sie es. Sprechen Sie ihm das höchste Maß an Würde zu, in der nobelsten Weise, zu der Sie fähig sind. Schenken Sie ihm Ihre uneingeschränkte Liebe und Verbundenheit. Visualisieren Sie zum Abschluss noch einmal eine leuchtende Hülle aus Liebe, Freude und Licht um das Kind, das Sie einst waren.
Der Staffellauf der Segnenden
Vielleicht wollen Sie sich danach selbst noch eine Christkindkarte mit Ihren eigenen liebevollen Gedanken und Segenswünschen schenken. Vielleicht möchten Sie aber auch in Gedanken einen anderen Menschen ans Herz nehmen und seine von Dualismen geplagte Seele wiegen und segnen? Sie praktizieren damit ein verborgenes Gebet des Mitgefühls, ein Segen, der sich in der Stille entfaltet. Segnen ist ja kein priesterliches Privileg, sondern Vorrecht der Eltern und der Älteren, die die Kinder und Jüngeren segnen. So wie Simeon und Hanna das neugeborene Jesuskind segneten (Lk 2,22–40). Segnen sollten wir uns darum als eine Art heiliger Staffellauf von Generation zu Generation vorstellen. Für mich ist das tatsächlich die spirituelle Chance unserer immer älter werdenden Gesellschaft: Sie könnte sich in ein Segensbiotop verwandeln, bei dem gerade die Ältesten sich darum kümmern, den großen Segen nicht abreißen zu lassen und die Segenskette lebendig zu halten.
Ich habe einmal zusammen mit einem katholischen Theologen ein Paarseminar geleitet für Ehepaare, die gerade eine konflikthafte Phase ihrer Partnerschaft zu meistern hatten. Für ihre Kinder gab es parallel dazu eine eigenes Kinderprogramm. Die Paare überwanden nach und nach ihre Sprachlosigkeit und stellten sich tapfer ihren Problemen. Am Ende der sehr intensiven Woche gab es einen gemeinsamen Gottesdienst für Eltern und Kinder. Höhepunkt war ein Segensritual mit duftendem Rosenöl, das in drei kleinen Kreuzzeichen auf die Stirn und in die offenen Hände gezeichnet wurde. Die Paare segneten erst sich gegenseitig und dann ihre Kinder. Es begann immer der Vater mit den Worten »Ich segne dich und du sollst ein Segen sein« (1 Mose / Genesis 12,2b). Ein Ehepaar hatte einen zwölfjährigen Sohn dabei, der an Trisomie 21 litt. In unserer großen Runde hatte er sich gleich den Platz neben mir gesichert. Als seine Eltern in der Mitte des Raumes standen und sich gegenseitig den Segen zusprachen, sprang er wie elektrisiert auf. Er hielt eine Hand wie eine Filmkamera vors Auge und drehte mit der anderen wie an einer Kurbel. Als ich ihn fragte, was er da mache, rief er begeistert: »Ich filme die Liebe!« Nicht nur seinen Eltern, sondern auch vielen anderen in der Runde kamen da die Tränen. Andere zu segnen ist der kürzeste Weg, um zur Liebe und Güte zurückkehren zu können. Es heilt unsere gespaltene Sicht auf die Welt, auf andere und auf uns selbst. Es macht uns die Interdependenz, die heilige Kommunion aller Wesen und Dinge bewusst.
Wechselseitige Korrespondenzen
Als Kindergartenkind besaß ich ein Bilderbuch, in dem liebe Engelchen vor Weihnachten zu verschneiten Kinderzimmerfenstern flogen, um dort die Post ans Christkind abzuholen. Meine Kinder liebten es auch, auf diese Weise ihre Briefe ans Christkind zu schicken, solange sie noch klein waren. Aber warum nur im Advent? Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700–1760), später eine Leitfigur des protestantischen Pietismus in Herrnhut, schrieb als kleiner Junge das ganze Jahr über Briefe an »den lieben Heiland«. Dann warf er sie zum Fenster hinaus im festen Vertrauen, dass Gott sie ganz bestimmt finden würde. Und warum sollten nicht auch wir Erwachsene an den erwachsenen Christus schreiben? Eine intime Korrespondenz mit ihm pflegen, uns ihm anvertrauen? Der Philosoph Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799), ein aufgeklärt-kritischer Kopf, schrieb noch als Erwachsener Briefchen mit Fragen an Gott. Er deponierte sie unter dem Dachstuhl mit dem Vermerk: »Lieber Gott, etwas auf Zettelchen!« Ich selbst habe immer wieder erlebt, wie mir ein Schreibdialog mit Christus half, Klarheit zu gewinnen. Oder ihm wenigstens meinen Kummer anzuvertrauen. Viele meiner »Briefchen« an Christus sind Tagebucheinträge. Bei einer Kreuzausstellung in Freising wurde einmal ein gotisches Astkreuz aus dem 14. Jahrhundert gezeigt, das aus einem Dominikanerinnenkloster stammte. Die Schwestern hatten ihre Bitten und Gebete auf kleine Zettelchen geschrieben und diese in die offene Seitenwunde des Gekreuzigten gesteckt. Erst viele hundert Jahre später entdeckte man beim Restaurieren des Kreuzes im Brustkorb des Gekreuzigten diese ganz persönlichen Briefchen, die Christus buchstäblich ans Herz gelegt worden waren.
Die spirituelle Post funktioniert aber immer in beiden Richtungen. Die große, eine Wirklichkeit Gottes, diese Werde- und Wunderkammer des Geistes, in der die Bewusstseinsprozesse aller Zeiten enthalten sind, verschickt auch ständig »Postkarten«, »Zettelchen« und »Briefe« an uns. Vom Augenblick unserer Geburt an bis zu unserem letzten Atemzug kann uns ein Ding, Tier oder Mensch begegnen, der als Brief Gottes eine Botschaft zu uns bringt. Wer könnte das besser wissen als wir Christen: Unsere ältesten neutestamentlichen Texte sind die Briefe des Paulus. Der erste Briefeschreiber der Christenheit nannte die Schwestern und Brüder in Korinth »Briefe Christi«, die ihm der »Geist des lebendigen Gottes ins Herz geschrieben« hatte. Paulus wollte, dass eine Gemeinschaft spirituell so lebendig ist, dass sie als Empfehlungsschreiben Gottes »von allen Menschen erkannt und gelesen« werden kann (2 Kor 3,2). Ein Brief der Freude – wie meine Postkarte vom Christkind, mit der Erna Suadicani die Freude und den vorauseilenden Segen Christi zum Ausdruck brachte.
Interbeing als unsere Bestimmung
Ich weiß nicht, ob Erna Suadicani von dem Bibelwort wusste, das ich als Taufspruch bekommen habe. Es ist Psalm 33,21: »Denn unser Herz freut sich seiner, und wir trauen auf seinen heiligen Namen.« Manchmal habe ich mich an dem Plural gestört, ich gehöre ja zu einer sehr individualistisch geprägten Generation. Warum heißt es nicht: »Mein Herz freut sich und ich traue auf seinen heiligen Namen?« Nun bin ich bald so alt wie Erna Suadicani damals und ich lerne dank zunehmender Lebenserfahrung dieses Wort aus dem Alten Testament und ihre Postkarte vom Christkind als einegemeinsameBotschaft zu lesen. Denn das erzählen mir beide heute:
Wir starten nicht als isolierte Individuen an einem Nullpunkt. Das Leben beginnt nicht mit mir und hört nicht mit mir auf, wie es der Modeschöpfer Karl Lagerfeld einmal über sich selbst sagte. Wir werden in eine Welt hineingeboren, deren Gewebe aus zahllosen Knotenpunkten besteht. Dieses Netzwerk aus unendlich vielen Hologrammen prägt die Kommunität des ganzen Universums. Alles ist mit allem verknüpft. Alles ist in etwas enthalten. Alles ist auf etwas bezogen. Wir werden uns nie außerhalb dieses geheimnisvollen Allumfassenden befinden. Wir sind von Anfang an davon durchtränkt, eingebunden in komplexe ökologische, historische, kulturelle, spirituelle und soziale Relationen in unfassbarem Umfang. Quer durch die Jahrhunderte, über Kontinente hinweg. Wissen wir, wer gerade an uns denkt oder uns googelt? In wessen Träumen oder Erinnerungen wir vorkommen? Wer einmal nach uns fragen wird wie ich nach Jahrzehnten nach Erna Suadicani? Wer sich mit uns verbunden fühlt oder für uns betet?
Unsere Vorstellung von Getrenntsein ist eine Täuschung. So groß die Dualismen auch sein mögen, wir sind immer verbunden. Wenn uns das bewusst wird, erkennen wir uns als ein Ganzes oder Holon, das selbst aus zahlreichen Subholons (Organen, Zellen, Atomen) besteht und wiederum Teil unzähliger umfassender Holons (Familie, Gesellschaft, Menschheit, Lebewesen) ist. Alles aber ist in einem größten Ganzen, einem kosmischen Superholon enthalten, dessen Dimensionen wir gar nicht begreifen können. In wunderbar einfachen Worten hat das der Mystiker Nikolaus von Kues (1401–1464) ausgedrückt: »In Gott ist alles eingefaltet, was ist. Gott ist die Entfaltung von allem. Er ist so in allen Dingen, dass alle Dinge in ihm sind.«
Und so landen wir als kleine Erdlinge mit unserem Bewusstseins-Starterkit irgendwo auf diesem Stern, ohne zu wissen, dass wir all das in uns tragen – in Form unserer kosmischen, genetischen und soziokulturellen DNA. Das lächelnde Christkind mit der Weltkugel und seiner Riesenkrone, Symbole für Ganzheit und ein erwachtes, heiliges Bewusstsein, fügt noch das Wissen um unsere spirituelle DNA hinzu. Es ist eine codierte Verheißung: In deinem Selbst will sich künftig das ganze beziehungsreiche Universum als eines spiegeln. Vertraue dem Geist, der uns alle von allen Seiten umgibt. Und der dich zur rechten Zeit am rechten Ort in seine Allverbundenheit hineinziehen und dir deinen Weg zeigen wird.
Botschaft in der Silvesternacht
Ich habe das selbst erlebt. Ein halbes Jahr vor meinem Abitur war ich unsicher, ob ich neben Germanistik auch evangelische Theologie studieren sollte. Es bedeutete, dass ich von zuhause wegziehen musste, weil man dieses Fach in Würzburg nicht studieren konnte. Mein Vater war erst seit gut einem Jahr tot und ich wusste, wie schwer es für meine Mutter werden würde, mich nicht mehr in der Nähe zu haben. Es lastete mir auf der Seele und blockierte mich. Einerseits wollte ich meine Mutter nicht im Stich lassen, andererseits war der innere Wunsch groß. Zur Jahreswende 1974 /75 fuhr ich mit meiner Freundin Vera zu einer Freizeit für junge Christen nach Schloss Craheim im Landkreis Schweinfurt. Dort hatte 1968 der evangelische Pfarrer Arnold Bittlinger zusammen mit einem franziskanischen Priester und einem methodistischen Pfarrer das ökumenische Lebenszentrum für die Einheit der Christen