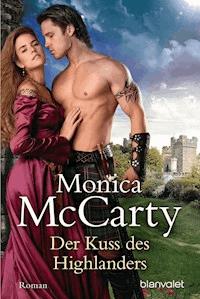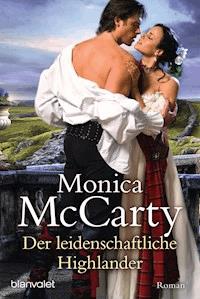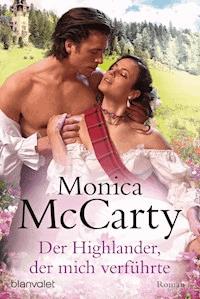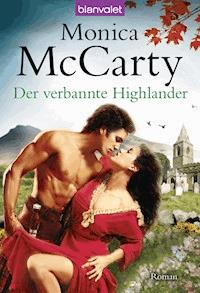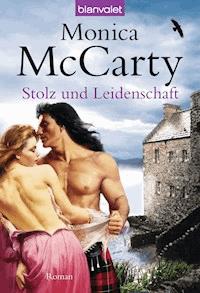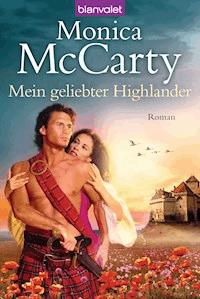
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Erotik
- Serie: Highland Guard-Reihe
- Sprache: Deutsch
Leidenschaftlich, ungezähmt, sinnlich
Der gefürchtete Highlander Tor MacLeod ist fest entschlossen, sich nicht in den Krieg gegen England verwickeln zu lassen. Niemand kann ihn dazu überreden – auch nicht die eigenwillige Christina Fraser, seine allzu verführerische Braut. Als Christina waghalsig versucht, seine Liebe zu gewinnen, gerät die schöne junge Frau zwischen die kriegerischen Fronten. Plötzlich steht Tor der gefährlichste Kampf seines Lebens bevor: Er muss Christina retten und ihr sein Herz öffnen – bevor es zu spät ist …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 625
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Buch
Der gefürchtete Highlander Tor MacLeod ist fest entschlossen, sich nicht in den Krieg gegen England verwickeln zu lassen. Niemand kann ihn dazu überreden – auch nicht die störrische Christina Fraser, seine allzu verführerische Braut. Doch diese hat ihren eigenen Kopf und ist sich sicher, dass hinter der harten Schale ihres Angetrauten mehr steckt, denn sie spürt Nacht für Nacht, zu welchen Gefühlen und welcher Leidenschaft der sonst so unnahbare Mann fähig ist. Und so versucht Christina waghalsig, endlich seine Liebe zu gewinnen. Dabei gerät die schöne junge Frau jedoch zwischen die kriegerischen Fronten. Plötzlich steht Tor der gefährlichste Kampf seines Lebens bevor: Er muss Christina retten und ihr sein Herz öffnen – bevor es zu spät ist …
Autorin
Monica McCarty studierte Jura an der Stanford Law School. Während dieser Zeit entstand ihre Leidenschaft für die Highlands und deren Clans. Sie arbeitete dennoch mehrere Jahre als Anwältin, bevor sie dieser Leidenschaft nachgab und zu schreiben anfing. Heute lebt sie mit ihrem Mann und ihren Kindern in Minnesota.
Von Monica McCarty bei Blanvalet lieferbar:
Mein ungezähmter Highlander (37035) · Der geheimnisvolle Highlander (37061) · Highlander meiner Sehnsucht (37062)
Mit Stolz und Leidenschaft (37403) · Der verbannte Highlander (37540) · Schottisches Feuer (37608)
Monica McCarty
Mein geliebter Highlander
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Anke Koerten
VORWORT
Im Jahre des Herrn 1305.
Nach neunjährigem blutigem Krieg ist Schottland nun fest in englischer Hand. Edward Plantagenet, der mächtigste und unerbittlichste Herrscher der Christenheit, hat den Thron inne, und William Wallace, Schottlands großer Freiheitskämpfer, schmachtet in einem englischen Kerker. Alles scheint verloren, da der große ›Schottenhammer‹ die Stimmen der Rebellion zum Schweigen brachte.
In ihrer dunkelsten Stunde wird die Fackel von Schottlands Freiheit dennoch von Neuem entzündet. Gegen nahezu unüberwindliche Übermacht erhebt Robert Bruce, Earl of Carrick und Lord of Annandale, Anspruch auf den Thron.
Er ist in seinem Kampf nicht allein.
Verloren in den Nebeln der Vergangenheit und fast vergessen lebt die Legende einer geheimen, auserlesenen Schar von Kämpfern fort, von Bruce persönlich aus den entlegensten Winkeln der Highlands und Western Isles zusammengerufen und auserwählt, um die tödlichste Kampftruppe zu bilden, die es bis dahin gegeben hatte.
Zu einer Zeit, da zwischen Leben und Tod nur der Hauch eines Schattens steht, ist das Ziel von Bruces Highland–Truppe nichts weniger als die Befreiung vom englischen Joch.
Um die Männer, die dem Ruf der Freiheit folgten und mithalfen, eine Nation zu schmieden, ranken sich viele Legenden.
PROLOG
Und nie, von heute bis zum Schluss der Welt,Werden Vergessene wir sein,Wir wen’gen, wir beglücktes Häuflein Brüder;Denn welcher heut’ sein Blut mit mir vergießt,Der wird mein Bruder.
William Shakespeare, König Heinrich V., 4. Akt, 3. Szene
Lochmaben Castle,Dumfries und Galloway, Schottland28. August 1305
William Wallace ist tot.«
Kurzfristig verschlug es Robert Bruce, Earl of Carrick, Lord of Annandale und einstigem Verweser Schottlands, die Sprache. War der Tod für Wallace seit seiner Gefangennahme vor wenigen Wochen auch unabwendbar, stellte die Nachricht in ihrer Endgültigkeit doch einen schweren Schlag dar. Die Hoffnung, die der tapfere Wallace in seinem Herzen – und im Herzen aller Schotten, die unter dem Joch englischer Tyrannei stöhnten – entflammt hatte, drohte zu erlöschen.
Schottlands großer Kämpfer war tot. Die Fackel würde nun an ihn übergehen – wenn er gewillt war, sie weiterzutragen. Eine schwere und, wie Wallaces Tod bewiesen hatte, tödliche Bürde. Er hatte alles zu verlieren.
Bruce zügelte seine abschweifenden Gedanken und nahm die Botschaft des Prälaten mit grimmigem Nicken zur Kenntnis. Er bedeutete seinem Freund auf der Holzbank Platz zu nehmen und sich am Feuer zu wärmen. William Lamberton, Bischof von St. Andrews, war bis auf die Haut durchnässt und einem Zusammenbruch nahe, als wäre er persönlich Tag und Nacht von London hergeritten, um die Nachricht zu überbringen.
Bruce goss dunkelroten Wein aus einer Karaffe auf dem kleinen Tisch in einen Becher und setzte sich neben den Bischof.
»Hier, trinkt das. Ihr seht aus, als hättet Ihr es nötig.«
Beide hatten es nötig.
Lamberton nahm mit einem gemurmelten Dank an und trank einen tiefen Schluck. Bruce tat es ihm gleich, doch schmeckte ihm die fruchtige Note des Weins dieses Mal sauer.
Er wappnete sich für den Rest der Botschaft und fragte in gedämpftem Ton:
»Wie?«
Lambertons Blick huschte hin und her. Mit seinem runden Knabengesicht und der erfrorenen roten Nase sah er aus wie ein Gefahr witternder Hase. Ein rundlicher obendrein. Bruce aber ließ sich von der harmlosen äußeren Erscheinung des geistlichen Würdenträgers nicht täuschen. Hinter der unscheinbaren Fassade lauerte ein wacher Verstand, gewitzt und ebenso gerissen wie jener König Edwards.
»Ist man hier sicher?«, fragte der Bischof.
Bruce nickte.
»Ja.« Lamberton tat gut daran, auf der Hut zu sein. Sie waren in seinem Privatgemach sicher, doch war Lochmaben Castle nun Edwards Besitz, und Bruce stand unter Beobachtung. Der König von England nannte ihn seinen Freund, traute ihm aber nicht. Edward war ein Tyrann, freilich ein sehr kluger.
»Niemand kann uns hören«, beruhigte er den Bischof.
»Ich habe mich vergewissert. Sprecht also.«
Lambertons dunkle Augen begegneten seinem Blick, und die Starre, die sich darin spiegelte, kündete von dem Grauen, von dem er nun berichten sollte.
»Er hat den Verrätertod erlitten.«
Bruce zuckte zusammen. Also hatte Wallace leiden müssen. Er nahm es zähneknirschend zur Kenntnis und bedeutete dem anderen mit einem Kopfnicken fortzufahren.
»Man hat ihn hinter einem Pferd drei Meilen durch die Straßen Londons bis nach Smithfield Elms geschleift. Er wurde gehängt, ausgeweidet und gevierteilt, nachdem er entmannt worden war und man seine Eingeweide vor seinen Augen verbrannt hatte. Sein Kopf steckt auf einer Pike an der London Bridge.«
In Bruces Augen loderte der Zorn.
»Hochmut hat Edward den Verstand geraubt.«
Wieder blickte Lamberton verstohlen um sich, doch die einzige Bewegung war das Schattenspiel des Kerzenlichts auf den mit Wandteppichen behängten Steinwänden. Seine Furcht war nur allzu verständlich. Man konnte schon für harmlosere Äußerungen im Tower landen. Als jedoch keine Bewaffneten hereinstürmten, entspannte er sich.
»Ja. Edwards Rachedurst hat einen mächtigen Märtyrer geschaffen. Der Geist des Getöteten wird ihm viel mehr zu schaffen machen als der lebendige Wallace. Ein solch folgenschwerer Fehler sieht Edward nicht ähnlich.«
»Er ist ein Plantagenet.«
Lamberton nickte. Es genügte als Erklärung. Die königliche Familie war bekannt für ihre rasenden Wutanfälle. Bruce war mehr als einmal Ziel eines Zornausbruchs geworden. Bislang hatte er es geschafft zu überleben, doch er wusste, dass er beim nächsten Mal nicht mehr so viel Glück haben würde.
Lamberton, der seine Gedanken las, fragte:
»Ihr seid nicht anderen Sinnes geworden?«
Die Erwartung, die aus dem Blick seines Gastes sprach, legte sich mit lähmender Schwere auf Bruce. Mit einem Schlag sah er alles, was er zu verlieren hatte, vor sich: Ländereien, Titel, sein Leben. Dann dachte er an Wallaces unvorstellbare Qualen. Die Pein musste so grauenhaft gewesen sein, dass der Hieb des Henkerbeils als willkommene Erlösung kam. Schlug Bruce nun die Richtung ein, die Wallace gegangen war, drohte ihm ein ähnliches Schicksal.
Bruce schwankte nur einen einzigen Moment. Er war nur ein Mensch. Noch nicht König, wenngleich die Krone ihm gehörte. Dieses Wissen und der Glaube, der jede Faser seines Seins durchdrang, verliehen Robert Bruce jedoch wieder Mut und Entschlossenheit. Er und nicht Edward war der rechtmäßige König von Schottland. Sein Königreich verlangte nach ihm.
Er würde die Fackel der Freiheit von Wallace übernehmen, koste es, was es wolle.
»Nein, ich bin nicht anderen Sinnes geworden.« Die stählerne Entschlossenheit, die in seinen Worten mitschwang, ließ nichts von dem Augenblick des Zögerns ahnen.
Fünf Monate zuvor hatten Lamberton und er einen geheimen Pakt geschlossen – ein Bündnis gegen alle Rivalen, nicht nur gegen den mächtigsten Herrscher der Christenheit, Edward Plantagenet, gerichtet, sondern auch gegen alle anderen, die Ansprüche auf den schottischen Thron erhoben. Hatte man sich Edwards entledigt, war erst der halbe Kampf gewonnen; seine schottischen Landsleute unter einem Banner zu vereinen, würde ebenso schwierig sein. Innere Zwietracht und blutige Familienfehden hatten es Edward erst ermöglicht, in Schottland Fuß zu fassen.
Lamberton auf seiner Seite zu wissen, nährte die Hoffnung auf Erfolg. Trotz seiner Jugend – Lamberton war ein Jahr jünger als der einunddreißigjährige Bruce – war der Bischof von St. Andrews Oberhaupt der reichsten Diözese und einer der wichtigsten und angesehensten Männer Schottlands. Auch Edward schätzte ihn und hatte ihn jüngst zu einem der beiden Reichsverweser Schottlands ernannt.
»Gut.« Lamberton machte kein Hehl aus seiner Erleichterung.
»Wir müssen bereit sein.«
»Hat sich die Gesundheit des Königs verschlechtert?« Aus der Frage klang unverhohlene Hoffnung.
»Nein. Er ist wieder einmal vom Totenbett auferstanden. Ein Wunder, das zweifellos Wallaces Festnahme zuzuschreiben ist.«
Bruce seufzte. Seine Hoffnung darauf zu setzen, dass Edward ihm den Gefallen tat, im Krankenbett zu sterben, war wohl zu hoch gegriffen. Mit seinem Nachfolger, dem Prince of Wales, der weder die Klugheit noch den eisernen Willen seines Erzeugers besaß, hätte man leichteres Spiel gehabt.
»Worauf müssen wir uns jetzt gefasst machen?«
»Der Tod von Wallace wird die Flamme des Aufruhrs wieder entzünden«, sagte Lamberton.
»Wir müssen dafür sorgen, dass der Brand sich in die von uns gewünschte Richtung ausweitet.«
Hass, weit über jenen hinausreichend, den er für Edward empfand, loderte in Bruce auf.
»Sind Euch Gerüchte zu Ohren gekommen? Führt Comyn etwas im Schilde?« John »der Rote« Comyn, Lord of Badenoch, war sein größter Widersacher und erbittertster Rivale im Kampf um die Krone.
Lamberton zuckte mit den Schultern.
»Gehört habe ich nichts, doch wäre es klug vorauszuplanen.«
Bruce umfasste seinen Becher so fest, dass die Ränder des verzierten Zinngefäßes in seine Hand schnitten. Ja, das Losschlagen seines Feindes war keine Frage des Ob, sondern des Wann.
Sie sprachen noch eine Weile miteinander und erörterten, wer sich wohl auf Bruces Seite schlagen würde und wer nicht. Edwards Schreckensherrschaft der letzten Jahre hatte Erfolg gezeitigt. Es würde kein leichtes Unterfangen sein, die Schotten zu überreden, ihre Piken und Speere gegen die überlegenen englischen Streitkräfte mit ihren berittenen Kämpfern in voller Rüstung einzusetzen.
Bauern und Fischer gegen die Blüte der Ritterschaft. War es Wahnwitz, an eine Chance zu glauben? Wallace hatte es versucht, und jetzt konnte man sehen, was es ihm eingebracht hatte. Den Kopf aufgespießt, den Körper gevierteilt und in alle Gegenden Englands verschickt. Bruces Herz sank angesichts dieses Jammers – nicht nur, weil ein großer Mann sein Leben gelassen hatte, sondern weil seine Heimat sich in einer so verzweifelten Lage befand.
Aus den Fehlern, die Wallace begangen hatte, konnte man aber auch lernen. Wallace hatte bewiesen, dass man den Engländern mit unkonventionellen Kampfmethoden beikommen konnte. Mit Banditentaktik. Bruce schauderte. Der Gedanke behagte ihm nicht.
Er stand auf und ging vor dem Feuer auf und ab, bemüht, mit dem, was er vorbringen wollte, zu Rande zu kommen. Es verstieß gegen alles, woran er glaubte. Aber sie brauchten eine Möglichkeit, um ihre Chancen zu verbessern. Schließlich blieb er stehen und drehte sich zu seinem Freund um, der ihn von der Bank aus stumm beobachtete.
»Wir können nicht gewinnen«, sagte er, frustriert von dieser unbestreitbaren Tatsache.
»Nicht in offener Feldschlacht, Armee gegen Armee. Die englische Streitmacht ist größer, besser organisiert und viel besser ausgerüstet.«
Lamberton nickte zustimmend. Es war keine neue Erkenntnis.
»Wir müssen zu einer anderen Kampftaktik greifen«, fuhr Bruce fort.
»Keine offenen Schlachten oder langen Belagerungen, keine Reiterattacken. Wir müssen einen Weg finden, ihre Stärke gegen sie zu wenden.«
Der Bischof sah ihn aufmerksam an.
»Wir müssen unseren Krieg zu unseren Bedingungen führen.«
»Ihr sprecht von Piratentaktik?« Lamberton zog erstaunt eine Braue hoch.
»Das wäre nicht ritterlich.«
Lambertons Reaktion war verständlich. Bruce konnte selbst kaum glauben, dass er diesen Vorschlag machte. Als einer der kühnsten Ritter der Christenheit war er durchdrungen von ritterlichem Wesen. Wie ein Bandit oder Pirat zu kämpfen, lief allem zuwider, woran er glaubte: Regeln, Werte, Ehre.
»Kämpfen wir nach Ritterart, werden wir verlieren«, sagte Bruce entschlossen.
»Armee gegen Armee … da sind die Engländer übermächtig. Aber Wallace hat gezeigt, wie ein Sieg möglich sein könnte – indem man Piratentaktik zu Lande anwendet.«
»Wallace ist untergegangen«, wandte Lamberton ein.
»Aber wir werden etwas haben, das Wallace nicht hatte.« Bruce hielt inne und zog ein zusammengefaltetes Stück Pergament aus seiner Felltasche.
Lamberton nahm das Pergament und überflog die Liste, die etwa ein Dutzend Namen aufwies.
»Was ist das?«
»Meine geheime Armee.«
Lamberton zog eine Braue hoch, unsicher, ob Bruce es scherzhaft meinte.
»Eine Armee von einem Dutzend Männern?« Wieder überflog er die Liste.
»Und wie ich sehe nur ein einziger Ritter darunter?«
»Ritter habe ich schon. Was mir fehlt, sind Männer, die wissen, wie man als Pirat kämpft.«
»Highlander«, sagte Lamberton. Nun erschienen ihm einige der Namen auf der Liste in anderem Licht.
»Und welcher Ort wäre geeigneter, um einen Piraten zu finden, als die Western Isles mit ihren Wikinger-Nachfahren?«
»Genau. Die Anzahl der Männer spiegelt den Kampfstil wider – rasche, kühne Attacken kleiner Gruppen, die den Feind mit List und Überrumpelung in Angst und Schrecken versetzen.«
»Aber warum so geheim?«
»Angst kann eine mächtige Waffe sein, und Geheimhaltung wird die Angst im Herzen der Feinde noch steigern. Ist es Wirklichkeit oder nur ein Mythos? Wenn man nicht weiß, wen man sucht, lässt sich der Feind auch schwerer aufhalten.«
Lamberton tippte sich mit dem Finger ans Kinn, während er das Pergament studierte. Bruce wartete. Die Meinung des Bischofs besaß für ihn großen Wert – als Vorausblick auf andere Meinungen. Aber Bruce machte sich nichts vor. Seine Waffenbrüder zu überzeugen – seine ritterlichen Brüder – würde nicht leicht sein. Schließlich sagte Lamberton:
»Eine bestechende Idee, wie ich zugeben muss.«
Bruce, der spürte, dass Lamberton noch nicht ganz überzeugt war, setzte hinzu:
»Es geht um mehr. Was Ihr vor Euch seht, sind die Namen der größten Krieger Schottlands auf allen Gebieten der Kampftechnik – von Waffenführung über Seefahrt, Aufklärung, Auswertung bis zu Infiltration. Bedenkt doch: Was auch immer gebraucht wird, welch scheinbar aussichtsloser Mission man sich gegenübersieht … ich werde die allerbesten Männer zur Verfügung haben. Denkt daran, was diese Männer allein vermögen, und stellt sie Euch dann gemeinsam vor.«
Lambertons Augen leuchteten auf, und er lächelte, wobei seine pfiffig-durchtriebene Miene mit seinem jugendlichen Äußeren und der priesterlichen Kleidung im Widerstreit lag.
»Das ist geradezu visionär.« Aus seinem Blick sprach Bewunderung.
»Eine revolutionäre Idee für eine Revolution.«
»Genau.« Bruce lächelte, erfreut von der Reaktion seines Freundes. Ausgewählte, hervorragende Krieger, die ohne familiäre oder feudale Verbindungen in kleinen Gruppen kämpfen – dergleichen war noch nie gewagt worden. Auf der Liste standen zwar einige, die miteinander in Fehde lagen, doch wenn man es schaffte, sie zusammenzuschweißen, boten sich gewaltige Möglichkeiten.
»Leicht wird es nicht«, sagte Lamberton, der wusste, was Bruce dachte.
»Diese Männer zu einen, ist nahezu ein Ding der Unmöglichkeit.«
»So wie die Einigung Schottlands unter meinem Banner?«
Lamberton legte den Kopf schräg und überlegte. Keines der beiden Ziele war leicht zu erreichen, doch durfte man sich von Widrigkeiten nicht abhalten lassen.
»Und wer wird diese Geheimarmee befehligen?«
Bruce deutete mit dem Finger auf den obersten Namen.
»Wer sonst als der Mann, der als größter Krieger der Western Isles gepriesen wird: Tormod MacLeod. Niemand ist ihm im Schwertkampf überlegen. Wie Wallace ist er ein Mann von eindrucksvoller Statur, der ein beidhändiges Langschwert führt. Er soll einmal ein Dutzend Männer bezwungen haben, die ihn umzingelt hatten.«
Der Bischof zog einen Mundwinkel hoch.
»Übertreibung?«
»Zweifellos«, pflichtete Bruce ihm bei und erwiderte das schiefe Lächeln.
»Aber ein Mythos kann ebenso mächtig sein wie die Wahrheit. Die Barden singen bereits das Lob MacLeods und vergleichen ihn mit Finn MacCool. Wie der legendäre irische Held wird er nicht nur wegen seiner eigenen kämpferischen Qualitäten verehrt, sondern auch wegen jener seiner Mannen.«
Der Blick des Prälaten traf seinen. Es gab keinen größeren Helden unter den Gaelen als Finn MacCool, den Anführer der legendären, als Fianna bekannten Streitmacht. Ein großartiger Vergleich.
Bruce grinste, erfreut, dass sein Freund den Wert der Beziehung erkannt hatte.
»Ja, MacLeod hat ein Vermögen damit gemacht, Männer als Söldner in Irland auszubilden.«
»Er ist also käuflich?«
»Vielleicht.« Bruce zog stirnrunzelnd die Schultern hoch.
»Ihr kennt ja die Insel-Chiefs. Bestenfalls unberechenbar, schlimmstenfalls feindselig.« Erst seit einigen Jahrzehnten Untertanen der britischen Krone, hielten die eigenwilligen Insel-Chiefs sich noch immer für unabhängige Herrscher, für ›Seekönige‹, die über ein riesiges, abgeschiedenes Territorium geboten. Der Mangel an Lehnstreue wurmte Bruce, doch anders als seine Vorgänger wusste er, dass er auf die Highlander und die Isles angewiesen war, wenn er die Engländer bezwingen und eine Krone gewinnen wollte. Die westlichen Inseln waren nicht nur der Schlüssel zum Erfolg, sondern auch unverzichtbar für Handel und Nachschub. Bruce strich sich übers Kinn, an dem die dunklen Haare seines kurzen Bartes spitz zuliefen.
»Ich werde ihm ein Angebot machen müssen, das er nicht ausschlagen kann.«
Lamberton blieb skeptisch.
»Seid Ihr sicher, dass es klug ist, Mylord? Diese Clan-Chiefs beugen sich keinem Zwang.«
Bruce grinste.
»Ich habe nicht die Absicht, Zwang anzuwenden. Das wird nicht nötig sein, Geld, Land, eine schöne Frau – jeder Mann hat seinen Preis. Man muss nur herausfinden, was der seine ist.«
Lamberton nickte wenig überzeugt.
»Dann steht Euer Entschluss fest?«
Bruce hielt inne. War er fähig, die ritterlichen Ideale der Vergangenheit für eine neue Art der Kriegführung völlig aufzugeben und alles zu vergessen, was er seit seiner Knabenzeit gelernt hatte?
Für den Sieg konnte er es. Vor allem aber musste er bereit sein. Und er zweifelte nicht daran, dass er mit dieser Armee bestens gerüstet sein würde.
»Ja, er steht fest. Diese Männer zusammenzubringen, wird nicht leicht sein. Unternehmt daher alles in Eurer Macht Stehende, um es zu erreichen. Ich werde die Truppe vielleicht eher brauchen, als wir uns wünschen.«
Lamberton sah ihn an. Beide waren von dem langen Weg, der sich vor ihnen erstreckte, ernüchtert. Ein Weg, von Nebeln verhüllt, mit ungewissem Ende.
Ein Frösteln durchlief ihn.
»Die Wolken ballen sich zusammen, Mylord.«
»Ja«, erwiderte Bruce voller Ingrimm. Sie hatten den Punkt erreicht, an dem es kein Zurück gab. Eingedenk der Worte Cäsars, ehe er den Bürgerkrieg gegen Pompeius begann, sagte er:
»Alea jacta est.«
Lamberton wiederholte die Worte in ähnlich resigniertem Ton und übersetzte:
»Die Würfel sind gefallen.«
Gott schütze uns alle.
1. KAPITEL
Der »größte Held seines Geschlechts«.
I.E. Grant über Tormod MacLeod
Dunvegan Castle, Isle of SkyeSt. Michaelstag, 1305
Er würde ihn töten. Langsam.
Als der Geistliche das Schreiben vorgelesen hatte, senkte sich wie nach einem lauten Donnerschlag plötzliche Stille über die Halle. Die Gruppe von Männern, die sich in der großen Halle von Dunvegan Castle zusammengefunden hatte, stand in Erwartung seiner Entgegnung reglos da. In ihren wilden Gesichtern las er Empörung und Schock, Gefühle, die auch er empfand, aber hinter einer steinernen Fassade verbarg.
Allein auf dem Podium, lehnte Tormod MacLeod, Chief der MacLeods, sich auf seinem erhöhten Sitz vor und durchbohrte den Unglücklichen vor ihm mit seinen Blicken.
»Er hat was getan?« Die tödliche Ruhe seines Tones war nicht angetan, die Spannung zu lockern.
Der Geistliche erschrak und gab etwas von sich, das nur als Quietschen bezeichnet werden konnte. Das Schreiben flog aus seiner Hand und schwebte durch die verräucherte Luft, um auf dem mit Binsen bestreuten Boden zu landen. Tor trat mit dem Fuß auf das anstößige Stückchen Pergament. Als er sich danach bückte, konnte er unter seiner Ferse die ihm wohlbekannte krakelige Schrift erkennen. Torquil MacLeod, sein um zwei Minuten jüngerer Zwillingsbruder, hatte ihm geschrieben.
Die Flammen der jüngsten Attacke auf das Dorf waren kaum erloschen und jetzt hatte sein Bruder dies getan? Langsam, schwor er sich, während er das Schreiben zu einer festen Kugel zerknüllte.
Der Geistliche fand seine Stimme wieder, die jedoch zitterte, als er auf Tors Frage antwortete.
»Eu-euer Bruder kann nicht hinnehmen, dass der Chief der Nicolson ihm seine Tochter verweigert. Er sieht sich gezwungen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen.« Der junge Kleriker hielt inne und wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn.
»Er hat gesagt, seine Liebe …«
»Genug davon!« Tors Faust landete mit dumpfem Aufprall auf der Armlehne des reich verzierten hölzernen Thronsessels. Es war einer seiner seltenen Wutausbrüche. Zorn rötete seine Augen.
»Ich … habe … genug … gehört.«
Liebe. Die allerdümmste Ausrede, wenn jemand sich wie ein Idiot aufführte. Er hätte es vorgezogen, Torquil hätte sich damit gerechtfertigt, dass Margaret Nicolson eine große Erbin war – was den Tatsachen entsprach – und er sie zum Besten seines Clans entführt hatte; dann hätte Tor zumindest versucht, für diesen ungeheuerlichen Mangel an Urteilsvermögen Verständnis aufzubringen.
Mit einer einzigen übereilten Tat würde Torquil einen Krieg entfesseln und alles gefährden, was Tor in den letzten zwanzig Jahren erkämpft hatte. Vor zwanzig Jahren hatte sein Clan am Rand des Untergangs gestanden – erst das Massaker, das viele Opfer, darunter seine Eltern, gefordert hatte, und dann die Jahre des Hungers. Harte Arbeit und Entschlossenheit hatten den Clan gerettet, ihn erstarken und wohlhabend werden lassen. Tor konnte nicht zulassen, dass ein Krieg nun Not und Vernichtung über alles brachte, was er erreicht hatte. Eine eigenartige Position für einen Mann, der nichts anderes kannte – der seinen Namen und sein Vermögen dem Krieg verdankte –, doch sein Clan verdiente Frieden, und diesen wollte er ihm erhalten.
Die letzte Welle von Angriffen war schlimm genug gewesen. Im letzten Jahr war zweimal Vieh geraubt worden, die Ernte geplündert, die Felder gebrandschatzt. Feige Überfälle dieser Art waren vor allem den MacRuairis zuzutrauen. Hatten sie die Waffenruhe gebrochen, würde Tor dafür sorgen, dass sie es büßten.
Aber zuvor galt es einer unmittelbareren Bedrohung entgegenzutreten. Es galt, einen Weg zu finden, Nicolson zu beschwichtigen und einen Krieg abzuwehren. Sein Mund bildete einen schmalen, Ingrimm verratenden Strich. Fast war er versucht, seinen Bruder persönlich in Ketten zu Nicolson zu schleppen. Das würde diesem Genugtuung verschaffen.
Verdammt wollte er sein, wenn er den Hektor eines liebeskranken Paris in Gestalt Torquils abgeben und somit zulassen würde, dass sein Clan das Schicksal der Trojaner erlitt. Es gab viele Gründe für einen Krieg, eine Frau aber zählte nicht dazu.
Er und sein Bruder waren einander sehr ähnlich – zumindest war er dieser Meinung gewesen. Wo zum Teufel waren Torquils Pflichtgefühl und die Treue gegenüber seinem Clan geblieben? Er stieß einen unwilligen Laut aus. Das heiße Blut zwischen seinen Beinen hatte seinem Bruder vermutlich den Verstand getrübt.
Tor zwang sich zur Ruhe und bewahrte seine Fassung, was keine Auswirkung auf das Zittern des offenkundig zutiefst erschrockenen Mannes vor ihm hatte.
Tors Blick wurde unter der Last seiner Brauen schmal, als er den jungen Geistlichen maß. John war sein Name, wenn sein Gedächtnis ihn nicht trog. Mittelgroß und von leichtem Körperbau war der Mann nicht der Typ, der Eindruck machte. Sein glattes braunes Haar war in einem Bogen um das glatte, narbenlose Gesicht geschnitten. Mit seinen ebenmäßigen, etwas ausdruckslosen Zügen schien er wie geschaffen für seinen Stand. Seine dünnen Arme waren für die Schreibfeder und nicht für das Schwert gemacht.
Tor sparte sich seine Kampfkraft für würdigere Gegner. Torquil sollte seinen Zorn zu spüren bekommen und nicht dieser grüne Junge. Welche Genugtuung war es denn, eine Maus zu zertreten? Wer Schwächere schlug – seien es Bediente, Kinder oder Frauen –, beschämte sich selbst.
Da der Geistliche neu war, wollte Tor ihm die Beleidigung vergeben. Diesmal.
»Zügelt Eure Angst, Mann«, fuhr er ihn an.
»Ich werde Euch nicht die Zunge herausschneiden, nur weil Ihr der Überbringer schlechter Kunde seid.«
Anstatt sich zu beruhigen, schien die Färbung des Geistlichen in ein noch krankhafteres Grau zu spielen. Pfaffen, dachte Tor angeekelt. Gelehrt, aber schwächlich. Für Empfindsamkeit fehlte ihm die Geduld. Der Kirchenmann würde sich eine dickere Haut zulegen müssen.
»Wo befindet sich mein Bruder jetzt?«
Der Mann schüttelte den Kopf, sodass sein vorstehender Adamsapfel hüpfte.
»Ich weiß es nicht, Chief. Der Bote ist gegangen, ehe man ihn befragen konnte.«
Falls Torquil noch einen Funken Verstand besaß, hatte er seine geraubte Braut gepackt und war mit ihr in der ewigen Verdammnis verschwunden – der einzige Ort, an den Tor ihm nicht folgen würde.
Murdoch, sein Vertrauter und Captain der Wache, trat vor, um als erster seiner Männer das Wort zu ergreifen. Nicht Furcht war es, die die Wachen schweigen ließ, sondern Achtung vor Tors Urteil. Das Urteil sprach er allein.
»Ich werde ihn finden, ri tuath. Sehr wahrscheinlich hat er sich nach Irland oder auf die Isle of Man geflüchtet.«
Zu diesem Schluss war Tor selbst gelangt. Wie sie alle hatte sein Bruder den Großteil der vergangenen zwanzig Jahre als Söldner in Irland verbracht. Indem er Krieger nach Irland schickte, hatte Tor seinem Clan wieder Wohlstand verschafft. Er und seine Leute kannten sich in Irland fast so gut aus wie in ihrem heimatlichen Skye.
Er nickte.
»Nimm so viele Männer wie nötig.« Er sah Murdoch vielsagend an.
»Mein Bruder kann von Glück reden, wenn du ihn findest, ehe Nicolson ihn aufspürt.«
»Und wenn er nicht zurückkommen will?«, fragte Murdoch unverblümt.
Niemand würde infrage stellen, wenn er Torquils Tötung genehmigte – trotz dessen Beliebtheit bei den Männern. Das Wort des Chiefs war Gesetz. Um seinen Mund erschien ein harter Zug, während er versucht war, genau diesen Befehl zu geben. Aber wie immer behielt er seine Gedanken für sich.
»Sag ihm, der Befehl käme direkt von seinem Chief.« Nicht einmal sein starrköpfiger Bruder konnte in diesem Fall den Gehorsam verweigern.
Er wünschte, er hätte daran gedacht, es ihm zu verbieten. Nach dem Verdruss, den die Entführung ihrer Schwester Muriel mit sich gebracht hatte, war er der Meinung gewesen, Torquil würde es besser wissen. Doch er hätte es voraussehen müssen, als die Verhandlungen scheiterten und Nicolson die Verlobung seiner Tochter mit dem Sohn MacDougalls verkündete.
Zum Teufel. Man würde MacDougall entschädigen müssen, und da er den habgierigen Bastard kannte, würde es ihn viel kosten.
Tor warf den zusammengeknüllten Brief ins Feuer in der Mitte der Halle und entließ den jungen Kleriker mit einer knappen Handbewegung. Obwohl dem Mann anzusehen war, dass er es eilig hatte, sich in die Sicherheit seiner Bücher und Schriften zurückzuziehen, rührte er sich nicht, sondern beschränkte sich darauf, ängstlich von einem Fuß auf den anderen zu treten.
Die Zaghaftigkeit des Mannes machte Tor nervös.
»Wenn Ihr noch etwas auf dem Herzen habt, dann heraus damit, oder geht wieder an Eure Arbeit.«
»Ja, Chief. Es tut mir leid, Chief.« Der Geistliche holte ein zusammengefaltetes Stück Pergament aus dem Beutel, den er an einem Gürtel um sein braunes Gewand trug.
»Das kam eben erst.« Er reichte es Tor zur Lektüre.
Tor prüfte das Wachs und erkannte sofort das Siegel mit den vier Männern in einem birlinn. Angus Og MacDonald, Ri Innse Gall. Amüsiert zog er eine Braue in die Höhe. MacDonald zeigte Mut, wenn er den alten Titel eines Königs der Inseln benutzte und König Edwards Unmut riskierte, anstatt sich mit Lord of Islay zu begnügen.
Was wollte der ›König der Inseln‹ von ihm?
Er brach das Siegel, überflog das Schreiben und reichte es dem jungen Kleriker. Obschon er etwas Gaelisch lesen konnte, verfügte er nicht über die Übung des Kanzlisten. Wie die meisten Chiefs der West Highlands hielt er sich Leute für diese Aufgabe.
Der Geistliche las vor. Es dauerte eine Weile, bis er die weitschweifige Begrüßung hinter sich gebracht hatte – Tormod, Sohn des ebensolchen; Sohn Leods, Sohn Olafs des Schwarzen, König von Man; Sohn Harald Hardradas, König von Norwegen – aber schließlich war klar, dass MacDonald die Insel-Chiefs zu einer Ratsversammlung nach Finlaggan, seiner Trutzburg auf Islay, befahl.
Unklar blieb, warum er Tor aufforderte, der MacDonald nicht zu Diensten sein musste. Skye hatte niemals zu MacDonalds Herrschaftsbereich gehört. Durch Tors Adern floss Blut, das ebenso königlich war wie jenes MacDonalds. Seit sein Onkel Magnus, der letzte König von Man, den Thron eingenommen hatte, hatten die MacLeods sich niemandem gebeugt.
Verdammt, Innse Gall – die Western Isles – waren erst seit vierzig Jahren ein Teil Schottlands. Dem Gesetz nach schuldete Tor Edward als König von Schottland Gefolgschaft, doch war er noch nicht aufgefordert worden, den Lehnseid zu leisten. Und er würde es auch nicht tun.
Warum also berief MacDonald ihn zu sich? Er argwöhnte, dass es mit den Unruhen in Schottland zusammenhing, die immer spürbarer wurden, je rigoroser König Edward das Land im Griff hielt.
Tor wollte keinesfalls in die Zwistigkeiten der schottischen Machthaber hineingezogen werden. Er hatte es peinlich vermieden, Partei zu ergreifen – nicht nur zwischen einem englischen und einem schottischen König, sondern auch zwischen MacDonalds und MacDougalls. Auf den Western Isles tobte ein Machtkampf zwischen diesen zwei Zweigen von Somerleds Nachfahren, die die politische Szene der Inseln beherrschten.
Der Geistliche hielt inne und runzelte die Stirn.
»Ganz unten steht ein Zusatz von anderer Handschrift. Er lautet: ›Ich habe einen Vorschlag für Euch, eine Gelegenheit, die Ihr bestimmt nicht verpassen wollt.‹«
Tor biss nicht an. Falls MacDonald glaubte, ihn mit irgendwelchen, jeder Grundlage entbehrenden Plänen ködern zu können, hatte er sich verrechnet. Was immer Angus Og an Vorschlägen für ihn hatte, es interessierte ihn nicht. Er hatte drückendere Sorgen. Nicolson beispielsweise.
Er machte den Mund auf, um den Geistlichen anzuweisen, eine höfliche, aber deutliche Absage abzufassen, als ihm etwas einfiel. Nicolson würde auch kommen.
Anders als die MacLeods unterstand der Nicolson-Clan mit seinem ausgedehnten Landbesitz in Assynt dem König der Isles. Der Chief der Nicolsons würde der Vorladung nach Finlaggan Folge leisten, und das würde Tor Gelegenheit geben, die von Torquil verursachte Katastrophe zu bereinigen, ehe es zu Kampfhandlungen kam, die viel Geld verschlangen. Auch wenn sein Instinkt ihn zum Kampf drängte, war er es als Chief seinem Clan schuldig, Kämpfen aus dem Weg zu gehen.
Er lehnte sich entspannt auf seinem Sitz zurück und richtete den Blick auf seine Männer.
»Macht die birlinns für morgen bereit.« Ein Mundwinkel zog sich in einem spöttischen Lächeln hoch.
»Sieht aus, als müsste ich der Aufforderung nachkommen.«
Der Geistliche sah ihn verblüfft an, seine Krieger aber lachten. Sie hatten den Scherz verstanden. Wenn sie nach Finlaggan zogen, geschah es nicht, weil man ihn dazu aufgefordert hatte.
Niemand konnte den Chief der MacLeods dazu bringen, etwas zu tun, das er nicht wollte.
Touchfaser, Stirlingshire
Christinas Atem stockte so jäh, dass sie an der gezuckerten Pflaume, die sie kaute, fast erstickte. Ihr Blick flog über die Seite, doch sie konnte nicht schnell genug lesen, um ihr rasendes Herz zu beruhigen.
Lancelot und Königin Guinevere hatten eben ein nächtliches Treffen arrangiert. Um seine Geliebte zu erreichen, erfasst Lancelot die Eisenstäbe vor dem Fenster, verbiegt sie und entfernt sie, um ins Innere zu gelangen.
Eisenstäbe! Was für ein Kraftakt! Sie steckte die nächste Pflaume in den Mund, ohne sich auch nur einen Moment in ihrer Konzentration ablenken zu lassen. Prickelnde Erwartung erfüllte sie, da sie wusste, was nun kommen würde: das Treffen der Liebenden.
Und die Königin streckt die Arme nach ihm aus, drückt ihn fest an ihre Brust, zieht ihn neben sich auf das Bett und schenkt ihm jede nur denkbare Befriedigung. Ihre Liebe und ihr Herz gehören ihm. Liebe ist die Quelle ihrer Zärtlichkeit. Liebt sie ihn schon über alle Maßen, erwidert er ihre Gefühle hundertfach. Seine Liebe übertrifft jene anderer Herzen bei Weitem; so tief ruht seine Liebe in seinem Herzen, dass es für andere Herzen nur wenig empfindet. Jetzt besitzt Lancelot alles, was er erstrebte, da die Königin seine Nähe und Liebe sucht, und sie einander umarmen. Ihr Tun ist so angenehm und süß, während sie sich küssen und liebkosen, dass sie eine Freude überkommt, wie es sie noch nie gab.
Mit geröteten Wangen schloss Christina behutsam den Band, lehnte sich an die Truhe am Fußende ihres Bettes und drückte das Buch mit einem tiefen Seufzer an ihre Brust. Sie wusste, dass sie es sehr sündig hätte finden sollen, doch sie konnte es nicht. Es war zu romantisch.
Sie konnte Chrétiens Le Chevalier de la Charrette »Der Karrenritter« immer wieder lesen, ohne dessen überdrüssig zu werden. Zu denken, dass ein Mann sie jemals so sehr lieben könnte!
Und Lancelot war nicht irgendein Mann. Er war der größte Ritter der Christenheit, kühn, galant, stattlich; gewillt, für die Frau seiner Liebe alles zu tun, ja sogar die Rittertugenden – Ehre und Stolz – abzulegen, indem er das Angebot des Zwerges annimmt und mit einem Karren vorliebnimmt, nur um seine Dame aus den üblen Fängen Meleagants zu befreien. In einem Karren zu fahren, war für einen Ritter eine schreckliche Demütigung. Wie hätte Guinevere diesen Mann nicht lieben können, der sich so erniedrigte, der aber auch für sie gekämpft und sie zweimal gerettet hatte?
Christina konnte ihn vor sich sehen, auf seinem großen Schlachtross, der große, muskulöse Kriegerkörper in schimmernder, in der Sonne glänzender Wehr. Das Azurblau seines Waffenhemdes gleicht dem leuchtenden Blau seiner Augen im Visier seines Helms. Das goldene Haar ist bedeckt. Nur eine lose Locke weht über seinen starken, schönen Zügen, als er über das Schlachtfeld sprengt, das schwere Schwert mühelos in der Hand, um allen entgegenzutreten, die seiner holden Dame übel wollen.
Wieder seufzte sie und ihr Blick wurde weich, während ein verträumtes Lächeln sich auf ihre Lippen legte. Diese Szene kam zwar in dem Buch nicht vor, spielte sich aber immer wieder in ihrem Kopf ab.
Eines Tages vielleicht …
Ein Ruf von unten bedeutete das jähe Ende ihrer Tagträume. Die romantischen Sehnsüchte, die ihre Brust erfüllten, wichen eiskalter Angst.
Vater.
War es nicht zu früh? Ihr Blick flog zu dem kleinen Fenster der kleinen Turmkammer. Das weiche Gelb und Rosa der untergehenden Sonne drang durch die offenen Fensterbalken.
Sie erstarrte. Zu dumm! Wie hatte sie den Tag nur so vertrödeln können? Sie wusste um das Risiko. Ihre Hand drückte sich andächtig auf die kostbare, in dunkelbraunes Leder gebundene hölzerne Hülle, deren bemalte Eckstücke aus Metall wie farbiges Glas aussahen. Der Band war ihr kostbarster Besitz. Und wenn ihr Vater sie ertappte, ihr gefährlichster. Die Erinnerung an den Zorn ihres Vaters war noch schmerzlich frisch. Ihre Finger fassten nach der empfindlichen Stelle an ihrem Backenknochen. Die durch seinen Ring aufgerissene Haut heilte allmählich, doch das Gefühl der Hilflosigkeit war noch spürbar.
Christina hatte ihm so aufgeregt von ihren Lernfortschritten berichtet, da sie wusste, wie stolz er auf ihre Brüder gewesen war. Aber anstatt beeindruckt zu sein, war der Mann, der für sie zum Fremden geworden war, in Zorn geraten, als er hörte, dass sie und ihre Schwester Beatrix in den vergangenen drei Jahren, die er als Gefangener König Edwards in England verbracht hatte, vom Priester im Dorf lesen gelernt hatten.
Lektüre würde ihre Köpfe nur mit dummen Ideen füllen und sie von ihren Pflichten ablenken. Bildung war Männern und Nonnen vorbehalten.
Ins Kloster zu gehen und sich in den Frieden einer Abtei zu flüchten, war genau das, was die Mädchen wollten und was ihnen Prügel eingebracht hatte. Die Schläge hatten die zarte Beatrix fast getötet. Sein Verbot, jemals wieder ins Kloster zu gehen, hatte ihr den Rest gegeben. Nur Christinas Versprechen, sie würde einen Weg für ihre Schwester finden, den Schleier zu nehmen, hatte Beatrix abgehalten, sich ihrer Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung völlig hinzugeben. Ihre Schwester träumte von einem Gott geweihten Leben. Auch Christina fühlte sich vom klösterlichen Frieden angesprochen, doch aus einem anderen Grund. Für sie bedeutete er Sicherheit.
Ein Angstschauer überlief sie. Wer konnte wissen, was ihr Vater tun würde, wenn er entdeckte, dass sie in einem Buch las?
Er war völlig unberechenbar geworden. Seine Stimmungen schwankten zwischen kalter Verachtung und rasender Wut wegen scheinbar unwichtiger Nichtigkeiten. Andrew Fraser, ehemaliger Sheriff von Stirlingshire, Spross einer edlen, schottisch gesinnten Familie, einst kühner, angesehener Ritter, war vor Hass grausam geworden. Seine glühende Liebe zu Schottland war durch das Bestreben, Edward zu vernichten, zur Raserei verkommen. Es fiel ihr schwer, sich an den Mann zu erinnern, der er gewesen war, sodass sie sich fragte, ob das einst bereitwillige Lächeln ihres Vaters nur in ihrer Einbildung existierte. Es war nun hinter seiner ständig wechselnden Maske vergessen.
Seit seiner Rückkehr vor einem halben Jahr hatte Christina das Gefühl, am Rande eines Abgrunds in ständiger Angst zu leben. Angst, das Falsche zu sagen oder zur falschen Zeit aufzutauchen. Sie hatte gelernt, durch die Korridore zu huschen, sich in den Schatten zu verbergen und keine Aufmerksamkeit zu erregen.
Sie zwang sich zur Ruhe. Noch nie hatte er die kleine Dachkammer betreten, die sie mit ihrer Schwester und ihrer Dienerin bewohnte.
Dennoch drängte ihre Vorsicht sie zur Eile.
Sie drehte sich auf den Knien um und wickelte den kostbaren Band unter Herzklopfen in eine helle Leinenhülle. Das Buch war ein Abschiedsgeschenk Pater Stephens. Er hatte ihr versichert, dass das Buch trotz seines Wertes niemandem fehlen würde. Chrétiens Romane, die vom sündigen Ehebruch Lancelots mit Arthurs Königin kündeten, standen nicht mehr in Gunst. Sie hatten Legenden um Arthur weichen müssen, die der kirchlichen Lehre eher entsprachen.
Pater Stephen fehlte ihr sehr. Er hatte ihr eine ganz neue Welt eröffnet.
»Eines Tages wird jemand erkennen, wie besonders du bist, Kind.« Seine Abschiedsworte kamen ihr wieder in den Sinn. Sie wünschte sich verzweifelt, ihm zu glauben, doch angesichts der grausamen Missachtung ihres Vaters fiel es ihr immer schwerer.
Zum ersten Mal in ihrem Leben beherrschte sie etwas sehr gut. Sie konnte nicht singen oder Laute spielen, und ihre Handarbeiten waren grässlich – Fertigkeiten, die ihrer Schwester leichtfielen –, sie aber hatte Lesen und Schreiben schneller gelernt, als Pater Stephen es je erlebt hatte. Nicht nur Latein, sondern auch Gaelisch und Französisch. Sie hätte eine Begabung, die nicht vergeudet werden sollte, hatte er gesagt und ihr damit etwas gegeben, das sie nie zuvor gehabt hatte: ein Ziel.
Der Deckel der Truhe quietschte, als sie ihn anhob, um das Buch in seinem Versteck unter einem hohen Stapel Leinenzeug zu verbergen.
Ehe sie den Deckel schließen konnte, zuckte sie unter dem Geräusch eines splitternden Krachens zusammen, als die Tür aufgerissen wurde.
Ihr Blick flog zur Tür, und Christina stand fast das Herz still.
Andrew Fraser, schmutzig und nach einem Tag auf dem Übungshof nach Schweiß riechend, stand im Eingang. Nicht groß, aber sehr stark gebaut, hatte er in den sechs Monaten seit seiner Rückkehr dank zielstrebiger Entschlossenheit die im Kerker verlorenen Muskeln fast zur Gänze wieder aufgebaut. Andere Spuren der Haft waren nicht so leicht zu tilgen. Sein Antlitz wirkte älter, als es seinen vierundfünfzig Jahren zukam. Grau hatte das Braun aus seinem Haar gesogen. Knochenbrüche und Kampfnarben im Gesicht, die sie einst für edel gehalten hatte, dienten jetzt nur dazu, die Kälte seiner Augen zu betonen.
Augen, die sie nun argwöhnisch anstarrten. Am liebsten hätte sie sich unter dem Bett verkrochen oder wäre hinter der Täfelung verschwunden, aber hier gab es kein Versteck.
»Was machst du da?«, herrschte er sie an.
Das Buch kann er nicht finden. Kalte Angst lief ihr das Rückgrat entlang, doch sie zwang sich zur Ruhe. Wie jedes Raubtier würde er Furcht wittern. Stattdessen stand sie langsam auf und schüttelte ihre Röcke betont unbefangen aus, obwohl ihre Knie zitterten. Sie zwang sich, seinem Blick standzuhalten.
»Ach, ich habe frisch gewaschene Wäsche eingeräumt. Möchtest du etwas?« Sie zuckte innerlich zusammen. Sogar ihre Stimme klang schwach und unterwürfig.
»Wo steckt deine Schwester?«
Ihr Herz tat einen Sprung.
»Beatrix?«, quiekte sie. Der hohe Ton machte ihre gespielte Unbekümmertheit vollends zunichte.
Sein Gesicht zeigte ein fleckiges zorniges Rot. Er tat einen Schritt auf sie zu, und sie duckte sich unwillkürlich.
»Natürlich Beatrix, du dummes Ding. Hast du eine andere Schwester?«
Christina verwünschte ihre helle Haut, als sie spürte, wie ihr die Hitze der Panik in die Wangen stieg.
»Sicher ist sie in der Küche«, äußerte sie stockend.
Bitte, lass nicht zu, dass sie dort ist, wo ich sie vermute. Beatrix versuchte es vor ihr zu verbergen, doch vermutete Christina, dass ihre Schwester sich ins Kloster stahl, wann immer es sich einrichten ließ. Der Ruf Gottes war stärker als die Realität der eisernen Faust ihres Vaters.
Wieder trat er einen Schritt näher. Seine Haltung war nun nicht mehr nur zornig, sondern drohend.
»Du lügst«, grollte er und ergriff ihren Arm. Seine starken Finger umfassten sie wie eine stählerne Klammer.
Ihr Herz flatterte wild. Angst drückte ihr die Kehle zu. Aus dem Augenwinkel konnte sie sehen, dass er die andere Hand hob. Ihr Inneres krampfte sich zusammen. Sie versuchte sich zu befreien.
»Bitte, nicht…«
»Wo ist sie?«, wollte er wissen und schüttelte sie brutal.
Der letzte Sonnenstrahl des schwindenden Tageslichts fiel auf den goldenen Ring an seiner offenen Hand. Nein! In Erwartung seines Schlages wandte sie ihr Gesicht ab, Tränen trübten ihren Blick.
»Ich weiß es nicht«, schluchzte sie. Wie sie dieses Gefühl der Hilflosigkeit hasste, das sie von einem Moment zum anderen durch einen Menschen, den sie einst verehrt hatte, in ein zitterndes Häufchen Elend verwandelte.
»Hier ist sie, Vater!«
Wie groß war ihre Erleichterung, als sie die Stimme ihres Bruders hörte. Mit achtzehn drei Jahre jünger als sie, war Alex bereits eine große Hoffnung auf dem Schlachtfeld. Er war zudem das einzige helle Licht im finsteren Leben seines Vaters. Ihre drei anderen Brüder, die außer Haus erzogen wurden, waren noch zu jung, in Alex aber sah er etwas Besonderes.
»Beatrix war in der Küche und hat bei der Zubereitung des Abendessens geholfen«, erklärte Alex, dessen unbekümmerter, lockerer Ton den heftigen Zornausbruch ihres Vaters sofort milderte.
Alex war erst seit wenigen Wochen zu Hause, doch hatte Christina in ihm sofort einen Verbündeten entdeckt. Er würde sie und ihre Schwester beschützen, so gut er konnte. Wenn er nur nicht so jung gewesen wäre …
Ihr Vater ließ sie los, sodass Christina sehen konnte, wie Beatrix an Alex vorbei eintrat.
Fast hätte Christina laut aufgeatmet.
Ihre Schwester stand wie eine Sünderin vor ihrem Vater, die Hände gefaltet, den Kopf unter einem langen, hellblauen, von einem Goldreif gehaltenen Schleier gebeugt. Hochgewachsen und gertenschlank, war ihre Schwester mit Zügen ausgestattet, die aussahen wie aus feinstem Marmor gemeißelt – bis auf die gelblich-braunen Stellen, die ihre Wange entstellten. Ihr Anblick erfüllte Christina mit Zorn. Wie konnte er sie schlagen? Wie konnte man ein so liebliches Geschöpf züchtigen? Ihre Schwester hatte nicht nur die Gesichtszüge eines Engels, sie besaß auch dessen innere Schönheit. Sie war unschuldig. Rein. Und engelhaft zart.
»Du wolltest mich sehen, Vater?«, fragte Beatrix mit gesenktem Blick. Auch ihre Stimme klang engelhaft, leise, musikalisch, voller ätherischer Atemlosigkeit.
Das liebliche Bild, das ihre Schwester abgab, schien ihren Vater noch mehr zu reizen. Fast war es, als könne er nicht fassen, dass so viel Zartheit von ihm abstammte.
»Du packst deine Sachen.« Er blickte Christina an, als wäre es ihm jetzt erst eingefallen.
»Du auch. Morgen geht es los.«
»Los?« Christina war bestürzt. »Aber wohin?«
Der Blick ihres Vaters wurde noch härter ob ihrer Dreistigkeit. Befehle mussten fraglos befolgt werden. So war sie nicht wenig erstaunt, als er antwortete:
»Nach Finlaggan Castle auf Islay.«
Hätte er London gesagt, wäre sie weniger erschrocken.
Sogar Alex war bestürzt.
»Auf den Western Isles?«
Das war eine andere Welt. Barbarenland, voller … nun, voller Barbaren, Wilden, Kriegern und Piraten mit Norwegerblut, die die Inseln im Westen mit ungezügelter Autorität beherrschten. Der Schock verlieh Christina den Mut zu der Frage:
»Aber warum?«
Ihr Vater kniff seine harten schwarzen Augen drohend zusammen, als hätte er gute Lust, sie mit seinem Stiefelabsatz zu zertreten. Als er dann lächelte, anstatt sie zu schlagen, wusste sie, dass die Antwort schlimm ausfallen würde. Sehr schlimm.
»Um ein Bündnis zu schließen.«
»Wozu brauchst du uns dazu?«
Christina staunte, als sie die Stimme ihrer Schwester hörte. Beatrix brachte sonst kaum den Mut auf, ihren Vater direkt anzusprechen. »Na, was glaubst du?«, sagte er herausfordernd.
»Eine von euch wird ihn heiraten.«
Den drei jungen Leuten blieb die Luft weg. Heiraten? Einen gewalttätigen Kriegsherrn? Gott bewahre uns! Aus Christinas Gesicht wich alle Farbe. Stumm schüttelte sie den Kopf. Sie konnte es nicht tun.
Ihr Vater machte Anstalten, als wolle er sie eines Besseren belehren, überlegte es sich aber.
»Wahrscheinlich wird es Beatrix tun, da sie älter ist.«
Eine Woge der Erleichterung erfasste sie. Gott sei Dank.
Dann sah sie ihre Schwester an.
»Nein«, hauchte Beatrix, vor Entsetzen fast erstickt und einer Ohnmacht nahe. Alex umfing ihre schmale Taille und drückte sie an sich.
Bei diesem Anblick krampfte sich in Christinas Brust alles zusammen. Ihre zarte, unschuldige Schwester an einen großen Krieger in Rüstung gedrückt. Alex, dunkelhaarig wie sie, war trotz seiner Jugend hochgewachsen und breitschultrig. Neben ihm wirkte Beatrix geradezu schmerzhaft verletzlich. Wie ein Schmetterling in Eisenfängen.
Beatrix würde in der Gewalt eines grausamen Wüstlings nicht überleben. Christina wusste es mit absoluter Gewissheit.
Ohne zu überlegen, trat Christina vor. Ihr Magen hob sich, doch sie unterdrückte ihre Panik.
»Nein, Vater. Ich werde es tun. Ich werde ihn heiraten.«
Der Blick ihres Vaters wanderte von einem Mädchen zum anderen, als gelte es, zwei Rösser auf einem Markt abzuschätzen. Er schien zufrieden mit dem, was er sah.
»Ihr beide kommt mit. Soll er selbst entscheiden, welche ihm besser gefällt.«
Als er sich ohne ein weiteres Wort abrupt umdrehte und hinausging, waren die zwei Mädchen einer Ohnmacht nahe.
Christina fasste Halt suchend nach dem Bettpfosten. Beatrix hing noch immer schlaff wie eine Stoffpuppe an ihrem Bruder, der ihren Kopf streichelte, während sie sich leise an seiner Schulter ausweinte.
Ihre Blicke trafen sich über dem verschleierten Haupt ihrer Schwester. Christina las Mitleid im Blick ihres Bruders. Beide wussten, dass man ihren Vater nicht von seinem Plan abbringen konnte. Dass die Mädchen nicht schon längst verlobt worden waren, war der Kerkerhaft ihres Vaters zu verdanken sowie dem Umstand, dass man König Edwards nächste Schritte nicht abschätzen konnte. Es wurde erwartet, dass sie heirateten. Sie hatte es gewusst … und hatte diese Tatsache verdrängt, obwohl ihr klar war, dass dieser Tag kommen würde.
Das Bild Lancelots kam ihr so jäh in den Sinn, dass sie es nicht verdrängen konnte. Nur ein Traum. Aber nie hätte sie das erwartet, was nun auf sie zukam.
»Vielleicht gefällt ihm keine?«, äußerte sie hoffnungsvoll.
Der mitleidige Blick ihres Bruders sprach Bände. Alex schüttelte den Kopf, als wäre sie das traurige Opfer einer Illusion.
»Das bezweifle ich sehr, Schwester. Du und Beatrix, ihr seid … nun …« Er hielt verlegen inne.
»Ihr seid sehr schön. Auf verschiedene Weise vielleicht, aber beide außergewöhnlich. Beatrix gleicht einem Engel, und du …« Er errötete.
»Du nicht.«
Das hätte eine boshafte Bemerkung sein sollen, doch klang es wie das genaue Gegenteil. Sie zog die Brauen zusammen.
»Das verstehe ich nicht.«
Alex verzog das Gesicht, als wäre ihm die ganze Sache höchst unangenehm.
»Dein Mund und deine Augen sind es.«
»Was ist los mit ihnen?« Ihre Augen standen vielleicht ein bisschen schräg und ihr Mund war eine Spur zu groß, doch war ihr nicht klar, was daran nicht stimmen sollte.
Er stieß einen ungeduldigen Laut aus.
»Nichts. Es ist nur … ich habe Männer sagen hören, dass dein Anblick sie auf sündige Gedanken brächte.«
Ihre Augen wurden groß. Verlegen legte sie die Hand auf ihren Mund.
»Wirklich? Wie schrecklich!«
Er nickte ernst.
»Ja, leider. Die Entscheidung wird dem Mann sehr schwerfallen.«
Beatrix’ leises Wimmern war das einzige Geräusch, das in der nun eintretenden verlorenen Stille zu hören war. Die drohende Ausweglosigkeit lastete auf ihr, aber Christina wusste, was sie zu tun hatte. Beatrix mochte ein Jahr älter sein, doch war es immer Christina gewesen, die sich ihrer angenommen hatte, und das wollte sie auch weiterhin tun.
Sie schluckte ihre würgende Angst hinunter. Wenn es darauf ankam, würde sie dafür sorgen müssen, dass die Wahl dieses grässlichen Menschen auf sie fiel.
2. KAPITEL
Finlaggan Castle, Isle of Islay
Ich habe kein Interesse.« Tor lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und sah die Handvoll Männer an, die um den großen runden Tisch im Ratssaal von Finlaggan auf Islay saßen, in der Hochburg der MacDonalds, dem Mittelpunkt des Inselkönigreichs seit undenklichen Zeiten.
Die runde Tafel stand in keinerlei symbolischer Beziehung zu dem größten Helden Britanniens, sondern war eine praktische Lösung, um die Form des Raumes bestmöglich zu nutzen. Anstatt den Luxus von MacDonalds neuem Turmhaus zu genießen, hatten sie sich in dem alten Rundhaus daneben eingefunden. Der finstere und zugige Steinbau ging bis auf die Zeit vor Somerled zurück, dem großen König, von dem die MacDonalds, MacDougalls, MacSorleys und MacRuairis ihre Herkunft ableiteten, und diente den Königen der Inseln seit Jahrhunderten als Residenz. Sein Gastgeber wusste sehr wohl um die Macht der Tradition. Rundtafel oder nicht, auf Finlaggan herrschte einzig und allein Angus Og MacDonald, Nachfahre des mächtigen Somerled.
Bei einem typischen Kriegsrat hätten sich im Raum Chiefs, Stammesführer und ihr Gefolge gedrängt. Heute aber waren neben dem Hausherrn und Tor nur vier Männer anwesend: William Lamberton, Bischof von St. Andrews; Sir Andrew Fraser, ein schottischer Edler, der ihm dem Namen nach, aber nicht persönlich bekannt war; Erik MacSorley, Angus Ogs Angehöriger und Gille-coise, Gefolgsmann und Leibwächter, der als bester Seefahrer der Inseln galt; und Sir Neil Campbell, MacDonalds mit Bruce verwandter Onkel aus einem immer bedeutender werdenden Clan mit Besitzungen unweit von Loch Awe.
Robert Bruce, der dieses Treffen veranlasst hatte, wurde von Edward zu genau überwacht, um anwesend sein zu können.
Nach Tors Entgegnung wechselten MacDonald und Lamberton Blicke, und der Bischof versuchte nun seinerseits ihn umzustimmen.
»Ihr versteht vielleicht nicht ganz …«
»Ich verstehe nur zu gut«, sagte Tor und unterbrach die drohende langatmige Erklärung.
»Ich soll eine geheime, hoch spezialisierte Kampftruppe ausbilden und anführen, um Bruce bei seinem Aufstand gegen Edward zu unterstützen.«
Der Prälat rutschte unbehaglich hin und her.
»So würde ich es nicht formulieren. Die Truppe würde verschiedene Aufgaben erfüllen – Erkundung, Aufklärung, Strategie und Sondermissionen.«
»Ja, kurz gesagt die gefährlichsten Unternehmungen«, erwiderte Tor trocken. Ihn amüsierte der Versuch des Bischofs, die Sache zu bagatellisieren.
»Aber Ihr missversteht meine Ablehnung. Nicht das Töten oder die Gefahr sind es, die hinter meiner Ablehnung stehen« – er hatte sich seinen Namen aus ebendiesen Gründen gemacht, und deswegen waren sie zu ihm gekommen –, »sondern weil es nicht mein Krieg ist und ich kein Interesse habe, ihn dazu zu machen.«
Andernfalls hätte es ihn gereizt. Die Idee war so ausgefallen, dass es ihn in den Fingern juckte. Die besten Krieger der Highlands und der Inseln zu einer einzigen Streitmacht vereint? Sie wären nicht aufzuhalten. Nahezu unbezwingbar.
»Aber es ist Euer Krieg«, wandte Lamberton ein.
»Die Inseln sind jetzt Teil Schottlands, und ihr seid schottische Untertanen, ungeachtet dessen, was einige denken mögen.« Die verschmitzt vorgebrachte Bemerkung des Bischofs ließ einige um den Tisch auflachen. Die meisten Inselbewohner dachten wie Tor – er war Inselbewohner und kein Schotte. Lamberton bedachte ihn mit einem eindringlichen Blick.
»Ihr werdet Euch schließlich für eine Seite entscheiden müssen.«
Tor zog eine Braue hoch.
»Während Ihr und Bruce die Seiten so oft wechselt, dass man kaum mitkommt.«
Der Bischof empfand ein zorniges Prickeln, sein rundes Gesicht rötete sich vor Entrüstung.
»Ich kämpfe für Schottland.«
»Ja, und Bruce kämpft immer auf der Seite, auf der Comyn nicht steht, und MacDonald hier kämpft immer für die Seite, gegen die MacDougall antritt. Im Moment sehe ich keinen Nutzen oder Grund, dass mein Clan sich für eine Seite entscheiden sollte. Auch ist trotz Eurer geheimen Armee der Sieg nicht sicher.« Er ignorierte das zornige Raunen, das nun folgte. Hier ging es um Hochverrat, eine Tatsache, der diese Männer ins Auge sehen mussten.
»Ich hege keine Liebe für den englischen König oder John MacDougall, aber sie sind sehr mächtige Gegner.«
»Ja«, gab MacDonald ihm recht.
»Und sie werden mit jeder Minute mächtiger.« Er beugte sich zu Tor und ließ seinen Pokal schwer auf dem Tisch landen.
»Tut Ihr nichts, werdet Ihr den Druck von Edwards eiserner Faust nur zu bald auch auf Skye spüren. Edward mag weit weg sein, aber sein neuer Günstling ist es nicht.«
»Umso mehr Grund, ihn nicht zu erzürnen.« Obschon Tors Sympathien bei Angus Og MacDonald lagen, hatte er es sorgfältig vermieden, in der Fehde zwischen den Sippen Partei zu ergreifen. Er konnte darauf verzichten, John MacDougalls Atem im Nacken zu spüren; er hatte drückendere Sorgen. Aber Nicolson war leider noch nicht eingetroffen.
»Wir werden es Euch vergelten«, zeigte Lamberton sich beharrlich, indem er die Taktik änderte und versuchte, die wachsende Spannung zu mildern.
»Fraser hat zwei unverheiratete Töchter. Beide sind schön und bekommen als Mitgift viel Land.«
»Was im Fall einer Niederlage nichts wert sein wird«, gab Tor unverblümt zurück.
»Edward wird alle enteignen, die sich gegen ihn wenden, und ihnen Land und Titel nehmen – nachdem er sie ihrer Köpfe beraubt hat. Und ich hänge an meinem.«
»Nur zu wahr!«, äußerte MacSorley mit gutmütigem Lachen.
»Edward besitzt eine wachsende Kollektion dieser schottischen Zierden, mit denen er die Tore seiner Schlösser schmückt.«
MacDonald bedachte seinen Gefolgsmann mit einem finsteren Blick, MacSorley aber reagierte mit einem Hochziehen der Schultern und einem Grinsen, das wenig Reue zeigte.
Das Heiratsangebot reizte Tor nicht. Er hatte schon eine Ehe hinter sich und verspürte kein Verlangen, sich wieder eine Frau zu nehmen. Söhne hatte er bereits. Seine Frau war vor fast acht Jahren bei der Geburt des zweiten Sohnes gestorben. Murdoch und Malcolm wurden auf der Isle of Lewis erzogen.
Falls er wieder heiraten sollte, würde er eine Verbindung mit dem Westen suchen, mit Irland oder der Isle of Man, aber nicht mit der Tochter eines schottischen Edelmannes. Da er nicht beleidigend wirken wollte, wandte er sich an Fraser.
»Habt Dank für Euer Angebot. Ich bin sicher, dass Eure Töchter sehr schön sind« – wie alle Damen edler Geburt bei Heiratsverhandlungen –, »aber ich möchte mich nicht vermählen.«
Fraser nickte, doch Tor sah ihm an, dass seine knappe Ablehnung den stolzen Edelmann verstimmt hatte. Etwas an dem alten Krieger störte ihn. In einem Raum voller kampferfahrener Männer brannten Frasers Augen zu heiß. So viel Gefühl war gefährlich und hatte auf dem Schlachtfeld und in der Ratsversammlung keinen Platz. Kühle und Beherrschung waren die Kennzeichen eines klugen Anführers und Kriegers.
MacDonald, dessen Unmut verflogen war, lehnte sich zurück und schenkte Tor einen belustigten Blick.
»Vielleicht werdet Ihr Eure Meinung ändern, wenn Ihr sie seht?«
Tor schüttelte den Kopf.
»Mein Entschluss steht fest.« Anders als sein Bruder würde er sich nie von einer Frau – und sei sie noch so schön – von seinen Pflichten ablenken lassen.
»Ihr werdet einen anderen finden müssen, der Eure geheime Highlander-Streitmacht befehligt.«
Auf der langen Reise von Stirlingshire nach Islay hatte Christina es fast geschafft, sich einzureden, dass alles nur halb so schlimm war. Vielleicht war Tormod MacLeod – sie kannte inzwischen den Namen des Insel-Chiefs, mit dem ihr Vater sie vermählen wollte – kein Unmensch, sondern ein kühner und edler Ritter.
Kaum aber war sie auf Finlaggan eingetroffen, wusste sie sofort, dass ihre Fantasie ihr wieder einmal einen Streich gespielt hatte. Es war schlimmer, als sie ursprünglich befürchtet hatte. Viel schlimmer. Noch nie hatte sie so viele schrecklich aussehende Männer auf einem Fleck gesehen. Nein, nicht Männer, sondern Krieger. Die Inselbewohner sahen aus, als wäre Kampf ihre einzige Bestimmung. Kampflust lag ihnen nicht nur im Blut, sie durchdrang ihren ganzen Körper – von den wilden, narbigen und immer finsteren Gesichtern bis zu ihrer ungewöhnlichen Größe.
Letzteres erwies sich als richtig beunruhigend.
Auch ohne Kettenpanzer – sie trugen überraschend wenig Rüstung – wirkten die Inselbewohner größer und breiter als die Menschen aus den Lowlands. Wohin sie auch blickte, standen Männer, die weit über einen Meter achtzig maßen und mit stark hervortretenden Muskeln ausgestattet waren. Speziell ihre Arme – stark und mit eisenharten Muskeln durchzogen – schienen eigens dafür geschaffen, die Furcht einflößenden Zweihänder, Kampfhämmer, Streitäxte und anderen Kriegswaffen zu schwingen, die sie am Körper befestigt trugen. Und nicht nur die Männer. Auch die Frauen waren groß und kräftig. Ein Geschlecht wahrer Riesen, zumindest hatte sie diesen Eindruck. Anders als ihre große und schlanke Schwester brachte Christina es auf Zehenspitzen stehend auf einen guten Meter fünfzig.
Hier hätte man sie vermutlich nach der Geburt ertränkt.
Die Männer trugen ihr Haar schulterlang, einige mit Zöpfen an den Schläfen, und eine überproportional große Zahl war hellblond.
Das musste am Wikingerblut liegen, dachte sie schaudernd, und empfand plötzlich Mitleid mit ihren Vorfahren, die voller Angst und Schrecken die Langschiffe dieser Barbaren am Horizont auftauchen sahen, in deren Gefolge Chaos und Zerstörung über sie gekommen waren.
Christina verspürte ähnliche Hilflosigkeit und ein überwältigendes Gefühl nahenden Unheils. Sie wusste, dass sie ihre Schwester beschützen musste, doch ihr Plan, den Chief der MacLeods so zu betören, dass er sie und nicht Beatrix zu seiner Gemahlin erkor, erschien ihr nun, an Ort und Stelle angekommen, noch viel beängstigender.
Auf der letzten Etappe ihrer Seereise war ihr jedoch eine andere Möglichkeit eingefallen. Sie hatte gesehen, wie schnell die Seewege im Vergleich zu den Straßen waren. Bei günstigem Wind konnte man lange Strecken in Stunden anstatt in Tagen zurücklegen. Als einer der Bootsleute erwähnt hatte, dass er jüngst von der heiligen Isle of Iona gekommen wäre, war der Funke einer Idee in ihr aufgeflammt. Sie und Beatrix konnten sich nach Iona flüchten und im berühmten Frauenkloster Zuflucht suchen.
Ein verrückter Plan – mit unzähligen Risiken behaftet –, aber immerhin etwas.
An diesem Morgen waren sie und Beatrix nach dem Frühstück ins Dorf gegangen, um erste Erkundigungen einzuziehen, aber Christina würde später am Abend noch einmal hinuntergehen und eine Überfahrt finden müssen. Eine Pilgerfahrt zu der heiligen Insel Sankt Columbans war nichts Außergewöhnliches, vorausgesetzt, niemand entdeckte, wer sie waren.
Der Wind pfiff durch das Schilf entlang des steinernen Dammes, als sie zurück zur Burg gingen. Das unheimliche Geräusch stand im Einklang mit der geradezu bedrückenden Wuchtigkeit der alten Festung, war aber nicht dazu angetan, ihre angespannten Nerven zu beruhigen.
Beatrix musste ihr Unbehagen gespürt haben. Sie nahm Christinas Arm und zog sie im Gehen an sich.
»Bist du dir sicher, Chrissie? Wenn Vater entdeckt, was wir planen …«
»Das wird er nicht«, versicherte Christina ihr mit viel mehr Zuversicht, als sie selbst empfand. Der Gedanke, ihrem Vater zu trotzen, bereitete ihr große Angst.
»Wir machen ja nichts Ungewöhnliches. Wir liefern ihm keinen Grund, misstrauisch zu werden.«
Erst später am Abend, wenn sie ein Boot suchen musste, drohte echte Gefahr. Aber sie wagte nicht, ihre Befürchtungen vor ihrer Schwester zu äußern. Tatsächlich waren Lug und Trug Beatrix völlig wesensfremd. Kam auch noch Furcht dazu, konnte diese Mischung sich als katastrophal erweisen. Ihr Vater durfte keinesfalls Verdacht schöpfen.
»Aber wenn etwas schiefgeht …«
»Nichts wird schiefgehen«, antwortete Christina mit Überzeugung. Sie hoffte es jedenfalls. Ihr Plan war ganz einfach, aber sie hatten noch nie dergleichen unternommen und konnten nicht riskieren, jemanden einzuweihen. Wäre Alex mitgekommen, hätten sie ihn um Hilfe bitten können, aber er war zu ihrem Vetter Simon gesandt worden, einem der engsten Gefährten von Robert Bruce. Sie sah in das verängstigte Gesicht ihrer Schwester.
»Du möchtest doch nach Iona, oder?«
Beatrix’ ganzer Ausdruck veränderte sich. Ihr Gesicht wurde von einem überirdischen Licht erhellt, das Christina den Atem raubte.
»Natürlich möchte ich das. Es ist die Erhörung meiner Gebete, nur hätte ich mir nicht im Traum vorstellen können, dass es möglich würde.« Beatrix seufzte.
»Man denke … das Kloster auf Iona. Es muss der heiligste Ort von ganz Schottland sein.«
»Das werden wir selbst herausfinden«, sagte Christine lächelnd. Zwar teilte sie die religiöse Hingabe ihrer Schwester nicht, aber es war unmöglich, nicht von ihrer freudigen Erregung mitgerissen zu werden. Dort würden sie in Sicherheit sein. Das allein war maßgebend. Zwei jungen Frauen standen nur wenige Möglichkeiten offen. Und wenn man nur die Wahl zwischen einer Ehe mit einem Barbaren und dem Klosterleben hatte, fiel einem die Entscheidung nicht schwer.
Trotzdem war sie nicht ganz überzeugt …
»Aber bist du sicher, dass du es möchtest, Chrissie?« Ihre Schwester ließ den Blick ihrer hellblauen Augen über ihr Gesicht gleiten.
»Das ist mein Traum und nicht deiner. Ich möchte nicht heiraten, aber kannst du das von dir auch sagen?«, schloss sie leise.