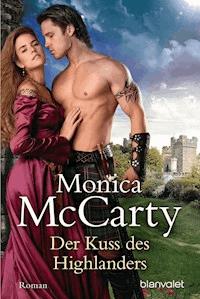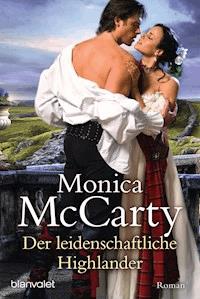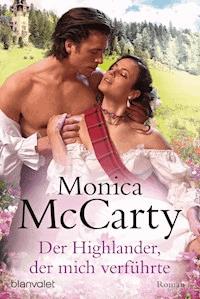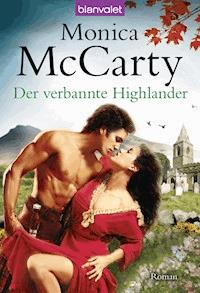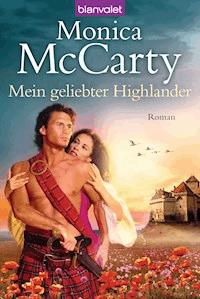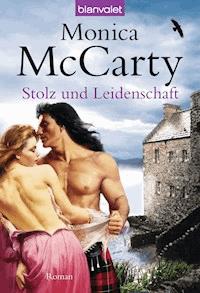4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Highland Guard-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein feuriger historischer Liebesroman!
Als der stolze Highlander Erik MacSorley eine schöne junge Frau aus den Fluten vor der irischen Küste rettet, ahnt er noch nicht, wie viel Ärger das mit sich bringen wird. Denn Lady Elyne de Burgh ist ausgerechnet die Tochter des einflussreichsten irischen Lords und Verbündete von König Edward. Noch dazu scheint sie sein Charme in keiner Weise zu interessieren – eine Herausforderung, der der eigensinnige Mann nicht widerstehen kann …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Buch
Der stolze Highlander Erik MacSorley ist ein brillanter Seemann und Verführer, der keinen Sturm scheut und noch nie von einer Frau abgewiesen wurde. Bis er eines Tages die schöne Ellie aus den Fluten vor der irischen Küste rettet. Und gleich einem Irrtum erliegt: denn die junge Frau ist keinesfalls das Kindermädchen, für das er sie hält, nein, sie ist die Tochter des mächtigsten Adligen Irlands und damit Verbündete von König Edward. Schlimmer ist für Erik jedoch, dass sie keinerlei Interesse an ihm zeigt und sein Charme sie offenkundig kaltlässt. Und obwohl er mit aller Verführungskunst um die temperamentvolle Lady wirbt, Ellie macht klar, dass es für sie mehr als einen gutaussehenden Mann braucht, um sie zu beeindrucken. Das wiederum ist eine Herausforderung, der der eigensinnige Erik nicht widerstehen kann …
Autorin
Monica McCarty studierte Jura an der Stanford Law School. Während dieser Zeit entstand ihre Leidenschaft für die Highlands und deren Clans. Sie arbeitete dennoch mehrere Jahre als Anwältin, bevor sie dieser Leidenschaft nachgab und zu schreiben anfing. Heute lebt sie mit ihrem Mann und ihren Kindern in Minnesota.
Von Monica McCarty bei Blanvalet lieferbar:
Mein ungezähmter Highlander (37035) · Der geheimnisvolle Highlander (37061) · Stolz und Leidenschaft (37403) · Der verbannte Highlander (37540) ·Schottisches Feuer (37608) · Meingeliebter Highlander (37870)
Monica McCarty
Der Highlander,der mein Herz stahl
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Anke Koerten
Die Highlander-GardeWinter 1306-1307
Mit Bruce bereiten sich auf den Western Isles auf den Kampf vor:
Tor »Chief« MacLeod: Führer der Kampftruppe und Meister im Schwertkampf.
Erik, genannt »Hawk«, der Falke, MacSorley: Seemann und Schwimmer.
Gregor »Arrow«, der Pfeil, MacGregor: meisterlicher Bogenschütze.
Zur Rekrutierung von Söldnern mit Bruces Brüdern in Irland:
Eoin »Striker«, der Faustkämpfer, MacLean: Stratege der Piratenkampfweise.
Ewen »Hunter«, der Jäger, Lamont: Fährtenleser und Menschenjäger.
Begleiter und Beschützer der Königin und ihrer Damen im nördlichen Schottland:
Lachlan »Viper«, die Viper, MacRuairi: Experte für heimliches Eindringen und Herausholen.
Magnus »Saint«, der Heilige, MacKay: Bergführer und Waffenschmied.
William »Templar«, der Tempelritter, Gordon: Experte für Alchemie und Sprengkörper.
Robert »Raider«, der Angreifer, Boyd: Meister im Einzelkampf.
Alex »Dragon«, der Drache, Seton: Meister im Dolch- und Nahkampf.
Vorwort
Im Jahre des Herrn dreizehnhundertsechs. Drei Monate nach seiner Krönung zum König von Schottland zu Scone Abbeyerweist sich Robert Bruces verzweifelter Griff nach der Krone als Fehlschlag. Der kurzlebige Aufruhr wird vom englischen König Edward, dem grausamen »Schottenhammer«, erbarmungslos niedergeschlagen.
Wegen der Ermordung seines Rivalen vom Papst exkommuniziert, vom mächtigsten König der Christenheit gejagt sowie von zwei Dritteln seiner Landsleute, die nicht für ihn ins Feld ziehen wollten, im Stich gelassen, kämpft Bruce nun nicht nur um die schottische Krone, sondern um sein Leben. Zwischen ihm und der Niederlage stehen nur die zehn Krieger seiner geheimen Highlander-Garde.
Verloren im Nebel der Vergangenheit und fast vergessen lebt die Legende einer geheimen, von Bruce persönlich auserwählten Abteilung von Elitekriegern aus den finstersten Winkeln der Highlands und Western Isles weiter, einer schlagkräftigen Streitmacht, die ihresgleichen sucht. In einer geheimen Zeremonie aneinandergeschmiedet, bilden sie eine Phantom-Truppe, erkennbar nur an ihren außerordentlichen Fähigkeiten, an ihren Decknamen und am Tatoo auf ihrem Arm, das einen Löwen zeigt.
König Edwards Schreckensherrschaft aber steht erst am Anfang. Sein gefürchtetes Drachenbanner verheißt Gnadenlosigkeit. In den nun kommenden dunklen Tagen haben diese Elite-Kämpfer ihre größte Herausforderung zu bestehen. Nichts Geringeres als die Freiheit einer Nation steht auf dem Spiel.
PROLOG
König Hood, er schleicht verstohlen durchs Moor,Und meidet Stadt und DorfGinge er Englands Baronen ins Netz,Sie würden ihn Englisch lehrenMit aller Gewalt, seinem Mut zum Trotz.Noch wird er gesuchtLandauf, landab.
Politische Lieder aus England, übersetzt von Thomas Wright
Rathlin Island, drei Meilen vor der irischen Küste.In den Iden des September 1306
Robert Bruce schloss die Augen wie ein Feigling und nicht wie ein König. Er wollte die Bilder auslöschen, doch hörten sie nicht auf, ihn zu verfolgen, und blitzten vor seinen Augen wie die Szenen eines Albtraums auf, immer wieder.
Schwerter, in einer endlosen Todeswoge klirrend und schlagend. Vom Himmel dichter Pfeilhagel, der den Tag zur Nacht macht. Lauter Hufschlag der mächtigen englischen Schlachtrösser, alles zertrampelnd, das sich ihnen in den Weg stellt. Der Silberglanz der Kettenhemden dunkel vor Blut und Dreck. Entsetzen und Angst auf den Gesichtern seiner Getreuen, die dem Tod ins Auge blicken. Und der Geruch … eine ekelerregende Mischung aus Blut, Schweiß und Übelkeit, die Nase, Lungen und Gebein durchdringt.
Er hielt sich die Ohren zu, doch ließen sich Geheul und Todesschreie nicht zum Verstummen bringen.
Einen Augenblick lang befand er sich wieder auf dem blutigen Schlachtfeld von Methven, dem Ort der schrecklichen Niederlage. Wo Ritterlichkeit ihn fast das Leben gekostet hätte.
Doch es war kein Albtraum. Bruce schlug die Augen auf, nicht um dem Zorn Edwards von England zu begegnen, sondern jenem Gottes. Der Lärm kam nicht von den Schwertern, sondern vom Gewitter. Vom Himmel hagelten nicht Pfeile, es prasselte eisiger Regen herab. Nicht Todesschreie waren es, die heulten, sondern der Wind. Und das ständige Hämmern kam nicht von Hufen, sondern von den Hammerschlägen des Bootsmannes auf seinen Schild, um den Rhythmus der Ruderer zu steigern.
Aber die Angst … die Angst war die gleiche. Er konnte es den Mienen der umstehenden Männer ansehen. Das Wissen, dass sie alle sterben würden. Nicht auf einem blutigen Schlachtfeld, sondern auf einem gottverfluchten Schiff mitten auf der sturmbewegten See, wie ein Geächteter auf der Flucht aus seinem eigenen Königreich.
»King Hood«, der vermummte König, so nannten ihn die Engländer. Der geächtete König. Umso demütigender, weil es die Wahrheit war. Weniger als eine Hundertschaft Männer in zwei birlinns war von der stolzen Streitmacht geblieben, der er einst zugetraut hatte, sie würde das mächtige englische Heer besiegen können.
Und jetzt … was für ein Anblick. Kein halbes Jahr nach seiner Krönung waren sie zu einem zerlumpten Haufen Geächteter zusammengeschrumpft, auf einem vom Sturm hin und her geworfenen Schiff zusammengedrängt, einige so elend, dass sie sich nur verzweifelt festhielten, andere bibbernd und weiß vor Angst, während sie um ihr Leben Wasser schöpften.
Ausgenommen die Highlander. Die hätten auch nicht den Teufel gefürchtet, wenn er persönlich die Pforte der Hölle öffnen würde, um sie zu empfangen.
Und keiner war furchtloser als der Mann, dem ihr Überleben anvertraut war. Am Heck stehend, während der Regen über sein Gesicht strömte, gepeitscht von Winden in Sturmstärke, kämpfte er mit den Segeltauen – wie ein heidnischer Meergott, bereit, es mit allem aufzunehmen, was die Natur ihm aufzwang.
Wenn jemand sie aus dieser Hölle retten konnte, war es Eric MacSorley – oder Hawk, der Falke, wie man ihn nannte, seit er zur Highlander-Garde gestoßen war, zu Bruces geheimem Elite-Team der besten Kämpfer des Landes. Der kühne Seemann war wegen seiner Geschicklichkeit im Schwimmen und Segeln ausgewählt worden, doch besaß er auch enormen Mut und stellte sich jeder auch noch so gewagten Herausforderung.
An diesem Morgen hatte MacSorley sie vor der Nase der englischen Truppen aus Dunaverty Castle herausgeschmuggelt. Und jetzt versuchte er, die schmale, sechzehn Meilen breite Meeresstraße zwischen Kintyre in Schottland und der irischen Küste im schlimmsten Sturm zu überwinden, den Bruce je erlebt hatte.
»Festhalten, Jungs«, übertönte der wilde Clanführer das Tosen des Sturms. Sein Grinsen war das eines Irren.
»Jetzt kommt es ganz dicke.«
Wie die meisten Highlander hatte auch MacSorley einen Hang zum Tiefstapeln.
Bruce hielt den Atem an, als der Wind das Segel erfasste, das Schiff anhob wie ein Kinderspielzeug und es über aufragende hohe Wellen trug, um es auf der anderen Seite in die Tiefe zu schleudern. Einen schrecklichen Herzschlag lang neigte das Schiff sich gefährlich zur Seite, und er glaubte schon, das wäre es gewesen – nun wäre der Augenblick des endgültigen Kenterns gekommen. Aber wieder einmal setzte der Seemann die Naturgesetze mit einer raschen Bewegung der Segeltaue außer Kraft, und das Schiff lag wieder aufrecht da.
Aber nicht lange.
Wieder kam der Sturm mit aller Macht über sie. Woge um Woge wie hohe, steile Klippen, die sie mit jedem krachenden Anprall zum Kentern zu bringen drohten, grausame Winde, die gegen die Segel schlugen und die Wasser aufwühlten, dichte Regenwände, die den Schiffsrumpf schneller füllten, als man das Wasser ausschöpfen konnte. Sein Herz sank mit jedem Ächzen und Knacken, während die wilde See gegen die Planken schlug und er sich jedes Mal fragte, ob dies die Woge war, die das Schiff zerbrechen lassen und ihn aus seinem Elend befreien würde.
Ich hätte es nie tun sollen. Ich hätte nie gegen die Macht Englands und seinen starken König aufbegehren sollen. Im wirklichen Leben war es nicht David, der Goliath besiegte. Im wirklichen Leben wurde David vernichtet.
Oder endete tot auf dem Grund eines stürmischen Meeres.
Der Highlander jedoch war nicht bereit, die Niederlage hinzunehmen. Voller Zuversicht stand er am Steuer, unnachgiebig wie der Sturm, ohne das leiseste Anzeichen von Zweifel, dass er siegreich bleiben würde. Und doch war es ein Zweikampf des Willens, den er nicht gewinnen konnte. Die Naturkraft war zu stark, auch für den halb gälischen, halb nordischen Spross der berüchtigtsten Seeräuber, die die Welt je gesehen hatte – der Wikinger.
Bruce hörte ein haarsträubendes Krachen, dann erst die Stimme des Seemannes:
»Achtung …!«
Zu spät.
Ein rascher Blick in die Höhe, und er sah, dass ein Teil des Mastes direkt auf ihn heruntersauste.
Dunkelheit umgab ihn, als Bruce die Augen aufschlug. Einen Augenblick lang wähnte er sich in der Hölle. Über seinem Kopf konnte er nur eine Wand scharfer schwarzer Steine ausmachen, glänzend vor Feuchtigkeit. Ein Geräusch zu seiner Linken weckte seine Aufmerksamkeit. Er drehte sich um, und in seinem Kopf explodierte der Schmerz, er sah Sterne, die sich mit ihren Zacken wie Messer in seinen Kopf zu bohren schienen.
Als seine Sicht sich klärte, konnte er Bewegung sehen. Männer – seine Männer – schleppten sich über den steinigen Strand und brachen an einem gewölbten Eingang zusammen, am Eingang einer Höhle, wie es aussah.
Also doch nicht tot.
Er wusste nicht, ob er Freude empfinden sollte. Ein Tod im Wasser war vermutlich jenem vorzuziehen, den Edward ihm bereiten würde, wenn er sie zu fassen bekam.
So weit also war es gekommen. Sein Königreich war auf die feuchte schwarze Wölbung einer einsamen Höhle in den Klippen zusammengeschrumpft.
Eine Bewegung knapp über seinem Kopf verriet, dass sogar sein Anspruch auf dieses elende Königreich nicht unbestritten war. Eine große schwarze Spinne lauerte an der Wand über ihm. Vergeblich bemüht, von einem Felsband zu einem anderen zu springen, fand sie auf der feuchten Oberfläche keinen Halt, rutschte immer wieder ab und baumelte an einem einzigen seidenen Faden im Wind hilflos hin und her. Zum Versagen verdammt, versuchte sie immer wieder ihr Netz zu weben und schaffte es nicht.
Ein Gefühl, das er kannte.
Er hatte geglaubt, schlimmer könne es nach zwei verheerenden Niederlagen auf dem Schlachtfeld nicht kommen. Er hatte ansehen müssen, wie seine Freunde und Parteigänger in Gefangenschaft gerieten, war von seiner Frau getrennt worden und hatte unter beschämenden Umständen aus seinem Königreich fliehen müssen. Er hätte es besser wissen müssen. Nun hatte die Natur ihm fast den Todesstoß versetzt, was die englischen Armeen nicht geschafft hatten.
Aber wieder hatte er den Teufel um seinen Preis betrogen, diesmal dank der todesmutigen Segelmanöver MacSorleys. Wie die Spinne wussten auch diese Highlander nicht, wann man aufgeben musste.
Er aber wusste es.
Er war am Ende. Die See hatte sie diesmal zwar verschont. Seine Sache aber war verloren, und mit ihr Schottlands Chance, das Joch der englischen Tyrannei abzuschütteln.
Hätte er auf Methven auf den Rat seiner Garde gehört, wäre es vielleicht anders gekommen. Aber Bruce hatte sich hartnäckig an seinen ritterlichen Ehrenkodex geklammert und ihren Rat missachtend Sir Aymer de Valences Versprechen geglaubt, den Kampf erst am Morgen zu beginnen. Der englische Kommandant hatte sein Wort gebrochen und mitten in der Nacht angegriffen. Sie waren aus der Burg getrieben worden. Viele seiner größten Mitkämpfer und Freunde waren umgekommen oder in Gefangenschaft geraten.
Die Ritterlichkeit war wahrlich tot. Bruce würde es niemals vergessen. Die alte Art der Kriegführung war dahin. Seine nur halbherzige Zustimmung zu der von den Highlandern geübten Piraten- oder Partisanentaktik, als seine Garde gegründet worden war, war ein Fehler gewesen. Hätte er sich ohne Vorbehalte darauf eingelassen und auf den ritterlichen Ehrenkodex gepfiffen, wäre es nicht zur Katastrophe von Methven gekommen.
Die Spinne versuchte es abermals. Diesmal schaffte sie es beinahe, die Spanne zwischen den Felsen mit ihrem silbernen Faden zu überbrücken, wurde aber im letzten Moment durch einen plötzlichen Windstoß um den Triumph gebracht. Bruce seufzte enttäuscht, von den hoffnungslosen Bemühungen der Spinne sonderbar gefesselt.
Vielleicht weil er eine gewisse Übereinstimmung zwischen ihnen erkannte.
Auch nach der Niederlage von Methven hatte Bruce noch zu hoffen gewagt. Dann war er in Dail Righ auf die MacDougalls getroffen und hatte abermals einen verheerenden Schlag hinnehmen müssen. Die darauf folgende Verfolgungsjagd hatte ihn gezwungen, sich von Frau, Tochter, Schwestern und der Countess of Buchan zu trennen – von der Frau, die ihm vor kaum einem halben Jahr so beherzt die Krone aufs Haupt gedrückt hatte.
Er hatte die Frauen mit Nigel, seinem jüngsten Bruder, unter dem Schutz der Hälfte seiner kostbaren Highlander-Garde nach Norden geschickt und gehofft, bald wieder zu ihnen zu stoßen. Doch waren er und der Rest der Armee zur Flucht nach Süden gezwungen worden.
Die Frauen sind in Sicherheit, beruhigte er sich. Gott stehe ihnen bei, wenn sie Edward in die Hände fielen. Das Drachenbanner machte sogar aus Frauen Geächtete, an denen man sich ungestraft vergehen konnte. Die Männer würden ohne Gerichtsverhandlung hingerichtet werden.
Nach Dail Righ hatte Bruce in den Bergen und in der Heide Zuflucht gesucht und war der Gefangennahme durch MacDougall dank Gregor »Arrow« MacGregor entkommen, einem Highlander-Gardisten, der ihn durch Lennox nach Kintyre und Dunaverty Castle in Sicherheit brachte.
Es war nur eine kurze Atempause. Drei Tage zuvor war die englische Armee eingetroffen und hatte einen Belagerungsring um die Burg gezogen. MacSorley hatte sie nur mit größter Mühe lebend herausgeschafft.
So viele Fehlschläge. Zu viele.
Die Spinne war an ihrem Faden hinaufgeklettert und schien zu einem neuerlichen Versuch bereit. Bruce verspürte eine Anwandlung irrationaler Wut und hätte sie in diesem Augenblick am liebsten mit der Faust zerdrückt.
Siehst du denn nicht, dass der Kampf verloren ist?
Ihm fiel ein, welche Gedanken ihm auf dem Schiff durch den Kopf gegangen waren. Er war so dumm wie diese Spinne gewesen, als er glaubte, Edward von England besiegen zu können. Er hätte es gar nicht versuchen sollen. Er hätte jetzt mit Frau und Tochter in seinem Haus in Carrick sein können, von der Verwaltung seiner Güter in Anspruch genommen, anstatt um sein Leben zu laufen und zuzusehen, wie seine Freunde und Anhänger für ihn starben.
Es war ein Leben, das ihm zum Glück genügt hätte, wäre da nicht seine unerschütterliche Überzeugung gewesen, dass die Krone ihm gehörte. Er war der rechtmäßige König Schottlands.
Aber was machte das jetzt noch aus? Er hatte alles aufs Spiel gesetzt und verloren. Nun stand er mit leeren Händen da.
O Gott, wie müde er war. Am liebsten hätte er die Augen geschlossen, wäre eingeschlafen, um den Albtraum hinter sich zu lassen. Als er den Kopf drehte, fiel sein Blick auf Hawk, der mit dem Anführer der Highlander-Garde, Tor MacLeod, bekannt als Chief, am Ufer ein Gespräch führte. Gemeinsam kamen die zwei Furcht einflößenden Krieger auf ihn zu.
Der Schlaf musste warten.
Seine Geheimgarde war der einzige Lichtblick in den vergangenen Monaten gewesen. Die Kampftruppe hatte seine Erwartungen weit übertroffen. Aber auch sie hatte gegen die katastrophalen Nachwirkungen seiner verhängnisvollen Fehlentscheidung bei Methven nichts ausrichten können.
Als die Krieger näher herangekommen waren, sah Bruce Spuren der Mattigkeit in ihren kampfgestählten Zügen. Es wurde auch Zeit. Anders als die anderen schienen die Highlander von der Serie der Niederlagen, die sie aus Schottland vertrieben hatte, nicht entmutigt. Gegen schwankende Gemütslagen immun, schien nichts sie aus der Ruhe bringen zu können. Obschon er ihre Entschlossenheit und Widerstandskraft schätzte, empfand er seinen eigenen Frust dagegen als Schwäche.
»Wie geht es Eurem Kopf?«, fragte MacSorley.
»Ihr habt einen ordentlichen Schlag abgekriegt.«
Der Mast, fiel Bruce ein. Er rieb seitlich seinen Kopf und massierte die große Beule, die sich gebildet hatte.
»Ich werde es überleben.« Im Augenblick jedenfalls.
»Wo sind wir?«
»Auf Rathlin«, sagte MacLeod, »an unserem Ziel, sicher und relativ heil.«
MacSorley zog eine Braue in die Höhe.
»Hattet Ihr Zweifel?«
Bruce schüttelte den Kopf. Inzwischen hatte er sich an die Scherze des Highlanders gewöhnt.
»Und die übrigen Männer?«, fragte er.
»In Sicherheit«, erwiderte Tor.
»Sie haben Schutz in einer nahen Bucht gefunden, da diese Höhle nur etwa ein Dutzend Mann aufnehmen kann. Ich habe Hunter und Striker beauftragt, morgen Proviant von der Burg zu holen. Seid Ihr sicher, dass Sir Hugh uns seine Hilfe nicht versagen wird?«
Bruce zog die Schultern hoch.
»Der Lord of Rathlin steht treu zu Edward, doch er ist auch mein Freund.«
Tors Mund wurde zu einem grimmigen Strich.
»Wir können nicht riskieren, länger hierzubleiben. Wenn die Engländer merken, dass wir nicht mehr auf Dunaverty sind, werden sie die ganze Flotte auf uns hetzen. Wegen Eurer Bindungen an Irland werden sie dort zuerst nachsehen.«
Die Familie hatte seit Jahren Landbesitz in Antrim an der irischen Nordküste. Und seine Frau Elizabeth de Burgh war die Tochter des mächtigsten Earls von Irland. Doch sein Schwiegervater, der Earl of Ulster, war ein Mann Edwards.
»Sobald ich die Vorräte habe, brauchen wir nur einen oder zwei Tage zur Reparatur der Schiffe«, sagte Hawk.
Bruce nickte. Er hätte Befehle erteilen sollen, war aber nicht fähig, das überwältigende Gefühl der Sinnlosigkeit abzuschütteln, das ihn niederdrückte.
Welche Rolle spielte das alles?
Aus dem Augenwinkel nahm er wahr, wie die Spinne wieder von der Felskante glitt.
»Seht Ihr diese Spinne?« sagte er, auf die Wand zu seiner Rechten deutend. Die Männer nickten ausdruckslos. Bruce war sicher, dass sie sich fragten, ob er den Verstand verloren hätte.
»Ich warte schon eine ganze Weile, dass sie endlich aufgibt. Es ist ungefähr das sechste Mal, dass ich beobachte, wie sie die Distanz zu überwinden sucht und immer wieder ins Nichts fällt.« Er schüttelte den Kopf.
»Möchte wissen, wie oft sie es noch versucht, bis ihr klar wird, dass es nicht klappt.«
Hawk grinste ihn an.
»Jede Wette, dass es eine Highland-Spinne ist, Euer Gnaden, und dass sie es so lange versucht, bis sie es schafft. Für uns Highlander gibt es kein Aufgeben. Wir sind ein hartnäckiger Schlag.«
»Meint Ihr nicht eher eigensinnig und stur?«, erwiderte Bruce spöttisch.
Hawk lachte.
»Auch das.«
Bruce konnte ihm seine Bewunderung nicht versagen, weil der Seemann auch in der aussichtslosesten Lage nicht den Humor verlor. Meist war es Hawks gute Laune, die die anderen aufmunterte und weitermachen ließ, heute aber schaffte es nicht einmal der hünenhafte Nordmann, Bruce aus seinem Zustand der Hoffnungslosigkeit zu reißen.
»Schlaft ein wenig, Sire«, sagte Tor, »für uns alle war es ein langer Tag.«
Bruce nickte, zu müde, um zu widersprechen.
Licht kitzelte seine Lider, milde Wärme liebkoste Bruces Wange wie eine sanfte, mütterliche Umarmung. Er öffnete die Augen einem Sonnenstrahl, der die Höhle erhellte. Ein neuer Tag war hell und sonnig heraufgedämmert, ein scharfer Kontrast zu der Weltuntergangsstimmung des Tages zuvor.
Es dauerte einen Augenblick, bis er den Schlaf abgeschüttelt hatte und sein Blick sich klärte. Er schaute zu den Felsen über sich auf und stieß eine Verwünschung aus.
Verdammt will ich sein …
Zwischen zwei Felsvorsprüngen spannte sich über etwa zwölf Zoll das prächtigste Spinnennetz, das er je gesehen hatte. Die feinen Seidenfäden glitzerten und funkelten wie eine prächtige Krone fein miteinander verbundener Diamanten in der Sonne.
Sie hatte es geschafft. Die kleine Spinne hatte ihr Netz gewoben.
Er lächelte. Einen Moment konnte er ihren Triumph nachempfinden.
Methven. Dal Righ. Tod und Gefangennahme seiner Freunde. Die Trennung von seiner Frau. Der Sturm. Vielleicht war es doch nicht Gottes Vergeltung, sondern eine Prüfung.
Und die Spinne eine Sendbotin Gottes.
Er bemerkte, dass sich ein Stück weiter der Seemann rührte, und rief ihm zu:
»Ihr habt recht behalten.« Er deutete nach oben.
Hawk benötigte einen Moment, um zu begreifen, was Bruce meinte, doch als er das Netz sah, grinste er.
»Ach, hat sie es doch geschafft. Eine gute Lektion an Ausdauer, meint Ihr nicht auch?«
Bruce nickte nachdenklich.
»Allerdings. Nach einem Fehlschlag darf man nicht aufgeben. Eine Lebensregel.«
Eine, die er vergessen hatte.
Er wusste nicht, ob es die Spinne oder das Heraufdämmern eines neuen Tages war, doch es spielte keine Rolle. Die schwarze Hoffnungslosigkeit des Vortages lag hinter ihm, er fühlte sich für den vor ihm liegenden Kampf frisch gestärkt. Mochte Edward ihn noch so oft bezwingen, solange noch Atem in ihm war, würde Robert Bruce weiterkämpfen.
King Hood, der König, der sich verbergen musste, war der rechtmäßige König von Schottland und würde sein Reich zurückerobern.
»Ihr habt einen Plan, Sire?«, fragte Hawk, der die Veränderung in ihm spürte.
Bruce nickte.
»Allerdings.« Nach kurzer Pause lieferte er dem kühnen Seemann jene Art forscher Äußerung, die dieser schätzen würde.
»Ich will gewinnen.«
Hawk grinste. »Jetzt sprecht Ihr wie ein Highlander.«
Bruce würde sich Zeit lassen. Die nächsten Monate würde er im Nebel verschwinden und sich zwischen den hunderten Inseln an der Westküste verlieren. Er würde seine Streitmacht um sich scharen, um es von Neuem zu versuchen. Immer wieder.
Bis es ihm glückte.
1
Rathlin Sound, vor der Nordküste IrlandsLichtmess-Tag, 2. Februar 1307
Erik MacSorley konnte einer Herausforderung niemals widerstehen, auch einer unausgesprochenen nicht. Ein Blick auf das Fischerboot, das von der englischen Galeere verfolgt wurde, und er wusste, dass es heute Nacht nicht anders sein würde.
Er hätte das Schiff ignorieren und seine Mission fortsetzen sollen, die erforderte, dass er ungesehen am englischen Patrouillenschiff vorbeischlüpfte, um nach Dunluce Castle zu gelangen, wo er mit den irischen Söldnern zusammentreffen würde.
Aber wo wäre da der Spaß geblieben?
Nach über vier Monaten des Versteckspiels, einem Hüpfen von einer Insel zur anderen, das ihnen nur kurze Vorstöße aufs Festland gestattete, um Bruces Pachtzins einzuheben und gelegentliche Erkundungsmissionen zu wagen, verdienten Erik und seine Leute ein klein wenig Aufregung.
Er war so brav wie ein Mönch zur Fastenzeit gewesen (bis auf das schöne Geschlecht, aber ein Keuschheitsgelübde hatte er nicht abgelegt, als er Bruces Highlander-Garde beigetreten war), hatte sich bei den wenigen Gelegenheiten, bei denen er seit dem Sturm und der Flucht aus Dunaverty Castle hatte aktiv werden müssen, von Ärger ferngehalten und hatte eine für ihn unnatürliche Zurückhaltung geübt. Da nun Devil’s Point praktisch in Pinkelweite lag, Flut war und er starken Rückenwind hatte, war die Versuchung zu groß, um eine Gelegenheit vorbeigehen zu lassen.
Mit neunundzwanzig gab es für Erik keinen Wind, den er nicht beherrschen konnte, keinen Mann, der ihm auf oder im Wasser gewachsen war, kein Schiff, das er nicht austricksen konnte, oder, dachte er mit spitzbübischem Schmunzeln, keine Frau, die ihm widerstehen konnte.
An diesem Abend würde es nicht anders sein. Der dichte Nebel machte die Nacht perfekt für ein Wettrennen, zumal er an der tückischen Küste von Antrim blindlings navigieren konnte.
Sie hatten die Nordwestecke von Rathlin Island auf dem Weg südwärts nach Dunluce Castle an der Nordküste Irlands eben umschifft, als sie unweit Ballentoy Head das englische Patrouillenschiff sichteten. Seitdem die Engländer vor Kurzem Dunaverty Castle eingenommen und festgestellt hatten, dass Bruce aus Schottland entwichen war, hatte die feindliche Flotte ihre Aufklärungsfahrten im North Channel verstärkt und jagte den flüchtigen König.
Aber Erik gefiel es gar nicht, wenn sich ein Aufklärer so nahe bei seinem Ziel herumtrieb. Um zu verhindern, dass die Engländer seine Pläne durchkreuzten, musste er sie irgendwohin lotsen, wo sie keinen Ärger machen konnten. Außerdem konnten die Fischer ein wenig Hilfe gebrauchen, wie es aussah.
Englische Hunde. Die heimtückische Ermordung von MacLeods Clanleuten stand ihm noch deutlich vor Augen. Und die wagten, ihn als Piraten zu beschimpfen.
Er gab Befehl, die Segel zu hissen.
»Was soll das?«, stieß Sir Thomas Randolph gedämpft hervor, »man wird uns sichten.«
Erik schüttelte seufzend den Kopf. Bruce stand in seiner Schuld. Als Mitglied einer Elite-Truppe war es nicht seine Aufgabe, Kindermädchen für den aufgeblasenen Neffen des Königs zu spielen. Der König würde eine oder zwei Burgen zusätzlich zu den Ländereien in Kintyre herausrücken müssen, die er ihm zurückzugeben versprochen hatte, wenn Bruce seine Krone zurückgewonnen und Edward Langbein nach England zurückgedrängt hatte.
Randolph war dem ritterlichen Ehrenkodex und seinen ritterlichen »Pflichten« so sehr verhaftet, dass Alex Seton – einziger Ritter (und Engländer) in der elitären Highlander-Garde – neben ihm geradezu locker wirkte. Nach zwei Monaten, in denen Erik Randolph »trainiert« hatte, empfand Erik neuen Respekt vor Setons Partner Robbie Boyd. Erik hatte so viel über Regeln und Ehre zu hören bekommen, dass es ihm für sein ganzes verdammtes Leben reichte. Randolph ging ihm, der eigentlich sehr verträglich war, zunehmend auf die Nerven.
Erik zog eine Braue übertrieben langsam in die Höhe.
»Das ist genau der Punkt, wenn wir sie vom Kurs abbringen wollen.«
»Aber verdammt, Hawk, was ist, wenn sie uns erwischen?«, sagte Randolph, der Erik mit seinem nom de guerre, seinem Kampfnamen, anredete.
Auf einer Mission wurden Decknamen benutzt, um die Identität der Highlander-Garde nicht preiszugeben, doch als Seemann konnte Erik nicht anders, als Außenstehende mit hineinzuziehen. Er brauchte Männer als Ruderbesatzung, und da die anderen Mitglieder der Highlander-Garde verstreut agierten, hatte er sich an seine eigenen Leute vom Clan der MacSorleys gehalten. Die Handvoll Männer, die Erik auf dieser geheimen Mission begleitet hatten, waren seine vertrautesten Sippenangehörigen und gehörten zu seinem persönlichen Gefolge. Sie würden ihn bis zum Tod verteidigen.
Bislang war das berüchtigte »Hawk«-Segel nicht mit den Gerüchten in Verbindung gebracht worden, die sich landauf, landab um Bruces angebliche Geheimarmee rankten, doch wusste er, dass sich das jeden Moment ändern konnte.
Die in Hörweite Randolphs sitzenden Ruderknechte lachten schallend über dessen absurde Vermutung.
»Ich habe kein Rennen verloren seit …« Erik wandte sich fragend an seinen Ersten Offizier Domnall, der mit einem Schulterzucken reagierte.
»Wenn ich das wüsste, Captain.«
»Seht Ihr«, sagte Erik mit überlegenem Grinsen zu Randolph, »kein Grund zur Besorgnis.«
»Aber was ist mit dem Silber?«, zeigte der junge Ritter sich beharrlich.
»Wir können nicht riskieren, dass es den Engländern in die Hände fällt.«
Das Geld – im Wert von fünfzig Pfund –, das sie mit sich führten, war für die Söldner bestimmt. Kleine Spähtrupps hatten es im Lauf des Winters von Bruces Pächtern in Schottland eingesammelt. Die nächtlichen Überfälle hatten nur dazu gedient, die Gerüchte von Bruces Phantom-Garde zu nähren. Dank wichtiger Informationslecks des feindlichen Lagers hatten MacSorley und die anderen Gardisten es geschafft, unentdeckt nach Schottland und wieder heraus zu gelangen. Erik glaubte, die Quelle zu kennen.
Bruce hoffte, die Stärke seiner Streitmacht mit Söldnern auf das Dreifache zu steigern. Ohne diese zusätzlichen Kämpfer war es dem König unmöglich, die englischen Garnisonen in den schottischen Burgen anzugreifen und sein Königreich zurückzuerobern.
Es war Eriks Aufgabe, sie dorthin zu bringen. Während der Zeitpunkt des Angriffs näher rückte, rechnete Bruce damit, dass Erik die Anwerbung der Söldner sicherte und sie an der englischen Flotte vorüber rechtzeitig für den am fünfzehnten Februar geplanten Angriff – in weniger als zwei Wochen – nach Arran schaffte.
»Immer mit der Ruhe, Tommy, mein Junge«, sagte Erik, wohl wissend, dass der Widerspruchsgeist des jungen Edelmannes, dessen Schwert fest an seine Kehrseite geschnallt war, durch diese Ermahnung noch wachsen würde.
»Ihr redet wie ein altes Weib. Das Einzige, das sie erwischen werden, ist unser Kielwasser.«
Randolph schürzte die Lippen so heftig, dass sie weiß wurden und einen starken Gegensatz zu seinem geröteten Gesicht bildeten.
»Ich heiße Thomas«, knurrte er, »Sir Thomas, wie Ihr verdammt gut wisst. Unsere Befehle lauten, die Söldner zu holen und sie zu meinem Onkel zu bringen, ohne dass die englischen Patrouillen von unserer Anwesenheit etwas mitbekommen.«
Ganz so einfach war es nicht, aber den gesamten Plan kannte nur eine Handvoll Menschen, und Randolph gehörte nicht zu ihnen. Es war nicht vorgesehen, dass die Söldner jetzt schon zu Bruce stießen, es ging nur um die nächste Zusammenkunft.
So war es sicherer. Wollte Bruce auch nur die kleinste Chance gegen die schlagkräftige englische Armee haben, war es unumgänglich, sich einen Überraschungseffekt zu sichern.
Nach vielen Jahren, die er als Söldner in Irland gekämpft hatte, wusste Erik, dass man mit Informationen vorsichtig umgehen musste. Die meisten Söldner brachten nur für Bares Loyalität auf, und die McQuillans waren ein wilder Haufen – vorsichtig ausgedrückt.
Der König würde ihnen Einzelheiten ihres Planes erst anvertrauen, wenn es unbedingt erforderlich war, den Ort des Zusammentreffens sowie Zeit und Ort des Angriffs eingeschlossen. Erik sollte die Iren zwei Nächte vor dem Angriff in Empfang nehmen und sie sodann persönlich nach Rathlin geleiten, wo Bruce die gesamte Armee um sich scharen würde. In der Nacht darauf sollte Erik die gesamte Flotte zur Insel Arran bringen, von der aus Bruce am fünfzehnten Februar seinen Angriff gegen das schottische Festland führen wollte.
Der Zeitpunkt war von größter Bedeutung, da Bruces Truppen aus zwei Richtungen vorrücken sollten. Bruce selbst würde bei Turnberry angreifen, seine Brüder am selben Tag im Süden bei Galloway.
Da die Zeit knapp war, und sie sich nur bei Nacht fortbewegen konnten, durften sie sich keinen Fehler leisten.
»Ich kann keine Überraschungen gebrauchen, Tommy. Auf diese Weise sichern wir uns ab.«
Nichts würde seiner Mission in die Quere kommen, aber ein wenig Spaß durfte dabei schon herausschauen.
»Es ist tollkühn«, protestierte Randolph wütend.
Erik schüttelte den Kopf. Der Bursche war wirklich hoffnungslos.
»Tommy, wirf nicht mit Worten um dich, die du nicht verstehst. Du würdest Tollkühnheit nicht als solche erkennen, wenn sie dich in den Hintern beißt. Tollkühn ist es nur, wenn die Möglichkeit bestünde, dass sie uns fassen, was sie – wie du eben gehört hast – nicht tun werden.«
Seine Männer hissten das Rahsegel. Die schweren Wollfasern des mit Tierfett imprägnierten Segeltuchs entfalteten sich laut knatternd im Wind und enthüllten den Furcht einflößenden schwarzen Seefalken auf weiß-golden gestreiftem Hintergrund, ein Anblick, bei dem er unweigerlich von Erregung erfasst wurde.
Wenig später hörte er einen Schrei übers Wasser hallen. Erik wandte sich mit ungerührtem Grinsen seinem missbilligenden Gefährten zu.
»Sieht aus, als wäre es zu spät, Junge. Man hat uns gesichtet.« Er nahm die zwei Schoten, wappnete sich gegen den Windstoß und rief seinen Männern zu:
»Sollen die englischen Köter nicht nur ihren Schwänzen nachjagen. Auf nach Benbane, Burschen.«
Die Männer lachten über seinen Scherz. Für einen Engländer war »Schwanz« ein schmähliches Schimpfwort. Verdammte Feiglinge.
Das Segel füllte sich mit Wind, und das birlinn flog dahin, fegte über die Wellen wie ein Vogel im Flug und machte dem Falkenwappen des Segels und der Figur am Schiffsbug alle Ehre.
Je schneller sie dahinflogen, desto heißer brauste das Blut durch Eriks Adern. Seine Muskeln strafften sich, bebten vor roher Energie und hielten das Boot in einem spitzen Winkel zum Wasser. Der Wind riss an seinem Haar, besprühte sein Gesicht und füllte seine Lungen wie ein Elixier. Dieses rasend schnelle Gleiten war unglaublich. Elementar. Freiheit in ihrer reinsten Form.
Er hätte sich nicht lebendiger fühlen können. Ja, dafür war er geboren.
In den nächsten Minuten waren die Männer ganz still, während Erik das Boot in Position manövrierte und direkt Kurs auf Benbane Head nahm, den nördlichsten Punkt von Antrim. Seine Clanleute kannten ihn gut genug, um zu wissen, dass er es so geplant hatte. Es war nicht das erste Mal, dass er die Flut und tückische Felsenriffe zu seinen Gunsten nutzte.
Ein Blick über die Schulter zeigte ihm, dass seine List geglückt war. Die englische Patrouille hatte die Fischer vergessen und nahm die Verfolgung auf.
»Schneller«, übertönte Randolph das Tosen des Windes, »sie holen auf.«
Der Junge wusste, wie man jemandem den Spaß verderben konnte. Erik musste jedoch widerstrebend zugeben, dass die englische Galeere näher herangekommen war als erwartet. Der Captain verstand sein Geschäft – und hatte Glück. Der Engländer hatte einen Windschwall genutzt, der stärker war als jener, dem Erik sich anvertraut hatte, und steigerte die Geschwindigkeit dank seiner Ruderknechte. Eriks Ruder waren noch ungenutzt. Er würde sie später brauchen.
Das bisschen englisches Glück bekümmerte ihn nicht sonderlich – hin und wieder fand sogar ein blindes Huhn ein Korn.
»So soll es sein, Tommy. Ich möchte sie so nahe haben, dass ich sie in die Klippen befördern kann.«
Devil’s Point war ein Felsvorsprung, der wie ein Steinfinger an der Küste westlich Benbane Head an der Nordküste Irlands ins Meer ragte. Es war Flut, der Felsen war nun unsichtbar, bis es zu spät war. Sein Plan sah vor, die Engländer zwischen sich und das Land zu drängen, sodass nicht sein Schiff von den scharfen Klippen in Stücke gerissen wurde. Im letzten Moment wollte Erik sie dicht an sich herankommen lassen, dann scharf nach Westen knapp am Felsenriff vorbei wenden und den Kurs exakt halten, während er die Engländer dem Teufel entgegenlenkte.
Eines jener waghalsigen Manöver, die er im Schlaf ausführen konnte.
»Felsen?«, sagte Randolph mit angstvollem Unterton, »aber wie wollt Ihr bei diesem Nebel etwas sehen?«
Erik seufzte. Wenn der Bursche nicht endlich lernte, Ruhe zu bewahren, würde ihn sein Herz im Stich lassen, ehe er dreiundzwanzig wurde.
»Ich sehe genug. Vertraut mir, mein furchtloser junger Ritter.«
Die dramatisch hohen Felsen der Küste tauchten vor ihnen auf. An klaren Tagen wirkten die majestätischen, dunklen, von smaragdgrünen Hügelkuppen gekrönten Felswände atemberaubend, an diesem Abend aber waren die aufragenden dunklen Gebilde gespenstisch und bedrohlich.
Er warf einen Blick zurück und zog eine Braue hoch. Sein Blick verriet einen Anflug von Bewunderung. Der englische Köter hielt sich gar nicht so übel. Tatsächlich war er so gut, dass Eriks Zeitplan über den Haufen geworfen wurde. Parallel zur Küste zu segeln würde nicht klappen; er musste sie direkt auf das Riff zuführen und erst im letzten Moment wenden – direkt in den Wind.
Der englische Captain mochte gut sein …
… aber Erik war besser.
Ein breites Lächeln legte sich um seinen Mund. Es würde noch spaßiger werden, als er geahnt hatte.
Da sein Vetter Lachlan »Viper« MacRuairi im Norden bei den Frauen war, und Tor »Chief« MacLeod als persönlicher Leibwächter des Königs auf dem Festland gebunden war, hatte Erik schon länger keinen richtigen Wettstreit mehr ausgetragen. Mit einem Engländer aber hätte er ihn am allerwenigsten erwartet.
Es war so dunkel und verhangen, dass man den genauen Verlauf der Küste nicht erkennen konnte. Erik aber wusste, dass sie ganz nahe war. Er spürte es. Das Blut brauste rascher durch seine Adern, als er sich die Gefahr der nächsten Augenblicke ausmalte. Wenn etwas schiefging oder wenn er sich in seinen Berechnungen geirrt hatte, würden nicht nur die Engländer zur Küste schwimmen müssen.
Er drehte sich zu Domnall um, der für das Ruder am Heck zuständig war.
»Jetzt!« Es war der Befehl, gegen den Wind steuerbords zu kreuzen.
»Los, wir schicken die englischen Hunde direkt in die Hölle!«
Die Männer reagierten mit begeistertem Johlen.
Augenblicke später knatterte das Segel, und das Schiff drehte scharf steuerbords: Devil’s Point lag direkt voraus.
Er hörte das scharfe Schnappen des Segels hinter sich, als die Engländer ihrem Beispiel folgten und das jähe Wendemanöver gekonnt durchführten.
Die Engländer waren direkt hinter ihnen, beinahe in Reichweite ihrer Langbogen.
Es war fast so weit …
»Haltet an … im Namen Edwards, durch Gottes Gnade König von England!«, rief hinter ihnen eine Stimme auf Englisch.
»Ich diene keinem König außer Bruce«, erwiderte Erik auf Gälisch.
»Airson an Leomhann!« Er brüllte den Schlachtruf der Highlander-Garde: Für den Löwen.
Die Stimmenkakophonie hinter ihnen ließ erkennen, dass jemand seinen Ruf verstanden hatte.
»Verräter!«, erklang es.
Ohne den Rufen Beachtung zu schenken, konzentrierte er sich voll und ganz auf den schmalen Streifen schwarzen Wassers, der vor ihm zu sehen war.
Auf dem Schiff herrschte höchste Anspannung. Nur ein kleines Stück noch. Ein paar hundert Fuß. Er nahm die Klippen an der Küste zur Linken scharf ins Visier, suchte nach dem scharfen Grat, der seinen Bezugspunkt markierte, doch der Dunst behinderte ihn und erschwerte ihm die Sicht.
Ich bin blind, ermahnte er sich.
Seine Männer rutschten beklommen auf ihren Bänken hin und her, in Erwartung seines Befehls die Hände an den Rudern.
»Was ist los?«, fragte Randolph ein wenig schrill. Er spürte die Spannung.
»Ruhig, Jungs«, sagte Erik, ohne den Ritter zu beachten.
»Wir sind fast da …«
Erik schlug das Herz heftig in seiner Brust, stark und stetig. Jetzt kam die echte Nervenprobe. O Gott, wie er das liebte! Alle Instinkte waren auf die drohende Gefahr ausgerichtet, drängten ihn, das Schiff zu wenden, doch er zuckte nicht mit der Wimper. Noch nicht …
Noch ein paar Fuß, und der englische Captain – erfahren oder nicht – konnte dem felsigen Bett, das Erik ihm bereitet hatte, nicht mehr entkommen.
Gerade wollte er den Befehl geben, als die Katastrophe hereinbrach. Ein Riesenbrecher, ein richtiger Wellenberg, erhob sich wie ein Schlangenrachen über ihnen und krachte steuerbords gegen das Schiff, drängte sie näher zur Küste hin und verzögerte sein präzise berechnetes Manöver, das ihn um den Felsvorsprung führen sollte, um weitere zwanzig Fuß.
Fluchend hielt er die Segeltaue fest. Die Klippen waren zu nahe. Schon konnte er das verräterische weiße Schaumband der Wellen ausmachen, die sich an der Spitze der unter Wasser liegenden Felsen brachen.
Nun war für die geplante kühne Wende kein Platz mehr. Seine einzige Chance, den Felsen zu entgehen, war ein höchst riskantes Manöver direkt in den Wind.
Sehr interessant. Sein Puls schlug schneller. Für Augenblicke wie diese, die Können und Nerven auf die Probe stellten, lebte er.
»Jetzt!«, brüllte er. »Legt euch in die Riemen, Jungs!«
Domnall agierte entsprechend am Steuer, und die Männer tauchten die Ruder zu einer jähen Wende ein, während Erik das Segel mit aller Kraft scharf am Wind hielt, um sie aus der Gefahrenzone zu bringen.
Er hörte laute Stimmen auf dem Schiff hinter sich, war aber völlig auf die vor ihm liegende, fast unmögliche Aufgabe konzentriert. Wasser und eigener Schwung drängten sie zu den keine zehn Fuß backbords dräuenden Felsen. Die Männer ruderten stärker und nutzten jede Unze ihrer aufgesparten Energie. Energie, über die die englischen Ruderknechte nicht mehr verfügten.
Der Kiel glitt knapp an der Spitze des Felsenriffes vorbei.
Ein paar Fuß mehr …
Aber die Klippen zur Linken kamen immer näher – und wurden höher – während das birlinn auf die Katastrophe zuschoss. Er hörte Randolph abwechselnd fluchen und beten, ließ aber in seiner gespannten Aufmerksamkeit nicht nach.
»Rascher!«, rief er seinen Männern zu. Seine hervortretenden Armmuskeln brannten von der Anstrengung, die Taue zu halten.
»Fast geschafft …«
Er hielt den Atem an, als das Boot an der Spitze des Vorsprungs vorüberglitt und alle seine Sinne auf die Geräusche unter der Wasserlinie gerichtet waren. Dann hörte er das leise Schürfen. Das unverkennbare Geräusch von Fels an Eiche, das den meisten Seeleuten Angst eingejagt hätte. Erik aber blieb ruhig. Das Geräusch dauerte einige Sekunden an, verstärkte sich aber nicht. Sie hatten es geschafft.
Ein breites Grinsen zeigte sich auf seinem Gesicht. Ja, so sollte es sein! Noch mehr Erregung als in dem Sturm, in den sie auf der Flucht aus Dunaverty geraten waren.
»Geschafft, Leute!«
Jubel erhob sich. Ein Jubel, der noch lauter wurde, als sie hinter sich einen Schreckensschrei hörten, dem ein lautes Krachen folgte, als das englische Schiff gegen den Fels prallte.
Er überließ die zwei Taue einem seiner Männer und sprang auf eine als Bank dienende Kiste. Sein Lohn war der freie Blick auf die englischen Seeleute, die sich auf den Klippen, die eben ihr Boot in Stücke gerissen hatten, verzweifelt in Sicherheit brachten. Der Wind trug ihm ihre Flüche zu.
Er verbeugte sich mit einer dramatisch-schwungvollen Handbewegung.
»Grüßt Eddie von mir, Jungs.«
Die neue Welle von Flüchen, die sich daraufhin erhob, reizte ihn zu noch lauterem Lachen.
Er sprang herunter und versetzte Randolph einen Schubs in den Rücken. Der arme Junge sah ein wenig grün aus.
»Das war jetzt riskant.«
Der junge Ritter sah ihn mit einer Mischung aus Bewunderung und Ungläubigkeit an.
»Ihr habt ein höllisches Glück, Hawk. Aber eines Tages wird es Euch im Stich lassen.«
»Ja, vielleicht habt Ihr recht.« Erik zwinkerte ihm mit Verschwörerblick zu.
»Aber heute Nacht nicht.«
Das glaubte er jedenfalls.
»Beim Gebein St. Columbans, Ellie! Wann hast du zum letzten Mal richtig Spaß gehabt? Du bist richtig langweilig geworden.« Matty betonte Letzteres mit der übertriebenen Dramatik einer Achtzehnjährigen, sodass es sich anhörte, als hätte Ellie sich mindestens mit Lepra angesteckt.
Ellie ließ sich von den auf ihrem Bett verstreuten Stoffbahnen nicht ablenken und antwortete ihrer jüngeren Schwester automatisch:
»Ich bin nicht langweilig, und du sollst nicht fluchen.« Sie hob ein Stück hellblaue Seide an ihre Brust.
»Was hältst du davon?«
»Siehst du!« Matty warf verzweifelt die Hände in die Höhe.
»Genau das meine ich. Du bist nur ein paar Jahre älter als ich und benimmst dich wie mein Kindermädchen. Dabei war die alte sauertöpfische Bertha lustiger als du. Und Thomas sagt ständig ›beim Gebein St. Columbans‹ und niemand verwehrt es ihm.«
»Ich bin sechs Jahre älter, und Thomas ist keine Lady.« Ellie rümpfte beim Anblick ihres Spiegelbilds die Nase und warf das Blau auf den wachsenden Haufen unpassender Farben. Die momentan so beliebten hellen Pastelltöne waren für ihr dunkles Haar und ihre dunklen Augen nicht günstig.
Matty, der Pastellfarben hervorragend standen, kniff ihre großen blauen Augen zusammen. Mathilda de Burgh ärgerte sich über alle Maßen, wenn man ihr die Freiheiten, die ihr Zwillingsbruder genoss, praktisch vor die Nase hielt. Wenn sie ihr reizendes Kinn entschlossen vorschob, sah sie aus wie ein störrisches Kätzchen.
»Du weißt genau, dass dies ein lächerlicher Grund ist.«
Ellie zog die Schultern hoch, weder zustimmend noch missbilligend.
»So ist es eben.«
»Es muss nicht so sein.« Matty nahm ihre Hand und sah sie flehend an. Ihrem seidigen Blondhaar, der Porzellanhaut, den roten, geschwungenen Lippen und den großen blauen Augen konnte man nur schwer widerstehen, aber Ellie hatte ausreichend Erfahrung darin. Bis auf einen waren alle ihre Geschwister auffallend hübsch, mit hellem Haar und hellen Augen. Sie und Walter waren die einzigen mit der dunklen normannischen Färbung ihres Vaters.
Eine heiße Woge der Traurigkeit übermannte sie. Jetzt war sie die einzige Dunkelhaarige.
»Deshalb wird es heute Abend so lustig sein«, bohrte Matty hartnäckig weiter.
»Es ist das einzige Mal, dass wir mit den Männern schwimmen dürfen. Es ist deine letzte Chance. Nächstes Jahr wirst du schon bei deinem jungen Ehemann in England sein.« Sie ließ einen verträumten Seufzer folgen.
Ellies Magen hob sich ein wenig wie immer, wenn die Rede auf ihre bevorstehende Heirat kam, doch unterdrückte sie das plötzliche Unbehagen.
»Der Jungfrauensprung ist nichts für Damen unseres Standes.«
Das klang selbst in ihren eigenen Ohren zu tugendhaft und züchtig. Sie biss sich auf die Lippen. So wie das heidnische Julfest dem Weihnachtsfest gewichen war, hatte auch der uralte nordische »Jungfrauensprung« (später Mädchensprung genannt, um die Kirche nicht zu verstimmen), bei dem die Heiden dem Meergott Aegir junge Mädchen geopfert hatten, dem Fest Maria Lichtmess weichen müssen – dem Tag, der die Weihnachtszeit beendete. Die Kirche sah das heidnische Fest nicht gern, unternahm aber nicht den Versuch, es zu verbieten. Vielleicht weil man wusste, dass jeder Versuch zum Scheitern verurteilt sein würde.
An jedem zweiten Februar um Mitternacht sprangen die Mädchen aus der Gegend in die eiskalte See und rannten dann zurück ans Ufer, um sich an den riesigen Feuern (anstatt wie im hohen Norden in Saunas) zu wärmen. Jenes Mädchen, das es am längsten im kalten Wasser aushielt, wurde zur Eisprinzessin gekrönt. Ellie hatte die Krone die letzten drei Male gewonnen. Walter pflegte zu scherzen, dass sie ein verzaubertes Robbenweibchen sein müsste, da sie sich in kaltem Wasser so wohl zu fühlen schien.
»So hast du aber nicht immer gedacht.« Matty schüttelte den Kopf und starrte Ellie an wie eine Fremde.
»Ich verstehe es nicht … du warst ganz närrisch aufs Schwimmen und auf den Mädchensprung.«
»Das war, ehe …« Ellie verstummte und schluckte. Ihre Kehle war wie zugeschnürt.
»Ich war doch noch ein Mädchen. Jetzt trage ich Verantwortung.«
Matty schwieg einen Augenblick, als Ellie sich wieder den Stoffen auf dem Bett widmete. Sie waren für die Gewänder bestimmt, die sie in ihrem neuen Leben am Hof König Edwards als Gemahlin seines ehemaligem Schwiegersohns Ralph de Monthermer tragen würde.
»Das ist nicht fair«, sagte Matty dann leise.
»Du bist nicht die Einzige, die sie vermisst. Auch mir fehlen sie sehr. Aber weder Mutter noch Walter hätten gewollt, dass man sie ewig betrauert.«
Das Fieber, das zwei Jahre zuvor die Hallen von Dunluce Castle heimgesucht hatte, hatte nicht nur ihren neunzehnjährigen Bruder hinweggerafft, sondern auch ihre Mutter Margaret, Countess of Ulster. Ellie – damals zweiundzwanzig – hatte das Fieber noch um etwas anderes gebracht: um das lebensfrohe junge, nach Abenteuer dürstende Mädchen, das sie damals gewesen war. Als älteste unverheiratete Tochter hatte Ellie die meisten Pflichten ihrer Mutter als Countess übernommen, und dazu gehörte die Beaufsichtigung ihrer jüngeren Geschwister.
Und was für ein Beispiel würde sie abgeben, wenn sie sich halbnackt im Meer vergnügte?
Es war das erste Mal, dass sie wieder auf Dunluce Castle weilten, seitdem Mutter und Bruder – Erbe des Earls – gestorben waren. Eigentlich hätte sie ihren Verlobten auf Carrickfergus, der Hauptfestung des Earl of Ulster, treffen sollen, König Edward aber hatte sie stattdessen hierher befohlen. Obwohl Ellie von ihrem Vater nicht ins Vertrauen gezogen worden war, vermutete sie, dass es etwas mit der nicht enden wollenden Jagd nach Robert Bruce zu tun hatte.
In den strahlenden Augen ihrer Schwester standen Tränen, und Ellie nahm Matty spontan in die Arme.
»Ich weiß, dass du sie auch vermisst.« Ellie seufzte.
»Und du hast recht. Sie würden nicht wollen, dass wir ewig um sie trauern.«
Matty schob sie von sich. Sie lächelte wieder, ihre Tränen waren versiegt.
»Das heißt also, dass du kommen wirst?«
Ellie kniff argwöhnisch die Augen zusammen. Raffiniertes Ding. Ihre Schwester war so unnachgiebig wie ihr Patenonkel König Edward.
»Sag wenigstens, dass du es dir überlegen wirst«, warf Mattie ein, ehe Ellie einen Einwand vorbringen konnte.
Ellie hatte überhaupt nicht die Absicht, es sich zu überlegen, aber Matty war nicht die Einzige, die wusste, wie man erreicht, wenn man etwas will. Die fünf kleinen Geschwister, die ihrer Obhut anvertraut waren und ein Nein nicht gern hörten, verstanden es nicht weniger raffiniert, ihre Wünsche durchzusetzen. Ellie hatte sich ihrer Taktik anpassen müssen, um zu überleben.
»Also gut, ich werde darüber nachdenken.«
Mattys Augen wurden groß.
»Wirklich?« Sie klatschte aufgeregt in die Hände.
»Es wird so lustig …«
»Ich denke darüber nach«, betonte Ellie, »wenn du mir bei der Auswahl der Stoffe hilfst, die verarbeitet werden sollen.«
Sie selbst brachte nicht die geringste Begeisterung für diese Aufgabe auf. Matty hatte ein Auge für Farben, das Ellie mit Sicherheit abging. Aber es steckte mehr dahinter, wie sie wusste. Etwas stimmte nicht mit ihr. Wie sonst war das Gefühl des Unbehagens zu erklären, das sie unweigerlich erfasste, wenn sie an ihre Heirat dachte? Eine Heirat, auf die sie sich nach allen objektiven Maßstäben freuen sollte.
Ungeachtet seiner alles andere als vielversprechenden Anfänge war ihr Verlobter einer von Edwards hochgeschätzten Edelleuten sowie sein einstiger Schwiegersohn. Ralph de Monthermer hatte sich in Edwards Tochter Joan of Acre verliebt und sie heimlich geheiratet. Als dies ruchbar geworden war, hatte Edward Ralph – damals nur ein schlichter Ritter – in den Tower geworfen und ihn nur dank der Intervention des Bischofs von Durham nicht hinrichten lassen.
Schließlich hatten Ralph und sein erboster Schwiegervater sich versöhnt, und Ralph hatte zu Lebzeiten Joans sogar die Titel Earl of Gloucester and Hereford erhalten. Da nun Bruce auf der Flucht war, wollte Edward sich der Unterstützung ihres Vaters versichern und hatte deshalb eine Verbindung mit seinem ehemaligen Schwiegersohn vorgeschlagen, um seine Dankbarkeit zu zeigen.
Ralph sah gut aus und war sehr nett. Groß und breitschultrig wirkte er sehr eindrucksvoll und galt als idealer Ritter. Alles in allem ein Mann, der viel Bewunderung erregte.
Wie kam es also, dass ihr Magen rebellierte, dass ihr Herz wild flatterte und ihr der kalte Schweiß ausbrach, wenn sie in einem Raum mit ihm war?
Und warum verspürte sie diese sonderbare Unruhe in sich, je näher der Hochzeitstag heranrückte? Eine Unruhe, die in ihr den Wunsch weckte, etwas Verrücktes zu tun, etwa mit bloßen Füßen durch den Sand zu laufen oder Schleier und Haarnadeln herauszureißen und den Wind in den Haaren zu spüren.
Oder sich in die eisige See zu stürzen.
Aber ihre irrationalen Gefühle änderten nichts an den Tatsachen. Sie würde den Mann heiraten, den ihr Vater für sie bestimmt hatte, so wie Matty es auch einmal tun musste. Sie waren Töchter des Earl of Ulster; und die Stimme ihres Herzens spielte bei diesen Entscheidungen keine Rolle.
In den nächsten Minuten verwarf Matty aus dem Haufen kostbarer Tuche und Damaste noch gnadenloser alles, was ihr nicht zusagte. Nur wenig fand Gnade vor ihren Augen. Und zu guter Letzt blieb ein noch viel kleinerer Stapel in Dunkelbraun, Grün, Rost und tiefem Gold übrig. Grelle Farben oder Pastelltöne waren nicht darunter.
Ellie seufzte mit einem sehnsüchtigen Blick auf den Haufen, in dem Rosa, Blautöne, Gelb und Rot prangten.
»Ich werde die unscheinbarste Dame bei Hof sein«, sagte sie finster.
Matty zog die Brauen zusammen.
»Du bist wunderschön. Die Herbsttöne bringen die goldenen Untertöne deiner Haut und die grünen Pünktchen in deinen Augen zur Geltung.«
Ein Mundwinkel hob sich. Grüne Pünktchen?
»Ich habe braune Augen.«
Matty zog einen trotzigen Schmollmund.
»Ein schönes, leuchtendes Nussbraun.«
Braun soll mir recht sein, dachte Ellie. Sie wusste, dass Gegenargumente nichts fruchteten. Ihre Geschwister versuchten ständig, ihr das Gefühl zu geben, sie wäre etwas Besonderes, und fassten es als persönlichen Affront auf, wenn jemand darauf anspielte, dass es Ellie am strahlenden Aussehen der Familie fehlte. In einer normalen Familie hätte sie als passabel hübsch gegolten, ihre Familie aber war nicht normal. Es erstaunte sie immer wieder – und andere offenbar auch – wie zwei so außergewöhnlich aussehende Menschen wie ihre Eltern ein so gewöhnlich aussehendes Kind wie sie hatten hervorbringen können.
Aber ihr unspektakuläres Aussehen störte ihre Geschwister weit mehr als sie selbst. Sie hatte sehr früh gelernt, dass Schönheit keine Garantie für Glück war, wie das Beispiel ihrer Mutter zeigte.
Sie gab sich mit Mittelmaß zufrieden, ihre Familie aber weigerte sich, sie anders als besonders zu sehen.
Matty beobachtete sie, als könnte sie ihre Gedanken lesen.
»Ich wünschte, du könntest dich mit meinen Augen sehen. Du bist viel schöner als wir alle zusammen. Deine Schönheit leuchtet von innen.« Eine Schönfärberei, wie sie im Buch steht, dachte Ellie.
»Du bist lieb, großzügig, süß …«
»Und langweilig«, warf Ellie ein, der das Lob ihrer Schwester unangenehm war.
Matty lächelte.
»Und langweilig. Aber nicht mehr lang. Vergiss nicht, du hast versprochen, darüber nachzudenken. Sag doch, dass du kommen wirst. Du wirst sehen, es wird ein Riesenspaß.« Sie lächelte spitzbübisch.
»Vielleicht wird dein stattlicher Verlobter auch da sein.«
Ellie erbleichte. Bloß nicht. Sie brachte in Gegenwart dieses Mannes keine zwei Worte heraus, dann brach ihr kalter Schweiß aus.
Matty sah sie sonderbar an.
»Ich weiß nicht, was mit dir los ist, Ellie. Du tust so, als wäre dir die Heirat zuwider. Ralph ist jung und sieht gut aus.« In ihre Augen trat ein verträumter Blick.
»Dunkles Haar, grüne Augen …« Sie sprach nicht weiter.
Ralph hatte grüne Augen? Das war Ellie gar nicht aufgefallen.
»Du hast großes Glück.«, fuhr Matty fort, »an deiner Stelle würde ich ihn mir sofort schnappen. Ich werde wahrscheinlich einen Mann abkriegen, älter als Vater, mit schlechtem Atem, teigiger Haut und Gicht.« Sie sah sie neugierig an.
»Gefällt er dir nicht?«
»Natürlich gefällt er mir«, erwiderte Ellie automatisch, obwohl ihr Herzschlag panisch flatterte. Was gefiel ihr nicht an ihm?
»Sicher wird er einen wundervollen Ehemann abgeben.«
»Und einen Vater«, sagte Matty, die den Kopf schräg legte.
»Macht dir das Sorgen? Wie viele Kinder hat er? Zehn?«
»Acht.« Fünf Mädchen, den jungen Earl und noch zwei Jungen. Alle unter zwölf. Für sie nicht ungewohnt. Sie schüttelte den Kopf.
»Nein, ich mag Kinder.«
Matty beugte sich zu ihr und gab ihr einen Kuss auf die Wange.
»Und sie können sich wie wir glücklich schätzen, dich zu haben.« Sie wackelte spitzbübisch mit ihren zart gewölbten Brauen.
»Das heißt aber nicht, dass du zuerst nicht ein wenig Spaß haben dürftest.«
Ellie verdrehte die Augen und scheuchte ihre Schwester aus der kleinen Kammer.
»Hinaus mit dir! Ich muss vor dem Abendbrot nach der kleinen Joan und nach Edmond sehen.«
»Wir sehen uns abends«, sagte Matty mit schlauem Blick.
Ihre Schwester war ganz schön eigensinnig. Sie tat so, als täte Ellie nichts als essen, beten und sich um die jüngeren Geschwister zu kümmern.
Ellie biss sich auf die Lippen. Es kam der Wahrheit sehr nahe. War sie zu ernst geworden? War sie – sie schluckte schwer – langweilig?
Was war aus dem Wildfang geworden, der viel schwamm und die Gegend durchstreifte? Der Herausforderungen liebte? Der von Abenteuern träumte? Der einmal glaubte, es wäre das Allergrößte, einmal jede Insel zwischen hier und Norwegen zu erkunden?
Wie lange das her war. Vielleicht zu lange. Träume ändern sich. Menschen ändern sich.
Jetzt war sie vierundzwanzig, mit einem mächtigen englischen Edelmann verlobt und praktisch die Countess des mächtigsten Edelmannes von Irland.
Sie konnte wohl kaum wie ein Bauernmädchen das Land durchstreifen.
Mochte es sich noch so verlockend anhören.
2
Eriks gute Stimmung, nachdem er die Engländer in die Klippen gelotst hatte, währte nicht lange. Als er und seine Männer sich der Burg näherten, wusste er sofort, dass etwas nicht stimmte. Mitternacht war längst vorbei, Dunluce aber war hell erleuchtet. An der Nordküste flammten zwei große Feuer wie die Scheiterhaufen, die den Krieger auf dem Weg nach Walhalla begleiteten.
»Was ist das?«, fragte Randolph, dem die Feuer auch aufgefallen waren.
Erik schüttelte den Kopf und blickte blinzelnd in die Dunkelheit. Sie waren zu weit entfernt, als dass er es deutlich hätte sehen können, doch hätte er geschworen, dass im Wasser Menschen schwammen.
»Die Dorfbewohner, wie es aussieht«, sagte Domnall.
Plötzlich erhellte sich Eriks Miene, als ihm das Datum einfiel.
»Ja, es sind Leute aus dem Dorf«, sage er.
»Zumindest die Dorfmädchen.«
Randolph sah ihn fragend an.
»Der Mädchensprung«, erklärte er.
Randolph runzelte die Stirn.
»Der heidnische Brauch? Ich wusste nicht, dass die Iren noch immer die heidnischen Feste feiern.«
»Auf den Inseln schon. Es handelt sich um einen Einweihungsritus. Aber in Wahrheit ist es für die jungen Leute ein Vorwand, ein wenig Spaß zu haben. Es ist ganz harmlos.«
Die Miene des jungen Ritters verriet Missbilligung.
»Es ist ungehörig.«
Erik lachte.
»Genau. Deshalb ist es ja so lustig. Und wenn Ihr die Wirkung kalten Wassers auf das Hemd eines Mädchens nicht würdigen könnt, ist Euch nicht zu helfen.«
Ein Mundwinkel Randolphs zuckte nach oben.
»Vielleicht könnte ich einen gewissen Reiz darin entdecken.«
Erik schlug ihm lachend auf den Rücken.
»Schon besser. Vielleicht gibt es für Euch doch Hoffnung, Sir Tommy.«
Das Segel war wieder eingeholt worden, damit sie möglichst unentdeckt blieben, auch hielt Erik das Boot in einer gewissen Distanz zur Küste, um von der Burg aus nicht gesichtet zu werden. Auf einer mächtigen, dreieckigen, hundert Fuß senkrecht ins Meer abfallenden Felsenklippe gelegen, bot Dunluce Castle einen Anblick von einzigartiger Dramatik. Eine schmale Holzbrücke über dem tiefen Abgrund hinter der Burg bildete die einzige Verbindung zum Festland.
Unter der Burg befand sich eine große Höhle, von den Einheimischen Nixen-Höhle genannt, die sich fast dreihundert Fuß von einem Ende zum anderen durch den Fels erstreckte, im Süden von See aus zugänglich, im Norden über ein Felsband von der Landseite her. Mit einer über fünfzig Fuß hohen Deckenwölbung glich sie einem riesigen unterirdischen Palast. Der leichte Zugang vom Meer her machte sie zu einem idealen Ort für ein Treffen mit den McQuillans, ehemaligen Schotten, die als Söldner nach Irland gekommen waren und als Verwalter von Dunluce für den Earl of Ulster geblieben waren. Diese wilden Krieger aber verdingten sich noch immer als Söldner … für einen gewissen Preis.
Erik steuerte das birlinn um die Ausläufer der Felsen, die den Höhleneingang schützten.
»Aufgepasst, Jungs«, stieß er gedämpft hervor. Der Mädchensprung erklärte zwar die ungewöhnliche nächtliche Aktivität, aber irgendetwas lag hier in der Luft und bewirkte, dass sich ihm die Nackenhaare sträubten.
Als das Boot durch den von schroffen Zacken gesäumten Eingang glitt, sah er mit einem Auge zu der Burg hoch über ihm, während das andere auf das rückwärtige Ende der langen Höhle fixiert war. Er wusste, dass sie von oben her nicht zu sehen waren, und obwohl man ihm keine übertriebene Vorsicht vorwerfen konnte, hatte ihm ein Gefühl für drohende Gefahr mehr als einmal den Kragen gerettet.
Momentan raubte Dunkelheit ihnen die Sicht. Dann aber sah er aus dem schwarzen Nichts flackernde orange Lichtsplitter vom anderen Ende der Höhle herantreiben. Drei lange Wellen. Eine Pause. Zwei kurze. Dann dasselbe noch einmal.
Es war das richtige Signal, er entspannte sich aber erst, als sie so nahe herangekommen waren, dass er die ungeschlachte Gestalt und die Züge Fergals, des obersten Gefolgsmannes der McQuillans, erkannte. Seine Miene wurde ungewohnt ernst. Fergal war nicht derjenige, den er erwartet hatte. Kein willkommener Ersatz.
Fergal McQuillan war ein übler Halunke, der seine eigene Mutter für Geld nicht nur töten, sondern sich daran auch noch ergötzen würde.
Als Erik Jahre zuvor an seiner Seite gekämpft hatte, hatte ihn Fergals Blutrausch, der sich nicht auf den Kampf beschränkte, abgestoßen, obwohl er Kampflust und Feuer in der Schlacht zu schätzen wusste. Aber er musste den Mann nicht mögen. Fergal mochte ein Schuft sein, doch wusste er mit dem Schwert umzugehen, und im Moment brauchte er alle Kämpfer, die er kriegen konnte. Der Chief – Tor MacLeod – hatte zu Bruce einmal gesagt, dass man sich schmutzig machen müsse, um den Sieg zu erringen. Wie wahr.
Solange Fergal und die übrigen McQuillans ihr Wort hielten, würde es keine Probleme geben.
Fast an Land angelangt, sprang Erik über die Bordwand und watete durch das knietiefe Wasser an das steinige Ufer.
Er begrüßte den McQuillan-Krieger, indem er dessen Unterarm mit festem Griff umfasste. Nachdem er einige der anderen Männer, die er namentlich kannte, begrüßt hatte, nahm er die nötige Vorstellung vor, als Randolph und Domnall ihn eingeholt hatten. MacQuillan schien über irgendetwas aufgebracht – etwas, das Erik nicht gefallen würde, wie er argwöhnte.
»Ich hatte deinen Chief erwartet«, sagte Erik gleichmütig und zwang sich zu einem Lächeln, das seine Augen nicht erreichte.
Fergal schüttelte den Kopf. Er war kahl, und sein Kopf wies eine sonderbar konische Form auf, die wegen seiner flachen Züge, des feisten Nackens und seines struppigen roten Barts umso auffallender wirkte.
»Die Pläne wurden geändert«, sagte der Krieger.
»Er konnte nicht kommen. Ulster ist eingetroffen, in der Burg wimmelt es von Engländern. Seine Abwesenheit könnte auffallen.«
Eriks Augen verengten sich unmerklich. Seine Instinkte hatten ihn nicht getrogen. Sie waren mitten in ein Hornissennest gesegelt. Falls es eine Falle war, würde Fergals missgestalteter Kopf für seinen Körper nicht mehr zu lang sein. Zwei Sekunden – mehr brauchte es nicht, um den Griff seiner Streitaxt zu erfassen und diese zu schwingen. Und er musste sich eingestehen, dass ihm der Vorwand nicht ungelegen gekommen wäre.
Halb in Erwartung, englische Truppen über das Felsband herunterströmen zu sehen, warf Erik einen Blick an Fergals Schulter vorbei, ehe er den Krieger mit einem kalten Blick ansah.
»Ich dachte, dein Chief hätte gesagt, Ulster würde auf Carrickfergus sein.«