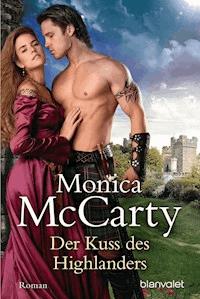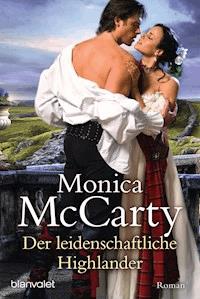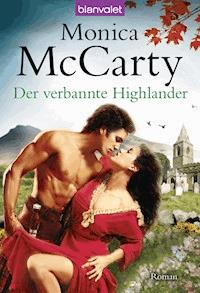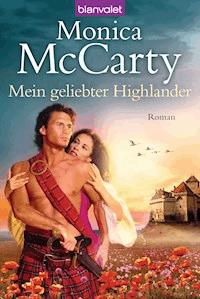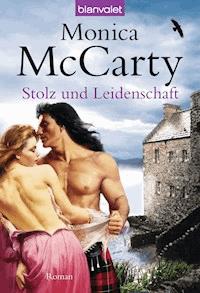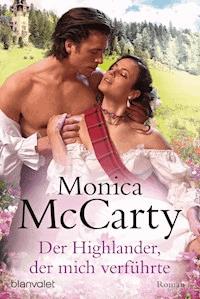
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Highland Guard-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein sündiger Kuss, der alles verändern wird – eine unerlaubte Liebe, die alle Grenzen überschreitet.
Ewen Lamont – auch »Der Jäger« genannt – nimmt einen gefährlichen Auftrag an: Er soll einen untergetauchten Boten aufspüren. Aber Ewens Ziel ist kein gewöhnliches, denn er ist seiner Beute schon einmal begegnet – der feurigen Janet, die sich für immer in sein Gedächtnis eingebrannt hat. Nach dem unglücklichen Versuch, ihre Zwillingsschwester zu retten, hat Janet endlich Frieden gefunden. Bis sie auf einen attraktiven Krieger trifft, der sie mit seinen Küssen um den Verstand bringt. Als Gefahr droht, hat Janet keine andere Wahl, als diesem einen Jäger zu vertrauen, der angeblich alles aufspüren kann – vielleicht sogar ihr Herz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 575
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Ewen Lamont wird auch »Der Jäger« genannt, denn seine Verfolgungsfertigkeiten sind unschlagbar. Aus diesem Grund nimmt er einen gefährlichen Auftrag an: Er soll einen untergetauchten Boten aufspüren. Aber Ewens Ziel ist kein gewöhnliches. Denn er ist seiner Beute vor einiger Zeit schon einmal begegnet – einer feurigen Frau, die sich für immer in sein Gedächtnis eingebrannt hat, nachdem sie ihm einen sündigen Kuss gestohlen hat. Jetzt, da er ihre wahre Identität kennt, will er sie mehr als je zuvor beschützen. Dieser Auftrag könnte der härteste Kampf sein, den der außergewöhnliche Krieger je geführt hat …
Nach dem unglücklichen Versuch vor drei Jahren, ihre Zwillingsschwester zu retten, hat Janet von Mar Erlösung gefunden, indem sie als königliche Botin fungierte – bis zu dem Zeitpunkt, als sie einem finsteren, aber unglaublich attraktiven Krieger begegnet, der mit seinen harten und sinnlichen Küssen die Leidenschaft in ihr anfeuert. Aber als ein Verrat zur Gefahr und eine grausame Verlautbarung zu einem Risiko wird, hat Janet keine andere Wahl, als diesem einen Jäger zu vertrauen, der angeblich alles aufspüren kann – vielleicht sogar ihr Herz.
Autorin
Monica McCarty studierte Jura an der Stanford Law School. Während dieser Zeit entstand ihre Leidenschaft für die Highlands und deren Clans. Sie arbeitete dennoch mehrere Jahre als Anwältin, bevor sie dieser Leidenschaft nachgab und zu schreiben anfing. Heute lebt sie mit ihrem Mann und ihren Kindern in Minnesota.
Von Monica McCarty bereits erschienen
Der geheimnisvolle HighlanderDer verbannte HighlanderMein geliebter HighlanderDer Highlander, der mein Herz stahlMein verführerischer HighlanderDie Geliebte des HighlandersDer Kuss des HighlandersDer leidenschaftliche Highlander
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Monica McCarty
Der Highlander,der mich verführte
Roman
Deutschvon Anke Koerten
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel »The Hunter«bei Ballantine Books, an Imprint of The Random HousePublishing Group, a division of Random House, Inc., New York.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
1. AuflageCopyright der Originalausgabe © 2013 by Monica McCartyThis translation is published by arrangement with Ballantine Books,an imprint of the Random House Publishing Group,a division of Random House, Inc.Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2016 by Blanvaletin der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenRedaktion: Margit von CossartUmschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesignUmschlagmotiv: © Chris CocozzaJvN · Herstellung: kwSatz: DTP Service Apel, HannoverISBN 978-3-641-12654-4V001www.blanvalet.de
Vorwort
Im Jahr des Herrn 1310
Vier Jahre zuvor scheint Robert the Bruce’ Kampf um den schottischen Thron verloren, da er als Geächteter aus seinem Land fliehen muss. Mithilfe seiner aus Elitekriegern gebildeten Highland-Garde gelingt Bruce eine an ein Wunder grenzende Rückkehr, worauf ein Sieg über jene seiner Landsleute folgte, die sich seinen Bestrebungen entgegenstellten, das Königreich nördlich des Tay zurückzuerobern.
Da das Grenzland und der Großteil schottischer Festungen noch immer von englischen Truppen kontrolliert werden, ist der Krieg jedoch nur halb gewonnen. Die größte Herausforderung für Bruce’ junges Königtum – die geballte Macht der englischen Armee – steht noch bevor.
Nach einer kurzen Atempause endet der Waffenstillstand – Edward II. zieht gegen die aufständischen Schotten ins Feld. Einer offenen Feldschlacht ausweichend geht Bruce von seinem Hauptquartier im Heideland aus gegen den Feind vor und drängt Edwards Truppen mit überfallartigen Attacken und Scharmützeln ins Grenzland zurück. Die Entscheidung wird hinausgeschoben.
Nun sind es nicht die Krieger der Highland-Garde, die Bruce beistehen, es ist ein anderer mächtiger Verbündeter, der von Anfang an auf seiner Seite stand: die Kirche. Die Unterstützung von Männern wie William Lamberton, Bischof von St. Andrews, erwies sich dank seines Netzwerks von Spitzeln im geistlichen Gewand als unschätzbar, die von ihm gelieferten Informationen waren unverzichtbar – Informationen, von denen Bruce’ Leben abhängen konnte.
Die Highland-Garde
Tor MacLeod: Führer der Kampftruppe und Meister im Schwertkampf, genannt Chief (Anführer)
Erik MacSorley: Seemann und Schwimmer, genannt Hawk (Falke)
Lachlan MacRuairi: Experte für heimliches Eindringen, genannt Viper (Giftschlange)
Arthur Campbell: Späher und Kundschafter, genannt Ranger (Waldhüter)
Gregor MacGregor: meisterlicher Bogenschütze, genannt Arrow (Pfeil)
Magnus MacKay: Überlebensexperte und Waffenschmied, genannt Saint (Heiliger)
Kenneth Sutherland: Experte für Sprengstoff, genannt Ice (der Eisige)
Eoin MacLean: Stratege der Seeräuberkampfweise, genannt Striker (Faustkämpfer)
Ewen Lamont: Fährtenleser und Menschenjäger, genannt Hunter (Jäger)
Robert Boyd: Meister im Einzelkampf, genannt Raider (Angreifer)
Alex Seton: Meister im Dolch- und Nahkampf, genannt Dragon (Drache)
Helen McKay, geborene Sutherland: Heilerin, genannt Angel (Engel)
Prolog
Dundonald Castle, Ayrshire, SchottlandSommer 1297
Fynlay Lamont war schon wieder betrunken. Ewen Lamont, der im hintersten Winkel der Großen Halle auf Dundonald Castle mit anderen jungen Kriegern beisammensaß, bemühte sich nach Kräften, seinen Vater zu ignorieren, hätte sich aber bei jeder wüsten Lachsalve, bei jeder angriffslustigen Prahlerei, die von Fynlays Tisch im vorderen Teil der Halle an seine Ohren drang, am liebsten unter der Bank verkrochen.
»Ist das dein Vater?«, fragte einer der Knappen des Earl of Menteith. »Kein Wunder, dass du so wortkarg bist. Er redet für zwei.«
Die ganze Runde junger Krieger brach in lautes Gelächter aus. Ewen, der vor Verlegenheit nicht aus noch ein wusste, zwang sich, mit ihnen zu lachen und den Unbekümmerten zu mimen. Er war jetzt ein Mann, fast siebzehn Jahre alt. Er konnte nicht mehr davonlaufen wie seinerzeit als Kind, wenn sein Vater zu viel getrunken und sich beschämend benommen hatte.
Doch die Unbeherrschtheit und Disziplinlosigkeit seines Vaters drohten alles zu ruinieren. Tatsächlich konnte dieses Treffen wie ein Haufen dürres Laub von einem Funken in Brand gesetzt werden. Die großen Lords, die sich hier an diesem Tag heimlich trafen, waren als Nachkommen Walter Stewarts, des dritten High Steward von Schottland, verwandtschaftlich verbunden, aber untereinander uneins. Ihre Zusammenkunft diente dem Zweck, einen Weg zu finden, ihre Meinungsverschiedenheiten zu begraben, um gemeinsam gegen die Engländer und nicht gegeneinander zu Felde zu ziehen. Wurde Fynlay zu diesem ohnehin schon unberechenbaren Haufen von Männern hinzugezogen, war es, als würde heiße Luft in die Flammen geblasen, sehr viel heiße Luft.
Aber Fynlay Lamont of Ardlamont war wie Ewen ein Mann Sir James Stewarts, des fünften High Steward von Schottland – und als einer von dessen angesehensten militärischen Befehlshabern hatte sein Vater das Recht, hier anwesend zu sein. Dass »der wilde Fynlay«, wie ihn viele nannten, kämpfen konnte, war unbestritten. Das Problem bestand darin, seine Kampflust auf das Schlachtfeld zu beschränken.
Fynlay hatte sich seinen Ruf ehrlich erworben. Er war schnell, wenn es zu kämpfen galt, schnell im Wortgefecht und schnell gekränkt. Gesetze und Regeln galten für ihn nicht. Er machte, was er wollte, wann und wo er es wollte. Als er dreißig Jahre zuvor Ewens Mutter auf einem Jahrmarkt erblickt hatte und sein Begehren erwacht war, hatte er sie entführt. Die Tatsache, dass sie mit Malcolm Lamont, seinem Vetter und Anführer, verlobt war und seine Tat ihm und dem Clan einen hohen Preis abgefordert hatte, war ihm gleichgültig gewesen.
Sein Vater hatte sich im Laufe der Jahre nicht geändert – bis auf den fehlenden Finger. Im Suff hatte er mit einem der Clanmitglieder gewettet, er werde seine Hand rascher vom Tisch ziehen, als der andere seine Klinge werfen könne. Das fehlende oberste Glied des Mittelfingers an seiner Rechten bewies das Gegenteil.
Ewens tollkühner, ungestümer und ungeschliffener Vater geriet immer wieder in Schwierigkeiten. Er verschaffte sich mit Schwert und Fäusten Gehör – meist im Rausch. Kämpfen und Saufen waren Disziplinen, derer er nie überdrüssig wurde. Fynlay Lamont wich einer Herausforderung, und wenn sie noch so aberwitzig oder gefährlich war, nie aus. Das Wetten war seine große Leidenschaft. Bei seinem letzten Besuch zu Hause hatte Ewens Vater gewettet, er könne es mit bloßen Händen mit einem Wolfsrudel aufnehmen – nackt bis auf die Haut. Er hatte es gewagt – und gewonnen, wenngleich ihm einer der Wölfe eine tiefe Beinwunde zugefügt hatte.
Anstatt wie für diesen Winter geplant auf Rothesay Castle sein Training wieder aufzunehmen, war Ewen auf Ardlamont geblieben, um seinen Vater während dessen Genesung als Anführer des Clans zu vertreten. Ein halbes Jahr war vergangen, bis Ewen sich wieder in Sir James’ Haus einfinden konnte. Ihm hatte jede einzelne Minute gefehlt, doch hatte er von Sir James eines gelernt – Pflichterfüllung ging über alles.
Ein Grundsatz, den er bei Gott nicht von seinem Vater mitbekommen hatte. Pflichten nachzukommen und Verantwortung zu übernehmen war Fynlay Lamont fremd. Hinter sich Ordnung zu schaffen, überließ er anderen. Zuerst Sir James und jetzt Ewen, wenn sein Wunsch sich erfüllte.
Aber Ewen wollte nicht zurück nach Ardlamont. Die Wünsche seines Vaters kümmerten ihn nicht, da er einen Platz im Gefolge Stewarts anstrebte und – falls die hier Anwesenden sich überreden ließen – in weiterer Folge hoffte, sich dem Aufstand anzuschließen, zu dem ein Mann namens William Wallace einen Monat zuvor aufgerufen hatte.
König Edward von England hatte die schottischen Lords für den 7. Juli nach Irvine befohlen. Die Frage war nur, ob sie die fünf Meilen nach Irvine marschieren würden, um sich den Engländern zu unterwerfen oder den Kampf gegen sie aufzunehmen.
Sir William Douglas, Lord of Douglas, hatte sich Wallace bereits angeschlossen und bemühte sich nun, seine Vettern Stewart, Menteith und Robert the Bruce, den jungen Earl of Carrick, zu überreden, es ihm gleichzutun. Sir James war geneigt, den Kampf aufzunehmen – es waren die anderen, die erst überzeugt werden mussten, dass es Sinn hatte, sich dem Aufstand eines Mannes anzuschließen, der nicht einmal Ritter war und es mit dem mächtigsten König der Christenheit aufgenommen hatte.
Mit etwas Glück würde Ewen in wenigen Tagen in seinen ersten Kampf ziehen. Er konnte es nicht erwarten. Wie alle anderen jungen Krieger dieser Tischrunde träumte er von Größe und von Ruhm und Ehre auf dem Schlachtfeld. Dann würde man vielleicht nicht mehr von seinem »wilden« Vater sprechen, von den Wölfen, mit denen er gekämpft hatte, von den Schiffen, die er bei einem tollkühnen Rennen um die Isles fast auf Grund gesetzt hatte, oder von der Braut, die er seinem eigenen Anführer geraubt hatte.
Die Stimme seines Vaters riss Ewen aus seinen Gedanken. »Wenn sie erst fertig ist, wird meine Burg die größte Festung von ganz Cowal sein – mit Verlaub, Stewart.«
O Gott, nicht schon wieder die Burg.
Dieses Mal konnte Ewen nicht verhindern, dass ihm die Röte in die Wangen stieg.
»Und wo willst du die Mittel dazu finden?« Einer der Männer lachte. »Unter dem Kopfkissen?«
Alle Welt wusste, dass Fynlay alles Geld verspielte. Ebenso war allgemein bekannt, dass die berüchtigte Burg seit sechzehn Jahren halb fertig dastand, seit Ewens Mutter im Kindbett gestorben war.
Ewen reichte es. Er ertrug seinen Vater und dessen Prahlereien nicht mehr. Abrupt rückte er vom Tisch ab und stand auf.
»Wohin willst du?«, fragte einer seiner Freunde. »Das Fest fängt erst an. Bald wird Sir James’ spezieller Whisky ausgeschenkt.«
»Spar dir die Mühe, Robby«, sagte ein anderer. »Du kennst doch Lamont – von Vergnügungen hält er nichts. Sicher geht er jetzt Sir James’ Rüstung polieren und dessen Klingen schärfen. Oder er starrt stundenlang zu Boden auf der Suche nach Spuren.«
Es stimmte. Aber Ewen war es gewohnt, dass seine Freunde ihn verspotteten. Es kümmerte ihn nicht.
»Du solltest ruhig länger in den Dreck starren, Thom«, sagte Robby. »Nach allem, was ich hörte, bist du mit Blindheit geschlagen.«
Als die anderen in lautes Gelächter ausbrachen, nutzte Ewen die Gelegenheit und verschwand. Kaum war er ins Freie getreten, traf ihn ein Schwall kalter Luft. Es hatte fast den ganzen Tag geregnet. Der hoch auf dem Burghügel aufragende Turm zeichnete sich vor einem fast dunklen Himmel ab, obwohl es erst später Nachmittag war.
Wie Stewarts Burg Rothesay auf der Insel Bute vor der Halbinsel Cowal war Dundonald Castle in Ayrshire eine der mächtigsten Festungen Schottlands, Zeichen der großen Bedeutung der Stewarts für die Krone. Ewen lief hinunter in den Burghof und blieb erst vor der Waffenkammer stehen, um nach Sir James’ Rüstung und Waffen zu sehen. Nachdem er sich überzeugt hatte, dass alles in Ordnung war, ging er zu den Stallungen und vergewisserte sich, ob sein Lieblingspferd bewegt worden war. Dann hockte er sich auf ein Heubündel, um in den Dreck zu starren, wie Thom es vorausgesagt hatte.
Es war ein Spiel, das er seit seiner Kinderzeit spielte. Immer wenn er allein sein musste, übte er sich darin, Spuren zu unterscheiden, möglichst viele Einzelheiten zu erkennen. In den Stallungen versuchte er, die einzelnen Hufabdrücke den Pferden zuzuordnen.
»Was tust du da?«
Er drehte sich um, erstaunt, Sir James im Eingang zu sehen. Hinter ihm der dunkle Himmel, der ihn wie einen Schattenriss erscheinen ließ. Hochgewachsen und schlank, mit rotem, schon leicht ergrauendem Haar, strahlte der angestammte High Steward of Scotland Vornehmheit und Autorität aus. Er war Ritter und wie alle seines Standes ein guter Schwertkämpfer, aber Stewarts wahre Stärke war seine Führungsqualität. Er war ein Mann, dem andere willig in den Kampf und nötigenfalls in den Tod folgten.
Sofort war Ewen auf den Beinen.
Wie lange habe ich schon hier gesessen? »Verzeihung, Sir. Habt Ihr mich gesucht? Hat die Versammlung sich schon aufgelöst? Wie wurde entschieden?«
Sir James ließ sich auf dem Heuballen nieder und bedeutete Ewen, sich neben ihn zu setzen. Dann schüttelte er den Kopf.
»Leider wurde gar nicht entschieden. Ich hatte das Gezänk satt und wollte frische Luft schnappen. Du wohl auch?« Ewen antwortete nicht. Er senkte nur den Kopf, damit man ihm seine Scham nicht ansah. »Du studierst die Spuren, nicht wahr?«, fragte Sir James.
Ewen nickte und deutete auf den Stallboden. »Ich versuche, Einzelheiten zu erkennen.«
»Wie ich hörte, hast du alle meine Ritter im Fährtenlesen geschlagen. Gut gemacht, Junge. Weiter so, dann wird aus dir noch der beste Fährtensucher der Highlands.«
Das Lob Sir James’ bedeutete ihm sehr viel, und Ewen war sicher, dass man ihm seine Gefühle ansah. Er wäre beinahe vor Stolz geplatzt.
Was soll ich nur sagen?
Anders als Fynlay fehlte es ihm an Wortgewandtheit.
Das Schweigen dauerte an.
»Du bist nicht wie dein Vater, mein Sohn«, sagte Sir James.
Mein Sohn.
Wenn es nur wahr wäre! Sir James war alles, was Fynlay nicht war: ehrenhaft, diszipliniert, beherrscht und umsichtig.
»Ich hasse ihn«, platzte Ewen aufgebracht heraus.
Er schämte sich sofort seiner kindischen Regung. Und doch konnte er seine Worte nicht zurücknehmen.
Zu den besten Eigenschaften Sir James’ gehörte es, dass er nicht herablassend war, auch nicht zu viel Jüngeren. Er ließ sich Ewens Worte durch den Kopf gehen.
»Du hättest ihn in seiner Jugend kennen sollen. Damals war er ganz anders. Bevor deine Mutter starb und er zu trinken begann«, sagte er dann.
Ewen reckte angriffslustig das Kinn. »Ihr meint, als er meine Mutter seinem Anführer entführte?«
Sir James runzelte die Stirn. »Wer hat dir das gesagt?«
Er zog die Schultern hoch. »Alle sagen es. Mein Vater behauptet es sogar. Es ist allgemein bekannt.«
»Von allen Sünden deines Vaters, darfst du ihm diese nicht anrechnen. Deine Mutter ging willig mit ihm.«
Schockiert starrte Ewen Sir James an. Wenn einer die Wahrheit kannte, dann er. Ewens Mutter war seine Lieblingscousine gewesen, und er war der Mann, an den sie sich gewandt hatte, als Malcolm Lamont die unüberlegte Tat seines Vaters rächen wollte.
»Deshalb habt Ihr ihnen geholfen«, sagte Ewen.
Plötzlich ergab alles einen Sinn. Ewen hatte nie begriffen, warum Sir James seinem Vater zu Hilfe gekommen war und seinen Untergang verhindert hatte, nachdem er durch seinen Brautraub eine wilde Fehde entfesselt hatte.
»Unter anderem«, erwiderte Sir James. »Das Schwert deines Vaters war einer der Gründe. Er war – er ist – einer der besten Krieger der Highlands. Du wirst ihm in dieser Hinsicht ähnlich werden. Und ja, ich wollte auch, dass deine Mutter glücklich wurde.«
Der Brautraub gehörte vermutlich zu den nichtigsten Sünden seines Vaters, aber es gab genügend andere. Es änderte nichts an seinem tollkühnen, treulosen Vorgehen, das den Bruch mit seinem Clan herbeigeführt hatte und beinahe mit der Vernichtung der Lamonts von Ardlamont geendet hätte. Auch änderte es nichts an all dem, was danach geschehen war.
»Ihr hättet nicht zulassen sollen, dass er kam, während Malcolm da war«, sagte Ewen.
Malcolm Lamont war nicht mehr sein Anführer. Die Taten seines Vaters hatten bewirkt, dass die Ardlamont Lamonts sich von ihm getrennt hatten. Sie waren nun Gefolgsleute Stewarts.
»Ich hatte keine andere Wahl. Malcolm ist der Mann meines Vetters Menteith, wie dein Vater mein Gefolgsmann ist. Dein Vater hat mir geschworen, den Waffenfrieden nicht zu brechen, auch wenn Malcolm ihm noch so sehr zusetzen sollte. Unter meinen Angehörigen gibt es ohne die alte Fehde zwischen deinem Vater und Malcolm weiß Gott genug Zwistigkeiten.«
Ewen stand es nicht zu, seinem Lord Fragen zu stellen, dennoch fragte er: »Und Ihr vertraut ihm?«
Sir James nickte. »Ja, das tue ich.« Er erhob sich. »Aber komm jetzt, wir müssen zurück. Das Fest neigt sich dem Ende zu.«
So war es, doch nicht aus dem Grund, den sie erwartet hatten. Als sie hinaus in die Dunkelheit traten, war Lärm von der anderen Seite des Burghofszu vernehmen. Erst aufmunternder Beifall, dann Stille. Man hörte nur das Tröpfeln des Regens.
»Was das wohl sein mag?«, überlegte Sir James.
Ewen verspürte das Aufflackern einer bösen Vorahnung. Plötzlich strömten Männer auf den Hof und hielten auf den Hauptturm zu. Ihre Mienen verrieten, dass etwas geschehen war.
»Was ist los?«, fragte Sir James den ersten Mann, der in ihre Nähe kam. »Ist etwas passiert?«
Ewen erkannte in ihm einen von Carricks Leuten.
»Der Anführer der Lamonts behauptete, niemand könne die regennassen Klippen erklimmen. Fynlay wettete um zwanzig Pfund, dass er es schafft. Er kam bis ganz nach oben, glitt aber beim Abstieg aus und schlug unten auf den Felsen auf.«
Ewen erstarrte. Sein Vater hatte Wort gehalten und sich auf keinen Kampf eingelassen, doch würde diese Wette mit Sicherheit einen Zwist auslösen. Es würde heiß hergehen, wenn die Männer jetzt Partei ergriffen. »Ist er tot?«, fragte Sir James.
»Noch nicht«, lautete die Antwort.
Wenig später trugen Gefolgsleute Fynlays ihren Anführer auf den Burghof.
Zunächst wollte Ewen nicht glauben, dass dieses Mal sich von den unzähligen Malen unterschied, an denen sein Vater verletzt worden war. Kaum aber hatten die Leute ihn auf einen Tisch im Gemach des Hausherrn hinter einer hölzernen Trennwand in der Großen Halle gelegt, wusste Ewen, dass es das Ende war. Das leichtfertige Spiel seines Vaters mit dem Tod hatte sich gerächt. Ewen stand in der hintersten Ecke des Raumes, als erst Fynlays Männer und dann Sir James Abschied nahmen.
Als er heiße Tränen aufsteigen spürte, hasste er sich für seine Schwäche und fuhr sich mit dem Handrücken über die Augen. Fynlay verdiente weder sein Mitleid noch seine Loyalität. Aber er war sein Vater. Wild, verantwortungslos und unbesonnen, doch sein Vater.
Ewen bereute seine Worte Stewart gegenüber so heftig, dass es in seiner Brust brannte. Er hatte nicht wirklich gemeint, dass er ihn hasste. Nicht wirklich. Er hatte nur gewollt, dass er anders wäre.
Er wäre in seinem Versteck geblieben, hätte Sir James ihn nicht nach vorne gerufen.
»Dein Vater möchte dir etwas sagen.«
Langsam näherte Ewen sich dem Tisch. Der Körper des hünenhaften Kriegers, dessen Antlitz seinem so ähnlich war, war vom Aufschlag auf den Felsen zerschmettert worden. Sämtliche Knochen schienen gebrochen, die Haut war zerfetzt. Überall war Blut. Unfassbar, dass er noch lebte.
Ewens Kehle wurde eng. Wut und Enttäuschung überfielen ihn ob dieser ungeheuren Vergeudung.
»Junge, du wirst einen guten Anführer abgeben«, flüsterte sein Vater. Die tiefe, dröhnende Stimme war nun heiser und schwach. »Einen weiß Gott besseren, als ich es je war.« Ewen sagte nichts. Er hatte seine Gefühle nie in Worte fassen können. Was hätte er auch sagen können? Es war die Wahrheit, verdammt. Zornig fuhr er sich erneut mit dem Handrücken über die Augen. »Sir James sagt dir Großes voraus. Er wird dir beistehen. Überlass dich seiner Führung und vergiss nie, was er für uns getan hat.« Als ob das möglich wäre. Er und sein Vater waren sich selten einig. Aber was Sir James betraf, waren sie einer Meinung: Sie verdankten ihm alles. Fynlays Stimme wurde immer schwächer. »Das Beste, was ich je zustande gebracht habe, war die Entführung deiner Mutter.«
»Warum sagst du das?«, stieß Ewen, nun doch von seinen Gefühlen überwältigt, hervor. »Warum sagst du, du hättest sie entführt, wenn es doch nicht der Fall war? Sie kam bereitwillig mit.«
Fynlay konnte nur einen Mundwinkel heben, die andere Gesichtshälfte war zermalmt. »Ich weiß nicht, was sie in mir sah.« Ewen wusste es auch nicht. »Dass sie sich in einen Barbaren verliebte, war das einzig Leichtsinnige, was sie in ihrem Leben tat.« Er hustete, begleitet von einem ekligen Geräusch, dem Ewen entnahm, dass seine Lunge sich mit Blut füllte. »Sie wäre stolz auf dich. Du siehst zwar auch wie ein Ungeheuer aus wie ich, aber du bist ihr sehr ähnlich. Es zerriss ihr das Herz, als sie ihrem Vater ungehorsam sein musste.« Ewen wusste so wenig von seiner Mutter, obwohl er so gern alles über sie erfahren hätte. Sein Vater hatte kaum von ihr gesprochen. Jetzt lief die Zeit aus. Es war zu spät. Sein Vater war so gut wie tot. In Fynlays Augen blitzte es mit einem Mal auf. Mit wildem Blick griff er nach Ewens Arm. »Versprich mir, dass du es für sie zu Ende bringst.« Ewen wurde steif. Er wollte so tun, als verstünde er nicht, konnte aber die Wahrheit nicht vor dem Tod verbergen. »Versprich es«, stieß sein Vater mit letzter Kraft aus.
Ewen wollte sich weigern. Immer wenn er nach Hause kam und den halb fertigen Steinhaufen sah, wäre er am liebsten vor Scham gestorben. Es war für ihn ein Symbol all dessen, was sein Vater falsch gemacht hatte, ein Symbol all dessen, was Ewen nicht sein wollte. Aber irgendwie brachte er ein Nicken zustande. Loyalität bedeutete ihm viel, wenngleich sie seinem Vater nichts bedeutet hatte. Im nächsten Moment tat Fynlay Lamont seinen letzten Atemzug.
Der Tod seines Vaters bedeutete das Ende von Ewens Zeit in Sir James’ Diensten. Anstatt nach Irvine zu marschieren und an der Seite von Wallace gegen die Engländer zu kämpfen, kehrte Ewen nach Ardlamont zurück, um seinen Vater zu bestatten und seinen Pflichten als Anführer seines Clans nachzukommen.
Sir James riet ihm zu Geduld. Er solle seine kriegerischen Fertigkeiten vervollkommnen und sich bereithalten. Zu gegebener Zeit werde man ihn rufen.
Acht Jahre später, als Robert the Bruce nach der Krone griff und aus einer Schar handverlesener Krieger eine Geheimarmee formte, war Ewen Lamont der beste Fährtensucher der Highlands und bereit, dem Ruf zu folgen.
1
Nahe Berwick-upon-TweedFrühjahr 1310
Ewen konnte seinen Mund nicht halten, eine Eigenschaft, die ihn oft in Schwierigkeiten brachte.
»Ihr habt eine Frau geschickt? Warum zum Teufel habt Ihr das getan?«
William Lamberton, Bischof von St. Andrews, lief vor Zorn rot an. Ewen wusste, dass es nicht seine gotteslästerliche Ausdrucksweise war, die den Kirchenfürsten reizte, sondern die Kritik, die aus seinen Worten herauszuhören war.
Erik MacSorley, Anführer der West Highlands und größter Seemann südlich des Landes seiner Wikinger-Ahnen, von der geheimen Garde Hawk genannt, warf Ewen einen ungeduldigen Blick zu. »Lamont meinte damit nur, dass es für das Mädchen gefährlich werden könnte, da die Engländer mittlerweile die Kirchen im ganzen Land verstärkt überwachen«, versuchte er den Bischof zu besänftigen.
MacSorley schaffte es nicht nur, durch eine Jauchegrube zu waten, er konnte sich auch aus jedem Mist herausreden und hinterher wie eine Rose duften. In dieser Hinsicht hätten sie nicht unterschiedlicher sein können. Ewen trat prompt in den Dreck, wo immer er ging. Nicht dass es ihn gekümmert hätte. Als Krieger war er daran gewöhnt.
Der Blick des Bischofs verriet, dass er Ewen sonst wohin wünschte. Ewen völlig ignorierend wandte er sich an MacSorley.
»Schwester Genna ist sehr wohl imstande, auf sich achtzugeben.«
Sie war eine Frau, noch dazu eine Nonne. Wie konnte Lamberton annehmen, eine sanftmütige, fügsame Unschuld könnte sich gegen englische Ritter behaupten, die es darauf abgesehen hatten, für die Schotten tätige »Kuriere im geistlichen Gewand«, wie sie genannt wurden, zu entlarven?
Während der ersten Phase des Krieges, als Bruce den Kampf um sein Königreich aufgenommen hatte, war es die Kirche gewesen, die für die Schotten ein dichtes Netzwerk zur Übermittlung von Nachrichten aufgebaut hatte. Da nun wieder eine kriegerische Auseinandersetzung drohte, versuchten die Engländer mit allen Mitteln, diese Nachrichtenkanäle zu schließen. Wer ein geistliches Gewand trug – sei es Priester, Mönch oder Nonne – und die schottische Grenze passieren wollte, musste sich von den englischen Patrouillen strenge Kontrollen gefallen lassen. Auch Pilger wurden behelligt.
Ehe Ewen den Mund aufmachen und es sich mit Lamberton noch mehr verscherzen konnte, warf Lachlan MacRuairi, Ewens Gedanken vorausahnend, ein: »Ich dachte, Ihr hättet gewusst, dass wir kommen?«
Der unscheinbare Bischof wirkte schwächlich, zumal in Gegenwart der vier eindrucksvollen Krieger, die die kleine Sakristei zu sprengen schienen. Lamberton hätte dem englischen König allerdings nicht die Stirn bieten können, um Robert the Bruce auf den Thron zu setzen, wenn er nicht dennoch über beträchtliche Kraft und großen Mut verfügt hätte. Er richtete sich nun zu voller Größe auf und sah einen der gefürchtetsten Männer Schottlands – MacRuairi trug seinen Decknamen Viper nicht zu Unrecht – von oben herab an, was seine Nase noch länger wirken ließ.
»Man sagte mir, ich solle Euch zu Neumond erwarten. Das war vor über einer Woche.«
»Wir wurden aufgehalten«, sagte MacRuairi ohne eine weitere Erklärung.
Der Bischof hakte nicht nach, vermutlich, da er annahm, dies müsste mit einer geheimen Mission der Highland-Garde zusammenhängen, der von Bruce persönlich zusammengestellten Elitetruppe. Eine ähnliche Kampfgruppe hatte die Welt noch nie gesehen – sie bestand aus Kriegern, von denen jeder in seiner Kampfdisziplin der Beste war.
»Ich konnte nicht länger auf Euch warten«, erklärte Lamberton. »Es ist dringend geboten, dass die Botschaft rasch den König erreicht.«
Sie befanden sich zwar auf englischem Boden, doch war es nicht Edward Plantagenet, der englische König, von dem die Rede war, sondern der schottische König Robert the Bruce. Sein Eintreten für Bruce hatte Lamberton zwei Jahre Haft in England eingebracht. Nach seiner Freilassung hatte er für weitere zwei Jahre die Diözese Durham nicht verlassen dürfen. Wenngleich der Bischof nun nach Schottland reisen durfte, war er wieder in England und unter englischer Autorität. Bruce brauchte ihn hier. Der Bischof war die wichtigste Quelle der Informationen, die über das dichte Wegenetz zwischen Kirchen, Klöstern und Abteien nach Schottland gelangten.
»Wohin ging sie?«, fragte MacLean, der sich zum ersten Mal äußerte.
»Über Kelso nach Melrose Abbey. Sie brach vor einer Woche auf und schloss sich einer kleinen Pilgergruppe an, die in Whithorn Abbey Heilung sucht. Selbst wenn die Engländer sie aufhalten, wird man sie gehen lassen, wenn man ihren Akzent hört. Aus welchem Grund sollte man einer italienischen Nonne misstrauen? Sicher befindet sie sich jetzt schon auf dem Rückweg.«
Die vier Gardisten wechselten Blicke. Wenn die Botschaft so wichtig war, wie der Bischof behauptete, war es besser, sie kümmerten sich selbst darum.
Erik MacSorley, der die Führung dieser Mission innehatte, hielt Ewens Blick fest. »Mach dich auf die Suche nach ihr. Und nimm Striker mit.«
Ewen nickte. Er hatte erwartet, dass man ihm die Aufgabe übertragen würde. Es war das, was er am besten konnte. Er war nicht wie MacSorley, der sich immer herausreden konnte, doch fand er in jeder kritischen Lage einen Ausweg, indem er alles und jeden aufspürte. MacSorley behauptete gern, Ewen könne ein Gespenst im Schneesturm finden. Eine kleine Nonne zu finden würde für ihn ein Leichtes sein.
Gewohnt, auf Schwierigkeiten zu stoßen, war Schwester Genna nicht weiter beunruhigt, als sie am Rand der kleinen Stadt von vier englischen Kriegern hoch zu Ross aufgehalten wurde. Es war nicht das erste Mal. Sie war schon öfter von englischen Patrouillen verhört worden, die von einer der nahen Burgen aus das Grenzland durchstreiften, und sie war zuversichtlich, wieder alle Schwierigkeiten meistern zu können.
Aber sie hatte die Rechnung ohne ihre Gefährtin gemacht. Warum nur hatte sie zugelassen, dass Schwester Marguerite sie begleitete? Sie hätte es besser wissen müssen und niemanden hineinziehen sollen. Hatte sie nicht schon Jahre zuvor ihre Lektion gelernt?
Die Nonne mit dem kränklichen Aussehen und den großen, dunklen Augen, aus denen Verlorenheit und Heimweh sprachen, hatte Gennas Entschluss, sich auf keine Begleitung einzulassen, ins Wanken gebracht. Auf dem Weg von Berwick-upon-Tweed nach Melrose hatte Genna das erst siebzehnjährige junge Mädchen, das kürzlich das ewige Gelübde abgelegt hatte, bemuttert und darauf geachtet, dass es genug aß sowie sich beim Gehen nicht überanstrengte. Schwester Marguerite hatte immer wieder Anfälle von Atemnot, sie litt an Asthma, wie die Griechen es nannten. Das Leiden hatte sie aus dem heimatlichen Calais auf die Pilgerreise nach Whithorn Abbey geführt, zum Schrein des heiligen Ninian, dem Heilkraft zugeschrieben wurde.
Aber Gennas Reise hatte in Melrose ein Ende gefunden, und als am Morgen die Stunde des Abschieds gekommen war, hatte sie ein verdächtiges Würgen in der Kehle gespürt. Marguerite hatte sie mit ihren seelenvollen Augen angesehen und Genna gebeten, sie noch ein Stück des Weges begleiten zu dürfen. Und Genna hatte sich erweichen lassen, Gott möge ihr verzeihen. »Nur bis Gallows Brae«, hatte sie gesagt und die kleine Erhebung gleich hinter dem Marktkreuz gemeint, wo die Kirche Verbrecher zu hängen pflegte. Was konnte dem Mädchen am helllichten Tag schon zustoßen, nur einen Steinwurf vom Kloster entfernt?
Sehr viel, wie es aussah.
Marguerite stieß einen Schrei aus, als die Soldaten sie umzingelten. Alles wird gut, gab Genna ihr mit einem Blick zu verstehen. Überlass alles mir.
Genna wandte sich an den stämmigen Soldaten mit dem rötlichen Bart, den sie für den Anführer hielt. Die Sonne spiegelte sich in seiner blitzblank polierten Rüstung, und sie musste blinzeln. Das Wenige, das sie unter dem stählernen Helm und der Kettenhaube von seinem Gesicht erkennen konnte, wirkte abgestumpft, grob und alles andere als einnehmend.
Zuerst sprach sie das dem Vulgärlatein entstammende Italienisch, das er nicht verstand, wie ihr gleich klar wurde, also wechselte sie zu dem stark akzentbehafteten Französisch, das in der Gegend eher gesprochen wurde. Sie sah ihm direkt in die Augen und sagte ihm mit ihrem demütigsten Lächeln die Wahrheit.
»Wir überbringen keine Botschaften Wir sind nur Besucherinnen Eures Landes. Wie sagt man? P… P…«, täuschte sie nach den richtigen Worten suchend Unwissenheit vor.
Er starrte sie dumpf an. O Gott, der Mann war schwer von Begriff – selbst für einen Krieger! In den letzten Jahren hatte sie von dieser Sorte jede Menge kennengelernt. Sie gab es auf, deutete auf ihren Pilgerstab und die kupferne Jakobsmuschel an ihrem Umhang.
»Pilgerinnen?«, half er aus.
»Ja, Pilgerinnen!« Sie strahlte ihn wie einen Helden an.
Der Mann mochte ein wenig stumpfsinnig sein, ließ sich aber nicht so leicht abwimmeln. Er musterte erst Marguerite und dann sie. Genna spürte, wie ihr Puls sich beschleunigte, als er seinen abschätzenden Blick auf sie lenkte. Das gefiel ihr gar nicht.
»Warum sprecht Ihr nicht, Schwester? Was treibt Ihr hier allein auf der Straße?«, fragte er nun Marguerite.
»Sie …«
Genna wollte für sie antworten, er aber unterbrach sie. »Ich will es von ihr selbst hören. Wie kann ich sicher sein, dass Ihr Fremde seid, wie Ihr behauptet?« Er wandte sich einem seiner Begleiter zu. »Sieh dir diese Brüste an«, sagte er auf Marguerite deutend. »Jede Wette, dass sie ihr halbes Gewicht ausmachen.«
Genna achtete darauf, keine Reaktion zu zeigen. Er sollte nicht wissen, dass sie des Englischen mächtig war. Nicht einmal Marguerite ahnte es.
Marguerite warf ihr einen entsetzten Blick zu, aber Genna nickte ermutigend, froh, dass Marguerite nichts verstanden hatte. Dennoch schlug ihr Herz heftiger.
»Wir sagten einander Lebewohl, Monsieur«, erklärte Marguerite in ihrer Muttersprache.
Die Augen des Mannes blitzten. »Lebewohl? Ich dachte, Ihr wäret auf Pilgerreise?«
Aus Angst, Marguerite könnte ohne Absicht etwas preisgeben, antwortete Genna schnell. »Mein Ziel war Melrose. Schwester Marguerite sucht Heilung in Whithorn Abbey.«
Er sah die junge Nonne aus zusammengekniffenen Augen an. Zur Abwechslung war Genna froh, dass Marguerites angegriffene Gesundheit sich in ihrer zarten Erscheinung und dem bleichen Teint widerspiegelte.
»Ist das so?«, fragte er langsam. »Ich wusste gar nicht, dass Melrose Abbey als Pilgerziel beliebt ist?«
»Vielleicht nicht so beliebt wie Whithorn oder Iona, aber für die Verehrer der Muttergottes ein großer Anziehungspunkt«, sagte sie und bekreuzigte sich andächtig.
Er runzelte die Stirn. Melrose war wie alle Zisterzienserklöster der heiligen Maria geweiht.
»Und Ihr reist allein? Das ist ungewöhnlich.«
Genna hatte einmal einen Hund besessen, der, wenn er sich einmal an einem Knochen festgebissen hatte, diesen nicht mehr losließ. Der Mann ähnelte ihrem Hund. Sie musste einen Weg finden, dass er den Knochen fallen ließ. Aber zuerst musste sie dafür sorgen, dass Marguerite sicher an ihr Ziel kam.
»In meiner Heimat ist es nicht ungewöhnlich. Nur ein vom Teufel Besessener würde einer Braut Christi etwas antun.« Sie hielt unschuldig inne und ließ ihm Zeit, sich ihre Worte durch den Kopf gehen zu lassen. Seine Miene verfinsterte sich jedoch, und so fuhr sie fort: »Wir überholten eine Pilgergruppe, deren Ziel Dryburgh Abbey ist.« Das Kloster war nur wenige Meilen entfernt. »Ich hoffe, mich ihnen für den Rest der Reise anschließen zu können. Vielleicht habt Ihr die Güte, mir den Weg zu zeigen?« Ohne seine Antwort abzuwarten, zog sie Marguerite in eine Umarmung. Mit etwas Glück würde das Mädchen fort sein, ehe ihm dämmerte, was sie getan hatte. »Leb wohl Schwester. Gottes Segen sei mit dir auf der Reise«, sagte sie und flüsterte ihr dann leise ins Ohr: »Geh … rasch … bitte.«
Das Mädchen machte den Mund auf und wollte wohl widersprechen, aber Gennas Hände auf ihren Schultern erstickten mit festem Druck jeden Protest.
Marguerites langer, angstvoller Blick sagte ihr, wie es um sie stand, dennoch tat sie, wie ihr geheißen, und machte sich auf den Weg. Sie versuchte, zwischen den Pferden hindurchzuschlüpfen, wurde hingegen vom Anführer daran gehindert.
»Wartet, Schwester. Wir sind mit unserer Befragung noch nicht fertig. Stimmt’s, Männer?«
Die Blicke, die zwischen den Männern gewechselt wurden, bereiteten Genna noch stärkeres Herzklopfen. Sie genossen die Situation, und es war klar, dass sie nicht das erste Mal in einer solchen waren. Ob diese Soldaten etwas mit dem Verschwinden der Nonnen zu tun hatten, die seit dem vergangenen Jahr vermisst wurden?
Hilfe suchend blickte sie um sich. Es war heller Tag. Das Dorf lag nur ein kleines Stück hinter ihnen, die rechts und links der Straße stehenden Bäume verhinderten allerdings, dass man sie sehen konnte. Und selbst wenn man sie sah … Wer würde wohl einschreiten? Um es mit vier englischen Soldaten in voller Rüstung aufzunehmen, bedurfte es großen Mutes.
Nein, es blieb ihr überlassen, sie aus dieser misslichen Lage zu befreien. Sie hatte versucht, den Anführer in seiner Eitelkeit zu verletzen, und das war ihr nicht gelungen. Auch der Appell an sein Ehrgefühl hatte nicht gefruchtet – offenbar besaß er gar keines. Der brutale Kerl hatte es auf Schwache und Verletzliche abgesehen – zu denen sie selbst glücklicherweise nicht gehörte. Aber er hatte verunsichert reagiert, als sie ihren geistlichen Stand betont hatte, und deshalb wollte sie sich darauf konzentrieren.
Ein rascher Blick zu Marguerite ließ ihr Herz sinken. Die Angst hatte einen Asthmaanfall ausgelöst! Genna erkannte die verräterischen raschen Atemzüge. Viel Zeit blieb ihr nicht.
Gott, steh mir bei!
Ohne dem Engländer weiter Beachtung zu schenken, lief sie zu dem Mädchen, nahm es schützend in den Arm und raunte ihm beschwichtigende Worte ins Ohr. Dennoch richtete sie unverwandt den Blick auf den Anführer.
»Seht doch, was Ihr angerichtet habt. Ihr habt sie so aufgeregt, dass sie einen Anfall bekommt.«
Ihre Worte schienen auf den Mann keinen Eindruck zu machen. »Es wird nicht lange dauern«, sagte er. »Bringt sie her«, wandte er sich auf Englisch an seine Männer.
Ehe Genna reagieren konnte, wurden sie und Marguerite tief in den Wald gezerrt. Ihr Pilgerstab blieb im Schmutz hinter ihnen liegen. Marguerite klammerte sich voller Furcht an sie und stieß einen verzweifelten Schrei aus, als es den Soldaten schließlich gelang, sie zu trennen.
Genna versuchte, äußerlich Ruhe zu bewahren, während ihr Herz wieder zu rasen begann. »Keine Angst, Schwester«, sagte sie, auch um sich selbst zu beruhigen. »Es wird sich alles rasch klären. Sicher wollen diese guten Christen uns nichts Böses.«
Lügen war eine Sünde, in manchen Fällen jedoch entschuldbar. Genna hätte die Worte des Soldaten gar nicht verstehen müssen, um zu wissen, was er plante, leider verstand sie sie, bekam sogar die schrecklichen Einzelheiten mit.
»Die Alte ist hübscher«, sagte der Anführer wieder auf Englisch zu seinen Männern. »Aber wir fangen besser mit der Kränklichen an, ehe sie den Geist aufgibt. Ich möchte ihre Brüste sehen.«
Gena zwang sich, keine Reaktion zu zeigen, obwohl Wut und nun auch Angst sie erfassten, als sie ihn so herzlos reden hörte. Sie würde nicht zulassen, dass sie der Freundin etwas antaten. Und mit siebenundzwanzig Jahren war sie reif, aber nicht alt!
Genna war schon oft in gefährliche Situationen geraten. Diese war vielleicht die gefährlichste, doch war noch nicht alles verloren.
Die Soldaten machten sich nicht die Mühe, sie weiter in den Wald zu bringen, fast so, als wüssten sie, dass niemand wagen würde einzuschreiten. Bruce mochte den Norden Schottlands in der Hand haben, in den Grenzmarken übten die Engländer nach wie vor ungehindert ihre Schreckensherrschaft aus – abgesehen von gelegentlichen Überfällen aus dem Hinterhalt von Bruce’ Truppen. Die Engländer sind nichts weiter als mit Autorität ausgestattete Briganten, dachte Genna. Aber Bruce würde sie bald zurück nach England treiben. In diese schreckliche Lage war sie geraten, weil sie mithalf, dass dieses Ziel endlich erreicht wurde.
Sie gelangten auf eine kleine Lichtung, und die Männer ließen sie mit einem heftigen Schubs los. Genna stolperte, schaffte es jedoch gerade noch, auf den Beinen zu bleiben. Marguerite hatte nicht so viel Glück. Und Genna erkannte entsetzt, dass sich ihr keuchender Atem immer bedrohlicher anhörte. Sie konnte sich kaum auf Hände und Knie stützen, die Kräfte schienen sie völlig verlassen zu haben.
»Man sieht, dass sie für uns bereit ist«, wieherte einer.
Genna senkte den Kopf und murmelte ein lateinisches Gebet, damit die Männer die Zornesröte nicht sehen konnten, die ihr in die Wangen stieg. Sie war unschuldig, hatte aber im Stall oft kopulierendes Vieh gesehen, um die Bedeutung der Worte zu erfassen. Offenbar waren die Menschen nicht anders.
Der Anführer beäugte Marguerites Hinterteil. Als er unter sein Kettenhemd griff, um die Bänder um seine Mitte zu lösen, wusste Genna, dass sie rasch handeln musste. Sie musste ihn von seinen üblen Absichten ablenken – oder sie zumindest auf sich lenken.
All ihren Mut zusammennehmend trat sie zwischen die Männer. »Meine Schwester ist krank, Sir«, erklärte sie. »Wenn Ihr mir sagt, was ihr sucht, kann ich das Missverständnis aufklären, und wir können uns wieder unseren Pflichten widmen. Unseren Pflichten Gott gegenüber«, rief sie ihm in Erinnerung, »und Ihr jenen, die Ihr dem König schuldet.«
Ganz klar, er hatte den eigentlichen Zweck seines Einschreitens vergessen. »Nachrichten«, sagte er, während sein Blick ungeduldig zu Marguerite hinter ihr glitt. »Nachrichten, die von Geistlichen und Nonnen den Rebellen im Norden geliefert werden«, setzte er hinzu. »Aber Verrat wird nicht länger unter heiligen Gewändern verborgen bleiben. Wir wissen, dass viele dieser Nachrichten ihren Weg durch Melrose Abbey nahmen. König Edward will dieses Leck stopfen.«
»Ach«, sagte sie, als wäre ihr ein Licht aufgegangen. »Jetzt verstehe ich den Grund für Euren Argwohn, Sir. Ihr wart zweifellos berechtigt, uns aufzuhalten. Aber wie schon gesagt, führen weder Schwester Marguerite noch ich geheime Botschaften mit uns.« Sie hielt ihm den Lederbeutel mit ihren Habseligkeiten hin und bückte sich dann nach Marguerites kleiner Tasche, wobei sie die schweren Atemzüge ihrer Freundin zu überhören trachtete. Der Trost musste warten. Sie öffnete die Tasche und zeigte sie ihm. Er warf kaum einen Blick hinein, stieß sie nur weg. »Seht«, sagte sie. »Wir haben nichts zu verbergen. Unsere Unschuld ist bewiesen. Ihr habt kein Recht, uns länger aufzuhalten.«
Sie sah ihm an, wie wütend er war. Aber je länger sie ihn aufhielt, desto mehr Zeit hatte er, sein Vorgehen zu überdenken – sein ungerechtfertigtes Vorgehen.
»Und wenn die Nachrichten an einer anderen Stelle versteckt sind?«, warf nun einer der anderen Männer ein.
Genna tat so, als verstünde sie nichts. Es lief ihr kalt über den Rücken, als sich ein träges Lächeln um den Mund des Anführers legte. Er bückte sich und riss ihr den Schleier herunter. Sie schrie auf, als die Haarnadeln sich lösten und ihr Haar sich als schwere seidige Flut über ihren Rücken ergoss. Rasch griff sie nach ihrem Kopf. Vergeblich – sie konnte es nicht verbergen.
Die Reaktion der Männer, ihre Ausrufe und zotigen Ausdrücke entlockten ihr eine leise Verwünschung. Das lange goldblonde Haar war die einzige Verbindung zu ihrer früheren Identität. Janet of Mar war tot. Es war töricht, sich an das zu klammern, was sie gewesen war, doch ertrug sie es nicht, sich das Haar abzuschneiden, wie die meisten anderen Nonnen es taten. Nun musste sie für diese Eitelkeit büßen.
Der Anführer stieß einen leisen Pfiff aus. »Seht euch das an, Jungs«, sagte er auf Englisch. »Wir haben da eine echte Schönheit entdeckt. Möchte wissen, was das Mädchen sonst noch unter seinem Gewand versteckt …«
Obwohl sie versuchte, sich zu beherrschen, zuckte sie unter den nicht für ihre Ohren bestimmten Worten zusammen. Sie wusste, was er meinte. Zum Glück war er zu abgelenkt, um ihre Reaktion wahrzunehmen. Er legte seine behandschuhten Hände in ihren Nacken und zog an dem groben Wollstoff von Habit und Skapulier. Er riss beides bis zur Taille auseinander.
Marguerite schrie erneut auf. Auch Genna hätte schreien mögen. Sie setzte sich zur Wehr, er aber war zu stark. Er schob das zerrissene Gewand von ihren Schultern. Vor völliger Nacktheit bewahrte sie nur ein dünnes Hemd, das für eine Nonne viel zu fein war – noch eine ihrer Schwächen –, doch fiel es ihm nicht auf. Genna konnte nicht verhindern, dass ihr Tränen in die Augen stiegen, einen Moment später war auch das Hemd zerrissen. Wolle und Leinen hingen in Fetzen von ihren Schultern. Sie versuchte sich zu bedecken, der Anführer aber zog ihre Arme weg.
Seine Augen verdunkelten sich vor Verlangen, als sein Blick auf ihre nackten Brüste fiel. Ihre Zuversicht geriet ins Wanken.
»Was hat sie auf dem Rücken?«, fragte einer der Männer hinter ihr.
Genna hätte sich am liebsten bei ihm bedankt. Seine Worte riefen etwas in Erinnerung und fegten die Angst aus ihrem Herzen. Wilde Entschlossenheit nahm ihre Stelle ein – sie würde sich und Marguerite retten. Sie fuhr herum, ohne sich zu bedecken.
»Das sind die Male meiner Hingabe an Gott. Habt Ihr noch nie Spuren von Geißelungen und einem härenen Hemd gesehen?«
Die Männer stutzten. Genna wusste, welcher Anblick sich ihnen bot. Rosiges, vernarbtes Fleisch verunstaltete ihren bleichen Rücken. Sie aber sah diese Entstellung anders. Die Narben waren eine Mahnung, ein Zeichen, das sie an einen Tag erinnerte, den sie niemals vergessen durfte. An einen Mann, der wie ein Vater für sie gewesen war und dessen Tod ihr auf der Seele lag. Diese Narben hatten sie stärker gemacht. Sie hatten ihr ein Ziel gegeben.
»Noch nie habe ich solche Narben an einer Frau gesehen.«
»Ich bin keine Frau«, fuhr sie den Sprecher an. Er war jünger und schien von der Vorgangsweise des Anführers nicht so überzeugt wie die anderen. »Ich bin eine Braut Christi.« Sie hoffte, dass ihre Lüge auch dieses Mal nicht als Sünde gewertet wurde. Die Kleiderfetzen um sich raffend vollführte sie eine langsame Drehung, damit jeder der Männer sie sehen konnte. »Wenn Ihr eine von uns anrührt, werdet Ihr ewiges Höllenfeuer erleiden müssen. Gott wird Euch für Eure Untaten strafen.« Der jüngere Mann erbleichte. Ihr nächster Blick galt dem Anführer. Aus ihren Augen loderte Zorn. Er sollte es nicht wagen, sich ihr zu nähern. »Unsere Unschuld gehört Gott. Nehmt Ihr sie uns, werdet Ihr dafür büßen.« Als der Mann zurückwich, wusste Genna, dass sie gewonnen hatte. Unverzagt trat sie auf ihn zu. »Euer Leib wird im Feuer Eurer Sünde brennen. Eure Männlichkeit wird schwarz verkohlen, Eure Eier werden zur Größe von Rosinen schrumpfen, und Ihr werdet nie wieder eine Frau haben. Eure Verdammnis wird ewig währen.«
Ewen Lamont und Eoin MacLean näherten sich der Abtei von Eildon Hill her durch den Old Wood, als sie die Frau schreien hörten. Ohne zu wissen, was sie erwartete, schlichen sie, von den Bäumen und Büschen gedeckt, näher.
Ewen hörte die Stimme als Erster und warf seinem Partner einen Blick zu. Auch MacLean hatte den Schrei gehört. Er nickte, die Lippen fest zusammengepresst. Die Worte waren in französischer Sprache gesprochen, aber der Akzent war italienisch – römisch, wenn er nicht irrte.
Es sah ganz danach aus, als hätten sie ihre Nonne gefunden. Er spähte zwischen den Bäumen hindurch, um sich zu vergewissern, und erstarrte bei dem Anblick, der sich ihm bot. Im ersten Moment war er wie betäubt.
Verflucht! Sein Mund wurde trocken, er spürte Glut in den Lenden, als er die halb nackte Frau mit der wallenden goldblonden Mähne erblickte. Das Licht verwandelte das Haar in eine schimmernde Kaskade aus Gold und Silber, doch war es die nackte Haut, über die es fiel, die sein Verlangen mit einem Schlag weckte. Gewiss, Brüste waren immer ein willkommener Anblick, aber diese hier …
Er vermeinte, noch nie so vollendete gesehen zu haben. Nicht übermäßig groß, sondern in richtiger Proportion zu der schmalen Taille der Frau und dem flachen Bauch. Weich und rund und jugendlich keck aufgerichtet. Die milchweiße Haut war so hell und makellos, dass es keiner Berührung bedurfte, um zu wissen, dass sie samtweich war.
Aber er wollte sie berühren, wollte die Hände über die weichen Hügel gleiten lassen und sein Gesicht in der tiefen Senke dazwischen begraben. Er wollte die zarten rosa Knospen liebkosen, bis sie hart wurden, und sie dann mit der Zunge umkreisen, ehe er sie in den Mund nahm und daran sog.
Jesus!
Zwischen seinen Brauen erschien eine Falte, als er die willkürlich verlaufenden Narben auf ihrem Rücken bemerkte. Flüchtig fragte er sich, woher sie rühren mochten, doch war seine Aufmerksamkeit zu stark von der Vollkommenheit der Frau gefesselt.
MacLean, dem sein Interesse nicht entgangen war, beugte sich vor, um ebenfalls einen Blick zu wagen. Sein Fluch riss Ewen aus seiner Starre.
Um Himmels willen, eine Nonne!
Ein Umstand, den die englischen Krieger wohl vergessen hatten. Nicht nur ihr zerfetztes Habit und das Hemd – für eine Nonne ein sehr feines Hemd, wie Ewen an der edlen Stickerei erkannte –, sondern die lüsternen Mienen der Soldaten verrieten ihre Absicht. Zorn erfasste Ewen. Einer Nonne Gewalt anzutun war nicht nur eine verwerfliche Untat, sondern Frevel.
Er stieß den ebenso erstarrten MacLean an, und beide machten sich für den Angriff bereit. In der Regel bevorzugte Ewen eine Pike, die Waffe des Fußsoldaten, da sie aber zu Pferd gekommen waren, zog er nun sein Schwert aus der Scheide auf seinem Rücken.
Eben wollte er das Zeichen zum Angriff geben, als sie zur Tat schritt und den Männern mit Worten Paroli bot. Er hielt inne. Großartig! So viel Tapferkeit hatte er noch nie bei einer Frau erlebt. Am liebsten hätte er sein Schwert gesenkt und ihr Beifall gezollt. Die Nonne besaß das Herz einer Walküre. Jedes einzelne, mit Leidenschaft geäußerte Wort, mit dem sie ihre Keuschheit, ihre heilige Keuschheit, verteidigte, verriet Autorität und Überzeugung.
Er zuckte zusammen, da er sich ein wenig getroffen fühlte. Ihre Worte, eine wahre Litanei des Schreckens, die aufzählte, was jeden treffen würde, der sie anzufassen wagte, ließ auch den letzten Rest an Lust schwinden.
Schrumpfen? Rosinen?
Er schauderte, dann fasste er sich wieder. Für eine Frau im Nonnenkleid mangelte es ihr nicht an Fantasie.
Aber grenzte es nicht an Sünde, eine Nonne mit solchen Brüsten auszustatten?
Er gab das Zeichen zum Angriff. »Airson an Leòmhann!«
Mit dem wilden Kampfruf der Highland-Garde stürzten er und MacLean auf die Lichtung.
2
Janet – oder vielmehr Genna – wusste, dass sie gewonnen hatte. Aus dem Blick des Anführers war jegliches Verlangen gewichen. Tatsächlich sah es aus, als vermiede er es, sie überhaupt anzuschauen.
Kaum aber hatte sie ihren Sieg ausgekostet, als zwei Männer zwischen den Bäumen hervorstürzten.
Bei ihrem Kriegsruf lief es ihr kalt über den Rücken. Es war lange her, seit sie ihre Muttersprache gesprochen hatte, doch verstand sie die gälischen Worte sofort: Für den Löwen. Ein Ruf, den sie nicht kannte und den sie keinem Clan zuordnen konnte. Doch waren es Highlander – so viel war klar – und daher Freunde.
Sie biss sich auf die Lippen. Zumindest hoffte sie, dass es sich um Freunde handelte.
Die kalte Effizienz, mit der die Highlander die Soldaten außer Gefecht setzten, weckte ihre Zweifel. Sie wollte sich keinesfalls noch einmal aus einer gefährlichen Situation herausreden müssen. Und alles an diesen Männern kündete von Gefahr.
In den letzten Jahren hatte sie mit ihren Landsleuten wenig Kontakt gehabt und schon vergessen, wie einschüchternd sie waren. Groß, breitschultrig und mit Muskeln bepackt, waren die Highlander genauso rau, zerklüftet und ungezähmt wie das wilde und unwirtliche Land, das sie hervorgebracht hatte. Auch waren sie außergewöhnliche Kämpfer, deren kompromisslose Kampfweise ein Erbe der nordischen Plünderer war, die Generationen zuvor ihre Küsten heimgesucht hatten.
Ein Schaudern überlief sie. Diese beiden waren nicht anders – im Kämpfen und Töten womöglich noch geübter. Sie zuckte zusammen und wandte sich ab, als einer der Männer seine Klinge in die Kehle des jungen Engländers stieß. Sie hasste Blutvergießen, auch wenn es berechtigt war.
Sie hatte kaum Zeit, sich nach ihrem Umhang zu bücken, ihn um die Schultern zu werfen und Marguerite auf die Beine zu helfen, als der Kampf schon vorbei war. Die vier Engländer lagen in ihrem Blut im Gras, die Gefahr war gebannt. Doch als sie den Mann auf sich zukommen sah, während sie die schluchzende Marguerite nach besten Kräften zu trösten versuchte, war sie dessen nicht mehr so sicher. Sie spürte ein merkwürdiges Prickeln auf der Haut, als der Blick des Kriegers dem ihren begegnete. Sie schnappte nach Luft, ihr Herzschlag stockte, um gleich darauf wieder einzusetzen.
Unter dem stählernen Nasenhelm war von seinem Gesicht wenig zu erkennen. Guter Gott, trugen die Highlander noch immer diese Helme? Man sah nur, dass sein unrasiertes Kinn ebenso kräftig und eindrucksvoll wie alles andere an ihm war. Alles an seinem Äußeren wirkte Furcht einflößend, vom metallgespickten, blutbesudelten Waffenrock bis zu den vielen Waffen, die er an seinem muskulösen Körper angeschnallt trug. Ein Blick in seine stahlblauen Augen aber zeigte ihr, dass er keine Bedrohung darstellte. Keine für sie jedenfalls. Die Toten hinter ihm hätten dem zu Lebzeiten natürlich widersprochen.
Erst als sie erleichtert aufatmete, merkte sie, wie lange sie den Atem angehalten hatte.
Er war nur ein Highland-Krieger. Vielleicht körperlich etwas dominanter als die meisten anderen, dennoch traute sie sich zu, mit ihm fertigzuwerden. Im Laufe der Jahre hatte sich ihr Weg mit dem vieler Kämpfer gekreuzt – sie hatte noch nie Probleme mit ihnen gehabt.
Und doch weckte etwas an ihm ihr Unbehagen. Vielleicht war es die Art, wie er ihren Blick festhielt, während er mit undurchdringlicher Miene auf sie zuschritt. Sie war geübt darin, Menschen zu durchschauen und sie einzuschätzen, er aber gab nichts preis.
Wie viel hatte er beobachtet? So wie er ihren Umhang ins Auge fasste, als er vor ihr stehen blieb, hatte er genug gesehen. Sie errötete in einem Moment, wie er unpassender nicht hätte sein können. Von dem Gefühl erfüllt, plötzlich die Oberhand gewonnen zu haben, wollte sie die Sache ganz rasch hinter sich bringen.
Sie ließ Marguerite los, fiel auf die Knie und ergriff seine in einem Lederhandschuh steckende Hand, um ihn sodann mit einer raschen Abfolge von Dankesfloskeln auf Französisch, vermischt mit italienischen Gebetsformeln, zu überschütten. Wenn sie Glück hatte, würde er wie die meisten gewöhnlichen Highlander – und nichts deutete darauf hin, dass er etwas anderes war – weder Italienisch noch Französisch sprechen, und die Unterhaltung würde ganz kurz ausfallen.
Wäre sie dazu imstande gewesen, sie hätte ein paar Tränen vergossen, doch lag die Kunst, das bewusst zu inszenieren, außerhalb ihrer schauspielerischen Fähigkeiten. Mit einem unterwürfigen Blick hätte sie es vielleicht geschafft, doch als er ihr Haar ansah und die Stirn runzelte, fiel ihr ein, dass sie ohne Schleier vor ihm kniete. Ohne diesen fühlte sie sich … entblößt. Es war lange her, dass sie sich in den Augen eines Mannes als Frau gefühlt hatte, und es weckte in ihr ein Gefühl großer Verletzlichkeit. Da sie sich so lange schon als Nonne ausgab, hätte sie beinahe vergessen, dass sie keine war. Noch nicht wenigstens.
Ohne innezuhalten, um ihm einen Einwurf zu gestatten, stand sie auf und bedankte sich abermals, ehe sie seine Hand freigab. Sie bückte sich nach ihrem Schleier und bedeckte ihren Kopf. Dann nahm sie Schwester Marguerites Arm. Sie musste schnell zurück ins Kloster, wo man sich um die junge Nonne kümmern würde, und dann musste sie rasch weiter – dieses Mal allein.
ENDE DER LESEPROBE