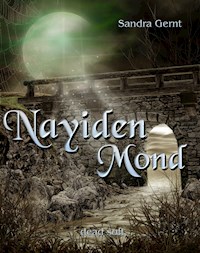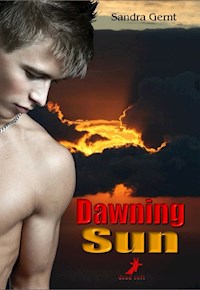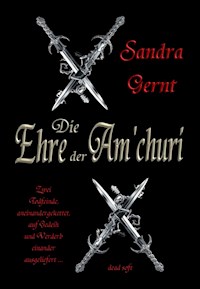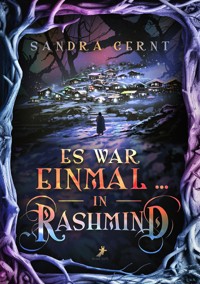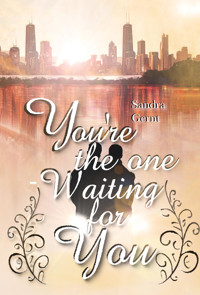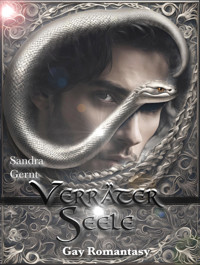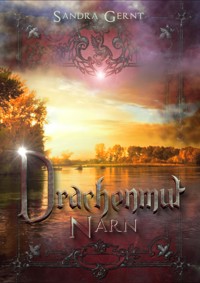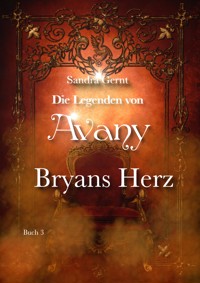3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hartmut, genannt Hardy, hat – neben seinem Namen – gleich mehrere Probleme: Er ist neunundzwanzig und will endlich aus dem Klammergriff seiner Mutter entfliehen, ihres Zeichens viermal geschiedene Psychiaterin. Außerdem wäre es gut, wenn er nach Vollendung seines Studiums so langsam mal mit Arbeit und Geldverdienen beginnen könnte. Und weil seine Erfahrungen mit Männern allesamt grauenhaft waren, will er auf keinen Fall jemals wieder irgendwas mit einem Kerl anfangen. Leider ist sein neuer Nachbar in der ersten eigenen Wohnung seines Lebens ein Spitzentyp, und auf eigenen Füßen stehen gar nicht so einfach wie gedacht … Doch Hardy beißt sich durch, denn Aufgeben ist keine Option. Ca. 40.000 Wörter Im gewöhnlichen Taschenbuchformat hätte dieses Buch ungefähr 200 Seiten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Hartmut, genannt Hardy, hat – neben seinem Namen – gleich mehrere Probleme:
Er ist neunundzwanzig und will endlich aus dem Klammergriff seiner Mutter entfliehen, ihres Zeichens viermal geschiedene Psychiaterin. Außerdem wäre es gut, wenn er nach Vollendung seines Studiums so langsam mal mit Arbeit und Geldverdienen beginnen könnte. Und weil seine Erfahrungen mit Männern allesamt grauenhaft waren, will er auf keinen Fall jemals wieder irgendwas mit einem Kerl anfangen.
Leider ist sein neuer Nachbar in der ersten eigenen Wohnung seines Lebens ein Spitzentyp, und auf eigenen Füßen stehen gar nicht so einfach wie gedacht … Doch Hardy beißt sich durch, denn Aufgeben ist keine Option.
Ca. 40.000 Wörter
Im gewöhnlichen Taschenbuchformat hätte dieses Buch ungefähr 200 Seiten
www.sandra-gernt.de
Alle Rechte vorbehalten. Ein Nachdruck oder anderweitige Verwertung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Autorin gestattet.
von
Sandra Gernt
„Ich begreife immer noch nicht, wozu das gut sein soll.“
Hardy versuchte sein Bestes. Er wusste, wie sehr seine Mutter es hasste, wenn er sie ignorierte. Sie wusste, wie sehr er es hasste, wenn sie seine Entscheidungen hinterfragte. Dann verfiel er jedes Mal in Selbstzweifel, die ihn dermaßen quälten, dass er selbst bei Erfolg anschließend oft keine echte Freude mehr empfinden konnte. Zu erschöpft war er von den ganzen Zweifeln, und verunsichert, ob er den Sieg tatsächlich genießen durfte. Quasi jeden Meilenstein seines Lebens hatte sie ihm auf diese Weise kaputt gemacht. Ihn von einer ganzen Reihe von Plänen abgebracht, an die er zuvor fest geglaubt hatte. Was er letztendlich durchboxen konnte, darauf war er mit dem Abstand einiger Jahre dann auch entsprechend stolz.
Sein Abitur etwa. Seine Mutter hatte gezweifelt, ob er das Zeug dazu besaß und ihm jahrelang zugeredet, dass er lieber mit dem Realschulabschluss zufrieden sein sollte. Damit bekäme er schließlich auch gute Jobs und nicht jeder wäre fürs Studium und die Geisteswissenschaften gemacht. Mit dem Ergebnis, dass er monate- und jahrelang Tag und Nacht gelernt und geschuftet und gebüffelt hatte, um ihr zu beweisen, dass er es eben doch konnte. Der Ehrgeiz hatte ihn fast bis in den Burnout getrieben und dafür gesorgt, dass er mit sechzehn Jahren zum ersten Mal Magengeschwüre erlitten hatte. Seinen Abschluss mit der Note 1,3 hatte sie lange betrachtet und dann gefragt, warum es keine Null hinter dem Komma geworden war.
Ja. Die Frage stellte er sich heute immer noch. Dabei war es zehn Jahre her. Den Führerschein hatte sie ihm ausreden wollen. Reine Zeit- und Geldverschwendung. Solange er in einer Großstadt lebte, kam er mit Bus und Bahn überall bequem hin und brauchte sich kein völlig überteuertes Auto zu leisten, mit dem er auch noch zum Klimawandel beitrug. Mit Ach und Krach und viel Mühe hatte er die Prüfungen bestanden, sich das teure Geld dafür mit Kellnern und anderen Jobs selbst verdient – und besaß bis heute kein eigenes Auto. Vermutlich konnte er also gar nicht mehr fahren, weil er seit neun Jahren nicht mehr hinter einem Steuer gesessen hatte. Sobald er daran dachte, dass er sich auch gegen den erklärten Willen seiner Mutter ein Auto zusammensparen könnte, bekam er sofort Bauchschmerzen und Durchfall und sein Magen muckte wieder.
Die Neigung zum Durchfall bei Stress hatte er über die Entscheidung entwickelt, welchen Berufsweg er wählen wollte. Erst wollte er in die Chemie. Seine Mutter hatte ernste Zweifel, das er den harten Wettbewerb aushalten würde, der in Forschung und Wissenschaft herrschte, und auch in der freien Wirtschaft zu spüren war. Ein ruhiger Schreibtischjob, vielleicht bei einer Versicherung, das wäre doch so viel besser für sein zartes Gemüt? Zumal man auch dort nicht mit Federn gestreichelt und Rosenblüten beworfen wurde.
Natürlich hatte er dennoch das Chemiestudium begonnen und nach zwei Semestern abgebrochen, als sich zwei idiotische Kommilitonen über seinen Namen lustig gemacht hatten. Dafür schämte er sich heute noch – aufgeben, weil zwei Vollpfosten Spaß hatten. Da war er in der Schule wesentlich schlimmer und bösartiger gemobbt worden.
Klar. Er hätte nicht aufgegeben, wenn er mit ganzem Herzen für dieses Studium gebrannt hätte. Es war eher eine praktische Entscheidung gewesen, da er die Uni bequem erreichen konnte und Chemikanten händeringend gesucht wurden. Trotzdem fühlte es sich nach Niederlage an, dass er einfach so aufgesteckt hatte.
Danach war er ziemlich herumgeirrt, hatte ein halbes Jahr mit Kellnern und Pizza backen verbracht, ein Semester Steuerrecht ausprobiert, hatte sehr mühsam das beständige Drängeln seiner Mutter in Richtung BWL und „sicherer, gemütlicher Schreibtisch“ ignoriert …
… Und war schließlich bei Museumspädagogik gelandet.
Das war so ziemlich das Trotzigste, was er bis zum heutigen Tag fertig gebracht hatte.
Nun ja.
Abgesehen von seinem Entschluss, endlich aus dem lächerlich großen Haus zu fliehen, in dem er die letzten neunundzwanzig Jahre verbracht hatte. Er wollte um jeden Preis ausziehen, bevor er das dritte Lebensjahrzehnt begann. Und natürlich war seine Mutter … skeptisch.
„Hardy, mein Schatz. Bist du wirklich sicher, dass dies die bestmögliche Entscheidung für dein Leben ist?“, fragte sie sanft. „Hier im Haus hast du deine eigene Etage für dich selbst. Du lebst streng genommen seit deinem zwölften Lebensjahr allein – mit Familienanschluss. Du kochst ja auch für dich selbst. Wozu also Geld für eine kleine, unkomfortable Wohnung ausgeben, wo dich lärmende Nachbarn stören, du viel weniger Platz hast, als du es gewohnt bist und du für jede Kleinigkeit mit dem Vermieter kämpfen musst?“
„Mutter.“ Hardy schnaufte erschöpft. „Ich muss einfach irgendwann einmal auf eigenen Beinen stehen. Wirklich selbstständig werden. Ohne den Familienanschluss. Hier geht es nicht um Pragmatismus. Du würdest jedem deiner Patienten dasselbe raten.“
„Das kommt ganz darauf an, wie stabil der Einzelne ist“, entgegnete sie und furchte die Stirn. Das war ein Zeichen für erhöhte Katastrophengefahr. Elisabeth von Altenau-Speer furchte die Stirn nur, wenn sie vor Empörung oder gar echtem Zorn die Kontrolle zu verlieren drohte. Sie hasste es, weil dadurch ihre Falten betont wurden. Dafür fühlte sie sich auch mit achtundfünfzig noch viel zu jung. Selbstverständlich färbte sie ihr Haar noch immer regelmäßig Aschblond. Diese Haarfarbe hatte sie ihm genauso vererbt wie die veilchenblauen Augen. Ihre Frisur war streng und kurz gehalten, um die Locken zu unterbinden, die sich sonst zeigen würden. Es ließ sie gepflegt, majestätisch und respekteinflößend wirken, zumindest in Kombination mit ihrem sorgfältig aufgetragenen Make-up, den dezenten Kostümen, mit denen sie auch auf einem G20-Gipfel der Spitzenpolitiker nicht weiter auffallen würde, und ihrem sichtlich teuren Schmuck.
Locken hatte sie ihm glücklicherweise nicht vererbt, darum konnte er das Haar sogar länger tragen als sie. Er achte auf modische Gepflegtheit, aber handspannenlang war für ihn das Minimum.
„Mein Schatz. Du bist emotional instabil, wie dir sehr wohl bekannt ist. Zudem hast du gerade erst den Master abgeschlossen. Es wäre äußerst vernünftig, aus einer vertrauten, sicheren Umgebung endgültig ins Berufsleben zu starten und in etwa einem halben Jahr damit zu beginnen, deinen Auszug zu planen. Überhastete Aktionen wie das hier“, sie wies missbilligend auf die Umzugskartons, die sich in Hardys Zimmer stapelten, „bringen nichts als Stress, Unruhe und Angstzustände. Deine Magengeschwüre könnten wiederkommen und aufbrechen. Willst du das wirklich riskieren?“ Sie blickte ihn über die randlose, vergoldete Brille hinweg an. Das war der Killerblick, mit dem sie schon unzählige Male die Luft aus seinen Gedankenballons geschossen hatte. Ideen, Projekte, Träume, Pläne – alles das hatte Hardy verworfen, wenn sie ihn auf diese Weise ansah und ihn nach dem Verstand fragte, statt direkte Verbote auszusprechen.
Doch diesmal würde er nicht klein beigeben!
„Der Vertrag ist unterschrieben, Mutter“, fiepte er kleinlaut. Hardy räusperte sich, richtete sich zu seiner vollen Größe von knapp 1,69 m auf, drückte den Rücken durch und versuchte es noch einmal. „Der Vertrag ist unterschrieben“, wiederholte er, diesmal kräftiger und mindestens eine Oktave tiefer. „Ich habe dir absichtlich vorher nichts gesagt. Das hier muss ich allein schaffen, Mutter. Gleich kommt mein Freund Leon, der mir hilft, die Kartons rüberzuschaffen. Es ist nur das Notwendigste, denn ja, meine Wohnung ist sehr klein. Das Meiste von meinen Sachen wird zurückbleiben müssen und ich wäre dir dankbar, wenn du …“
„Mein Gott, Hardy!“ Ihre Stimme fiel in Richtung absoluter Gefrierpunkt. Mit diesem Tonfall hatte sie viermal den Scheidungsprozess eingeleitet. „Mein Gott, Jörg!“ So hatte sie sich von Hardys Vater getrennt. Bei den späteren Herren hatte sie lediglich den Vornamen angepasst. Frau Doktor der Psychiatrie ertrug es nicht gut, wenn die Männer in ihrem Leben nicht genau das taten, was sie wollte und für gut, richtig und vernünftig hielt.
Dabei vergaß sie völlig, dass die meisten Menschen durchaus Freude daran hatten, eine eigene Meinung besitzen zu dürfen und sich gerne auch mal schlecht, falsch und unvernünftig benehmen wollten. Einfach weil sie es konnten.
Sie drehte sich schnaubend um und verließ das Schlachtfeld.
Verblüfft starrte Hardy ihr hinterher. Er hatte gewonnen. Was auch immer. Seine Mutter hatte ihm quasi die Scheidungspapiere überreicht und er durfte ausziehen. Besser konnte er es nicht haben, oder? Genau das hatte er sich gewünscht. Wozu auch immer …
Jetzt musste er nur noch zusehen, dass er tatsächlich auf eigene Füße kam. Er wollte frei sein. Frei! Der erste Schritt war gemacht.
Leon war ein guter Typ. Zuverlässig, pünktlich, pedantisch. Vermutlich der langweiligste Mensch dieser Welt. Er sagte oder tat nie irgendetwas Aufregendes. Dass er mit Leib und Seele Maurer war, sah man ihm mühelos an – er war in etwa genauso breit wie hoch, gefühlt jedenfalls, und wenn er sich modisch mutig fühlte, trug er sein kariertes Hemd in Grün statt in Rot. Sein trotz seiner Jugend von noch nicht einmal dreißig Jahren schwindendes Blondhaar verbarg er gerne unter Baseballcaps, die er sich falsch herum aufsetzte. Für ihn war die Welt in Ordnung, wenn er eine Schaufel in die Hand gedrückt bekam und eine Ladung Kies von links nach rechts bewegen sollte.
Hardys Mutter zog über Leon bloß die fein getrimmten Augenbrauen hoch, wann immer sie sich begegneten. Tatsache war: Für einen hastigen Umzug ohne viel Vorbereitungszeit brauchte man die Leons dieser Welt. Zumindest wenn man wollte, dass es zackig ablief und funktionierte. Außerdem mochte Hardy ihn wirklich gern. Sie kannten sich seit der Kindergartenzeit und waren auch in der Grundschule Freunde gewesen. Leon hatte ihn allein mit seiner Anwesenheit davor bewahrt, körperlich angegriffen zu werden, denn ja, Hardy war das typische Mobbingopfer, praktisch von Geburt an gewesen. Hardy hatte ihm die Multiplikation und Division mit und ohne Rest beigebracht. Später hatten sie sich etwas aus den Augen verloren, da Leon zur Realschule ging und Hardy aufs Gymnasium und sie einen völlig unterschiedlichen Freundeskreis entwickelt hatten. Da sie nah beieinander wohnten, war der Kontakt dennoch geblieben und hatte sich mit den Jahren wieder intensiviert, seit Hardy das Studium begonnen hatte. Leon hatte eine Wohnung im selben Haus wie seine Eltern genommen, um den beiden unter die Arme greifen zu können. Seine Mutter war herzkrank, der Vater hatte Alzheimer. Alles nicht einfach, zumal Leon verheiratet und seine Frau mit dem zweiten Kind schwanger war. Nichts davon konnte ihn aus der Ruhe bringen, am Leben hadern lassen oder davon abhalten, Hardy aus dieser grässlichen Villa zu befreien.
„Bin froh, dass du endlich mal Nägel mit Köpfen machst“, brummte er, während er drei Kartons auf einmal packte. „In dieser Bruchbude sollten keine Menschen leben müssen.“
Womit er ein wahres Wort gelassen aussprach. Das Haus war ein Erbstück. Hardys Urgroßeltern hatten es gekauft und seine Mutter hatte das Erbe angetreten, da ihre eigenen Eltern es damals nicht haben wollten. Hardys Großeltern waren schreckliche Leute. Konservativ, kalt, extrem auf ihren Adelstitel bedacht, von der Vorstellung durchgeistigt, dass sie dank ihres Vermögens etwas Besseres waren. Er war froh, dass er sie in seinem Leben kaum ein halbes Dutzend Mal gesehen hatte.
Von außen war das Haus beeindruckend: Edle Stuckverzierungen, hohe Holzfenster mit Sprossen, zwanzig Zimmer auf zwei Etagen, Marmorstatuen im Vorgarten, schmiedeeiserner Zaun, langgestreckte Auffahrt, über viertausend Quadratmeter Gartenfläche hintendran … Ja, wer in einem solchen Haus lebte, gehörte zu den besseren Leuten. Oder so dachte man das allgemein.
Von innen war es ein Albtraum aus zu viel Marmor und Fliesen, vier Meter hohen Decken, Räume, die schlichtweg nicht zu beheizen waren, ein Abwassersystem aus den Fünfzigern, Elektroleitungen aus der Hölle, kaum Steckdosen … Man konnte in diesem Gemäuer nicht warm werden. Ob Sommer oder Winter, es war immer zu kalt. Schwitzten andere bei vierzig Grad im Schatten im Hochsommer, musste Hardy noch immer nachts unter das dicke Federbett kriechen, um sich nicht die Zehen blau zu frieren. Seine Mutter gab allein für die Gärtnerfirma ein Vermögen aus, damit die Außenflächen immer schön aussahen. Die Villa von innen zu sanieren, die Idee hatte sie schon vor dreißig Jahren aufgegeben – es wäre billiger, alles abzureißen und komplett neu aufzubauen. Und so lebten sie mit Wänden, bei denen der Putz laut rieselte, sobald man mit der Fingerkuppe dagegen stieß. Mit der Tatsache, dass weder eine Telefonanlage noch Fernsehanschluss möglich war, ohne das halbe Haus abzureißen. Eine Dusche gab es nicht, dafür eine gusseiserne Wanne auf breiten Füßen, die sich eigentlich ganz gut in einem Museum machen würde. Aus dem Hahn kam meistens bloß kaltes Wasser und wenn man Pech hatte, war es rostig-braun und wirklich sehr kalt. Da es keine Heizungsanlage gab, wurde im Winter bloß das Wohnzimmer warm, denn dort gab es den Kamin. Zum Schlafen waren eben mehrere Decken übereinander notwendig und wenn es sehr kalt wurde, durfte Hardy die mobile Infrarotheizung einstöpseln. Das war ein Risiko, denn es führte schnell zu Kurzschlüssen in den überforderten Stromleitungen.
Die vier Ex-Männer von Hardys Mutter hatten jeweils tapfer versucht, Modernisierungen zu ermöglichen und mussten allesamt einsehen, dass es eben nicht immer eine Frage des Willens war – und selbst Geld keineswegs alle Probleme löste. Tatsächlich waren die mehr als unbequemen Wohnbedingungen mindestens ein gewichtiger Part bei den jeweiligen Scheidungen gewesen. Wobei Achim, der letzte Ex, es so formuliert hatte: „Dein verdammtes Herz ist mindestens genauso kalt wie diese Bruchbude, die du ein Haus nennst, Lizzie!“
Danach hatte sie kein einziges Wort mehr mit ihm gewechselt, denn er hatte gleich zwei Todsünden begangen: Ihr Haus beleidigt und sie Lizzie genannt statt Elisabeth.
„Früher hatte ich immer gedacht, wer in diesem Palast leben darf, muss mindestens ein König sein“, sagte Leon und starrte missbilligend auf die hässlichen Marmorfliesen im rosé-grauen Muster, das die gesamte untere Etage auskleidete. Allzu oft hatte er diese heiligen Hallen noch nicht betreten und das letzte Mal war lange her. „Heute weiß ich, dass es Höchststrafe ist.“
„Ich bin dran gewöhnt“, murmelte Hardy. „Es wird seltsam werden, mit niedrigen Decken, Laminat, Gasheizung und warmem Wasser klarzukommen.“
„Mann, du bist alt genug und ich bin so froh, dass du endlich dein Studium abgeschlossen hast. Hatte schon Angst, du gehst in Rente, bevor du mit dem Arbeiten anfängst. Wird aber komisch werden, dass du nicht mehr quasi nebenan wohnst.“
Das war fast schon der einzige Grund, warum Hardy seinen Auszug bedauern könnte. Andererseits wohnte er bloß zehn Minuten mit dem Auto entfernt, wenn nicht gerade Feierabendverkehr herrschte, und er wusste, dass er und Leon in Kontakt bleiben würden. Ulkigerweise war Leons Vater daran schuld, dass sie untrennbar geworden waren, obwohl sie eigentlich nicht wirklich viel gemeinsam hatten.
Damals waren sie etwa zwölf oder dreizehn gewesen. Leon klingelte eines Abends bei ihnen, bat Hardy um ein Gespräch, was so aussah, dass sie rund eine halbe Stunde schweigend in Hardys Zimmer gehockt hatten, bis Leon endlich herausplatzte:
„Mein Vater hat mir heute verboten, mit dir zu spielen. Er sagt, du bist garantiert eine Schwuchtel und er will nicht, dass du auf mich abfärbst. Außerdem hätte er es noch nie gemocht, dass ich mich mit dir abgebe, weil du glaubst, was Besseres zu sein, bloß weil deine Mutter Psychiaterin ist und tausend wichtige Leute kennt, weil sie in all diesen Vorständen sitzt und Politik macht.“ Er schaute Hardy forschend an, dem schlagartig die Luft zum Atmen fehlte. Ein Hieb mit einer Keule in den Magen hätte nicht verheerender oder schmerzhafter sein können. „Ist es denn wahr?“, fragte Leon. „Bist du eine Schwuchtel?“
Über diese Frage musste Hardy erst einmal nachdenken. Er wusste noch nicht allzu lange, was Homosexualität überhaupt bedeutete, und hatte erst vor einigen Monaten begonnen darüber zu grübeln, ob dieses sperrige Wort vielleicht etwas mit ihm zu tun haben könnte. Er fand jedenfalls prominente Sportler interessanter als Sängerinnen oder Schauspielerinnen.
„Ich glaube ja“, antwortete er schließlich, so würdevoll, wie es ihm möglich war. Lügen war nicht sein Ding. Er konnte es schlichtweg nicht und er hatte früh lernen müssen, dass es stets schlimm endete, wenn er es versuchte. Für ihn war es seltsam, wenn Leute behaupteten, es sei tapfer oder mutig, die Wahrheit auszusprechen, wenn ihm eigentlich bloß der Mut fehlte, es mit einer Lüge zu versuchen.
„Oh.“ Leon zögerte einige Minuten lang herum, statt sofort aufzustehen und ihre Freundschaft für beendet zu erklären. Manchmal brauchte er etwas länger, um solche Dinge zu durchdenken. Er nahm sich da gerne ausreichend Zeit. Hatte er sich erst einmal für etwas entschieden, blieb er dabei. Mit bang klopfendem Herzen wartete Hardy geduldig, während die Traurigkeit in ihm wuchs wie ein Ballon, den man unter einen Wasserhahn geklemmt hatte. Er wollte Leon nicht verlieren!
„Stimmt es denn auch, dass du dich für etwas Besseres hältst?“, fragte Leon.
„Nein. Absolut nein. Ich wüsste auch nicht, warum. Unser Haus ist vielleicht größer, aber nicht besser als eure Wohnung, oder? Und meine Mutter ist Ärztin, keine Königin“, erklärte Hardy entschieden. „Ich hab ja nicht mal einen eigenen Vater, der ist weggelaufen. Also nein, ich bin nicht besser.“
„Oh.“ Leon dachte weiter nach. Nach einigen weiteren quälenden Minuten nickte er vor sich hin und stand auf. „Okay. Dann können wir Freunde bleiben. Mit Schwuchteln komm ich klar, glaub ich. Mit Leuten, die sich für was Besseres halten, nicht. Bis morgen dann.“
Und das war es gewesen. Er war nach Hause gegangen und sie hatten sich am nächsten Tag nach der Schule zum Fußballspielen getroffen. Ob Leon jemals Ärger mit seinem Vater wegen dieses Themas bekommen hatte, wusste Hardy nicht, er hatte ihn nie gefragt. Klar war bloß, dass er für Leon jederzeit zur Hölle und zurück laufen würde.
„Wie geht es deinen Eltern?“, fragte Hardy, als sie die letzten beiden Kartons in den Firmentransporter geladen hatten, den Leon sich von seinem Chef geliehen hatte.
„Unverändert.“ Leon zuckte mit den Schultern. „Meine Mutter heult viel, weil mein Vater sie fertigmacht. Er beschimpft sie die ganze Zeit als Hure und behauptet, sie würde ihn bestehlen und solche Sachen. Demenz ist scheiße. Noch ein bisschen mehr und sie überlegt es sich doch noch mal mit dem Pflegeheim. Ich meine, der Mann ist gerade mal siebzig. Das kann noch zwanzig Jahre so weitergehen. Dann liegt sie aber zuerst unter der Erde.“ Statt in die Straße einzubiegen, die zu dem Wohnblock führte, in dem Hardys neues Zuhause lag, fuhr Leon auf den Parkplatz eines Supermarktes. „Sorry. Hab vergessen, dass heute Valentinstag ist. Muss meiner Prinzessin eine Kleinigkeit besorgen, damit sie mit mir schimpfen und sagen kann, dass das Verschwendung ist. Freuen tut sie sich dann doch. Muss auch nie was Originelles sein. Ein paar von ihren Lieblingspralinchen und alles ist fein.“ Er strahlte glücklich, wie stets, wenn er von Jasmin sprach. Seine Frau war sein Leben, das spürte man ganz einfach. Jasmin dankte es ihm, die beiden waren ein wunderschönes Paar.
Während er in den Laden huschte, um das vergessene Geschenk zu besorgen, dachte Hardy über sein Singleleben nach. Irgendwie war er sehr froh, dass er sich über solche Dinge wie Valentinstag keine Gedanken machen musste. Und nach den letzten Katastrophen in seinem Beziehungsleben wollte er sich definitiv nicht noch einmal auf dieses dünne Eis begeben. Nein, erst einmal seine Freiheit genießen! Allein leben, ohne dass ihm ständig jemand Vorhaltungen machte, ihn ermahnte, ausfragte, mit psychologischen Tricks folterte oder sich beschwerte, weil er resistent gegen den „Pygmalion-Effekt“ war, oder was immer seine Mutter aktuell an ihm ausprobieren wollte. Einmal hatte er sie gefragt, warum sie nicht Hunde-Therapeutin geworden war, dann hätte sie sich einen Labrador statt ein Kind anschaffen können.
„Ich bin allergisch gegen Hundekot-Abfallbeutel!“, war die bissige Antwort gewesen, die er wohl verdient hatte.
Leon kam zurück, eine Packung Pralinen und einen Topf mit rosafarbenen Orchideen in den Händen.
„So, meine Prinzessin wird schimpfen“, verkündete er lächelnd und übergab Hardy die Geschenke zum Festhalten. „Und Marie wird schimpfen, weil sie nichts bekommt.“ Marie war seine knapp vierjährige Tochter. Ein zuckersüßes Kind mit dunklen Wuschelhaaren, genau wie ihre Mutter, und dem extremen Willen, den Kinder in diesem Alter produzieren konnten.
„Hör mal, es tut mir leid“, murmelte Hardy. „Mir war überhaupt nicht in den Sinn gekommen, dass heute Valentinstag ist. Ich betrüge dich um einen schönen Abend mit Jasmin und das ist nicht richtig.“
Leon, der gerade den Transporter starten wollte, verharrte mitten in der Bewegung und starrte ihn verblüfft an.
„Tickst du noch ganz echt?“, stieß er dann hervor. „Jasmin ist im achten Monat schwanger. Mit einem Kleinkind an den Hacken. Den nächsten schönen Abend zu zweit erleben wir wohl nicht vor 2030. Bis dahin schlafen wir vorm Fernseher auf der Couch ein. Ich bring nachher Döner mit nach Hause, das ist unser Festessen. Das war’s. Wir finden’s großartig, okay? Also, heute ist nicht Valentinstag, sondern Valentins-Nottag. Du bist in Not, denn ohne den Transporter und meine Hilfe müsstest du mit der S-Bahn und Rucksack auf dem Rücken umziehen, und das würde vermutlich auch bis 2030 dauern.“ Er schnaufte augenrollend und stellte den Wagen an.
„In dem Fall müsste es eigentlich Hardy-Nottag heißen, oder?“
Hardy grinste, als er einen Klaps auf den Hinterkopf bekam.
„Bei dir ist jeder Tag Hardy-Nottag. Und jetzt halt bloß die Klappe, sonst steig ich aus!“
Leon schimpfte noch zwei Kilometer später über „Volldeppen“, was er durchaus liebevoll meinte, wie ein herzhafter Boxhieb gegen Hardys Schulter bewies, als sie ihr Ziel erreicht hatten. Gemeinsam schleppten sie die Kartons nach oben in den vierten Stock. Einen Aufzug gab es nicht, das wäre auch zu viel Glück auf einmal gewesen. Wenigstens war Hardy zwar nicht allzu kräftig, dafür ausdauernd, und Treppensteigen machte ihm sogar Spaß. Im Gegensatz zu Leon, der ganz schön ins Schwitzen und Fluchen kam, obwohl er jede Menge Kraft besaß.
Unterwegs begegneten sie Frau Altenmüller, Hardys neuer Nachbarin, die genau unter ihm wohnte. Er kannte sie von der Wohnungsbesichtigung, wo sie ein bisschen ins Gespräch gekommen waren. Die alte Dame war mit ihren zweiundachtzig Jahren noch fit genug, um die Treppen zu schaffen. Gegen das Angebot, dass Hardy ihr rasch die Einkäufe nach oben trug, hatte sie dennoch nichts einzuwenden.
„Mach dich ruhig direkt mal beliebt, Junge“, sagte sie lächelnd. Sie sah mit ihrem hellblauen Hosenanzug, der schmalen Figur und den kurzen, schlohweißen Haaren eher wie Mitte Fünfzig aus. Auch sonst würde er ihr zutrauen, dass sie sich morgen für den Stadtmarathon anmelden würde. Trotzdem war es ausgeschlossen, sie mit dem Wasserkasten und der schweren Tasche voller Lebensmittel und Katzenfutter drei Stockwerke laufen zu lassen. Der Taxifahrer hatte ihr das Zeug zwar vor die Tür gestellt, den Rest hätte sie allein bewältigen müssen. „Auf gute Nachbarschaft!“, rief sie ihm hinterher, als er die Treppen hinaufschnaufte. Ihre Katze, eine graugetigerte Schönheit, zeigte ihm die kalte Schulter, als er es wagte, in ihr Hoheitsgebiet, die Küche, einzudringen. Wenigstens fauchte sie nicht, darum war Hardy zuversichtlich, dass es zukünftig mit ihnen funktionieren würde. Und er versuchte auch nicht zu diskutieren, als Frau Altenmüller ihm eine Tafel Schokolade in die Hemdtasche steckte.
„Kleiner Willkommensgruß und ein Dankeschön für die Hilfe“, sagte sie. „Und nun lass deinen armen Helfer da nicht allein herumstehen!“
Schwupps, schon stand er verlassen im Treppenhaus und die Tür schloss sich hinter ihm. Hardy stieg nach oben. Die vierte Etage war auch die letzte in diesem Haus. Es gab zwei Wohnungen, seine und rechts neben ihm noch eine. Deren Bewohner kannte er noch nicht. „Steinbrück“ stand auf dem Namensschild.
Hardy war so unglaublich froh, dass er den Namen seines Vaters behalten konnte, weil keiner der nachfolgenden Ehegatten seiner Mutter ihn adoptiert hatte. „Wilters“ sah so viel normaler und alltagstauglicher als „von Altenau-Speer“ aus!
Sein kleines Reich war vollgestapelt mit Kartons. Ein Wohnzimmer mit abgetrennter Küchenzeile, winziges Bad mit Dusche, ein Schlafraum. Alles hell und freundlich und fertig möbliert.