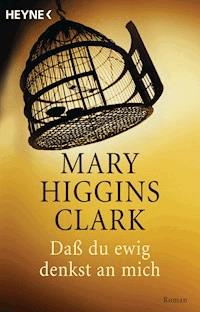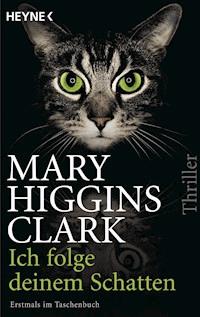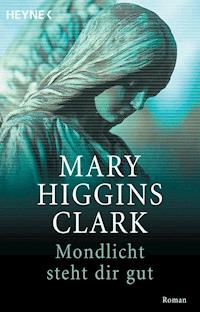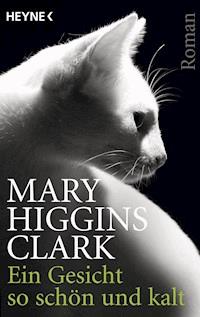9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Fluch scheint über der ehemaligen Schulklasse von Jean Sheridan zu liegen. Bereits fünf ihrer früheren Mitschülerinnen sind auf tragische Weise ums Leben gekommen. Noch ahnt niemand, dass ein wahnsinniger Serienkiller, der sich selbst »die Eule« nennt, dahinter steckt. Wird er sein mörderisches Werk bei dem bevorstehenden Klassentreffen vollenden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Das Buch:
Zwanzig Jahre nach dem Schulabschluss kehrt die renommierte Historikerin Jean Sheridan in ihre Heimatstadt zurück. Sie soll dort bei einem Klassentreffen gemeinsam mit sechs anderen aus ihrem Jahrgang geehrt werden. Doch will sich bei ihr keine Vorfreude einstellen: Gerade erst ist ihre Schulfreundin Alison im Swimmingpool ertrunken. Sie ist die fünfte der sieben Mitschülerinnen, die durch einen mysteriösen Unfall ums Leben gekommen sind. Jetzt leben nur noch zwei Freundinnen, Jean selbst und Laura. Im Laufe der Feierlichkeiten wird Jean Detective Sam Deegan vorgestellt, der hartnäckig in einem 20 Jahre zurückliegenden Mord an einer jungen Frau ermittelt. Gibt es eine Verbindung zwischen diesem Fall und dem Schicksal der toten Schulkameradinnen ?
Die Autorin:
Mary Higgins Clark, geboren 1928 in New York, lebt und arbeitet in Saddle River, New Jersey. Die Bücher der ›Königin der Spannung‹ führen regelmäßig alle internationalen Bestsellerlisten an. Ein komplettes Werkverzeichnis von Mary Higgins Clark finden Sie am Ende des Buches.
Inhaltsverzeichnis
Für Vincent Viola, stolzer Absolvent von West Point,und seine reizende Frau Theresa,in Zuneigung und Freundschaft
Der Gedanke an eine Eule hatte ihm immer gefallen: ein nächtlicher Raubvogel … scharfe Klauen und ein weiches Gefieder, das einen vollkommen geräuschlosen Flug erlaubt … als Sinnbild für einen Menschen mit nächtlichen Gewohnheiten. »Ich bin die Eule«, flüsterte er, bevor er sich auf seine Beute stürzte, »und mein ist die Stunde der Nacht.«
1
ZUM DRITTEN MAL innerhalb eines Monats war er nach Los Angeles gekommen, um ihren Tagesablauf zu beobachten. »Ich weiß genau, wann du kommst und wann du gehst«, flüsterte er, während er im Badehaus wartete. Es war eine Minute vor sieben. Die Morgensonne drang durch die Baumkronen und ließ den kleinen Wasserfall, der sich in das Becken ergoss, funkeln und glitzern.
Er fragte sich, ob Alison spürte, dass ihr nur noch eine Minute auf dieser Erde blieb. Hatte sie vielleicht eine vage Vorahnung, gab es eine unbewusste Stimme, die ihr einflüsterte, an diesem Morgen nicht schwimmen zu gehen? Aber selbst wenn dem so sein sollte, würde es ihr nichts mehr nützen. Es war zu spät.
Die verglaste Schiebetür öffnete sich, und sie trat auf die Terrasse. Sie war jetzt achtunddreißig Jahre alt und ungleich attraktiver als vor zwanzig Jahren. Ihr Körper, sonnengebräunt und wohl geformt, kam in dem Bikini gut zur Geltung. Ihre Haare, jetzt honigblond, rahmten und milderten ihr etwas kantiges Kinn.
Sie warf das Handtuch, das sie über dem Arm getragen hatte, auf einen der Liegestühle. Die unstillbare Wut, die in ihm gebrodelt hatte, schwoll zu ungebremstem Hass an, doch wurde sie gleich darauf ebenso rasch ersetzt durch das befriedigende Gefühl, genau zu wissen, was er in den nächsten Augenblicken tun würde. Er hatte einmal ein Interview gesehen, in dem ein waghalsiger Kunsttaucher gesagt hatte, der Moment vor dem Absprung – mit dem Bewusstsein, sein Leben zu riskieren – sei ein unbeschreiblicher Nervenkitzel, dem er sich wie unter Zwang immer wieder aussetzen müsse.
Bei mir ist es anders, dachte er. Es ist der Augenblick, bevor ich mich ihnen zeige, der mich in höchste Erregung versetzt. Ich weiß, dass sie sterben werden, und sobald sie mich sehen, wissen sie es ebenfalls. Sie begreifen, was ich ihnen antun werde.
Alison betrat das Sprungbrett und streckte sich. Er sah zu, wie sie ein paar Mal wippte, wie um das Brett zu testen, und dann ihre Arme ausstreckte.
Er öffnete die Tür des Badehauses genau in dem Moment, in dem sich ihre Füße vom Brett abstießen. Er wollte, dass sie ihn sah, während sie in der Luft schwebte. Noch bevor sie das Wasser berührte. Sie sollte begreifen, dass sie ihm ausgeliefert war.
In diesem Sekundenbruchteil trafen sich ihre Blicke. Er sah den Ausdruck auf ihrem Gesicht, bevor sie in das Wasser eintauchte: blankes Entsetzen, weil sie wusste, dass es keine Möglichkeit gab zu entkommen.
Noch bevor sie wieder an die Oberfläche gelangt war, hatte er sie erreicht. Er presste sie an seine Brust und musste lachen, als sie um sich schlug und mit den Beinen strampelte. Wie dämlich sie sich anstellte. Anstatt sich in das Unvermeidliche zu fügen. »Jetzt wirst du sterben«, flüsterte er mit ruhiger Stimme.
Ihre Haare klebten in seinem Gesicht und nahmen ihm die Sicht. Ungeduldig schüttelte er sie fort. Nichts sollte ihn von dem Vergnügen ablenken, ihren Kampf ums Überleben zu verfolgen.
Es würde nicht mehr lange dauern. Nach Luft ringend, hatte sie den Mund geöffnet und Wasser geschluckt. Er spürte ihr letztes verzweifeltes Aufbäumen, den letzten Versuch, von ihm loszukommen, dann die letzten schwachen Zuckungen, als ihr Körper zu erschlaffen begann. Er presste sie an sich, wie um herauszufinden, was in ihr vorging. Betete sie? Flehte sie Gott an, ihr Leben zu retten? Erblickte sie jenes ominöse Licht, von dem Menschen, die dem Tode nahe gewesen waren, immer wieder berichteten?
Er wartete drei volle Minuten, bevor er sie losließ. Mit zufriedenem Lächeln sah er zu, wie ihr Körper auf den Boden des Beckens sank.
Es war fünf nach sieben, als er aus dem Becken kletterte. Er zog ein Sweatshirt, Shorts, Laufschuhe und eine Mütze an und setzte eine dunkle Sonnenbrille auf. Er hatte bereits die Stelle ausgewählt, an der er das Erkennungszeichen für seinen Besuch hinterlassen würde, die Visitenkarte, die bisher alle übersehen hatten.
Sechs Minuten nach sieben joggte er die ruhige Straße entlang, ein frühmorgendlicher Fitnessfanatiker in einer Stadt voller Fitnessfanatiker.
2
SAM DEEGAN HATTE an diesem Nachmittag gar nicht die Absicht gehabt, die Akte von Karen Sommers zu öffnen. Er hatte in der untersten Schublade seines Schreibtischs gewühlt, auf der Suche nach einer Schachtel Erkältungstabletten, die er nach seiner Erinnerung dort deponiert hatte. Als der schon abgegriffene und merkwürdig vertraute Aktendeckel zum Vorschein kam, zögerte er kurz, nahm ihn dann mit einem Seufzen heraus und schlug ihn auf. Sein Blick fiel auf das Datum, und er dachte, es müsse wohl doch eine Art unbewusste Absicht gewesen sein, die ihn zu der Akte geführt hatte. Nächste Woche, am Columbus Day, würde es genau zwanzig Jahre her sein, dass Karen Sommers ermordet worden war.
Die Akte hätte eigentlich bei den anderen ungelösten Fällen aufbewahrt werden müssen, aber drei aufeinanderfolgende Staatsanwälte von Orange County hatten seinem Wunsch nachgegeben, sie in Reichweite zu behalten. Vor zwanzig Jahren war Sam als erster Beamter vor Ort gewesen, nachdem eine völlig verstörte Frau angerufen und in den Hörer geschrien hatte, ihre Tochter sei erstochen worden.
Wenige Minuten später, als er das Haus an der Mountain Road in Cornwall-on-Hudson betreten hatte, war im Schlafzimmer des Opfers bereits eine Reihe von zu Hilfe geeilten Menschen versammelt gewesen, denen das Grauen im Gesicht geschrieben stand. Ein Nachbar hatte sich über das Bett gebeugt und versucht, eine vollkommen nutzlose Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen. Andere hatten sich bemüht, die verstörten Eltern vom grässlichen Anblick der brutal zugerichteten Leiche ihrer Tochter wegzudrängen.
Karen Sommers’ schulterlanges Haar war über das Kissen ausgebreitet gewesen. Nachdem er den übereifrigen Helfer beiseitegeschoben hatte, war Sam der grauenhaften Stichwunden in Karens Brust und Herz ansichtig geworden, die zu ihrem sofortigen Tod geführt haben mussten. Das Laken war geradezu durchtränkt gewesen mit ihrem Blut.
Er entsann sich, dass er als Erstes gedacht hatte, die junge Frau habe ihren Mörder wahrscheinlich nicht einmal eintreten hören. Vermutlich ist sie überhaupt nicht aufgewacht, dachte er, während er kopfschüttelnd in der Akte blätterte. Die Schreie der Mutter hatten nicht nur die Nachbarn zu Hilfe eilen lassen, sondern auch einen Gärtner und einen Boten, die sich gerade auf dem Nachbargrundstück aufgehalten hatten. Am Tatort hatte daher ein großes Durcheinander geherrscht, wodurch möglicherweise wertvolle Spuren vernichtet worden waren.
Es hatte keinerlei Hinweise auf einen Einbruch gegeben. Gefehlt hatte auch nichts. Karen Sommers, eine zweiundzwanzigjährige Medizinstudentin, hatte ihre Eltern mit einem Besuch überrascht und war über Nacht geblieben. Der erste Verdacht war logischerweise auf ihren Exfreund, Cyrus Lindstrom, gefallen, der im dritten Jahr Jura an der Columbia University studierte. Er hatte zugegeben, dass es Karen gewesen sei, die den Vorschlag gemacht habe, sich fürs Erste zu trennen, aber er hatte gleichzeitig darauf beharrt, dass dies auch sein Wunsch gewesen sei, weil keiner von ihnen zu einer engeren Beziehung bereit gewesen sei. Sein Alibi – er habe in der Wohnung geschlafen, die er mit drei anderen Jurastudenten teilte – war bestätigt worden, obwohl alle drei Wohnungsgenossen zugegeben hatten, vor Mitternacht schlafen gegangen zu sein, und daher nicht mit Bestimmtheit ausschließen konnten, dass Lindstrom die Wohnung nach diesem Zeitpunkt verlassen hatte. Den Schätzungen zufolge war Karen Sommers’ Tod zwischen zwei und drei Uhr morgens eingetreten.
Lindstrom war ein paar Mal im Haus der Sommers’ zu Besuch gewesen. Er wusste, dass ein Reserveschlüssel unter dem Zierfelsen in der Nähe der hinteren Haustür lag. Er wusste, dass sich Karens Zimmer gleich rechts vom Treppenaufgang befand. Aber damit konnte man nicht beweisen, dass er mitten in der Nacht die fünfzig Meilen von der Ecke Amsterdam Avenue und 104. Straße in Manhattan nach Cornwall-on-Hudson gefahren war und sie ermordet hatte.
Person of interest, weder verdächtig noch unverdächtig – so bezeichnen wir heutzutage Leute wie Lindstrom, dachte Sam. Ich war und bin immer noch überzeugt, dass er es gewesen ist. Nie habe ich verstanden, wieso Karens Eltern so zu ihm gestanden haben. Meine Güte, man hätte fast glauben können, sie verteidigten ihren eigenen Sohn.
Unwillig ließ Sam die Akte auf seinen Schreibtisch fallen, erhob sich und ging zum Fenster. Von seinem Standpunkt aus konnte er den Parkplatz überblicken, und er erinnerte sich an einen Vorfall mit einem Häftling, der des Mordes angeklagt war. Der hatte zunächst einen Wärter überwältigt, war dann aus dem Fenster des Gerichtsgebäudes gesprungen, über den Parkplatz gehetzt, hatte einen Mann, der gerade in seinen Wagen steigen wollte, beiseitegestoßen und war davongebraust.
Binnen zwanzig Minuten haben wir ihn wieder eingefangen, dachte Sam. Wieso bin ich nach zwanzig Jahren nicht imstande, den Kerl zu überführen, der Karen Sommers auf dem Gewissen hat? Es war Lindstrom, da bin ich mir immer noch sicher.
Lindstrom hatte es mittlerweile zum New Yorker Staranwalt gebracht. Dafür zu sorgen, dass so ein Schwein von einem Mörder freikommt, darin ist er ein wahrer Meister, dachte Sam. Passt doch wunderbar – schließlich gehört er selber zu der Bande.
Er zuckte die Achseln. Es war ein mieser Tag, regnerisch und ungewöhnlich kalt für Anfang Oktober. Früher habe ich diesen Job geliebt, dachte er, aber das hat sich geändert. Mittlerweile bin ich reif für die Rente. Ich bin achtundfünfzig. Die meiste Zeit meines Lebens habe ich bei der Polizei gearbeitet. Warum in Gottes Namen sollte ich mich nicht auf die Pensionierung freuen? Ein paar Kilo abnehmen. Die Kinder besuchen und mehr Zeit für die Enkel haben. Bevor man’s richtig merkt, sind sie schon auf dem College.
Er spürte leichte Anzeichen von aufkommenden Kopfschmerzen, als er mit der Hand durch seine ausgedünnten Haare fuhr. Kate hatte ihn immer wieder ermahnt, sich das abzugewöhnen, dachte er. Sie hatte behauptet, es schwäche die Haarwurzeln.
Über die unwissenschaftliche Analyse seiner verstorbenen Frau, die damit wohl kaum die wahren Gründe für die fortschreitende Glatzenbildung benannt hatte, musste er unwillkürlich lächeln. Er kehrte an seinen Schreibtisch zurück und starrte wieder auf die Akte mit der Überschrift »Karen Sommers«.
Immer noch besuchte er regelmäßig Karens Mutter Alice, die inzwischen in einer Eigentumswohnung in der Stadt wohnte. Er wusste, dass es tröstend für sie war, das Gefühl zu haben, dass sie immer noch versuchten herauszufinden, wer ihre Tochter auf dem Gewissen hatte, aber es steckte noch mehr dahinter. Sam hatte das Gefühl, dass Alice irgendwann einmal etwas erwähnen könnte, das ihr bisher nicht wichtig erschienen war, etwas, das doch noch einen Hinweis auf denjenigen geben könnte, der in jener Nacht in Karens Zimmer eingedrungen war.
Das ist es, was mich in den letzten Jahren angetrieben hat, mit der Arbeit weiterzumachen, dachte er. Ich wollte diesen Fall unbedingt noch lösen. Aber jetzt kann ich es nicht mehr länger aufschieben.
Er setzte sich, öffnete die unterste Schublade, hielt inne. Es hatte keinen Sinn mehr. Es war an der Zeit, diese Akte zu den übrigen Akten mit den ungelösten Fällen ins Archiv zu geben. Er hatte sein Bestes getan. In den ersten zwölf Jahren nach dem Mord war er jeweils am Jahrestag auf den Friedhof gegangen. Den ganzen Tag lang war er dort geblieben, hinter einem Mausoleum versteckt, und hatte Karens Grab beobachtet. Er hatte sogar ein Mikrofon am Grabstein installiert, um gegebenenfalls irgendetwas einzufangen, was ein Besucher sagen könnte. Es hatte schon Fälle gegeben, bei denen Mörder am Jahrestag des Verbrechens das Grab ihres Opfers aufgesucht und mit ihm über die Tat gesprochen hatten.
Doch die einzigen Menschen, die je am Todestag vor Karens Grab erschienen waren, waren ihre Eltern gewesen, und er hatte tiefe Scham darüber empfunden, in ihre Privatsphäre eingedrungen zu sein, als er heimlich mitgehört hatte, was sie in Erinnerung an ihre einzige Tochter zueinander gesagt hatten. Vor acht Jahren hatte er es aufgegeben, hinzugehen, nachdem Michael Sommers gestorben war und nur noch Alice an dem Grab stand, in dem nunmehr ihr Mann und ihre Tochter lagen. An diesem Tag hatte er sich still entfernt, weil er nicht Zeuge ihrer Trauer sein wollte. Er war nie zurückgekehrt.
Sam stand auf und klemmte sich Karen Sommers’ Akte unter den Arm. Sein Entschluss war gefallen. Er würde nie mehr hineinschauen. Und in der nächsten Woche, am zwanzigsten Jahrestag von Karens Tod, würde er sein Gesuch um Pensionierung einreichen.
Und dann werde ich noch einmal auf den Friedhof gehen, dachte er. Nur um ihr mitzuteilen, dass es mir leid tut, aber dass ich einfach nicht mehr für sie tun konnte.
3
SIE HATTE FAST sieben Stunden für die Fahrt von Washington durch Maryland, Delaware und New Jersey nach Cornwall-on-Hudson gebraucht. Eine Reise, auf die sich Jean Sheridan nicht besonders gefreut hatte – nicht so sehr wegen der weiten Strecke, sondern weil für sie Cornwall, die Stadt, in der sie aufgewachsen war, mit schmerzvollen Erinnerungen verbunden war.
Was auch immer Jack Emerson – der Vorsitzende des Organisationskomitees für das zwanzigste Klassentreffen ihres Highschool-Jahrgangs – an Überzeugungskraft und Charme aufbieten mochte, sie hatte fest vorgehabt, ihre Teilnahme abzusagen. Arbeit, anderweitige Verpflichtungen, Krankheit – irgendetwas hatte sie vortäuschen wollen, um der Feier zu entgehen.
Sie hatte nicht den geringsten Wunsch, ihren Abschluss an der Stonecroft Academy vor zwanzig Jahren zu feiern, auch wenn sie durchaus dankbar war für das Wissen, das sie dort erworben hatte. Nicht einmal aus der Medaille für »herausragende ehemalige Schülerinnen und Schüler«, die sie bekommen sollte, machte sie sich etwas, ungeachtet der Tatsache, dass ihr Stipendium für Stonecroft eine wichtige erste Etappe auf dem Weg zum Stipendium für Bryn Mawr und zu der sich daran anschließenden Promotion in Princeton gewesen war.
Als aber eine Gedenkfeier für Alison in das Programm des Treffens eingefügt worden war, hatte sie unmöglich absagen können.
Alisons Tod hatte immer noch etwas so Unwirkliches, dass es Jean beinahe vorkam, als könne jederzeit das Telefon klingeln und sie die vertraute Stimme hören, die oft in atemberaubendem Tempo abgehackte Sätze hervorsprudelte, als ob alles in zehn Sekunden gesagt werden müsse: »Jeannie! Von dir hört man überhaupt nichts mehr. Du hast mich wohl vergessen. Ich hasse dich. Nein, tu ich nicht. Ich liebe dich. Ich bewundere dich. Du bist so verdammt klug. Nächste Woche ist eine Premiere in New York. Curt Ballard ist einer meiner Kunden. Ein absolut fürchterlicher Schauspieler, sieht aber dermaßen gut aus, dass es niemanden stört. Seine neueste Freundin kommt auch. Wenn ich dir den Namen verrate, fällst du in Ohnmacht. Also, was ist, kannst du am nächsten Dienstag kommen, Cocktails um sechs, dann der Film, danach privates Dinner mit zwanzig oder dreißig oder fünfzig Leuten?«
Alison hatte es immer geschafft, Botschaften dieser Art in nicht mehr als zehn Sekunden zu übermitteln, dachte Jean, und war jedes Mal schockiert gewesen, wenn Jean – in neunzig Prozent aller Fälle – nicht alles stehen und liegen lassen konnte, um nach New York zu eilen und sie zu treffen.
Fast einen Monat war Alison jetzt schon tot. Und so schwer das auch zu begreifen war, die Tatsache, dass sie möglicherweise ermordet worden war, schien geradezu unerträglich. Natürlich hatte sie sich im Laufe ihrer Karriere Feinde gemacht. Niemand gelangt an die Spitze einer der größten Agenturen für junge Talente im ganzen Land, ohne gehasst zu werden. Außerdem waren Alisons messerscharfer Verstand und ihr beißender Sarkasmus schon mit den gefürchteten Bemerkungen der legendären Dorothy Parker verglichen worden. Könnte jemand sie aus bloßer Rachsucht umgebracht haben, jemand, den sie lächerlich gemacht oder gefeuert hatte?
Mir wäre es lieber, wenn sie einen Schwächeanfall gehabt hätte, als sie in das Becken tauchte, dachte Jean. Der Gedanke, dass jemand sie unter Wasser gedrückt haben könnte, ist schwer zu ertragen.
Ihr Blick fiel auf ihre Tasche auf dem Beifahrersitz, und sofort begannen ihre Gedanken um den Briefumschlag zu kreisen, der sich darin befand. Was soll ich tun? Wer hat diesen Brief geschickt und warum? Wie kann jemand etwas von Lily erfahren haben? Steckt sie in Schwierigkeiten? O Gott, was soll ich nur tun? Was kann ich überhaupt tun?
Diese Fragen bereiteten ihr schon wochenlang schlaflose Nächte, seitdem sie den Laborbericht erhalten hatte.
Sie hatte jetzt die Stelle erreicht, an der die Straße nach Cornwall von der Route 9W abzweigt. Und in der Nähe von Cornwall befand sich West Point … Jean spürte, wie es ihr den Hals zusammenschnürte, und versuchte, ihre Aufmerksamkeit auf den herrlichen Oktobernachmittag zu lenken. Die Bäume leuchteten in den schönsten Herbstfarben, gold, orange und glühend rot. Darüber erhoben sich die Berge und strahlten wie immer eine majestätische Ruhe aus. Die Hudson River Highlands. Ich hatte ganz vergessen, wie schön es hier ist, dachte sie.
Doch unweigerlich brachte dieser Gedanke die Erinnerung an die Sonntagnachmittage in West Point zurück, als sie häufig bei solchen Stimmungen wie der heutigen auf den Treppen des Denkmals gesessen hatte. Dort hatte sie ihr erstes Buch angefangen, eine Geschichte von West Point.
Zehn Jahre habe ich gebraucht, bis es abgeschlossen war, dachte sie, hauptsächlich deshalb, weil ich lange Zeit überhaupt nicht darüber schreiben konnte.
Kadett Carroll Reed Thornton jr. aus Maryland. Jetzt nicht an Reed denken, ermahnte sich Jean.
Das Abbiegen von der Route 9W in die Walnut Street geschah immer noch fast automatisch, ohne dass sie bewusst daran denken musste. Das Glen-Ridge House in Cornwall, benannt nach einem der großen Gasthäuser der Stadt aus dem neunzehnten Jahrhundert, war für das Klassentreffen ausgewählt worden. Neunzig Schüler hatten in ihrem Jahrgang den Abschluss gemacht. In der letzten Nachricht, die sie erhalten hatte, hieß es, zweiundvierzig von ihnen hätten ihr Kommen zugesagt, zuzüglich der Ehefrauen, Ehemänner oder Lebensabschnittspartner sowie der Kinder.
Was sie selbst betraf, bestand kein Bedarf an zusätzlichen Reservierungen.
Es war Jack Emersons Entscheidung gewesen, das Treffen erst im Oktober statt im Juni stattfinden zu lassen. Er hatte eine Umfrage unter den Klassenmitgliedern gestartet, die ergeben hatte, dass im Juni ihre eigenen Kinder den Abschluss von der Highschool oder von der Grundschule feierten, weshalb viele verhindert gewesen wären.
Mit der Post hatte Jean ihr Erkennungsschild erhalten, auf dem ihr Foto aus der Abschlussklasse und darunter ihr Name prangten. In derselben Sendung war auch der geplante Tagesablauf für das Wochenende mitgeteilt worden: Freitagabend Begrüßung mit Cocktailparty und kaltem Büfett. Samstag Frühstücksbüfett, Besichtigung von West Point, Footballspiel Army gegen Princeton und schließlich Cocktailparty und festliches Dinner. Am Sonntag hatte das Treffen ursprünglich mit einem Brunch in der Stonecroft Academy ausklingen sollen, aber nach Alisons Tod war beschlossen worden, eine Morgenandacht zu ihrem Andenken einzufügen. Sie war auf dem Friedhof neben der Schule beerdigt worden, und die Gedenkfeier sollte an ihrem Grab stattfinden.
In ihrem Testament hatte Alison dem Stipendienfonds von Stonecroft eine größere Summe hinterlassen – das war wohl der Hauptgrund dafür, dass man diese Zeremonie kurzfristig angesetzt hatte.
Viel hat sich nicht verändert, dachte Jean, als sie langsam durch die Straßen der Stadt fuhr. Es war schon viele Jahre her, seit sie zuletzt hier gewesen war. Im Sommer nach ihrem Abschluss in Stonecroft hatten sich ihre Eltern endlich getrennt, das Haus verkauft und waren ihre eigenen Wege gegangen. Ihr Vater war jetzt Manager eines Hotels auf Maui. Ihre Mutter war zurück nach Cleveland gezogen, wo sie aufgewachsen war, und hatte dort ihre große Highschool-Liebe geheiratet. »Mein größter Fehler war, dass ich Eric nicht schon vor dreißig Jahren geheiratet habe«, hatte sie bei der Hochzeit geschwärmt.
Und was wird aus mir? Das war der Gedanke, der Jean damals durch den Kopf geschossen war. Wenigstens hatte die Trennung zur Folge gehabt, dass ihr Leben in Cornwall ein gnädiges Ende fand.
Sie widerstand der Versuchung, einen Abstecher zur Mountain Road zu machen und an ihrem alten Haus vorbeizufahren. Nicht jetzt, dachte sie, vielleicht irgendwann später an diesem Wochenende. Kurz darauf bog sie in die Einfahrt des Glen-Ridge House ein. Vor dem Eingang öffnete der Portier mit einem professionellen Lächeln die Wagentür und sagte: »Willkommen daheim.« Jean drückte den Knopf der Kofferraumentriegelung und sah zu, wie ihr Kleidersack und ihr Koffer herausgehoben wurden.
»Gehen Sie ruhig zur Rezeption«, meinte der Portier diensteifrig. »Wir kümmern uns um Ihr Gepäck.«
Die Empfangshalle des Hotels strahlte mit ihrem weichen Teppichboden und den bequemen Sesselgruppen eine gemütliche Clubatmosphäre aus. Die Rezeption befand sich auf der linken Seite, schräg dahinter erblickte Jean die Bar, die sich bereits in Erwartung der Cocktailparty mit den ersten Gästen zu füllen begann.
Ein über der Rezeption aufgespanntes Spruchband hieß die Teilnehmer des Stonecroft-Klassentreffens willkommen.
»Willkommen daheim, Miss Sheridan«, sagte der etwa sechzigjährige Angestellte hinter der Theke. Seine schlecht getönten Haare waren farblich haargenau auf das Kirschholzfurnier der Theke abgestimmt. Als Jean ihm ihre Kreditkarte überreichte, überkam sie der merkwürdige Gedanke, dass er vielleicht ein Stückchen von der Theke als Vorlage für seinen Frisör abgesäbelt hatte.
Sie fühlte sich innerlich noch nicht bereit, sich mit irgendeinem ihrer früheren Klassengenossen abzugeben, und hoffte, dass sie es bis zum Aufzug schaffen würde, ohne aufgehalten zu werden. Sie wollte wenigstens eine halbe Stunde Ruhe für sich haben, sich duschen und umziehen. Danach würde sie ihr Erkennungsschild mit dem Foto des ängstlichen und vom Schicksal gebeutelten achtzehnjährigen Mädchens, das sie damals gewesen war, anstecken und sich auf der Cocktailparty zu ihren alten Klassenkameraden gesellen.
Als sie den Zimmerschlüssel an sich nahm und sich umwandte, hörte sie den Angestellten sagen: »Ach, Miss Sheridan, fast hätte ich es vergessen. Für Sie ist ein Fax gekommen.« Er schielte auf den Namen auf dem Umschlag. »Oh, ich bitte um Verzeihung. Ich sollte wohl besser Dr. Sheridan sagen.«
Ohne etwas zu erwidern, riss Jean den Umschlag auf. Das Fax kam von ihrer Sekretärin an der Georgetown University: »Dr. Sheridan, eigentlich wollte ich Sie nicht stören. Wahrscheinlich ist dies nur ein übler Scherz, aber ich hielt es für besser, es Ihnen zu schicken.« Mit »es« war ein einzelnes Blatt Papier gemeint, das an ihr Büro gefaxt worden war. Es lautete: »Jean, sicherlich hast du dich mittlerweile davon überzeugen können, dass ich Lily tatsächlich kenne. Nun stehe ich vor dem Problem: Soll ich sie küssen oder umbringen? Kleiner Scherz. Ich melde mich wieder.«
Einige Sekunden lang war Jean weder imstande, sich zu bewegen, noch zu denken. Sie umbringen? Aber warum? Warum?
Er hatte an der Bar gestanden, Ausschau haltend, darauf wartend, dass sie hereinkommen würde. In den vergangenen Jahren hatte er Fotos von ihr auf den Schutzumschlägen ihrer Bücher gesehen, und jedes Mal musste er schockiert feststellen, was für eine attraktive, elegante Frau Jeannie Sheridan geworden war.
In Stonecroft war sie eine der Klügsten, aber auch eine der Stillsten der Klasse gewesen. Zu ihm war sie eigentlich ganz nett gewesen, wenn auch auf eher oberflächliche Weise. Er hatte angefangen, sie richtig zu mögen, bis Alison ihm erzählt hatte, wie sie sich über ihn lustig gemacht hatten. Er wusste, wer mit »sie« gemeint war: Laura, Catherine, Debra, Cindy, Gloria, Alison und Jean. Sie hatten beim Mittagessen immer zusammen an einem Tisch gesessen.
Eine süßer als die andere, dachte er, während die Wut in ihm hochkochte. Aber jetzt waren Catherine und Debra und Cindy und Gloria und Alison tot. Und Laura hatte er sich für zuletzt aufgehoben. Das Witzige an der Sache war, dass er immer noch nicht genau wusste, was er mit Jean machen sollte. Aus irgendeinem Grund war er sich unschlüssig, ob er sie töten sollte. Er erinnerte sich noch gut an den Tag, als er als Schulanfänger probeweise beim Baseballteam hatte mitspielen dürfen. Er war fast sofort ausgewechselt worden und in Tränen ausgebrochen – diese kindischen Tränen, die er nie hatte zurückhalten können.
Heulsuse. Heulsuse.
Er war vom Spielfeld gerannt. Kurze Zeit später hatte Jeannie ihn eingeholt. »Ich hab es auch nicht geschafft, bei der Cheerleader-Truppe aufgenommen zu werden«, sagte sie. »Was ist schon dabei?«
Sie war ihm gefolgt, weil sie Mitleid mit ihm hatte. Aus diesem Grund glaubte er nicht, dass sie unter denjenigen gewesen war, die sich über ihn lustig gemacht hatten, weil er Laura gefragt hatte, ob sie mit ihm zum Schulball gehen wolle. Doch sie hatte ihn auf eine andere Weise verletzt.
Laura war immer das hübscheste Mädchen der Klasse gewesen – goldblondes Haar, strahlend blaue Augen, tolle Figur, wie man trotz Bluse und Rock der Stonecroft-Uniform erkennen konnte. Sie war sich ihrer Anziehungskraft auf die Jungen stets bewusst gewesen. Sie war die geborene Anführerin, das Alphaweibchen.
Alison war schon immer gemein gewesen. In der Schülerzeitung schrieb sie regelmäßig eine Kolumne mit der Überschrift »Hinter den Kulissen«, in der es eigentlich allgemein um Aktivitäten in der Schule gehen sollte. Sie brachte es aber immer wieder fertig, jemandem darin eins auszuwischen, etwa, als sie in einer Kritik einer Theateraufführung geschrieben hatte: »Zur allgemeinen Überraschung schaffte es Romeo, gespielt von Joel Nieman, den größten Teil seines Textes auswendig aufzusagen.« Die beliebten Schüler fanden Alison toll. Die Klassentrottel hielten sich eher von ihr fern.
So, wie ich, dachte er, und erinnerte sich mit Genugtuung an das entsetzte Gesicht von Alison, als sie ihn aus dem Badehaus hatte kommen sehen.
Jean war auch beliebt gewesen, aber sie schien anders zu sein als die anderen Mädchen. Sie war in die Schülervertretung gewählt worden und hatte dort so wenig gesagt, dass man sich manchmal fragen musste, ob sie überhaupt reden konnte. Aber wenn sie den Mund aufmachte, sei es dort oder im Unterricht, dann hatte sie immer die richtige Antwort parat gehabt. Schon damals war sie in Geschichte besonders gut gewesen. Was ihn am meisten überraschte, war, wie viel hübscher sie geworden war. Ihr glattes hellbraunes Haar schien dunkler und voller geworden zu sein und umrahmte ihr Gesicht glockenförmig. Sie war schlank, aber nicht mehr spindeldürr wie früher. Im Lauf der Zeit hatte sie auch gelernt, sich elegant anzuziehen. Ihre Jacke und ihre Hose waren gut geschnitten. Er beobachtete, wie sie ein Fax in ihre Schultertasche steckte, und wünschte, er könnte den Ausdruck auf ihrem Gesicht sehen.
»Ich bin die Eule, und ich wohne in einem Baum.«
In seinem Kopf hörte er Lauras Stimme, die ihn nachäffte. »Sie kann dich perfekt nachmachen«, hatte Alison an jenem Abend gejauchzt. »Und sie hat uns auch erzählt, dass du dir in die Hosen gemacht hast.«
Er konnte sich vorstellen, wie die Mädchen sich über ihn kranklachten; er hörte förmlich ihr schrilles Gekreisch und Gelächter.
Es war vor langer Zeit passiert, in der zweiten Klasse, als er sieben Jahre alt gewesen war. Er hatte bei der Theateraufführung mitgemacht. Das war sein Satz gewesen, das Einzige, was er sagen musste. Aber er hatte ihn nicht herausgebracht. Er hatte so heftig zu stottern angefangen, dass alle Kinder auf der Bühne und sogar einige Eltern gekichert hatten.
»Ich b-b-bin d-die Eu-Eule, und ich l-l-lebe in ei-ei-einem …«
Das Wort »Baum« hatte er nicht mehr geschafft. Er hatte angefangen zu weinen und war von der Bühne gerannt, mit dem Zweig in der Hand. Sein Vater hatte ihn geohrfeigt und einen Schwächling genannt. Seine Mutter hatte gesagt: »Lass ihn. Er ist eben einfach zu blöd, was soll man da erwarten? Guck dir das an. Er hat sich wieder in die Hosen gemacht.«
Die Erinnerung an diese Schande mischte sich mit dem Gelächter der Mädchen und wirbelte in seinem Kopf herum, während er beobachtete, wie Jean Sheridan den Aufzug betrat. Warum sollte ich dich verschonen?, dachte er. Vielleicht zuerst Laura, dann du. Dann könnt ihr mich auslachen, so viel ihr wollt, alle miteinander, in der Hölle.
Er hörte, wie jemand ihn ansprach, und wandte den Kopf. Dick Gormley, der große Baseballstar seiner Klasse stand neben ihm an der Bar und starrte auf sein Erkennungsschild. »Freut mich, dich zu sehen«, sagte Dick aufgekratzt.
Du lügst, dachte er. Und ich freu mich auch nicht, dich zu sehen.
4
GERADE HATTE LAURA ihre Zimmertür aufgesperrt, da tauchte auch schon der Hoteldiener mit ihrem Gepäck auf: ein Kleidersack, zwei große Koffer, ein kleinerer und ein Necessaire. Was der Mann dachte, war nicht schwer zu erraten: Gute Frau, dieses Treffen dauert zwei Tage, nicht zwei Wochen.
Stattdessen sagte er: »Miss Wilcox, meine Frau und ich haben uns jeden Dienstagabend Henderson County angesehen. Wir fanden Sie großartig in dieser Rolle. Gibt es eine Chance, dass die Serie irgendwann fortgesetzt wird?«
Nicht den leisesten Hauch einer Chance, dachte Laura, aber dennoch tat ihr das offensichtlich ehrlich gemeinte Lob gut. »Henderson County nicht, aber ich habe gerade eine Pilotsendung für Maximum Channel gedreht«, sagte sie. »Ab Anfang nächsten Jahres soll die Serie gesendet werden.«
Das war zwar richtig, aber nur die halbe Wahrheit. Maximum hatte die Pilotsendung abgenommen und angekündigt, die neue Serie zu starten. Dann aber hatte Alison angerufen, zwei Tage vor ihrem Tod. »Laura, Schätzchen, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber es gibt da ein Problem. Maximum möchte jemand Jüngeren für die Rolle der Emmie engagieren.«
»Jünger?«, hatte sie sich ereifert. »Hör mal, Alison, ich bin achtunddreißig, verdammt noch mal. Die Mutter in dieser Serie hat eine zwölfjährige Tochter. Und schließlich seh ich gut aus, wie du weißt.«
»Schrei mich nicht an«, hatte Alison zurückgekeift. »Ich tu schließlich alles, was ich kann, um sie zu überzeugen, es mit dir zu versuchen. Und was das Aussehen betrifft: In Zeiten von Laserchirurgie, Botox, Lifting und dem ganzen Kram sieht jeder in der Branche gut aus. Deshalb ist es ja so schwierig, jemanden für eine Rolle als Großmutter zu finden. Niemand sieht mehr so aus wie eine Oma.«
Wir wollten gemeinsam zu dem Klassentreffen kommen, dachte Laura. Alison hatte erwähnt, dass sie die Liste der Teilnehmer, die zugesagt hätten, durchgegangen sei, und dass auch Gordon Amory kommen wolle, der ihres Wissens gerade erst bei Maximum eingestiegen sei. Sie meinte, er besitze genug Einfluss, um mir einen Job zu sichern, vorausgesetzt, man könne ihn dazu bringen, ihn geltend zu machen.
Sie hatte Alison mehrfach gedrängt, Gordie sofort anzurufen und ihn mit allen Mitteln zu bearbeiten, damit er Maximum zwingen würde, sie für die Rolle zu akzeptieren. Aber Alison hatte erwidert: »Erstens: Nenn ihn auf keinen Fall Gordie, das kann er nicht ausstehen. Zweitens: Ich wollte ein bisschen taktvoll sein, was mich sonst herzlich wenig kümmert, wie du weißt. Aber nun gut, ich will ganz offen zu dir sein. Du bist immer noch eine schöne Frau, aber als Schauspielerin bist du eine ziemliche Niete. Die Leute von Maximum glauben, dass die Serie ein richtiger Hit werden könnte, aber nicht, wenn du die Hauptrolle spielst. Vielleicht kann Gordon sie dazu bringen, ihre Meinung zu ändern. Du könntest ihn becircen. Schließlich war er mal in dich verknallt, oder?«
Der Hoteldiener war aus dem Zimmer gegangen, um den Eiseimer nachzufüllen. Jetzt klopfte er an die Tür und trat wieder ein. Ohne nachzudenken, öffnete Laura ihr Portmonee und reichte ihm einen Zwanzig-Dollar-Schein. Sein beflissenes »Oh, vielen Dank, Miss Wilcox« ließ sie zusammenzucken. Wieder mal hatte sie die reiche Diva herausgekehrt. Zehn Dollar wären völlig ausreichend gewesen.
Gordon Amory war einer von den Jungs, die unsterblich in sie verliebt gewesen waren, damals in Stonecroft. Wer hätte gedacht, dass aus ihm noch mal so ein hohes Tier werden würde? Gott, man weiß eben nie, dachte Laura, während sie ihren Kleidersack öffnete. Wir könnten alle eine Kristallkugel brauchen, um in die Zukunft zu schauen.
Der Schrank war klein. Kleines Zimmer. Kleine Fenster. Dunkelbrauner Teppichboden, brauner Sessel, Kürbis- und Brauntöne im Bettüberwurf. Ungeduldig zog Laura das Cocktailkleid und das Abendkostüm hervor, die sie in dem Kleidersack mitgebracht hatte. Sie wusste schon, dass sie heute Abend das Chanel-Kostüm tragen würde. Es muss glitzern. Blenden. Erfolgreich erscheinen, auch wenn man mit der Steuer im Rückstand ist und das Finanzamt einen Titel auf das Haus besitzt.
Alison hatte gesagt, Gordon Amory sei geschieden. Ihr letzter Rat klang noch in Lauras Ohren nach: »Hör zu, Schätzchen, wenn du ihn nicht überreden kannst, dich in der Serie spielen zu lassen, dann kannst du ihn vielleicht dazu bringen, dich zu heiraten. Ich hab gehört, dass er inzwischen eine beeindruckende Persönlichkeit sein soll. Vergiss einfach, was für ein Trottel er in Stonecroft gewesen ist.«
5
»KANN ICH SONST NOCH etwas für Sie tun, Dr. Sheridan?«, fragte der Hoteldiener.
Jean schüttelte den Kopf.
»Fühlen Sie sich nicht gut? Sie sehen so blass aus.«
»Mir geht’s gut, danke.«
»Gut, dann melden Sie sich einfach, wenn Sie noch etwas brauchen.«
Endlich schloss sich die Tür hinter ihm, und Jean konnte sich auf die Bettkante sinken lassen. Sie hatte das Fax in das Seitenfach ihrer Schultertasche gestopft. Jetzt kramte sie es hervor und las die kryptischen Sätze noch einmal durch: »Jean, sicherlich hast du dich mittlerweile davon überzeugen können, dass ich Lily tatsächlich kenne. Nun stehe ich vor dem Problem: Soll ich sie küssen oder umbringen? Kleiner Scherz. Ich melde mich wieder.«
Connors hatte der Arzt in Cornwall geheißen, dem sie vor zwanzig Jahren anvertraut hatte, dass sie schwanger sei. Er hatte widerstrebend eingewilligt, ihren Eltern nichts zu verraten. »Was auch immer sie einwenden würden, ich würde das Baby doch zur Adoption freigeben. Ich bin achtzehn, und es ist meine Entscheidung. Aber sie würden sich aufregen und wütend auf mich sein und mir das Leben noch schwerer machen als bisher schon«, hatte sie unter Tränen gesagt.
Dr. Connors hatte ihr von einem Ehepaar erzählt, das die Hoffnung aufgegeben habe, jemals ein eigenes Kind zu bekommen, und sich zur Adoption entschlossen habe. »Wenn Sie sicher sind, dass Sie das Baby nicht behalten wollen, dann kann ich Ihnen versichern, dass diese Menschen ihm ein wunderbares, liebevolles Zuhause schenken werden.«
Er hatte dafür gesorgt, dass sie in einer Entbindungsklinik in Chicago bis zu dem Termin arbeiten konnte, an dem das Kind auf die Welt kommen sollte. Dann war er nach Chicago geflogen, hatte sie entbunden und das Baby an sich genommen. Im darauf folgenden September hatte sie ihr Studium begonnen, und zehn Jahre später hatte sie erfahren, dass Dr. Connors an einem Herzanfall gestorben war, nachdem seine Praxis bei einem Brand zerstört worden war. Jean hatte gehört, dass seine gesamten Aufzeichnungen in den Flammen verloren gegangen seien.
Vielleicht waren nicht alle verbrannt. Doch selbst wenn – wer konnte sie gefunden haben, und warum sollte diese Person nach all den Jahren mit mir Kontakt aufnehmen?, fragte sie sich verzweifelt.
Lily – das war der Name, den sie dem Baby gegeben hatte, das sie neun Monate lang ausgetragen und dann nur vier Stunden gesehen hatte. Drei Wochen bevor Reed seinen Abschluss in West Point und sie den ihren in Stonecroft machen sollten, hatte sie festgestellt, dass sie schwanger war. Sie hatten beide einen Schreck bekommen, aber dann beschlossen, gleich nach dem Abschluss zu heiraten.
»Meine Eltern werden dich bestimmt mögen, Jeannie«, hatte Reed sie aufgemuntert. Aber ihr war klar, dass er sich Sorgen um ihre Reaktion machte. Er hatte zugegeben, dass sein Vater ihn davor gewarnt hatte, eine ernsthafte Bindung einzugehen, bevor er nicht mindestens fünfundzwanzig Jahre alt sei. Er kam nicht mehr dazu, es seinen Eltern zu sagen. Eine Woche vor seinem Schulabschluss wurde er auf einer schmalen Straße auf dem Campus von West Point von einem Auto überfahren, dessen Fahrer anschließend Fahrerflucht beging. Anstatt mitzuerleben, wie ihr Sohn als Fünftbester seiner Klasse graduiert wurde, nahmen General Carroll Reed Thornton und seine Frau in einer eigens angesetzten Zeremonie auf der Abschlussfeier das Diplom und den Säbel ihres verstorbenen Sohnes entgegen.
Sie erfuhren nie, dass sie eine Enkelin hatten.
Selbst wenn jemand die Aufzeichnungen über die Adoption aus den Flammen gerettet hätte, wie sollte er dann nahe genug an Lily herangekommen sein, um ihre Haarbürste an sich zu nehmen, an deren Borsten noch einige ihrer langen goldenen Haarsträhnen hafteten?, fragte sich Jean.
Bei der ersten Kontaktaufnahme des Unbekannten war ihr die Bürste zugeschickt worden, zusammen mit einer Notiz folgenden Inhalts: »Lass eine DNA-Analyse durchführen. Sie sind von deinem Kind.« Verwirrt hatte Jean einzelne Haare von der Locke, die sie von ihrem Baby behalten hatte, zusammen mit einer eigenen DNA-Probe und den Haaren von der Bürste einem privaten Labor zur Untersuchung übergeben. Das Ergebnis hatte ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt – die Haare an der Bürste stammten zweifelsfrei von ihrer mittlerweile neunzehneinhalbjährigen Tochter.
Oder ist es denkbar, dass das wunderbare, hingebungsvolle Ehepaar, das sie adoptiert hat, meine Identität kennt und das Ganze nur ein Vorgeplänkel ist, um Geld von mir zu fordern?
Sie war in der Öffentlichkeit ziemlich bekannt geworden, nachdem ihr Buch über Abigail Adams zu einem Bestseller avanciert und anschließend erfolgreich verfilmt worden war.
Hoffentlich geht es nur um Geld, dachte Jean, während sie sich erhob, um ihre Sachen auszupacken.
6
CARTER STEWART WARF SEINEN Kleidersack auf das Bett. Neben Unterwäsche und Socken enthielt er mehrere Sakkos von Armani, dazu einige Hosen. Doch aus einer Laune heraus beschloss er, auf der ersten Abendgesellschaft einfach Jeans und Pullover, die er bereits trug, anzubehalten.
Auf der Schule war er ein schmuddeliges, unordentliches Kind gewesen, Sohn einer schmuddeligen, unordentlichen Mutter. Wenn sie sich gelegentlich dazu aufraffte, Kleider in die Waschmaschine zu stopfen, war meistens gerade kein Waschmittel mehr da. Dann schüttete sie womöglich Bleichmittel hinein und ruinierte damit die gesamte Wäscheladung. Bevor er begonnen hatte, seine Kleidung vor ihr zu verstecken, um sie selbst zu waschen, war er auf der Schule durch ein leicht verschmutztes oder auch verwegenes Äußeres aufgefallen.
Wenn er bei seinem ersten Wiedertreffen mit den ehemaligen Klassengenossen zu geschniegelt wirkte, könnte das Bemerkungen über sein damaliges Aussehen hervorlocken. Was würden sie sehen, wenn sie ihn heute betrachteten? Nicht den mageren Knirps, der er die meiste Zeit über an der Highschool gewesen war, sondern einen Mann von mittlerer Größe und straffem Körperbau. Im Gegensatz zu manch anderem, den er in der Hotelhalle gesehen hatte, wies sein volles, akkurat geschnittenes dunkelbraunes Haar noch keinerlei graue Strähnen auf. Das Foto auf seinem Erkennungsschild zeigte ihn mit strubbeligen Haaren, die Augen zu Schlitzen verengt. Ein Kritiker hatte kürzlich über seine dunkelbraunen Augen geschrieben, dass aus ihnen »urplötzlich gelbe Blitze zu sprühen scheinen, wenn er in Zorn gerät«.
Mit verächtlichem Blick musterte er die Zimmereinrichtung. In seinem vorletzten Jahr in Stonecroft hatte er den Sommer über in diesem Hotel gearbeitet. Vermutlich war er auch öfter in diesem schäbigen Zimmer gewesen, hatte Tabletts hereingetragen für Geschäftsleute, für alte Schachteln, die sich auf Besichtigungstour im Hudson-Tal befanden, für Eltern, die ihre Kinder in West Point besuchten – aber auch für Pärchen, die sich von ihren angestammten Partnern und Familien fortgeschlichen hatten, um sich hier heimlich zu treffen. Die habe ich immer sofort durchschaut, dachte er. Bei solchen Gelegenheiten pflegte er immer mit einem breiten Grinsen »Auf Hochzeitsreise?« zu fragen, wenn er das Frühstück brachte. In die erschrockenen, schuldbewussten Gesichter zu blicken war jedes Mal ein Fest gewesen.
Er hatte diesen Ort damals gehasst und hasste ihn heute immer noch, aber nachdem er nun einmal hier war, konnte er ebenso gut hinuntergehen und beim großen Ritual des Auf-die-Schulter-Klopfens und Freut-mich-dich-zu-sehen-Sagens mitmischen.
Er prüfte nach, ob er das Stück Plastik, das ihm als Zimmerschlüssel überreicht worden war, eingesteckt hatte, schloss die Tür hinter sich und lief den Gang hinunter zum Aufzug.
Die Hudson-Valley-Suite, in der die Cocktailparty stattfinden sollte, befand sich im Zwischengeschoss. Als er aus dem Aufzug trat, tönten ihm die elektronisch verstärkte Musik sowie die lauten Stimmen entgegen, die versuchten, sich darüber hinweg verständlich zu machen. An die vierzig oder fünfzig Leute schienen sich bereits versammelt zu haben. Zwei Kellner standen am Eingang, Tabletts mit gefüllten Weingläsern präsentierend. Er nahm ein Glas Rotwein und nippte prüfend. Ein mieser Merlot. Nichts anderes hatte er erwartet.
Er betrat die Suite und spürte, wie jemand ihm an die Schulter tippte. »Mr Stewart, mein Name ist Jake Perkins, ich schreibe einen Artikel über das Treffen für die Schülerzeitung Stonecroft Gazette. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen?«
Mürrisch drehte sich Stewart um und musterte den nervös blickenden, übereifrigen rothaarigen Burschen, der sich direkt vor ihm aufgebaut hatte. Wenn man etwas von jemandem will, muss man als Erstes wissen, dass man dem andern nicht gleich so nah auf die Pelle rückt, dachte er irritiert, als er versuchte, zurückzuweichen, und dabei mit dem Rücken gegen die Wand stieß. »Ich schlage vor, dass wir hinausgehen und uns einen ruhigeren Ort suchen, es sei denn, Sie können von den Lippen ablesen, Jake.«
»Ich glaube nicht, dass das eine meiner Stärken ist, Sir. Gehen wir nach draußen, das ist eine gute Idee.«
Nach kurzem Überlegen beschloss Stewart, den Wein mitzunehmen. Mit einem Achselzucken folgte er dem Schüler zurück in den Gang.
»Bevor wir anfangen, Mr Stewart, möchte ich Ihnen sagen, wie sehr mir Ihre Theaterstücke gefallen. Ich möchte selbst Schriftsteller werden. Das heißt, ich denke, dass ich bereits Schriftsteller bin, aber ich möchte auch Erfolg haben wie Sie.«
O Gott, dachte Stewart. »Jeder, der mich interviewt, sagt dasselbe. Die meisten, wenn nicht alle, schaffen es nie.«
Er wartete auf die verärgerte oder verlegene Reaktion, die diese Bemerkung normalerweise zur Folge hatte. Zu seiner Enttäuschung zeichnete sich stattdessen auf Jake Perkins’ Babygesicht ein fröhliches Lächeln ab. »Bei mir ist das anders«, sagte er, »da bin ich ganz sicher. Mr Stewart, ich habe eine ganze Menge über Sie und die anderen, die geehrt werden, recherchiert. Sie alle haben eines gemeinsam. Die drei Frauen waren ziemlich erfolgreiche Schülerinnen, dagegen ist keiner der vier Männer damals in Stonecroft in irgendeiner Weise aufgefallen. Ich meine, in Ihrem Fall zum Beispiel konnte ich in den Jahrbüchern keine einzige Aktivität finden, und Ihre Noten waren auch nur mittelmäßig. Sie haben weder für die Schülerzeitung geschrieben noch …«
Ganz schön frech, der Bengel, dachte Stewart. »Zu meiner Zeit war die Schülerzeitung ziemlich stümperhaft gemacht, selbst für eine Schülerzeitung«, erwiderte er giftig. »Und ich bin sicher, dass sich daran bis heute nicht viel geändert hat. Ich war nie besonders sportlich, und mein Schreiben beschränkte sich auf das Führen eines Tagebuchs.«
»War dieses Tagebuch die Grundlage für eines Ihrer Stücke?«
»Vielleicht.«
»Sie sind alle ziemlich düster.«
»Ich mache mir über das Leben keine Illusionen, und das war bereits so, als ich hier zur Schule ging.«
»Würden Sie demnach sagen, dass Sie während Ihrer Zeit in Stonecroft nicht besonders glücklich waren?«
Carter Stewart nahm einen Schluck von seinem Merlot. »Ja, das würde ich sagen«, antwortete er gleichmütig.
»Was hat Sie dann dazu bewegt, auf dieses Treffen zu kommen?«
Stewart lächelte kühl. »Die Gelegenheit, von Ihnen interviewt zu werden. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich sehe gerade, dass Laura Wilcox, die Glamour-Schönheit unserer Klasse, aus dem Aufzug kommt. Mal sehen, ob sie mich noch erkennt.«
Er ignorierte das Blatt Papier, das Perkins ihm zu überreichen versuchte.
»Wenn Sie nur noch eine Minute für mich hätten, Mr Stewart. Ich habe hier eine Liste, die Sie sicherlich sehr interessieren wird …«
Doch Perkins konnte nur noch die Rückansicht von Carter Stewarts schlankem Körper begutachten, da er mit ausgreifenden Schritten davoneilte, um die Aufsehen erregende Blondine einzuholen, die sich gerade anschickte, die Hudson-Valley-Suite zu betreten. Was für ein Ekelpaket, dachte Perkins. Kommt in Jeans und Pullover, um seine Verachtung für die Anwesenden zu zeigen, die sich für den Abend extra aufgebrezelt haben. Er ist nicht der Typ, der hier aufkreuzt, nur um sich irgendeine bedeutungslose, billige Medaille abzuholen. Was hat ihn also wirklich hierhergeführt?
Dies war die Frage, die er im letzten Satz seines Artikels stellen würde. Er hatte bereits eine ganze Menge über Carter Stewart recherchiert. Auf dem College hatte er mit dem Schreiben begonnen, unkonventionelle Einakter, die von der Theatergruppe aufgeführt wurden und ihm einen Postgraduierten-Job in Yale eingebracht hatten. Zu dieser Zeit hatte er seinen ersten Vornamen, Howard – oder Howie, wie er in Stonecroft genannt wurde –, aufgegeben. Er war noch keine dreißig, als er seinen ersten großen Erfolg am Broadway landete. Er wurde als Einzelgänger beschrieben, der sich in eines seiner über das ganze Land verstreuten vier Häuser zurückzog, wenn er an einem Stück arbeitete. Menschenscheu, abweisend, ein Perfektionist, ein Genie – mit solchen Wörtern wurde er in der Presse charakterisiert. Mir fallen da noch einige mehr ein, dachte Jake Perkins grimmig. Und die kommen alle in meinen Artikel.
7
FÜR DIE FAHRT VON Boston nach Cornwall brauchte Mark Fleischman länger, als er erwartet hatte. Er hatte gehofft, noch ein paar Stunden Zeit zu haben, um ein bisschen in der Stadt herumzulaufen, bevor er auf seine ehemaligen Klassengenossen treffen würde. Er wollte die Gelegenheit nutzen, den Unterschied zwischen seiner Selbstwahrnehmung damals – als er hier aufgewachsen war – und der Gegenwart – wie er sich heute sah – zu ermessen. Vielleicht war es auch der Wunsch, die alten Dämonen in einer Art Exorzismus zu vertreiben, dachte er.
Während er in nervtötend träger Geschwindigkeit auf der überfüllten Autobahn von Connecticut fuhr, ging ihm immer wieder der Ausspruch des Vaters eines seiner Patienten durch den Kopf, den er an diesem Vormittag gehört hatte: »Doktor, Sie wissen genauso gut wie ich, dass Kinder grausam sind. Das war schon zu meinen Zeiten so, und daran hat sich nichts geändert. Sie benehmen sich wie ein Rudel Löwen, das sich an die verwundete Beute heranpirscht. Das ist es, was sie zurzeit mit meinem Sohn machen. Und dasselbe haben sie mit mir gemacht, als ich in seinem Alter war. Und wissen Sie was, Doktor? Ich bin beruflich ziemlich erfolgreich, aber wenn ich hin und wieder auf ein Klassentreffen meiner Schule gehe, dann bin ich plötzlich nicht mehr der Generaldirektor eines der erfolgreichsten Unternehmen unseres Landes. Auf einen Schlag bin ich wieder der ungeschickte Tollpatsch, der von allen gepiesackt wurde. Verrückt, finden Sie nicht?«
Als der Verkehr wieder einmal stockte und sich nur noch im Kriechtempo vorwärts bewegte, ging Mark durch den Kopf, dass sich die Connecticut-Autobahn, in Krankenhaus-Terminologie ausgedrückt, in einem Zustand der ständigen Intensivbehandlung befand. Immer war irgendwo ein größeres Bauprojekt im Gange, verbunden mit Baustellen, bei denen die drei Spuren zu einer einzigen zusammengeführt wurden, sodass die unvermeidliche Folge ein Stau war.
Er ertappte sich dabei, dass er anfing, die Verkehrsprobleme mit den Problemen seiner Patienten zu vergleichen, wie die jenes Jungen, dessen Vater zu ihm in die Sprechstunde gekommen war. Das Kind hatte im vergangenen Jahr einen Selbstmordversuch unternommen. Ein anderes Kind, das auf dieselbe Art abgelehnt und gequält worden wäre, hätte sich vielleicht eine Waffe besorgt und sie auf seine Klassengenossen gerichtet. Gefühle der Wut, Verletztheit und Demütigung stauten sich an und bahnten sich einen Ausweg durch ein Ventil. Manche Menschen versuchten, sich selbst zu zerstören, wenn das geschah; andere versuchten, diejenigen zu zerstören, die sie quälten.
Als Psychotherapeut, der sich auf Probleme von Jugendlichen spezialisiert hatte, trat Mark in einer eigenen Ratgeber-Sendung im Fernsehen auf, die seit einiger Zeit sogar von mehreren Sendern gleichzeitig ausgestrahlt wurde. Das Echo war überraschend positiv gewesen. »Groß, schlaksig, fröhlich, witzig und weise, nimmt sich Dr. Mark Fleischman dennoch mit dem gebotenen Ernst der Probleme dieses schmerzhaften Übergangsalters an, das man Adoleszenz nennt«, hatte ein Kritiker über die Sendung geschrieben.
Vielleicht kann ich das alles nach diesem Wochenende endgültig hinter mir lassen, dachte er.
Er hatte mittags nichts gegessen, deshalb ging er, nachdem er das Hotel endlich erreicht hatte, in die Bar und bestellte sich ein Sandwich und ein leichtes Bier. Doch als sich die Bar plötzlich mit den ersten Gästen des Treffens zu füllen begann, verlangte er rasch die Rechnung, ließ die Hälfte des Sandwichs stehen und ging auf sein Zimmer.
Es war Viertel vor fünf, und allmählich legten sich schwere Schatten auf die Landschaft. Er blieb eine Weile vor dem Fenster stehen. Das Bewusstsein dessen, was er zu tun hatte, lastete schwer auf ihm. Aber danach werde ich das alles abwerfen können, dachte er. Dann habe ich endlich reinen Tisch gemacht. Und dann erst werde ich wirklich fröhlich und witzig sein – vielleicht sogar weise.
Er spürte, wie seine Augen feucht wurden, und wandte sich abrupt vom Fenster ab.
Gordon Amory trug sein Erkennungsschild in der Hosentasche, als er auf den Aufzug zuschritt. Er wollte es erst anstecken, wenn er unten in den Partyräumen war. Einstweilen bereitete es ihm Vergnügen, unerkannt im Aufzug neben den früheren Klassengenossen zu stehen, die sich Stockwerk für Stockwerk einfanden, und auf ihre Namen und Fotos zu schielen.
Jenny Adams war die Letzte, die den Aufzug betrat. Sie war ein dummes, dickes Mädchen gewesen, und obwohl sie ein bisschen schlanker geworden war, wirkte sie immer noch matronenhaft. Das billige Brokatkostüm strahlte zusammen mit dem Kaufhaus-Modeschmuck etwas unverkennbar Kleinstädtisches und Spießiges aus. Sie wurde von einem kräftigen Kerl begleitet, dessen fleischige Arme wie eingeschweißt in den Ärmeln seines zu engen Sakkos steckten. Beide lächelten ausgiebig und begrüßten die im Aufzug Anwesenden mit einem allgemeinen »Hallo«.
Gordon antwortete nicht. Das halbe Dutzend der Übrigen, die alle ihr Schild angesteckt hatten, brach in einen Chor von Begrüßungen aus. Trish Canon, die, wie Gordon in Erinnerung geblieben war, für die Schule an Laufwettbewerben teilgenommen hatte und immer noch dünn wie eine Bohnenstange war, kreischte auf: »Jenny! Du siehst ja fabelhaft aus!«
»Trish Canon!« Jennys Arme flogen um ihre ehemalige Mitschülerin. »Herb, Trish und ich haben uns in Mathe immer gegenseitig Zettel zugeschoben. Trish, das ist mein Mann Herb.«
»Und das da ist mein Mann Barclay«, antwortete Trish. »Und …«
Der Aufzug hielt im Zwischengeschoss. Während alle ausstiegen, kramte Gordon widerwillig sein Erkennungsschild aus der Tasche und steckte es sich an. Aufwändige plastische Gesichtsoperationen hatten dafür gesorgt, dass er nicht mehr so aussah wie der verdruckste Junge auf dem Schulfoto. Seine Nase war jetzt gerade, die ehemals von schweren Lidern verhängten Augen waren nun offen. Man hatte sein Kinn herausgearbeitet und die Ohren an den Kopf angelegt. Implantate und die Kunstfertigkeit eines Spitzenfachmanns für Haartönung hatten seine dünnen und blassbraunen Haare in eine dicke kastanienbraune Mähne verwandelt. Ihm war bewusst, dass er ein gut aussehender Mann geworden war. Nur ein äußerliches Anzeichen war von dem einstigen gequälten Kind übrig geblieben: Wenn er unter großem Stress stand, konnte er sich nicht davon abhalten, auf den Fingernägeln zu kauen.
Den Gordie, den sie kannten, gibt es nicht mehr, sagte er sich, als er seine Schritte in Richtung Hudson-Valley-Suite lenkte. Er spürte, wie jemand an seine Schulter tippte, und drehte sich um.
»Mr Amory.«
Ein milchgesichtiger rothaariger Bursche stand vor ihm, einen Notizblock in der Hand.
»Mein Name ist Jake Perkins, ich schreibe für die Stonecroft Gazette. Ich mache Interviews mit den Ehrengästen. Hätten Sie kurz Zeit für mich?«
Die Originalausgabe NIGHTTIME IS MY TIME erschien bei Simon & Schuster, New York
7. Auflage
Vollständige deutsche Taschenbucherstausgabe 11/2005
Copyright © 2004 by Mary Higgins Clark
Copyright © 2004 der deutschen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlagillustration und Umschlaggestaltung: Eisele Grafik Design, München Redaktion: Oliver Neumann unter Verwendung eines Fotos von Evelyn Munnes
eISBN 978-3-641-10076-6
www.heyne.de
www.randomhouse.de
Leseprobe