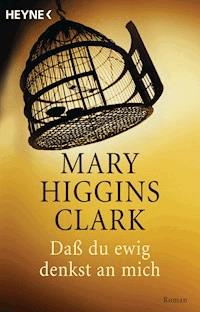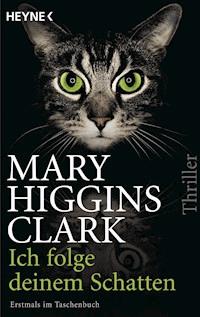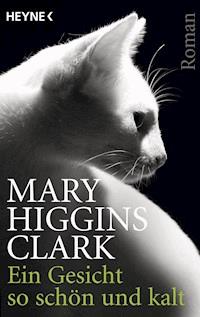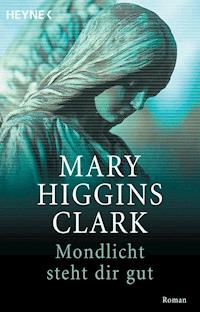
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nachdem ihre Stiefmutter ermordet wurde, beginnt die erfolgreiche Modefotografin Maggie Holloway Nachforschungen in einem Altenstift anzustellen. Sie kommt zu einer erschütternden Erkenntnis: Auch andere ältere Damen sind auf unerklärliche Weise verstorben. Schließlich gerät Maggie selbst in eine tödliche Falle.
«Mary Higgins Clark - die Königin der Hochspannung!» WELT AM SONNTAG
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Das Buch
Überraschend trifft die erfolgreiche Modefotografin Maggie Holloway nach über zwanzig Jahren auf einer Cocktailparty ihre Stiefmutter Finnula wieder – den einzigen Menschen, der ihr in ihrer Kindheit Liebe und Zuneigung gegeben hatte. Als Maggie auf Finnulas Drängen nach Newport, Rhode Island, fährt, um sie zu besuchen, findet sie das Haus ausgestorben vor. Finnula liegt tot auf dem Boden – erschlagen. Zu ihrem großen Erstaunen erfährt Maggie, daß diese noch im letzten Moment ihr Testament geändert und ihr Haus nicht, wie vorgesehen, dem Altenheim, sondern ihr vermacht hat. Als kurze Zeit später immer mehr Frauen aus dem Stift – alle wohlhabend und ohne Verwandte – auf rätselhafte Weise ums Leben kommen, wird Maggie mißtrauisch und beschließt, Nachforschungen anzustellen. Dabei stößt sie auf Professor Bateman und sein makabres Museum für Bestattungsgegenstände und gerät selbst in eine tödliche Falle.
Die Autorin
Mary Higgins Clark wurde 1928 geboren. Mit ihren Spannungsromanen hat sie weltweit Millionen von Leserinnen und Lesern gewonnen, und mit jedem neuen Roman erobert sie die Bestsellerlisten. Beinamen wie »Königin der Spannung« und »Meisterin des sanften Schreckens« zeugen von ihrer großen Popularität. Die Autorin lebt in Saddle River, New Jersey. Ein ausführliches Werkverzeichnis findet sich im Anhang.
Inhaltsverzeichnis
Für Lisl Cadeund Eugene H. Winick– meine Pressereferentin und meinen Literaturagenten –beide meine sehr geschätzten Freunde
Dienstag, 8. Oktober
Maggie versuchte die Augen aufzuschlagen, aber die Anstrengung war zu groß. Der Kopf tat ihr so weh. Wo war sie überhaupt? Was war geschehen? Sie hob die rechte Hand hoch, stieß jedoch schon Zentimeter über ihrem Körper gegen ein Hindernis, konnte nicht weiter vordringen.
Instinktiv drückte sie dagegen, aber es wich nicht von der Stelle. Was war das? Es fühlte sich weich wie Seide an, und es war kalt.
Sie ließ ihre Finger zur Seite und nach unten gleiten; die Oberfläche veränderte sich. Jetzt fühlte sie sich wie Rüschen an. Eine Steppdecke? War sie in irgendeiner Art von Bett?
Sie schob die andere Hand zur Seite und zuckte verstört zurück, als sie auch mit dieser Handfläche sofort auf die gleichen kühlen Rüschen stieß. Es gab sie also auf beiden Seiten dieser engen Einfassung.
Was zupfte da an ihrem Ring, wenn sie die linke Hand bewegte? Sie tastete mit dem Daumen ihren Ringfinger ab, spürte, wie er eine Schnur oder Kordel zu greifen bekam. Doch wieso?
Dann fiel es ihr mit einemmal wieder ein.
Ihre Augen öffneten sich und starrten voller Entsetzen in totale Dunkelheit.
Panisch jagten ihr die Gedanken durch den Kopf, während sie die Bruchstücke dessen zusammenzusetzen versuchte, was eigentlich passiert war. Sie hatte ihn gerade noch rechtzeitig gehört, um sich ruckartig genau in dem Moment umzudrehen, als ihr irgend etwas auf den Kopf krachte.
Sie wußte noch, wie er sich über sie gebeugt und dabei geflüstert hatte: »Maggie, denk an die Glockenläuter.« Danach konnte sie sich an nichts mehr erinnern.
Noch immer völlig durcheinander und zutiefst erschreckt, bemühte sie sich, zu begreifen. Dann war plötzlich die Erinnerung wieder da. Die Glockenläuter! Die Menschen im Viktorianischen Zeitalter hatten sich so davor gefürchtet, lebendig begraben zu werden, daß es sich damals einbürgerte, ihnen vor der Beisetzung eine Schnur an den Fingern zu befestigen. Eine Schnur, die durch ein Loch im Sarg hindurch bis zur Oberfläche der Grabstätte reichte. Eine Schnur, an die eine Glocke gebunden war.
Sieben Tage lang hielt dann am Grab ein Wachposten die Stellung und horchte, ob die Glocke zu läuten begann, zum Zeichen, daß die bestattete Person eben doch nicht tot war...
Aber Maggie wußte, daß kein Wachposten nach ihr lauschte. Sie war wahrhaftig allein. Sie versuchte zu schreien, aber es kam kein Ton hervor. Fieberhaft zog sie an der Schnur, horchte angestrengt in der Hoffnung, einen schwachen Klingelton oben über ihr zu hören. Aber es herrschte völlige Stille. Dunkelheit und Stille.
Sie mußte Ruhe bewahren. Sie mußte ihre Gedanken ordnen. Wie war sie hierher gekommen? Sie durfte sich nicht von Panik übermannen lassen. Aber wie nur?... Wie?...
Dann fiel es ihr wieder ein. Das Bestattungsmuseum. Sie war allein dorthin zurückgekehrt. Dann hatte sie die Suche aufgenommen, die Suche, mit der Nuala begonnen hatte. Dann war er aufgetaucht und...
O Gott! Sie war lebendig begraben! Sie trommelte mit den Fäusten gegen den Sargdeckel, aber selbst hier im Inneren dämpfte der dicke Satinstoff das Geräusch ab. Schließlich schrie sie. Schrie, bis sie heiser wurde, schrie, bis sie nicht mehr schreien konnte. Und noch immer war sie allein.
Die Glocke. Sie zerrte an der Schnur... wieder... und wieder. Ganz sicher gab sie Töne von sich. Sie selbst konnte es zwar nicht läuten hören, aber irgend jemand würde es doch hören. Mußte es einfach hören!
Über ihr schimmerte ein Hügel frisch aufgeschütteter Erde im Licht des Vollmonds. Die einzige Bewegung rührte von der Bronzeglocke her, die an einem aus dem Erdhügel ragenden Rohr befestigt war: Die Glocke schwang im unsteten Rhythmus eines Todestanzes hin und her. Rundum blieb alles still. Der Klöppel war entfernt worden.
Freitag, 20. September
1
Ich hasse Cocktailempfänge, dachte Maggie resigniert und fragte sich, weshalb sie sich immer wie ein Mensch von einem anderen Stern vorkam, wenn sie bei so einer Party war. Eigentlich bin ich zu hart, dachte sie. In Wahrheit hasse ich Cocktailempfänge, wo der einzige Mensch, den ich kenne, der ist, mit dem ich dort hingehe und der mich im Stich läßt, sobald wir zur Tür reinkommen.
Sie schaute sich in dem großen Raum um und seufzte. Als Liam Moore Payne sie zu diesem Familientreffen des Moore-Clans eingeladen hatte, hätte sie sich eigentlich denken müssen, daß er eher daran interessiert sein würde, Zeit mit seinen Dutzenden von Verwandten zu verbringen, als sich groß um sie zu kümmern. Mit Liam ging sie manchmal aus, wenn er von Boston zu Besuch kam, und normalerweise war er sehr aufmerksam, doch an diesem Abend setzte er offenbar grenzenloses Vertrauen in ihre Fähigkeit, allein zurechtzukommen. Nun ja, es waren eine Menge Leute da, überlegte sie; da konnte sie doch sicher einen Gesprächspartner finden.
Das, was Liam ihr über die Moores erzählt hatte, war ja der ausschlaggebende Faktor bei ihrer Entscheidung gewesen, ihn zu der Veranstaltung zu begleiten, hielt sie sich vor Augen, während sie einen Schluck Weißwein trank und sich einen Weg durch die Menschenmenge im Grill Room des an der Zweiundfünfzigsten Straße Ost gelegenen Four Seasons Restaurant in Manhattan bahnte. Der Gründervater der Familie – oder doch der Begründer des ursprünglichen Familienvermögens – war der inzwischen verstorbene Squire Desmond Moore gewesen, einst ein fester Bestandteil der besten Kreise von Newport. Der Anlaß zu diesem festlichen Familientreffen war die Feier des hundertfünfzehnten Geburtstages des bedeutenden Mannes. Der Einfachheit halber hatte man sich dazu entschlossen, die Veranstaltung lieber in New York anstatt in Newport abzuhalten.
Liam hatte über viele Familienmitglieder amüsante Details zum besten gegeben, als er ihr klarmachte, mehr als einhundert aus direkter Linie und von Seitenzweigen abstammende Nachkommen würden nebst einigen geschätzten ehemals angeheirateten Verwandten anwesend sein. Er hatte Maggie mit Anekdoten über den damals fünfzehnjährigen Einwanderer aus Dingle ergötzt, der sich nicht etwa als einer der Geknechteten verstand, die es nach Freiheit, sondern als einer der an den Bettelstab Gebrachten, die es nach Reichtum dürstete. Der Legende nach hatte Squire, als sein Schiff die Freiheitsstatue passierte, den anderen Zwischendeckpassagieren verkündet: »In Null Komma nichts werd ich so reich sein, daß ich das alte Mädchen kaufen kann, natürlich nur, falls die Regierung je beschließt, sie zu verkaufen.« Liam hatte die Erklärung seines Ahnherrn mit einem wunderbar breiten, typisch irischen Akzent vorgetragen.
Die Moores traten wirklich in allen Größen und Formen auf, dachte Maggie, während sie sich in dem Raum umsah. Sie beobachtete zwei Gäste in den Achtzigern, wie sie sich angeregt unterhielten, und kniff die Augen bei der Vorstellung zusammen, sie würde die beiden durch das Objektiv ihrer Kamera betrachten, von der sie nun wünschte, sie hätte sie mitgebracht. Das schneeweiße Haar des Mannes, das kokettierende Lächeln der Frau, das Vergnügen, mit dem die beiden ganz offensichtlich ihr Beisammensein genossen – es hätte ein wundervolles Foto ergeben.
»Das Four Seasons wird nie mehr dasselbe sein, wenn die Moores erst einmal fertig damit sind«, sagte Liam, als er plötzlich neben ihr auftauchte. »Amüsierst du dich gut?« fragte er, stellte ihr dann jedoch, ohne eine Antwort abzuwarten, noch einen weiteren seiner Verwandten vor, Earl Bateman, der sie nun, wie Maggie belustigt feststellte, mit unverhülltem Interesse musterte.
Ihrer Schätzung nach war der Neuankömmling genau wie Liam Ende Dreißig. Er war einen halben Kopf kleiner als sein Vetter, war also knapp einen Meter achtzig groß. Sie fand, daß sich in seinem schmalen, nachdenklichen Gesicht eine gewisse Neigung zum Gelehrten widerspiegelte, obwohl seine blaßblauen Augen etwas Beunruhigendes an sich hatten. Mit seinen sandfarbenen Haaren und dem fahlen Teint war er nicht auf so markante Weise attraktiv wie Liam. Liams Augen waren eher grün als blau, seine dunklen Haare von attraktiven grauen Strähnen durchzogen.
Sie wartete ab, während er sie weiterhin ausführlich betrachtete. Nach einer langen Weile schließlich fragte sie mit hochgezogenen Augenbrauen: »Werde ich der Überprüfung standhalten?«
Er sah verlegen aus. »Entschuldigen Sie bitte. Ich kann mir nicht gut Namen merken, und ich habe nur versucht, Sie irgendwie einzuordnen. Sie gehören doch zum Clan, oder nicht?«
»Nein. Ich habe zwar irische Wurzeln, die drei oder vier Generationen zurückliegen, aber mit dem Clan hier bin ich nicht verwandt. Es sieht im übrigen nicht so aus, als bräuchten Sie noch mehr Verwandte.«
»Damit könnten Sie gar nicht richtiger liegen. Wirklich schade allerdings, daß die meisten von ihnen nicht annähernd so attraktiv sind wie Sie. Ihre wunderschönen blauen Augen, Ihre elfenbeinfarbene Haut und Ihr zierlicher Knochenbau weisen darauf hin, daß Sie keltischen Ursprungs sind. Den beinahe schwarzen Haaren nach zu urteilen, gehören Sie dem ›schwarz-irischen‹ Teil der Familie an, deren Mitglieder ihre genetische Ausstattung zum Teil dem kurzen, aber bedeutungsvollen Besuch von Überlebenden des Untergangs der spanischen Armada verdanken.«
»Liam! Earl! Oh, du lieber Himmel, jetzt bin ich wohl doch froh, daß ich hergekommen bin.«
Ohne Maggie weiter zu beachten, wandten sich beide Männer ab, um begeistert einen Mann mit frischer Gesichtsfarbe zu begrüßen, der sich ihnen von hinten näherte.
Maggie zuckte mit den Achseln. Das war’s dann also, dachte sie und zog sich in Gedanken in eine Ecke zurück. Dann fiel ihr ein Artikel ein, den sie vor kurzem gelesen hatte und der Menschen, die sich bei geselligen Anlässen isoliert fühlten, dazu ermutigte, Ausschau nach jemand anders zu halten, der sogar noch verlorener wirkte, und eine Unterhaltung in Gang zu bringen.
Innerlich schmunzelnd beschloß sie, die Taktik zu erproben und sich dann, sollte sie am Ende noch immer auf Selbstgespräche angewiesen sein, still davonzumachen und heimzugehen. In diesem Augenblick erschien ihr die Aussicht auf ihr behagliches Apartment an der Sechsundfünfzigsten Straße in der Nähe des East River sehr anziehend. Ihr war bewußt, daß sie diesen Abend lieber hätte zu Hause verbringen sollen. Sie war erst vor wenigen Tagen von einem Fototermin in Mailand zurückgekehrt und sehnte sich nach einem ruhigen Abend, an dem sie die Füße hochlegen konnte.
Sie blickte sich um. Es schien keinen einzigen Verwandten von Squire Moore zu geben, der nicht darum kämpfte, Gehör zu finden.
Countdown zum Abgang, entschied sie. Da hörte sie in der Nähe eine Stimme – eine melodische, vertraute Stimme, die ganz unvermutet angenehme Erinnerungen zum Vorschein brachte. Maggie wirbelte herum. Die Stimme stammte von einer Frau, die soeben die kurze Treppe zur Galerie des Restaurants hinaufging und stehengeblieben war, um einer Person unterhalb von ihr etwas zuzurufen. Maggie starrte, hielt verblüfft die Luft an. War sie verrückt? Konnte das wirklich und wahrhaftig Nuala sein? Es war nun schon so lange her, und doch klang sie genau wie die Frau, die einst ihre Stiefmutter gewesen war, von Maggies fünftem bis zu ihrem zehnten Lebensjahr. Nach der Scheidung hatte Maggies Vater ihr sogar verboten, Nualas Namen auch nur zu erwähnen.
Maggie bemerkte, daß Liam gerade vorbeiging, um eine weitere Verwandte zu begrüßen, und packte ihn am Arm. »Liam, diese Frau da auf der Treppe. Kennst du sie?«
Er kniff die Augen zusammen. »Oh, das ist Nuala. Sie war mit meinem Onkel verheiratet. Ich nehme an, sie ist meine Tante, aber sie war seine zweite Frau, deshalb hab’ ich sie eigentlich nie als Tante angesehen. Sie ist ein bißchen eigenwillig, aber wirklich erfrischend. Wieso?«
Maggie ließ sich keine Zeit für eine Antwort, sondern begann sich durch die Trauben von Moores hindurchzuwinden. Als sie schließlich bei der Treppe ankam, war die Frau, auf die sie es abgesehen hatte, bereits oben auf der Galerie im Gespräch mit einer Gruppe von Leuten begriffen. Maggie ging die Stufen hinauf, blieb jedoch auf der vorletzten Stufe stehen, um die Frau zu betrachten.
Als Nuala damals so abrupt weggegangen war, hatte Maggie darum gebetet, sie möge schreiben. Doch sie meldete sich nie, und Maggie hatte ihr Schweigen als besonders schmerzlich empfunden. Im Lauf der fünf Jahre, in der die Ehe bestanden hatte, war sie Maggie sehr ans Herz gewachsen. Ihre eigene Mutter war bei einem Autounfall ums Leben gekommen, als Maggie noch ein Säugling war. Erst nach dem Tod ihres Vaters dann erfuhr sie von einer Freundin der Familie, daß ihr Vater alle Briefe vernichtet und die Geschenke zurückgesandt hatte, die Nuala ihr geschickt hatte.
Maggie starrte jetzt auf die winzige Gestalt mit den lebhaften blauen Augen und dem weichen, honigblonden Haar. Sie konnte das feine Geflecht der Falten sehen, die ihren schönen Teint nicht im mindesten beeinträchtigten. Und während sie ins Schauen versunken war, strömten ihr die Erinnerungen ins Herz. Kindheitserinnerungen, vielleicht ihre glücklichsten.
Nuala, die bei Auseinandersetzungen stets ihre Partei ergriff und gegen Maggies Vater Position bezog: »Owen, um Himmels willen, sie ist doch noch ein Kind. Hör auf, sie ständig zurechtzuweisen.« Nuala, die immerzu sagte: »Owen, alle Kinder in ihrem Alter tragen Jeans und T-Shirts... Owen, was spielt es für eine Rolle, wenn sie drei Filme verbraucht hat? Sie macht schrecklich gern Fotos, und sie ist gut darin... Owen, sie spielt nicht einfach nur im Dreck. Kannst du denn nicht sehen, daß sie etwas aus dem Ton zu machen versucht? Mein Gott noch mal, erkenn doch wenigstens das künstlerische Talent deiner Tochter an, wenn du schon meine Bilder nicht leiden kannst.«
Nuala – immer so hübsch, immer so lustig, immer so geduldig bei Maggies Fragen. Nuala war es gewesen, von der Maggie Kunst lieben und verstehen gelernt hatte.
Typischerweise trug Nuala heute abend ein blaßblaues Kostüm aus Satin mit dazu passenden hochhackigen Pumps. Maggies Erinnerungen an Nuala waren schon immer pastellfarben getönt.
Nuala war Ende Vierzig gewesen, als sie Dad heiratete, dachte Maggie, während sie ihr derzeitiges Alter auszurechnen versuchte. Sie hielt fünf Jahre lang mit ihm durch. Sie ging vor zweiundzwanzig Jahren fort.
Es war ein Schock, zu erkennen, daß Nuala inzwischen Mitte Siebzig sein mußte. Zweifellos sah sie nicht danach aus.
Ihre Augen trafen sich. Nuala runzelte die Stirn, sah dann verblüfft aus.
Nuala hatte ihr erzählt, daß sie in Wirklichkeit Finnuala hieß, nach dem legendären Kelten Finn MacCool, der einst einen Riesen zu Fall brachte. Maggie wußte noch, welches Vergnügen ihr als kleines Mädchen der Versuch gemacht hatte, Finn-u-ala auszusprechen.
»Finn-u-ala?« sagte sie jetzt mit zögernder Stimme.
Ein Ausdruck absoluter Verblüffung machte sich auf dem Gesicht der älteren Frau breit. Dann stieß sie einen Freudenschrei aus, der das Stimmengewirr der Gespräche um sie herum zum Schweigen brachte, und Maggie fand sich nach so langer Zeit wieder von liebevollen Armen umschlungen. Von Nuala ging der zarte Duft aus, der all diese Jahre hindurch in Maggies Gedächtnis haften geblieben war. Im Alter von achtzehn Jahren hatte sie entdeckt, daß dieses Parfum Joy hieß. Freude – wie passend für heute abend, dachte Maggie.
»Laß mich dich anschauen«, rief Nuala aus, während sie von ihr abließ und zurücktrat, dabei aber noch immer Maggies Arme mit beiden Händen festhielt, als befürchte sie, Maggie könne weglaufen.
Ihre Augen wanderten forschend über Maggies Gesicht. »Ich hab’ nie geglaubt, dich jemals wiederzusehen! O Maggie! Wie geht’s diesem schrecklichen Mann, deinem Vater?«
»Er ist vor drei Jahren gestorben.«
»Oh, das tut mir leid, mein Schatz. Aber ganz bestimmt war er bis zum Schluß vollkommen unmöglich.«
»Einfach war er nicht gerade«, gab Maggie zu.
»Schatz, ich war mit ihm verheiratet. Weißt du noch? Ich weiß doch, wie er war! Immer im Brustton der Moral, mürrisch, mißmutig, launisch und nörglerisch. Was soll’s, es hat keinen Sinn, weiter darüber zu reden. Der arme Mann ist tot, möge er in Frieden ruhen. Aber er war so altmodisch und steif, ehrlich, der hätte für ein farbiges Glasfenster aus dem Mittelalter Modell stehen können...«
Da sie plötzlich merkte, daß verschiedene Leute ungeniert zuhörten, schob Nuala den Arm um Maggies Taille und verkündete: »Das ist mein Kind! Ich hab’ sie natürlich nicht zur Welt gebracht, aber das ist völlig unwichtig.«
Maggie merkte, daß auch Nuala gegen Tränen ankämpfte.
Ebenso begierig darauf, miteinander zu reden wie dem Ansturm des dicht gefüllten Restaurants zu entkommen, huschten sie gemeinsam zum Ausgang. Maggie konnte Liam nicht finden, um sich zu verabschieden, war sich aber ziemlich sicher, daß er sie nicht vermissen würde.
Arm in Arm wanderten Maggie und Nuala durch den dämmernden Septemberabend die Park Avenue hinauf, wandten sich an der Sechsundfünfzigsten Straße nach Westen und kehrten im Il Tinello ein. Bei Chianti und delikaten Streifen gebratener Zucchini begannen sie einander zu erzählen, was sie inzwischen erlebt hatten.
Für Maggie war es einfach. »Internat; ich wurde gleich nachdem du weg warst, reingesteckt. Dann ins Carnegie-Mellon, und schließlich hab’ich einen Magister in angewandter Kunst an der New York University gemacht. Ich verdiene jetzt gut als Fotografin.«
»Das ist wunderbar. Ich hab’ mir schon immer gedacht, es würde entweder das sein oder Bildhauerei.«
Maggie lächelte. »Du hast ein gutes Gedächtnis. Ich mache liebend gern Skulpturen, aber bloß als Hobby. Fotografin zu sein ist wesentlich praktischer, und um ganz ehrlich zu sein, bin ich, glaub ich, ziemlich gut. Ich hab’ ein paar hervorragende Kunden. Jetzt aber, wie steht’s mit dir, Nuala?«
»Nein. Erzähl erst mal von dir zu Ende«, unterbrach sie die ältere Frau. »Du wohnst in New York. Du hast eine Arbeit, die dir gefällt. Du hast es durchgezogen, etwas zu entwickeln, was eine angeborene Gabe ist. Du bist genauso hübsch geworden, wie ich’s mir immer gedacht habe. Du bist an deinem letzten Geburtstag zweiunddreißig geworden. Wie steht’s mit der Liebe oder einem Menschen, der dir wichtig ist, oder wie immer ihr jungen Leute so was heutzutage nennt?«
Maggie spürte den wohlvertrauten schmerzlichen Stich, als sie sachlich berichtete: »Ich war drei Jahre lang verheiratet. Er hieß Paul, und er machte seine Ausbildung bei der Air Force Academy. Er war damals gerade für das NASA-Programm ausgesucht worden, als er bei einem Trainingsflug ums Leben kam. Das war vor fünf Jahren. Es ist ein Schock, über den ich vermutlich nie hinwegkommen werde. Es fällt mir jedenfalls immer noch schwer, über ihn zu reden.«
»Oh, Maggie.«
Eine Welt des Verstehens sprach aus Nualas Stimme. Maggie dachte daran, daß ihre Stiefmutter eine Witwe gewesen war, als sie ihren Vater heiratete.
Mit einem Kopfschütteln murmelte Nuala: »Warum nur müssen solche Sachen passieren?« Dann wurde ihr Tonfall fröhlicher. »Sollen wir bestellen?«
Beim Essen gingen sie zweiundzwanzig Jahre gemeinsam durch. Nach der Scheidung von Maggies Vater war Nuala nach New York gezogen, sah sich dann eines Tages Newport an und traf dort Timothy Moore – einen Mann, mit dem sie tatsächlich schon als Teenager ausgegangen war – und heiratete ihn. »Mein dritter und letzter Ehemann«, erklärte sie, »und wirklich ganz wunderbar. Tim ist letztes Jahr gestorben, und ich vermisse ihn einfach schrecklich! Er war keiner von den reichen Moores, aber ich habe ein süßes Haus in einem wunderschönen Viertel von Newport und ein angemessenes Einkommen, und natürlich spiele ich noch mit der Malerei herum. Also geht’s mir gut.«
Aber Maggie sah ein kurzes Aufflackern der Verunsicherung über Nualas Gesicht huschen und erkannte in diesem Moment, daß Nuala ohne den energischen, fröhlichen Ausdruck genauso alt aussah, wie sie war.
»Wirklich gut, Nuala?« fragte sie leise. »Du scheinst... dir Sorgen zu machen.«
»O doch, mir geht’s bestens. Es ist bloß... Also, weißt du, letzten Monat bin ich fünfundsiebzig geworden. Vor Jahren hat mal jemand zu mir gesagt, wenn du über sechzig bist, fängst du an, deinen Freunden Lebewohl zu sagen, oder sie sagen dir Lebewohl, aber wenn du dann in die Siebziger kommst, dann passiert es die ganze Zeit. Du kannst mir glauben, es stimmt. Ich hab’in letzter Zeit eine Reihe guter Freunde verloren, und jeder neue Verlust tut noch etwas mehr weh als der davor. Es wird allmählich ein bißchen einsam in Newport, aber dort gibt es eine wunderschöne Wohnanlage – ich hasse das Wort Altersheim –, und ich habe ins Auge gefaßt, mich bald dort niederzulassen. Eine Wohnung von der Art, wie ich sie dort haben möchte, ist gerade frei geworden.«
Dann, als der Kellner ihnen Espresso einschenkte, sagte sie eindringlich: »Maggie, komm mich doch besuchen, bitte. Es ist bloß eine Drei-Stunden-Fahrt von New York aus.«
»Liebend gern«, antwortete Maggie.
»Meinst du das ernst?«
»Ganz bestimmt. Jetzt, wo ich dich wiedergefunden habe, werd ich dich nicht wieder entwischen lassen. Außerdem hatte ich schon immer dran gedacht, gelegentlich mal nach Newport zu fahren. Wie ich höre, ist es ein Paradies für Fotografen. Wenn ich’s mir genau überlege –«
Sie wollte Nuala gerade erzählen, daß sie ihren Kalender von der nächsten Woche ab freigeräumt hatte, um Zeit für einen dringend notwendigen Urlaub zu haben, als sie jemanden sagen hörte: »Dachte ich mir doch, daß ich euch hier finde.«
Verblüfft blickte Maggie auf. Neben ihnen ragten Liam und sein Vetter Earl Bateman hoch. »Du bist mir davongelaufen«, sagte Liam vorwurfsvoll.
Earl beugte sich herab, um Nuala einen Kuß zu geben. »Du hast dir ganz schön was eingehandelt, weil du ihm sein Mädchen entführt hast. Woher kennt ihr beide euch überhaupt?«
»Das ist eine lange Geschichte.« Nuala lächelte. »Earl wohnt auch in Newport«, erklärte sie Maggie. »Er lehrt Anthropologie am Hutchinson College in Providence.«
Ich hatte recht mit dem Aussehen eines Gelehrten, dachte Maggie.
Liam zog einen Stuhl von einem Nachbartisch heran und nahm Platz. »Ihr müßt uns erlauben, einen Digestif mit euch zu trinken.« Er lächelte Earl an. »Und macht euch keine Sorgen wegen Earl. Er ist seltsam, aber er ist harmlos. Sein Zweig der Familie ist schon seit über hundert Jahren im Bestattungswesen tätig. Sie begraben Leute. Er gräbt sie aus! Er ist ein Grabplünderer. Er verdient sogar Geld damit, darüber zu reden.«
Maggie hob die Augenbrauen, während die anderen lachten.
»Ich halte Vorlesungen über Bestattungsbräuche einst und jetzt«, erklärte Earl Bateman mit dem Anflug eines Lächelns. »Manche finden das vielleicht makaber, aber ich liebe es.«
Freitag, 27. September
2
Er schritt zügig den Cliff Walk entlang, die Haare zerzaust von der steifen Brise, die im Lauf des Spätnachmittags aufgekommen war. Die Sonne war zur Mittagszeit wunderbar warm gewesen, doch jetzt waren ihre schräg einfallenden Strahlen wirkungslos gegen den kühlen Wind. Er hatte den Eindruck, daß die Luftveränderung den Wandel in seiner eigenen Stimmung reflektierte.
Bis jetzt hatte er seinen Plan erfolgreich durchziehen können, doch nun, da Nualas Einladung zum Abendessen in nur zwei Stunden bevorstand, überkam ihn mit einemmal eine Vorahnung. Nuala hatte Verdacht geschöpft und würde sich ihrer Stieftochter anvertrauen. Alles konnte aus den Fugen geraten.
Die Touristen hatten Newport noch nicht verlassen. Es gab sie sogar im Überfluß, Tagesreisende der Nachsaison, die darauf erpicht waren, die alten Herrenhäuser, die von der Preservation Society in Schuß gehalten wurden, abzuklappern und die Überbleibsel eines vergangenen Zeitalters anzugaffen, bevor die meisten davon bis zum nächsten Frühjahr geschlossen wurden.
Tief in Gedanken versunken blieb er stehen, als er zum Breakers kam, zu diesem unschlagbar protzigen Juwel, diesem amerikanischen Palast, diesem atemberaubenden Beispiel dafür, was Geld und Einbildungskraft und unermüdlicher Ehrgeiz zu erzielen vermochten. Für Cornelius Vanderbilt II und seine Frau Alice Anfang der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts erbaut, erfreute das Herrenhaus Vanderbilt selbst nur für kurze Zeit. Nachdem ihn ein Schlaganfall im Jahr 1895 gelähmt hatte, starb er 1899.
Während er noch für eine kleine Weile vor dem Breakers verweilte, lächelte er. Vanderbilts Geschichte war es gewesen, die ihn auf diese Idee gebracht hatte.
Jetzt aber mußte er rasch handeln. Er nahm wieder sein altes Tempo auf und kam nun an der Salve Regina University vorbei, ehemals als Ochre Court bekannt, einer Hundert-Zimmer-Extravaganz, die sich mit ihren wunderschön erhaltenen Kalksteinfassaden und dem gepflegten Mansardendach prächtig gegen den Horizont abzeichnete. Fünf Minuten später war er dann bei Latham Manor angelangt, dem großartigen Gebäude, das ein geschmackvolles Gegenstück zum Breakers darstellte. Ursprünglich der stolze Besitz der exzentrischen Familie Latham, war es zu Lebzeiten des letzten Latham immer mehr verfallen. Nachdem es vor dem völligen Zerfall bewahrt und weitgehend zu seiner vormaligen grandiosen Schönheit wiederhergestellt worden war, diente es nun als Wohnsitz für wohlhabende Privatiers, die hier ihren Lebensabend in einer opulenten Umgebung verbrachten.
Er blieb stehen und weidete seine Augen an der majestätischen Marmorfassade des Latham Manor. Er griff in die tiefe Tasche seiner Windjacke und zog ein Mobiltelefon hervor. Er wählte rasch, lächelte ein wenig, als die Stimme erklang, die er zu hören gehofft hatte. Eine Sache weniger, um die er sich später kümmern mußte.
Er sagte drei Wörter: »Nicht heute abend.«
»Wann dann?« fragte eine ruhige, unverbindliche Stimme nach einer kurzen Pause.
»Weiß ich noch nicht. Ich muß was anderes erledigen.« Seine Stimme war scharf. Er ließ keine Fragen zu seinen Entscheidungen zu.
»Selbstverständlich. Entschuldigung.«
Während er ohne weiteren Kommentar die Leitung unterbrach, drehte er sich um und machte sich rasch auf den Weg.
Es war Zeit, sich für Nualas Einladung fertigzumachen.
3
Nuala Moore summte vor sich hin, während sie auf dem Schneidebrett ihrer sympathisch unaufgeräumten Küche mit schnellen, sicheren Bewegungen Tomaten in Scheiben schnitt. Die Spätnachmittagssonne war im Begriff unterzugehen, und eine steife Brise brachte das Fenster über dem Spülbecken zum Klappern. Sie konnte bereits spüren, daß ein Anflug von Kälte durch die schlecht isolierte hintere Wand eindrang.
Trotzdem wußte sie, daß ihre Küche mit ihrer rot-weißen, im Kolonialstil gemusterten Tapete, dem abgetretenen roten Linoleum-Fußboden und den Regalen und Einbauschränken aus Kiefernholz warm und einladend war. Als sie mit dem Schneiden der Tomaten fertig war, griff sie nach den Zwiebeln. Ein Tomatensalat mit Zwiebeln, einer Vinaigrette und großzügig mit Oregano bestreut war eine perfekte Ergänzung zu einer gebratenen Lammkeule. Sie hoffte inständig, daß Maggie noch immer so gerne Lammfleisch aß. Als sie klein gewesen war, hatte es zu ihren Lieblingsgerichten gehört. Vielleicht hätte ich sie ja danach fragen sollen, dachte Nuala, aber ich will sie überraschen. Zumindest wußte sie, daß Maggie keine Vegetarierin war – an ihrem gemeinsamen Abend in Manhattan hatte sie Kalbfleisch bestellt.
Die Kartoffeln tanzten bereits in dem großen Topf. Wenn sie gar gekocht waren, würde sie sie abgießen, aber erst im allerletzten Moment zu Brei stampfen. Ein Backblech mit Brötchen stand bereit und mußte nur in den Ofen geschoben werden. Die grünen Bohnen und die Karotten waren geputzt und geschält, damit sie, kurz bevor Nuala ihre Gäste zu Tisch bat, gedämpft werden konnten.
Sie warf einen Blick ins Eßzimmer und überprüfte noch einmal alles. Der Tisch war gedeckt. Das hatte sie schon am Morgen als erstes getan. Maggie würde ihr gegenüber in dem anderen Gastgeberstuhl sitzen. Eine symbolische Geste, das war ihr klar. Gemeinsame Gastgeberinnen für diesen Abend, wie Mutter und Tochter.
Sie lehnte sich eine Weile an den Türrahmen und dachte nach. Es würde wundervoll sein, einen Menschen zu haben, dem sie endlich diese schreckliche Sorge anvertrauen konnte. Ein oder zwei Tage wollte sie zunächst abwarten, und dann würde sie sagen: »Maggie, ich muß mit dir über etwas Wichtiges reden. Du hast recht, ich mache mir Sorgen wegen einer Sache. Vielleicht bin ich ja verrückt oder bloß eine alte, mißtrauische Närrin, aber...«
Es wäre wohltuend, ihre Verdachtsgründe Maggie gegenüber offenzulegen. Selbst als sie noch klein war, hatte sie schon einen klaren, analytischen Verstand gehabt. »Finn-u-ala«, begann sie dann, wenn sie mich in etwas einweihen wollte, ihre Art, mich wissen zu lassen, daß es um eine sehr ernsthafte Besprechung ging, erinnerte sich Nuala.
Ich hätte bis morgen abend warten sollen, um dieses Essen zu veranstalten, dachte sie. Ich hätte Maggie die Chance geben sollen, wenigstens erst mal Luft zu holen. Nun ja, wieder mal typisch für mich – ich handle immer zuerst und denke hinterher nach.
Aber nachdem sie schon soviel über sie erzählt hatte, war es ihr ein Bedürfnis gewesen, ihren Freunden Maggie nun auch vorzuführen. Und außerdem war sie zu dem Zeitpunkt, als sie ihre Freunde einlud, davon ausgegangen, daß Maggie einen Tag früher kommen würde.
Maggie hatte jedoch am Tag zuvor angerufen, um ihr zu sagen, bei einem ihrer Aufträge gebe es ein Problem und es werde daher einen Tag länger als erwartet dauern, ihn abzuschließen. »Der Art-director ist ein nervöses Hemd und macht sich völlig verrückt mit den Aufnahmen«, hatte sie erklärt, »also kann ich erst morgen gegen Mittag losfahren. Aber ich müßte trotzdem so um vier oder halb fünf dasein.«
Um vier hatte Maggie angerufen. »Nuala, ich hab’ dich schon vorher ein paarmal versucht zu erreichen, aber bei dir war besetzt. Ich packe jetzt grade mein Zeug zusammen und bin auf dem Weg zum Auto.«
»Macht nichts, solange du nur wegkommst.«
»Ich hoffe bloß, daß ich vor deinen Gästen ankomme, damit ich noch Zeit habe, mich umzuziehen.«
»Ach, das ist nicht so wichtig. Fahr nur vorsichtig, und ich schütte sie mit Cocktails zu, bis du da bist.«
»Einverstanden. Ich mach mich auf die Socken.«
Als sie jetzt an das Gespräch zurückdachte, lächelte Nuala. Es wäre furchtbar gewesen, wenn Maggie noch um einen weiteren Tag aufgehalten worden wäre. Mittlerweile müßte sie wohl in der Gegend von Bridgeport sein, überlegte sie. Vermutlich gerät sie in etwas Berufsverkehr, aber zumindest ist sie schon mal unterwegs. Lieber Gott, Maggie ist unterwegs zu mir.
Da es für den Augenblick nichts weiter für sie zu tun gab, beschloß Nuala sich hinzusetzen und die frühen Abendnachrichten anzuschauen. Das ließ ihr noch genügend Zeit für ein angenehm warmes, entspannendes Bad, bevor die Leute dann allmählich eintrafen.
Sie war gerade im Begriff, die Küche zu verlassen, als es an der Hintertür klopfte. Bevor sie zum Fenster hinausschauen konnte, um nachzusehen, wer es war, bewegte sich der Türgriff. Sie war zunächst verblüfft, doch als die Tür aufging und ihr Besucher eintrat, lächelte sie warm.
»Hallo du«, sagte sie. »Schön, dich zu sehen, aber du bist doch erst in ein paar Stunden fällig, also kannst du nicht lange bleiben.«
»Ich hab’ nicht vor, lange zu bleiben«, sagte ihr Besucher ruhig.
4
Nachdem seine Mutter nach Florida gezogen war und das Haus verkauft hatte, das einst das Hochzeitsgeschenk des alten Squire für Liams Großmutter gewesen war, hatte sich Liam Moore Payne eine Eigentumswohnung an der Willow Street erstanden. Er benützte sie regelmäßig im Sommer, kam aber auch noch häufig, nachdem sein Segelboot am Ende der Saison stillgelegt worden war, am Wochenende von Boston her, um der hektischen Welt internationaler Finanzen zu entfliehen.
Die Wohnung, ein geräumiges Vier-Zimmer-Apartment mit hohen Zimmerdecken und einer Terrasse mit Blick auf die Narragansett Bay, war mit den schönsten Gegenständen aus dem alten Familiensitz ausstaffiert. Als sie damals umzog, hatte seine Mutter erklärt: »Diese Sachen taugen nicht für Florida, und ich hab’ mir sowieso nie was aus dem ganzen Zeug gemacht. Nimm du’s nur. Du bist wie dein Vater. Du liebst diesen schweren alten Kram.«
Als Liam aus der Dusche trat und nach einem Badehandtuch griff, dachte er an seinen Vater. War er ihm tatsächlich so ähnlich? Sein Vater war nach seiner Heimkehr von einem Tag des Handelns auf einem ständiger Veränderung unterworfenen Markt immer direkt zu der Bar im Arbeitszimmer gegangen und hatte sich einen sehr trockenen, sehr kalten Martini zubereitet. Er pflegte ihn langsam zu genießen und dann, sichtlich entspannt, nach oben zu gehen, um ein Bad zu nehmen und sich für den Abend umzuziehen.
Liam trocknete sich kräftig ab und lächelte ein wenig bei dem Gedanken, daß er und sein Vater sich sehr ähnlich waren, obwohl sie sich im Detail voneinander unterschieden. Die schon fast zelebrierten ausgiebigen Bäder seines Vaters hätten Liam verrückt gemacht; er bevorzugte eine kräftigende Dusche. Er hatte seinen Martini auch lieber, nachdem er geduscht hatte, nicht vorher.
Zehn Minuten später stand Liam an der Bar in seinem Arbeitszimmer und schenkte sorgfältig Finlandia-Wodka in einen gekühlten, mit Eisstücken gefüllten Silberpokal ein und rührte um. Nachdem er den Drink dann in ein feines Stengelglas abgegossen hatte, träufelte er einen oder zwei Tropfen Olivensaft auf die Oberfläche, zögerte kurz und nahm mit einem anerkennenden Seufzer den ersten Schluck. »Amen«, sagte er laut.
Es war zehn vor acht. Er wurde in zehn Minuten bei Nuala erwartet, und obwohl die Fahrt dorthin mindestens neun Minuten dauern würde, war es ihm nicht weiter wichtig, auf die Minute pünktlich zu sein. Jeder, der Nuala kannte, wußte, daß ihre Cocktailstunde gut und gerne bis neun und manchmal auch noch länger dauerte.
Liam beschloß, sich ein wenig Zeit zum Abschalten zu gönnen. Er ließ sich auf das schöne, mit dunkelbraunem marokkanischem Leder bezogene Sofa fallen und legte seine Füße sorgsam auf einen alten Couchtisch, der in seiner Form einem Stapel uralter Hauptbücher glich.
Er schloß die Augen. Es war eine lange, anstrengende Woche gewesen, aber das Wochenende versprach interessant zu werden.
Maggies Gesicht tauchte vor seinem inneren Auge auf. Es war ein bemerkenswerter Zufall, daß sie tatsächlich zu Newport eine Verbindung hatte, eine ausgesprochen enge Verbindung, wie es sich erwies. Er war erstaunt gewesen, als er von ihrer Beziehung zu Nuala erfahren hatte.
Er dachte daran, wie aufgeregt er gewesen war, als er merkte, daß Maggie die Party im Four Seasons verlassen hatte, ohne ihm Bescheid zu sagen. Da er wütend auf sich selbst war, weil er sie so gründlich vernachlässigt hatte, setzte er dann alles daran, sie zu finden und die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Als seine Nachforschungen ergaben, daß Maggie gesehen worden war, wie sie vor dem Essen mit Nuala wegging, war ihm die Eingebung gekommen, die beiden könnten im Il Tinello sein. Für eine junge Frau hatte Maggie ziemlich feste Gewohnheiten.
Maggie. Er malte sie sich für einen Moment aus, ihr schönes Gesicht, die Intelligenz und die Energie, die sie ausstrahlte.
Liam trank seinen Martini aus und rappelte sich mit einem Seufzer aus seiner bequemen Lage hoch. Zeit, sich auf den Weg zu machen, dachte er. Er überprüfte sein Aussehen in dem Spiegel am Eingang und fand, daß die rot-blaue Hermès-Krawatte, die ihm seine Mutter zum Geburtstag geschickt hatte, nicht schlecht zu seinem marineblauen Blazer paßte, obwohl eine traditionell gestreifte wohl noch besser gewesen wäre. Mit einem Achselzucken entschied er sich, der Sache keine Bedeutung beizumessen; es war wirklich Zeit, zu gehen.
Er nahm seinen Schlüsselbund an sich, und nachdem er die Tür abgeschlossen hatte, brach er auf zu Nualas Abendessen.
5
Earl Bateman lag mit einem Glas Wein in der Hand auf dem Sofa ausgestreckt da, das Buch, das er soeben ausgelesen hatte, auf dem Tisch neben ihm. Er wußte, daß es Zeit war, sich für Nualas Abendessen umzuziehen, aber er genoß ein Gefühl von Muße und nutzte den Moment aus, um sich die Ereignisse der vergangenen Woche noch einmal vor Augen zu führen.
Bevor er von Providence hergekommen war, hatte er noch die Arbeiten seiner Studenten im Einführungskurs Anthropologie 101 fertig korrigiert und mit Freude festgestellt, daß fast alle Studenten ausgezeichnete Noten erzielt hatten. Es würde ein interessantes – und vielleicht ein herausforderndes – Semester mit ihnen werden, dachte er sich.
Und nun konnte er sich auf Wochenenden in Newport freuen, die erfreulicherweise von diesen für die Sommersaison so typischen, die Restaurants belagernden und Verkehrstaus verursachenden Menschenmassen frei waren.
Earl wohnte in einem Gästeflügel des Familiensitzes Squire Hall, dem Haus, das Squire Moore für seine jüngste Tochter anläßlich ihrer Hochzeit mit Gordon Bateman gebaut hatte, dem ›Grabplünderer‹, wie Squire ihn genannt hatte, weil die Batemans schon seit vier Generationen als Direktoren von Bestattungsunternehmen fungierten.
Von allen Wohnsitzen, die er seinen sieben Kindern geschenkt hatte, war es bei weitem der kleinste, was den Umstand widerspiegelte, daß er gegen die Hochzeit gewesen war. Das war nicht persönlich gemeint, doch Squire hatte einen Horror vor dem Sterben und verbat sich sogar die bloße Erwähnung des Wortes ›Tod‹ in seiner Gegenwart. Den Mann in den Schoß der Familie aufzunehmen, der zweifellos die mit seinem eigenen Ableben verbundenen rituellen Handlungen dereinst beaufsichtigen würde, bedeutete, von nun an beständig an das verbotene Wort gemahnt zu werden.
Als Reaktion darauf hatte Gordon Bateman seine Frau überredet, ihr gemeinsames Heim Squire Hall zu nennen, als spöttischen Tribut an seinen Schwiegervater und als subtilen Hinweis, daß keines seiner übrigen Kinder auf die Idee gekommen war, ihn auf diese Weise zu ehren.
Earl war schon immer der Ansicht gewesen, daß sein Vorname ebenfalls eine gegen Squire gerichtete Spitze darstellte, da der alte Mann stets den Eindruck zu erwecken suchte, er sei nach Generationen von Moores getauft worden, die einst in der Grafschaft Dingle den Ehrentitel Squire trugen. Ein Squire von Dingle zupfte sich in Huldigung eines Earl an der Stirnlocke.
Nachdem Earl seinen Vater endlich davon überzeugt hatte, daß er nicht beabsichtigte, der nächste Bestattungsunternehmer Bateman zu werden, verkauften seine Eltern das Unternehmen an einen Privatkonzern, der daraufhin unter Beibehaltung des Familiennamens einen Geschäftsführer mit der Leitung beauftragte.
Seine Eltern verbrachten nun neun Monate des Jahres in South Carolina in der Nähe seiner verheirateten Schwestern und hatten Earl gedrängt, er möge doch während dieser Zeit das ganze Haus mit Beschlag belegen, doch er hatte dankend abgelehnt. Der Flügel war seinen Bedürfnissen angepaßt, mit seinen Büchern und Artefakten in abgeschlossenen Glasvitrinen, sicher verwahrt gegen womöglich sorgloses Abstauben. Zudem hatte er einen grandiosen Ausblick auf den Atlantik; Earl fand das Meer unendlich beruhigend.
Ruhe. Das war vielleicht das Wort, das er am höchsten schätzte.
Bei dem geräuschvollen New Yorker Zusammentreffen der Nachfahren Squire Moores hatte er sich soviel wie möglich im Hintergrund aufgehalten, wo er sie einfach alle beobachten konnte. Er versuchte nicht allzu kritisch zu sein, aber ihren »Na, kannst du das übertrumpfen?«-Geschichten schloß er sich nicht an. Seine Verwandten neigten offenbar alle dazu, damit anzugeben, wie weit sie es gebracht hatten, und wie Liam liebten sie es, einander mit weithergeholten Geschichten über ihren exzentrischen – und gelegentlich skrupellosen – Ahnherrn zu unterhalten.
Earl wußte auch, wie gern sich einige von ihnen über die Herkunft seines Vaters als Bestattungsunternehmer in vierter Generation lustig machten. Bei dem Familienfest hatte er zufällig mitbekommen, wie ihn zwei Leute dort heruntermachten und billige Witze über Leichenbestatter und ihre Branche rissen.
Soll sie doch alle der Teufel holen, dachte er jetzt, während er seine Beine auf den Boden schwang und sich aufsetzte. Es war zehn vor acht, Zeit, sich allmählich zu sputen. Er freute sich nicht darauf, heute abend zu Nualas Essen zu gehen, doch andererseits würde Maggie Holloway dasein. Sie war außerordentlich attraktiv...
Ja, ihre Anwesenheit würde dafür sorgen, daß es kein langweiliger Abend wurde.
6
Dr. William Lane, Direktor der Latham Manor Residence, blickte zum drittenmal innerhalb von fünf Minuten auf seine Uhr. Er und seine Frau sollten um acht Uhr in Nuala Moores Haus eintreffen; es war jetzt zehn vor acht. Dr. Lane war ein fülliger Mann in den Fünfzigern mit angehender Glatze, und er ging besänftigend und freundlich mit seinen Patienten um – auf eine nachsichtige Weise, die sich nicht auf seine neununddreißigjährige Ehefrau erstreckte.
»Odile«, rief er, »mein Gott noch mal, nun mach schon!«
»Bin gleich soweit.« Ihre musikalische Stimme flutete die Treppe ihres Hauses hinunter, eines Gebäudes, das einst als Remise des Latham Manor gedient hatte. Einen Augenblick später kam Odile ins Wohnzimmer gerauscht, wobei sie sich noch einen Ohrring festmachte.
»Ich hab’ Mrs. Patterson etwas vorgelesen«, erklärte sie. »Du weißt doch, wie das ist, William. Sie hat sich hier noch nicht eingelebt, und es regt sie wirklich auf, daß ihr Sohn einfach ihr Haus verkauft hat.«
»Sie gewöhnt sich schon noch ein«, sagte Lane abweisend. »Alle andern scheinen es doch auch geschafft zu haben, sich hier am Ende ziemlich wohl zu fühlen.«
»Ich weiß, aber manchmal dauert’s eben eine Weile. Ich finde jedenfalls ein paar Streicheleinheiten wichtig, solange sich ein neuer Gast einlebt.« Odile ging zum Spiegel über dem offenen Kamin aus gemeißeltem Marmor hinüber. »Wie seh ich aus?« Sie lächelte ihr Spiegelbild mit den großen Augen und den blonden Haaren an.
»Du siehst reizend aus. Tust du doch immer«, sagte Lane knapp. »Was weißt du über diese Stieftochter von Nuala?«
»Nuala hat mir alles über sie erzählt, als sie letzten Montag bei Greta Shipley zu Besuch war. Sie heißt Maggie, und Nuala war vor langer Zeit mit ihrem Vater verheiratet. Sie hat vor, zwei Wochen zu bleiben. Nuala freut sich anscheinend riesig darüber. Findest du das nicht köstlich, daß die beiden sich wieder begegnet sind?«
Ohne zu antworten, machte Dr. Lane die Haustür auf und stellte sich dann daneben. Du bist aber toll gelaunt, dachte Odile, als sie an ihm vorbei und die Stufen zum Wagen hinunter ging. Sie blieb eine Weile stehen und betrachtete das Latham Manor, dessen Marmorfassade im Mondlicht schimmerte.
Zögernd schlug sie vor: »Ich wollte dir eigentlich noch sagen, daß mir Mrs. Hammond, als ich nach ihr geschaut habe, etwas kurzatmig und ziemlich blaß vorkam. Ich frage mich, ob du nicht nach ihr sehen solltest, bevor wir gehen.«
»Wir sind schon jetzt spät dran«, erwiderte Dr. Lane ungeduldig und öffnete die Wagentür. »Falls ich gebraucht werde, kann ich in zehn Minuten zurück sein, aber ich kann dir versichern, daß es Mrs. Hammond heute abend gutgehen wird.«
7
Malcolm Norton freute sich nicht auf den Abend. Er war ein Mann mit silberweißen Haaren und einer militärisch aufrechten Haltung und gab eine imposante Erscheinung ab. Es war jedoch eine Erscheinung, hinter der sich ein beunruhigtes Gemüt verbarg.
Nualas Anruf vor drei Tagen, als sie ihn einlud, heute zum Abendessen zu kommen und ihre Stieftochter kennenzulernen, war ein Schock gewesen – nicht die Einladung zum Essen selbst, sondern die unerwartete Mitteilung, daß Nuala eine Stieftochter hatte.
Norton, der allein eine Anwaltskanzlei betrieb, hatte in den letzten paar Jahren miterleben müssen, wie die Zahl seiner Mandanten drastisch abnahm, zum Teil auf natürlichem Wege – er war nahezu zum Experten für die Verwaltung von Nachlässen geworden –, aber auch, da war er sich sicher, infolge des Neuzugangs mehrerer junger, zupackender Anwälte in der Region.
Nuala Moore war eine der wenigen, die aus seiner Klientel übriggeblieben waren, und er war eigentlich der Meinung, ihre Angelegenheiten in- und auswendig zu kennen. Kein einziges Mal hatte sie diese Stieftochter erwähnt.
Seit geraumer Zeit schon versuchte Malcolm Norton Nuala dazu zu bringen, ihr Haus zu verkaufen und ins Latham Manor zu ziehen. Bis vor kurzem hatte sie den Eindruck erweckt, als halte sie das für eine gute Idee. Sie räumte ein, daß sie sich seit dem Tod ihres Mannes Tim einsam in dem Haus fühlte, und außerdem fange es an, immer mehr an Reparaturen zu kosten. »Ich weiß, es braucht ein neues Dach, das Heizungssystem ist völlig veraltet, und irgend jemand, der es kaufen würde, will dann bestimmt noch eine Klimaanlage einbauen«, hatte sie zu ihm gesagt. »Glauben Sie, ich könnte zweihunderttausend dafür kriegen?«
Er hatte bedächtig reagiert und erklärt: »Nuala, der Immobilienmarkt hier kommt im September nach dem Labor Day praktisch zum Erliegen. Vielleicht könnten wir nächsten Sommer soviel dafür bekommen. Aber ich möchte, daß alles für Sie geregelt ist. Wenn Sie dazu bereit sind, jetzt ins Latham zu ziehen, dann nehme ich Ihnen das Haus zu diesem Preis ab und renoviere das, was nötig ist. Früher oder später bekomme ich mein Geld schon wieder zurück, und Sie haben keine Kosten mehr damit. Mit dem Versicherungsgeld von Tim und dem Erlös des Hauses könnten Sie sich den besten Komfort im Latham leisten, vielleicht sogar einen Raum in einer Wohnung dort in ein Atelier umwandeln.«
»Das fände ich schön. Ich werde mich dort anmelden«, hatte Nuala damals erklärt; dann hatte sie ihn auf die Wange geküßt. »Sie sind immer ein guter Freund gewesen, Malcolm.«
»Dann setze ich also den Vertrag auf. Sie treffen eine gute Entscheidung.«
Was Malcolm Nuala nicht hatte wissen lassen, war eine Information, die ihm ein Freund aus Washington gegeben hatte. Eine Eingabe zur Änderung der Umweltschutzgesetze werde mit Sicherheit durchkommen, was bedeutete, daß einige bis dato durch den Erlaß zur Erhaltung von Feuchtbiotopen geschützte Grundstücke von Baueinschränkungen befreit werden würden. Die gesamte rechte Seite von Nualas Grundstück war von dieser Nutzungsänderung betroffen. Den Teich trockenlegen, ein paar Bäume fällen, und der Blick aufs Meer wäre einfach sensationell, überlegte sich Malcolm. Betuchte Leute waren scharf auf diesen Ausblick. Sie würden eine Menge für das Grundstück bezahlen, dann vermutlich sogar das alte Haus abreißen und ein dreimal so großes mit Aussicht auf den Ozean errichten. Nach seiner Schätzung würde allein schon der Grund und Boden eine Million Dollar wert sein. Wenn alles wie geplant klappte, würde er in den nächsten ein, zwei Jahren einen Profit von achthunderttausend Dollar machen.
Dann war er endlich in der Lage, sein Leben neu in den Griff zu bekommen. Mit dem Gewinn, den er aus dem Verkauf des Grundstücks einstreichen konnte, würde er genügend Geld haben, um mit seiner Frau Janice eine Scheidungsvereinbarung zu treffen, seine Kanzlei aufzugeben und mit Barbara nach Florida zu ziehen.
Wie sich doch sein Leben verändert hatte, seit Barbara als Anwaltsgehilfin für ihn zu arbeiten begonnen hatte! Sie war sieben Jahre jünger als er und eine ausgesprochen hübsche Witwe von sechsundfünfzig. Ihre Kinder waren erwachsen und in alle vier Winde verstreut, und sie hatte die Stelle in seiner Kanzlei angenommen, um eine Beschäftigung zu haben. Es hatte jedoch nicht lang gedauert, bis die Anziehungskraft, die sie beide aufeinander ausübten, deutlich fühlbar wurde. Barbara besaß all die Wärme, die ihm Janice nie geboten hatte.
Aber sie gehörte nicht zu den Frauen, die sich auf eine Affäre im Büro einließen – soviel hatte sie klargestellt. Wenn er sie haben wolle, dann müsse er schon als freier Mann zu ihr kommen. Und das einzige, was dazu nötig war, war Geld, sagte er sich. Dann...
»Also, bist du soweit?«
Malcolm blickte auf. Seine ihm seit fünfunddreißig Jahren angetraute Frau stand mit verschränkten Armen vor ihm.
»Wenn du’s bist«, sagte er.
Er war erst spät nach Hause gekommen und direkt in sein Schlafzimmer verschwunden. Es war das erste Mal seit dem Vormittag, daß er Janice zu Gesicht bekam. »Wie war dein Tag heute?« fragte er höflich.
»Wie sind meine Tage denn sonst immer?« sagte sie scharf. »Als Buchhalterin in einem Altersheim? Aber wenigstens bringt einer von uns ein regelmäßiges Gehalt nach Hause.«
8
Um 19 Uhr 50 erhob sich Neil Stephens, Generaldirektor der Carson & Parker Investment Corporation, und streckte sich. Bis auf die Reinigungsmannschaft, die er irgendwo im Korridor staubsaugen hören konnte, war er hier im World Trade Center Nummer 2 der letzte, der noch im Büro war.
Als leitender Geschäftsführer des Unternehmens hatte er ein geräumiges Eckbüro, das ihm eine mitreißende Aussicht auf Manhattan bot, einen Blick, den er bedauerlicherweise selten genießen konnte. Heute war dazu besonders wenig Zeit gewesen.
Das Börsengeschäft war in den letzten paar Tagen extrem sprunghaft, und einige der Wertpapiere, die bei C & P als ›höchst empfehlenswert‹ geführt wurden, hatten enttäuschende Resultate erzielt. Die Anlagen waren alle solide, zumeist sogar erstklassig, und ein vorübergehender Wertverlust war nicht eigentlich problematisch. Sehr wohl ein Problem aber war, daß dann zu viele der kleineren Anleger auf einen Verkauf drängten, weshalb Stephens und seinen Mitarbeitern die Aufgabe zufiel, diese Kunden zur Geduld zu bewegen.
Nun, genug für heute, dachte Neil. Es wird Zeit, daß ich hier wegkomme. Er schaute sich nach seinem Jackett um und entdeckte es auf einem der Sessel im ›Gesprächsbereich‹, einem Arrangement bequemer Möbel, die dem Zimmer laut der Aussage des zuständigen Innenarchitekten eine ›kundenfreundliche Atmosphäre‹ verliehen.
Er verzog das Gesicht, als er bemerkte, wie zerknautscht sein Jackett aussah, schüttelte es aus und schob seine Arme hinein. Neil war ein kräftiger Mann, der es mit seinen siebenunddreißig Jahren dank eines Programms diziplinierter körperlicher Bewegung, einschließlich Squash an zwei Abenden pro Woche, schaffte, seine Muskulatur vor der langsamen Verfettung zu bewahren. Die Resultate seiner Anstrengungen waren deutlich sichtbar, und er war ein auffallend anziehender Mann mit durchdringenden braunen Augen, die Intelligenz verrieten, und einem ungezwungenen Lächeln, das Vertrauen hervorrief. Und dieses Vertrauen war in der Tat wohlbegründet, denn wie seine Kollegen und Freunde wußten, entging Neil Stephens nur äußerst selten etwas.
Er strich über die Ärmel seines Jacketts und dachte daran, daß Trish, seine Assistentin, es zwar morgens aufgehängt, später aber betont ignoriert hatte, als er es nach der Lunchpause wieder einmal zur Seite geworfen hatte.
»Die anderen werden sauer auf mich, wenn ich Sie zuviel bediene«, hatte sie erklärt. »Außerdem räum ich genug hinter meinem Mann her. Wieviel kann eine Frau ertragen?«
Neil lächelte bei der Erinnerung daran, doch dann schwand das Lächeln, als ihm einfiel, daß er vergessen hatte, Maggie anzurufen und nach ihrer Telefonnummer in Newport zu fragen. Erst am Morgen hatte er beschlossen, nächstes Wochenende zum Geburtstag seiner Mutter nach Portsmouth zu fahren; das bedeutete, daß er dann nur Minuten von Newport entfernt sein würde. Maggie hatte ihm gesagt, sie werde dort zwei Wochen bei ihrer Stiefmutter verbringen. Er hatte angenommen, daß sie sich dort treffen konnten.
Er und Maggie waren seit Anfang des Frühjahrs des öfteren zusammen ausgegangen, nachdem sie sich in einem Bagel-Laden an der Second Avenue begegnet waren, um die Ecke von ihren Wohnungen an der Sechsundfünfzigsten Straße Ost. Sie hatten angefangen miteinander zu plaudern, wann immer sie sich dort über den Weg liefen; dann begegneten sie sich eines Abends ganz zufällig im Kino. Sie setzten sich nebeneinander und spazierten anschließend zu Neary’s Pub hinüber zum Abendessen.
Zu Anfang gefiel es Neil, daß Maggie die Verabredungen offenbar genausowenig ernst nahm wie er selbst. Es gab kein Anzeichen dafür, daß sie in ihm mehr sah als einen guten Bekannten, mit dem sie gern ins Kino ging. Sie schien genauso intensiv beruflich engagiert zu sein wie er selbst.
Nach sechs Monaten gelegentlicher Verabredungen jedoch begann Neil sich zu ärgern, daß Maggie auch weiterhin uninteressiert an ihm schien. Ohne überhaupt zu merken, wie ihm geschah, war es ihm immer wichtiger geworden, sie zu sehen und soviel wie möglich über sie in Erfahrung zu bringen. Er wußte, daß sie fünf Jahre zuvor ihren Mann verloren hatte, eine Tatsache, die sie so nüchtern erwähnte, daß ihr Tonfall nahelegte, sie habe das emotional ganz verarbeitet. Allmählich aber begann er sich zu fragen, ob sie vielleicht einen festen Freund hatte. Begann er sich zu fragen und sich deswegen Sorgen zu machen.
Nach einer Weile des Grübelns beschloß Neil zu probieren, ob Maggie vielleicht ihre Newporter Nummer auf ihrem Anrufbeantworter hinterlassen hatte. Wieder an seinem Schreibtisch angelangt, lauschte er ihrer Ansage auf dem Band: »Hallo, hier ist Maggie Holloway. Danke für den Anruf. Ich bin bis dreizehnten Oktober verreist.« Der Apparat stellte sich mit einem Klick ab. Offenbar war sie nicht daran interessiert, irgendwelche Nachrichten zu erhalten.
Na, großartig, dachte er mürrisch, als er den Hörer auflegte und zum Fenster hinüberschritt. Vor ihm dehnte sich das Lichtermeer von Manhattan aus. Er betrachtete die Brücken über den East River und erinnerte sich an Maggies Reaktion darauf, als er ihr gesagt hatte, sein Büro sei im einundvierzigsten Stock des World Trade Center: Sie hatte ihm davon erzählt, wie sie zum erstenmal für einen Cocktail im Window on the World oben auf der Spitze des Gebäudes gewesen war. »Die Abenddämmerung setzte gerade ein. Die Lichter auf den Brücken gingen an, und dann fingen all die Lichter an den Gebäuden und auf den Straßen an zu leuchten. Es war, als schaute man einer adligen Dame zu Viktorianischer Zeit zu, wie sie ihren Schmuck anlegt – Halskette, Armbänder, Ringe, sogar ein Diadem.«
Das anschauliche Bild war Neil im Gedächtnis haften geblieben.
Er hatte auch noch ein anderes Bild von Maggie im Sinn, das ihn jedoch beunruhigte. Drei Wochen zuvor, an einem Samstag, war er spontan ins Cinema I gegangen, um sich den dreißig Jahre alten französischen Klassiker Ein Mann und eine Frau anzusehen. Das Kino war nicht besonders voll, und irgendwann mitten während des Films hatte er entdeckt, daß ein paar Reihen vor ihm, vier Sitze weiter weg, Maggie alleine dasaß. Er hatte sich gerade zu ihr setzen wollen, als er merkte, daß sie weinte. Stille Tränen liefen ihr über die Wangen, und sie hielt sich die Hand vor den Mund, um ein Schluchzen zu unterdrücken, während sie der Geschichte einer jungen Witwe folgte, die den Tod ihres Mannes nicht zu akzeptieren vermochte.
Er war während des Abspanns hinausgeeilt, weil er ihr die Verlegenheit ersparen wollte, in einem Moment solcher Verletzlichkeit ertappt zu werden.
Titel der Originalausgabe MOONLIGHT BECOMES YOU erschien im Verlag Simon & Schuster, New York
16. Auflage
Copyright © 1996 by Mary Higgins Clark
Copyright © 1997 der deutschen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlagillustration: Iris Kaczmarczyk/fr online Umschlaggestaltung: Martina Eisele, München Satz: Leingärtner, Nabburg
elSBN 978-3-641-10063-6
www.heyne.de
www.randomhouse.de
Leseprobe