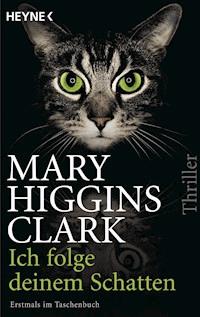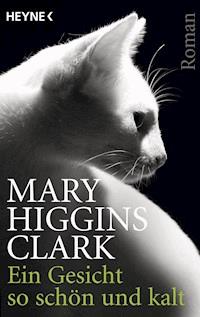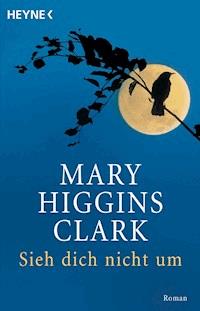2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wenn die Toten auferstehen
Zehn Jahre ist es her, dass Carolyns Bruder von einem Tag auf den anderen spurlos verschwand. Um der quälenden Ungewissheit über sein Schicksal endlich ein Ende zu bereiten, beginnt Carolyn zu recherchieren. Sie stößt auf ein fürchterliches Verbrechen in der Vergangenheit – und auf einen Täter, dem sie bereits viel zu nahe gekommen ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Zum Andenken an Patricia Mary Riker,»Pat«, liebe Freundin und wundervolle Frau
Wo bist du jetzt,Wer erlag deinem Zauber?
»THE KASHMIRI SONG« (TEXT VON LAURENCE HOPE; MUSIK VON AMY WOODFORDE-FINDEN)
1
Es ist Punkt Mitternacht, und das bedeutet, dass Muttertag soeben begonnen hat. Ich übernachte heute in der Wohnung meiner Mutter in Sutton Place, wo ich aufgewachsen bin. Meine Mutter liegt in ihrem Schlafzimmer am anderen Ende des Flurs. Beide halten wir Wache am Telefon und warten, so wie jedes Jahr, seit mein Bruder Charles MacKenzie jr., genannt »Mack«, vor zehn Jahren aus der Wohnung verschwand, die er mit zwei anderen Studenten der Columbia University teilte. Seitdem hat ihn niemand mehr gesehen. Doch jedes Jahr an Muttertag ruft er irgendwann an, um Mom zu versichern, dass es ihm gut geht. »Mach dir keine Sorgen um mich«, sagt er zu ihr. »Eines Tages werde ich den Schlüssel ins Schloss stecken und wieder da sein.« Danach legt er auf.
Wir wissen nicht, wann Mack in diesen vierundzwanzig Stunden anrufen wird. Letztes Jahr rief er ein paar Minuten nach Mitternacht an, und das Warten fand bereits ein Ende, bevor es richtig begonnen hatte. Vor zwei Jahren kam sein Anruf buchstäblich in letzter Sekunde, und Mom war schon in größter Verzweiflung, dass die einzig verbliebene Verbindung endgültig unterbrochen sein könnte.
Mack muss davon erfahren haben, dass mein Vater beim Anschlag auf die Twin Towers ums Leben kam. Eigentlich war ich mir sicher: Was auch immer mit ihm los war, dieser schreckliche Tag würde ihn dazu bewegen, nach Hause zu kommen. Doch dem war nicht so. Und als er am darauffolgenden Muttertag wieder anrief, stammelte er mit tränenerstickter Stimme: »Es tut mir leid wegen Dad. Es tut mir wirklich leid«, dann unterbrach er die Verbindung.
Mein Name ist Carolyn. Ich war sechzehn, als Mack aus unserem Leben verschwand. In seine Fußstapfen tretend, schrieb ich mich an der Columbia University ein. Nach dem Collegeabschluss habe ich dann gewechselt und bin zum Jurastudium an die Duke University gegangen. Mack war gerade erst dort aufgenommen worden, als er verschwand. Im letzten Jahr habe ich mein Studium abgeschlossen, und danach habe ich als Assistentin für einen Richter am Zivilgericht in der Centre Street im unteren Manhattan gearbeitet. Richter Paul Huot ist gerade in Pension gegangen, daher bin ich im Augenblick arbeitslos. Ich habe vor, mich um eine Stelle als Assistentin bei der Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan zu bewerben, aber damit lasse ich mir noch etwas Zeit.
Zunächst muss ich einen Weg finden, meinen Bruder aufzuspüren. Was ist mit ihm passiert? Warum ist er verschwunden? Es gab keine Anzeichen für ein Verbrechen. Macks Kreditkarten wurden nicht benutzt. Sein Wagen stand in der Garage in der Nähe seiner Wohnung. Niemand, auf den seine Beschreibung passte, landete im Leichenschauhaus, obwohl meine Eltern in der ersten Zeit hin und wieder aufgefordert wurden, sich den Leichnam irgendeines nicht identifizierten jungen Mannes anzuschauen, der aus dem Fluss gefischt worden oder bei einem Unfall ums Leben gekommen war.
In meiner Kindheit war Mack mein bester Freund, mein Vertrauter, mein Kumpel. Die Hälfte meiner Freundinnen verliebte sich in ihn. Er war der perfekte Sohn, der perfekte Bruder, gut aussehend, freundlich, witzig, ein hervorragender Student. Was ich heute für ihn empfinde? Ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere mich, wie sehr ich ihn geliebt habe, doch diese Liebe hat sich fast vollständig in Zorn und Groll verwandelt. Am liebsten würde ich glauben, er sei nicht mehr am Leben und jemand erlaube sich einen grausamen Scherz, aber es besteht kein Zweifel, dass er noch lebt. Vor Jahren haben wir einen seiner Anrufe aufgenommen und die Merkmale seiner Stimme mit Stimmproben aus alten Familienvideos abgleichen lassen. Sie waren identisch.
Das alles bedeutet, dass Mom und ich in einem Zustand ständiger Unsicherheit über sein Schicksal ausharren, und bevor Dad im brennenden Inferno des 11. September umkam, galt dasselbe auch für ihn. In all diesen Jahren konnte ich nie in ein Restaurant oder in ein Theater gehen, ohne dass ich mit dem Blick alles absuchte in der Hoffnung, durch einen Zufall auf ihn zu stoßen. Sobald jemand ein ähnliches Profil und rötlich braune Haare hat, schaue ich genauer hin, und manchmal muss ich den Betreffenden dann aus der Nähe betrachten. Ich erinnere mich, dass ich mehr als einmal beinahe Leute umgestoßen habe, um in die Nähe eines Mannes zu gelangen, der sich dann als völlig Unbekannter entpuppte.
All das ging mir durch den Kopf, als ich die Lautstärke des Telefons auf die höchste Stufe stellte, mich ins Bett legte und versuchte, ein bisschen zu schlafen. Ich vermute, dass ich tatsächlich in einen unruhigen Schlummer gesunken war, denn beim dröhnenden Aufjaulen des Telefons fuhr ich hoch und saß kerzengerade im Bett. Auf dem beleuchteten Zifferblatt sah ich, dass es fünf vor drei war. Mit einer Hand knipste ich die Nachttischlampe an, mit der anderen griff ich nach dem Hörer. Mom hatte bereits abgehoben, und ich vernahm ihre Stimme, atemlos und angespannt: »Hallo, Mack.«
»Hallo, Mom. Alles Gute zum Muttertag. Ich hab dich lieb.«
Seine Stimme klang kraftvoll und zuversichtlich. Es hört sich so an, als ob er nicht die geringsten Sorgen hätte, dachte ich bitter.
Wie immer, wenn sie seine Stimme vernahm, brach Mom in Tränen aus. »Mack, du fehlst mir so. Ich muss dich sehen«, flehte sie. »Es ist mir egal, in was für Schwierigkeiten du steckst, welche Probleme du hast, ich werde dir helfen, da rauszukommen. Mack, um Gottes willen, es sind jetzt zehn Jahre vergangen. Bitte tu mir das nicht noch länger an. Bitte … bitte …«
Sein Anruf dauerte nie viel länger als eine Minute. Sicherlich war er sich bewusst, dass wir versuchen würden, den Ort, von dem er anrief, herauszufinden. Doch seitdem es diese Handys mit Prepaid-Karte gibt, benutzt er immer ein solches Gerät für seine Anrufe.
Ich hatte mir im Voraus überlegt, was ich ihm sagen wollte, und schaltete mich jetzt hastig ein, bevor er auflegte. »Mack, ich werde dich finden«, sagte ich. »Die Polizei hat das nicht geschafft, und der Privatdetektiv auch nicht. Aber ich werde es schaffen, das schwöre ich dir.« Ich hatte das in ruhigem und bestimmtem Ton gesagt, doch das Schluchzen meiner Mutter brachte mich aus der Fassung. »Ich werde dich finden, du mieser Kerl«, platzte ich heraus, »und ich kann nur für dich hoffen, dass du einen guten Grund hast, uns so hundsgemein zu quälen.«
Ich hörte ein Knacken und wusste, dass er die Leitung unterbrochen hatte. Ich hätte mir die Zunge abbeißen mögen, um meine harschen Worte zurückzunehmen, doch natürlich war es dafür zu spät.
Ich wusste, dass Mom wütend auf mich sein würde, weil ich Mack angeschrien hatte, dennoch streifte ich einen Morgenmantel über und ging den Flur hinunter zu der Zimmerflucht, die sie früher mit Dad geteilt hatte.
Sutton Place ist eine gehobene Wohngegend in Manhattan, bestehend aus Stadthäusern und Wohngebäuden, die auf den East River hinausgehen. Mein Vater hat diese Wohnung gekauft, nachdem er in den Abendstunden ein Jurastudium an der Fordham Law School absolviert und sich anschließend bis zum Teilhaber einer Anwaltssozietät hochgearbeitet hatte. Unsere wohlbehütete Kindheit war das Ergebnis seines klugen Verstands und der strengen Arbeitsmoral, die ihm von seiner schottisch-irischen Mutter eingeimpft worden war. Niemals ließ er zu, dass auch nur ein Groschen des Geldes, das meine Mutter geerbt hatte, in unserem Leben eine Rolle spielte.
Ich klopfte an die Tür und öffnete sie. Sie stand am Panoramafenster, von dem der Blick über den East River ging. Sie drehte sich nicht um, obwohl sie wusste, dass ich in der Tür stand. Es war eine klare Nacht, und auf der linken Seite sah ich die Lichter der Queensboro Bridge. Selbst zu dieser nachtschlafenden Zeit floss ein ununterbrochener Verkehrsstrom in beiden Richtungen über die Brücke. Kurz ging mir der merkwürdige Gedanke durch den Kopf, dass Mack in einem dieser Autos sitzen könnte und jetzt, nachdem er seinen jährlichen Anruf hinter sich gebracht hatte, zu irgendeinem entfernten Ziel unterwegs war.
Mack hat schon immer gerne Reisen unternommen; es lag ihm im Blut. Der Vater meiner Mutter, Liam O’Connell, wurde in Dublin geboren, studierte am Trinity College und wanderte in die Vereinigten Staaten aus, klug, gebildet, doch mittellos. Nach weniger als fünf Jahren war er so weit, dass er Kartoffeläcker auf Long Island kaufte, in dem Gebiet, das später zu den Hamptons wurde, dazu Grundstücke in Palm Beach County und an der Third Avenue, als diese noch eine schmutzige, dunkle Straße war, die im Schatten der darüber verlaufenden Hochbahntrasse lag. Damals warb er erfolgreich um meine Großmutter und heiratete sie, jenes englische Mädchen, das er am Trinity College kennengelernt hatte.
Meine Mutter Olivia ist eine echte englische Schönheit, groß gewachsen, mit zweiundsechzig immer noch rank und schlank, mit silbergrauen Haaren, blaugrauen Augen und ebenmäßigen Gesichtszügen. Mack war ihr wie aus dem Gesicht geschnitten.
Ich habe die rotbraunen Haare, die braunen Augen und das kräftige Kinn meines Vaters geerbt. Wenn meine Mutter Absätze trug, war sie sogar eine Spur größer als mein Vater, und genau wie er bin ich nur von durchschnittlichem Wuchs. Eine plötzliche Sehnsucht nach ihm überfiel mich, als ich jetzt auf meine Mutter zuging und ihr einen Arm um die Schultern legte.
Sie wirbelte herum, und ich spürte geradezu körperlich den Zorn, der von ihr ausging. »Carolyn, wie konntest du nur so mit Mack reden?«, fuhr sie mich an, die Arme fest vor der Brust verschränkt. »Begreifst du denn nicht, dass es irgendein schreckliches Problem geben muss, das ihn davon abhält, zurückzukommen? Begreifst du nicht, dass er in irgendeiner hilflosen Lage sein muss und dass dieser Anruf eine einzige Bitte um Verständnis ist?«
Als mein Vater noch lebte, hatte es oft ähnlich aufgewühlte Gespräche zwischen ihnen gegeben. Mom, die Mack stets in Schutz nahm, mein Vater, der irgendwann so weit war, dass er die ganze Sache abhaken und aufhören wollte, sich Sorgen zu machen. »Herrgott noch mal, Liv«, konnte er sich dann ereifern, »schließlich klingt es ganz so, als ob es ihm gut geht. Vielleicht hat er sich mit irgendeiner Frau eingelassen, von der wir nichts wissen sollen. Vielleicht versucht er, Schauspieler zu werden. Das wollte er doch immer, als er noch ein Kind war. Womöglich war ich auch zu hart zu ihm, weil er immer diese Sommerjobs machen musste. Wer weiß das schon?«
Es endete immer damit, dass sie einander um Verzeihung baten, Mom in Tränen aufgelöst, Dad zerknirscht und wütend auf sich, weil er sie in einen solchen Zustand versetzt hatte.
Ich wollte nicht noch den zusätzlichen Fehler begehen und versuchen, mich zu rechtfertigen. Stattdessen sagte ich: »Hör zu, Mom. Da wir Mack bis heute nicht gefunden haben, wird ihn meine Drohung auch nicht besonders kümmern. Sieh es einmal so. Er hat sich bei dir gemeldet. Du weißt, dass er am Leben ist. Er klingt geradezu munter. Ich weiß, dass du Schlaftabletten hasst, aber ich weiß auch, dass dir dein Arzt welche verschrieben hat. Am besten nimmst du jetzt eine davon und versuchst, ein bisschen zu schlafen.«
Ich wartete nicht auf eine Antwort. Es war besser, wenn ich nicht noch länger bei ihr blieb, denn auch ich spürte eine gehörige Portion Wut in mir. Wut auf sie, weil sie mich so beschimpft hatte, Wut auf Mack, Wut darüber, dass diese zweistöckige Zehnzimmerwohnung zu groß für Mom allein war, außerdem zu sehr angefüllt mit Erinnerungen. Sie will sie nicht verkaufen, weil sie sich nicht darauf verlassen will, dass Macks jährlicher Anruf an eine neue Adresse weitergeleitet wird, und natürlich erinnert sie mich jedes Mal daran, dass er versprochen hatte, eines Tages würde er den Schlüssel ins Schloss stecken und wieder zu Hause sein … Zu Hause. Hier.
Ich schlüpfte wieder in mein Bett, doch an Schlaf war zunächst nicht zu denken. Ich überlegte, wie ich die Suche nach Mack angehen sollte. Ich fasste den Gedanken ins Auge, Lucas Reeves aufzusuchen, den Privatdetektiv, den Dad engagiert hatte, verwarf ihn jedoch bald wieder. Ich wollte Macks Verschwinden so handhaben, als ob es erst gestern passiert sei. Als sich Dad damals ernsthafte Sorgen um Mack zu machen begann, hatte er als Erstes die Polizei angerufen und seinen Sohn als vermisst gemeldet. Ich nahm mir vor, ganz von vorn anzufangen.
Ich kannte Leute, die in dem Gerichtsgebäude arbeiteten, in dem auch das Büro des Bezirksstaatsanwalts untergebracht war. Ich beschloss, meine Suche dort zu beginnen.
Schließlich fand ich doch noch in den Schlaf und träumte, dass ich eine schattenhafte Gestalt verfolgte, die über eine Brücke lief. Obwohl ich mich bemühte, sie nicht außer Sichtweite geraten zu lassen, war sie zu schnell für mich, und als ich die andere Seite erreichte, wusste ich nicht, in welche Richtung ich mich wenden sollte. Doch dann hörte ich ihn rufen, seine Stimme klang bekümmert, fast klagend. Du sollst mich nicht verfolgen, Carolyn, bleib da, bleib da.
»Ich kann nicht, Mack«, sagte ich laut und wachte auf. »Ich kann nicht.«
2
Monsignore Devon MacKenzie pflegte Besuchern gegenüber die wehmütige Bemerkung fallen zu lassen, seine geliebte St.-Francis-de-Sales-Kirche befände sich so nahe bei der Kathedrale St. John the Devine, dass sie fast unsichtbar sei.
Vor knapp zehn Jahren hatte er noch damit gerechnet, dass irgendwann der Beschluss fiele, St. Francis zu schließen, und dagegen hätte er sich, wenn er aufrichtig sein wollte, kaum stemmen können. Schließlich stammte sie noch aus dem neunzehnten Jahrhundert, und es standen größere Restaurierungsarbeiten an. Doch dann, als neue Wohnblöcke in der Gegend errichtet und ältere renoviert wurden, durfte er mit Genugtuung erleben, dass nach und nach neue Gesichter bei der sonntäglichen Messe auftauchten.
Das Anwachsen der Gemeinde versetzte ihn in den vergangenen fünf Jahren in die Lage, einige dieser Reparaturarbeiten durchführen zu lassen. Die farbigen Glasfenster wurden gereinigt; die Wandgemälde von den über die Jahre angesammelten Schmutzablagerungen befreit; die Kirchenstühle abgeschliffen und neu gestrichen, die Kniebänke mit einem neuen weichen Bezug versehen.
Als dann Papst Benedikt den Erlass herausgab, wonach es im Ermessen des einzelnen Pfarrers lag, auch tridentinische Messen zu halten, gab Devon, der über sehr gute Lateinkenntnisse verfügte, bekannt, dass künftig die Elfuhrmesse in der altüberkommenen Sprache der Kirche zelebriert werden würde.
Das Echo war erstaunlich. Die Messe war jetzt immer gut besucht, teils sogar überfüllt, nicht nur mit älteren Gläubigen, sondern auch mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die ehrerbietig mit »Deo gratias« anstelle von »Dank sei Gott« antworteten und »Pater noster« statt »Vater unser« beteten.
Devon war achtundsechzig, zwei Jahre jünger als sein Bruder, den er am 11. September verloren hatte, und er war Onkel und Pate jenes Neffen, der verschwunden war. Wenn er bei der Messe die Gemeinde zum stillen Gebet aufforderte, galt seine erste Fürbitte immer Mack und dass er eines Tages zurückkommen möge.
An Muttertag war dieses stille Gebet immer besonders inbrünstig, und so war es auch heute gewesen. Als er nach der Messe ins Pfarrhaus zurückkehrte, fand er auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht von Carolyn vor. »Onkel Dev – er hat heute um drei Uhr in der Früh angerufen. Scheint ihm gut zu gehen. Hat ziemlich bald wieder aufgelegt. Wir sehen uns heute Abend.«
Monsignore Devon bemerkte die Anspannung in der Stimme seiner Nichte. Die Erleichterung darüber, dass sein Neffe angerufen hatte, mischte sich mit hellem Zorn. Zum Teufel, Mack, kannst du dir eigentlich vorstellen, was du uns antust? Devon löste sein Kollar und griff zum Telefon, um Carolyn zurückzurufen. Noch bevor er die Nummer eingeben konnte, klingelte es an der Haustür.
Es war sein Freund aus Kindertagen, Frank Lennon, ein pensionierter Softwaremanager, der an den Sonntagen als Gottesdiensthelfer fungierte und die Kollekte zählte, in das Buch eintrug und einzahlte.
Devon hatte langjährige Übung darin, aus den Gesichtern der Menschen zu lesen und sofort zu wissen, wenn es ein wirkliches Problem gab. Genau das las er in Lennons von zahlreichen Falten durchzogenem Gesicht. »Was ist los, Frank?«, fragte er.
»Mack war in der Elfuhrmesse, Dev«, antwortete Lennon. »Er hat eine Nachricht für dich im Körbchen hinterlassen. Sie war in einen Zwanzigdollarschein eingewickelt.«
Monsignore Devon MacKenzie nahm den Zettel entgegen, las die zehn Worte, die darauf gedruckt waren, las sie ein zweites Mal, weil er seinen Augen kaum trauen mochte. »ONKEL DEVON, SAG CAROLYN, SIE SOLL NICHT NACH MIR SUCHEN.«
3
Seit nunmehr neun Jahren fuhr Aaron Klein jedes Jahr die lange Strecke von Manhattan zum Friedhof von Bridgehampton, um einen Stein auf das Grab seiner Mutter Esther Klein zu legen. Sie war eine vierundfünfzigjährige geschiedene und lebenslustige Frau gewesen, die eines Morgens auf ihrer täglichen Joggingrunde in der Nähe der Kathedrale St. John the Divine das Opfer eines Raubmörders geworden war.
Aaron war damals achtundzwanzig und frisch verheiratet gewesen, und seine Karriere bei der Wallace and Madison Investment Bank hatte hoffnungsvoll begonnen. Mittlerweile war er Vater zweier Söhne, Eli und Gabriel, und einer kleinen Tochter, Danielle, die eine erschütternde Ähnlichkeit mit ihrer verstorbenen Großmutter hatte. Jedes Mal, wenn Aaron ihr Grab aufsuchte, wurden wieder Wut und Frustration darüber wach, dass der Mörder seiner Mutter immer noch als freier Mann herumlief.
Jemand hatte ihr mit einem schweren Gegenstand einen Schlag auf den Hinterkopf versetzt. Ihr Handy wurde neben ihr auf dem Boden gefunden. Hatte sie die Gefahr gespürt und es aus der Tasche genommen, um den Notruf zu verständigen? Diese Möglichkeit war immerhin so etwas wie ein schwacher Trost für ihn.
Sie musste versucht haben, jemanden anzurufen. Die von der Polizei untersuchten Gesprächsdaten hatten ergeben, dass sie in der fraglichen Zeit weder einen Anruf getätigt noch erhalten hatte.
Die Polizei war immer von einem gewöhnlichen Raubüberfall ausgegangen. Ihre Armbanduhr fehlte, das einzige Schmuckstück, das sie normalerweise um diese Tageszeit trug, ebenso ihr Hausschlüssel. »Warum sollte derjenige, der sie ermordet hat, ihren Hausschlüssel an sich nehmen, wenn er sie gar nicht kannte und nicht wusste, wo sie wohnt?«, hatte er die Polizisten gefragt. Aber auf diese Frage hatten sie auch keine Antwort gewusst.
Zu ihrer Wohnung gab es einen eigenen Eingang auf Erdgeschossebene, an der Seitenfront des Wohngebäudes, dessen Haupteingang von einem Portier überwacht wurde, doch die Beamten, die in dem Fall ermittelten, hatten darauf hingewiesen, dass in der Wohnung nichts gefehlt hatte. Ihr Portemonnaie, das mehrere hundert Dollar enthielt, befand sich in ihrer Handtasche. Ihre Schmuckkassette stand offen auf der Kommode, und ihre wenigen wertvollen Schmuckstücke lagen immer noch darin.
Der feine Regen setzte wieder ein, als Aaron niederkniete und das Gras auf dem Grab seiner Mutter berührte. Seine Knie sanken in dem schlammigen Boden ein, als er den Stein auf das Grab legte und murmelte: »Mom, ich hätte mir so sehr gewünscht, dass du die Kinder noch erlebst. Die Jungen haben jetzt die erste Klasse und den Kindergarten hinter sich. Danielle ist schon eine richtige kleine Schauspielerin geworden. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie in einigen Jahren für eines der Stücke vorgesprochen hätte, die du immer an der Columbia University inszeniert hast.«
Er lächelte, weil er daran denken musste, was seine Mutter ihm geantwortet hätte: »Aaron, du bist ein Träumer. Rechne doch mal nach. Bis es so weit ist und Danielle aufs College geht, wäre ich bereits fünfundsiebzig Jahre alt gewesen.«
»Du würdest immer noch unterrichten und Regie führen, und du wärst immer noch fit wie eh und je«, sagte er laut.
4
Am Montagmorgen machte ich mich mit dem Zettel, den Mack in das Kollektekörbchen geschmuggelt hatte, auf den Weg zum Büro des Bezirksstaatsanwalts im unteren Manhattan. Draußen war es schön, sonnig und warm, mit einer sanften Brise, die Art von Wetter, die man sich eigentlich für Muttertag gewünscht hätte anstelle des kalten, nassen Tages, der jede Hoffnung auf gesellige Aktivitäten unter freiem Himmel zunichte gemacht hatte.
Mom, Onkel Dev und ich waren am Sonntagabend zusammen essen gegangen. Natürlich hatte uns Macks Nachricht, die Onkel Dev uns überreichte, in ungeheure Aufregung versetzt. Mom konnte sich zunächst gar nicht darüber beruhigen, dass Mack sich anscheinend so nahe bei uns befunden hatte. Sie war immer davon überzeugt gewesen, dass er weit weg sein müsse, in Colorado oder in Kalifornien. Dann hatte sich aber die Angst bei ihr eingeschlichen, er könnte durch meine Ankündigung, ihn aufspüren zu wollen, in eine bedrohliche Lage geraten sein.
Ich selbst wusste zunächst nicht, was ich darüber denken sollte, doch mittlerweile hegte ich immer stärker die Vermutung, Mack müsse bis zum Hals in irgendwelchen Schwierigkeiten stecken und bemühe sich, uns davon fernzuhalten.
Die Eingangshalle in dem Gebäude am Hogan Place 1 war voller Menschen, und die Sicherheitsvorkehrungen waren äußerst strikt. Obwohl ich mich angemessen ausweisen konnte, war es nicht möglich, ohne einen vereinbarten Termin an dem Wachbeamten vorbeizukommen. Während die Leute hinter mir in der Schlange allmählich unruhig wurden, versuchte ich ihm zu erklären, dass mein Bruder als verschwunden gemeldet sei und dass wir jetzt vielleicht einen Hinweis darauf bekommen hätten, wo wir mit der Suche nach ihm beginnen könnten.
»Ma’am, da müssen Sie zunächst die Vermisstenstelle anrufen und sich einen Termin geben lassen«, beharrte der Beamte. »Und jetzt bitte ich Sie – es gibt hier Leute, die nach oben wollen, um sich an ihren Arbeitsplatz zu begeben.«
Frustriert verließ ich das Gebäude und holte mein Handy hervor. Huot war Richter am Zivilgericht gewesen, und ich hatte nie besonders viel mit den Assistenten der Bezirksstaatsanwaltschaft zu tun gehabt, doch einen von ihnen kannte ich, Matt Wilson. Ich rief das Büro der Staatsanwaltschaft an und wurde zu seinem Apparat durchgestellt. Matt befand sich nicht an seinem Schreibtisch, und es ertönte die übliche Ansage vom Anrufbeantworter. »Bitte hinterlassen Sie Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und eine kurze Nachricht. Ich rufe Sie zurück.«
»Hier spricht Carolyn MacKenzie«, sagte ich. »Wir haben ein paarmal miteinander gesprochen. Ich war Assistentin von Richter Huot. Mein Bruder ist seit zehn Jahren verschwunden. Er hat gestern einen Zettel mit einer Nachricht für mich in einer Kirche an der Amsterdam Avenue hinterlassen. Ich will versuchen, ihn ausfindig zu machen, bevor er wieder ganz verschwindet, und brauche dazu Ihre Hilfe.« Danach hinterließ ich noch meine Handynummer.
Ich stand auf den Eingangsstufen. Ein Mann kam von hinten an mir vorbei, breitschultrig, Mitte fünfzig, mit kurz geschnittenen grauen Haaren und energisch ausschreitendem Gang. Er musste meine Nachricht mitbekommen haben, denn zu meiner Verwunderung blieb er stehen und drehte sich um. Wir musterten uns einen Augenblick gegenseitig, dann sagte er abrupt: »Ich bin Detective Barrott. Kommen Sie mit mir nach oben.«
Fünf Minuten später saß ich in einem schäbigen kleinen Büro, das einen Schreibtisch, einige Stühle und zahlreiche Aktenstapel enthielt. »Hier können wir uns ungestört unterhalten«, sagte er. »Im großen Raum ist es zu laut.«
Er sah mich die ganze Zeit unverwandt an, während ich ihm über Mack berichtete, unterbrach mich nur, um mir ein paar Fragen zu stellen. »Er ruft immer nur an Muttertag an?«
»Ja, das ist richtig.«
»Hat er nie um Geld gebeten?«
»Nein, nie.« Ich hatte den Zettel in eine Plastiktüte gelegt. »Ich weiß nicht, vielleicht sind Fingerabdrücke von ihm darauf«, erklärte ich. »Es sei denn, er hat jemand anderen beauftragt, den Zettel in das Körbchen zu legen. Dass er das Risiko eingegangen wäre, Onkel Dev könnte ihn vom Altar aus erkennen, erscheint einem doch ziemlich unwahrscheinlich.«
»Kommt drauf an. Vielleicht hat er sich die Haare gefärbt, vielleicht wiegt er zehn Kilo mehr, oder er trägt eine Sonnenbrille. Es ist nicht so schwierig, sich in einer Menschenmenge zu verstecken, besonders wenn die Leute Regenkleidung tragen.«
Er musterte den Zettel. Die Schrift war deutlich durch die Plastikfolie zu sehen. »Haben wir Fingerabdrücke Ihres Bruders in unseren Akten?«
»Ich bin mir nicht sicher. Als wir ihn damals als vermisst gemeldet haben, hatte unsere Haushälterin sein Zimmer zu Hause abgestaubt und gestaubsaugt. Er hat mit zwei Freunden in einer Studentenwohnung gewohnt, und wie bei solchen Verhältnissen üblich, gingen täglich mindestens ein Dutzend andere Leute in der Wohnung ein und aus. Sein Auto wurde gewaschen und gereinigt, nachdem er es zuletzt benutzt hat.«
Barrott gab mir den Zettel zurück. »Wir könnten diesen Zettel auf Fingerabdrücke untersuchen lassen, aber ich kann Ihnen gleich sagen, dass nichts dabei herauskommen wird. Sie und Ihre Mutter haben ihn in der Hand gehabt. Außerdem Ihr Onkel, der Pfarrer. Dann noch der Gottesdiensthelfer, der ihn zu Ihrem Onkel gebracht hat. Und ich vermute, dass mindestens noch ein weiterer Gottesdiensthelfer beim Zählen der Kollekte geholfen hat.«
Weil ich das Gefühl hatte, ihm noch mehr bieten zu müssen, sagte ich: »Ich bin Macks einzige Schwester. Meine Eltern und ich haben uns bei einem Labor für DNS-Verwandtschaftstests registrieren lassen. Doch da wir bis jetzt nichts von ihnen gehört haben, nehme ich an, dass sie niemanden gefunden haben, bei dem wenigstens eine teilweise Übereinstimmung bestand.«
»Ms. MacKenzie, so, wie Sie mir das geschildert haben, hatte Ihr Bruder nicht den geringsten Grund, aus eigenem Entschluss und freiwillig zu verschwinden. Wenn es aber doch so gewesen ist, muss es einen Grund gegeben haben, muss es ihn immer noch geben. Vielleicht haben Sie schon mal einige dieser Sendungen über Verbrechen im Fernsehen gesehen, daher haben Sie vielleicht gehört, dass der Grund, weshalb Leute einfach verschwinden, in den allermeisten Fällen eine Anhäufung von Problemen ist, die mit Liebe oder Geld zusammenhängen. Der verratene Liebhaber, der eifersüchtige Ehemann, die lästig gewordene Ehefrau, der Drogenabhängige, der sich seinen Stoff besorgen muss. Sie müssen Ihre gesamten bisherigen Kenntnisse und Ansichten über Ihren Bruder noch einmal überprüfen. Er war einundzwanzig Jahre alt. Sie sagen, er sei bei den Mädchen beliebt gewesen. Gab es eine spezielle Freundin?«
»Keine, von denen uns seine Freunde erzählt hätten. Jedenfalls hat sich nie jemand bei uns gemeldet.«
»In diesem Alter versuchen viele junge Männer, mit Glücksspiel zu Geld zu kommen. Noch mehr experimentieren mit Drogen herum und werden abhängig. Nehmen wir mal an, er hatte Schulden. Wie hätten Ihre Eltern darauf reagiert?«
Ich merkte, dass ich nur ungern auf diese Frage antwortete. Doch dann sagte ich mir, dass ohne Zweifel solche Fragen schon vor zehn Jahren meinen Eltern gestellt worden waren. Ich überlegte, ob sie wohl ausweichend geantwortet hatten. »Mein Vater wäre wütend darüber gewesen«, gab ich zu. »Für Leute, die ihr Geld verschleudern, hatte er nur Verachtung übrig. Meine Mutter verfügt über ein eigenes Einkommen aus einer Erbschaft. Wäre Mack in Geldnot gewesen, hätte er es von ihr kriegen können, und sie hätte meinem Vater nichts davon erzählt.«
»Na schön. Ms. MacKenzie, ich werde jetzt vollkommen aufrichtig zu Ihnen sein. Ich glaube nicht, dass wir es hier mit einem Verbrechen zu tun haben, daher können wir auch nicht das Verschwinden Ihres Bruders als Verbrechen behandeln. Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Menschen Tag für Tag aus ihrem Leben aussteigen. Sie stehen unter Stress. Sie werden mit ihren Problemen nicht mehr fertig, oder noch schlimmer, sie versuchen gar nicht mehr, damit fertig zu werden. Ihr Bruder ruft regelmäßig an …«
»Ein Mal im Jahr«, unterbrach ich.
»Auch das ist regelmäßig. Sie teilen ihm mit, dass Sie ihn aufspüren wollen, und er reagiert sofort darauf. ›Lass mich in Ruhe‹ ist seine Botschaft. Ich weiß, es klingt ein bisschen hart, aber Sie sollten einfach einsehen, dass Mack offenbar dort ist, wo er sein will, und dass die einzige Verbindung, die er mit Ihnen und Ihrer Mutter aufrechterhalten will, dieser Anruf an Muttertag ist. Tun Sie sich allen dreien einen Gefallen: Respektieren Sie seinen Wunsch.«
Er stand auf. Offensichtlich war das Gespräch beendet. Offensichtlich sollte ich die wertvolle Zeit der Polizei nicht noch länger in Anspruch nehmen. Ich nahm den Zettel wieder an mich, und dabei fiel mir die Botschaft von neuem ins Auge: »ONKEL DEVON, SAG CAROLYN, SIE SOLL NICHT NACH MIR SUCHEN.«
»Ich danke Ihnen für Ihre … Aufrichtigkeit, Detective Barrott«, sagte ich, im letzten Moment das Wort »Hilfe« unterdrückend. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er mir in irgendeiner Weise weitergeholfen hatte. »Ich verspreche Ihnen, dass ich Sie nicht weiter belästigen werde.«
5
Seit zwanzig Jahren schon arbeiteten Gus und Lil Kramer, beide mittlerweile Anfang siebzig, als Hausmeister eines vierstöckigen Wohngebäudes an der West End Avenue, in dem der Besitzer Derek Olsen Wohnungen hatte einrichten lassen, um sie an Studenten zu vermieten. Bei ihrem Einstellungsgespräch hatte ihnen Olsen erklärt: »Wissen Sie, Studenten, egal, ob klug oder dumm, sind grundsätzlich ziemliche Schweinigel. Bei denen türmen sich die Pizzakartons in der Küche bis unter die Decke. In allen Ecken sammeln sich haufenweise leere Bierdosen an. Schmutzige Wäsche und nasse Handtücher werden einfach auf den Boden geworfen und liegen gelassen. Das alles kann uns herzlich egal sein. Sie ziehen sowieso wieder aus, wenn sie ihr Diplom geschafft haben.«
»Worum es mir geht, ist Folgendes«, hatte er hinzugefügt. »Ich kann die Miete erhöhen, wenn ich das für richtig halte, aber nur, solange die Gemeinschaftsbereiche einwandfrei in Schuss sind. Ich erwarte von Ihnen, dass der Eingangsbereich und die Flure immer so aussehen, als würde das Haus an der Fifth Avenue stehen. Ich möchte, dass Heizung und Klimaanlage immer einwandfrei funktionieren, dass Probleme mit der Installation auf der Stelle behoben werden und der Bürgersteig täglich gefegt wird. Jedes Mal, wenn ein Zimmer frei wird, müssen die Wände neu gestrichen werden. Wenn Interessenten mit ihren Eltern kommen, möchte ich, dass alles einen guten Eindruck auf sie macht.«
Zwanzig Jahre lang hatte das Ehepaar Kramer die Anweisungen Olsens gewissenhaft befolgt, und das Gebäude, in dem sie arbeiteten, hatte einen guten Ruf als gehobene Einrichtung für Studenten. Alle Studenten, die hier zeitweilig wohnten, hatten das Glück, Eltern zu haben, bei denen das Geld locker saß. Ein Teil dieser Eltern schloss darüber hinaus mit dem Ehepaar Kramer eine getrennte Vereinbarung ab, der zufolge sie regelmäßig die Zimmer ihrer Sprösslinge putzen sollten.
Die Kramers hatten sich am Muttertag mit ihrer Tochter Winifred und deren Ehemann Perry zu einem Brunch in der Tavern on the Green getroffen. Leider hatte fast die gesamte Konversation in einem Monolog Winifreds bestanden, die ihre Eltern davon überzeugen wollte, ihren Job aufzugeben und sich in ihr Landhäuschen in Pennsylvania zurückzuziehen. Es war ein Monolog, den sie schon öfter über sich hatten ergehen lassen müssen und der stets mit dem Refrain endete: »Mom und Dad, ich möchte einfach nicht, dass ihr euer ganzes Leben lang diesen verwöhnten Bengeln hinterherputzt und wischt und staubsaugt.«
Lil Kramer pflegte schon seit Langem nur noch ausweichend darauf zu antworten: »Vielleicht hast du recht. Ich werde es mir überlegen.«
Beim Nachtisch, Regenbogen-Sorbet, hatte es jedoch Gus Kramer nicht an Deutlichkeit missen lassen. »Wenn wir so weit sind, dass wir aufhören wollen, werden wir auch aufhören, vorher nicht. Was soll ich denn den ganzen Tag tun? Däumchen drehen?«
Am späteren Montagabend, als Lil an einem Pullover für das demnächst zu erwartende erste Kind eines der ehemaligen Studenten strickte, musste sie an Winifreds gut gemeinten, aber unwillkommenen Rat denken. Warum kapiert Winifred nicht, dass ich einfach wahnsinnig gern unter diesen jungen Leuten bin, ärgerte sie sich. Für uns ist es fast so, als ob wir Enkel hätten. Wo wir von ihr ja sowieso keine zu erwarten haben.
Das Klingeln des Telefons riss sie aus ihren Gedanken. Nachdem Gus allmählich ein bisschen schwerhörig wurde, hatte er die Lautstärke erhöht, aber er hatte etwas übertrieben. Mit dem Lärm könnte man Tote auferwecken, dachte Lil, während sie zum Apparat eilte.
Als sie den Hörer aufnahm, hoffte sie, dass es nicht Winifred war, die noch einmal auf ihre Predigt zurückkommen wollte. Einen Moment später hätte sie etwas darum gegeben, wenn der Anruf von Winifred gekommen wäre.
»Hallo, Carolyn MacKenzie hier. Spreche ich mit Mrs. Kramer?«
»Ja.« Lil spürte ihr Herz klopfen.
»Mein Bruder Mack hat vor zehn Jahren in Ihrem Haus gewohnt, bevor er verschwand.«
»Ja, das ist richtig.«
»Mrs. Kramer, Mack hat sich vor Kurzem bei uns gemeldet. Er will uns seinen Aufenthaltsort nicht verraten. Sie können sich sicherlich vorstellen, was das für meine Mutter und mich bedeutet. Nun möchte ich versuchen, ihn zu finden. Wir haben Grund zu der Annahme, dass er sich gar nicht so weit entfernt von uns aufhält. Könnte ich zu Ihnen kommen, um mit Ihnen zu sprechen?«
Nein, dachte Lil. Nein! Doch sie hörte sich die einzig mögliche Antwort geben: »Aber natürlich können Sie kommen. Ich … wir … haben Mack immer gern gehabt. Wann möchten Sie vorbeischauen?«
»Morgen früh?«
Zu früh, dachte Lil. Ich brauche mehr Zeit. »Morgen haben wir sehr viel zu tun.«
»Dann Mittwochvormittag gegen elf?«
»Ja, das würde gehen.«
Gus kam zur Tür herein, als sie auflegte. »Wer war das?«, fragte er.
»Carolyn MacKenzie. Sie will auf eigene Faust nach ihrem Bruder suchen. Sie kommt am Mittwochvormittag zu uns, um mit uns zu sprechen.«
Lil beobachtete, wie das breite Gesicht ihres Mannes rot anlief und sich seine Augen hinter den Brillengläsern zu Schlitzen verengten. Mit wenigen Schritten baute er sich mit seinem kurzen, stämmigen Körper vor ihr auf. »Als dich die Polizei damals befragt hat, haben alle gemerkt, dass du nervös geworden bist, Lil. Lass dir diesmal auf keinen Fall etwas anmerken. Hast du mich verstanden? Du wirst dir auf keinen Fall etwas anmerken lassen!«
6
Detective Roy Barrotts Schicht endete an diesem Montagnachmittag um vier Uhr. Der Arbeitstag war relativ zäh verlaufen, und um drei Uhr stellte er fest, dass es nichts mehr gab, was er noch unbedingt hätte erledigen müssen. Doch eine unbestimmte Unzufriedenheit ließ ihm keine Ruhe. Als würde er mit der Zunge nach einer wunden Stelle in seinem Mund forschen, ging er in Gedanken immer wieder den Tag durch und suchte nach der Quelle für sein Unbehagen.
Als er sich an das Gespräch mit Carolyn MacKenzie erinnerte, wusste er, dass er gefunden hatte, wonach er gesucht hatte. Der Ausdruck von Bestürzung und Unmut auf ihrem Gesicht, als sie ihn verließ, bereitete ihm im Nachhinein ein schlechtes Gewissen. Sie machte sich verzweifelte Sorgen um ihren Bruder und hatte gehofft, dass jener Zettel, der bei der Kollekte gefunden worden war, sie bei ihrer Suche nach ihm einen Schritt weiterbringen könnte. Obwohl sie das nicht ausdrücklich gesagt hatte, schien sie doch deutlich davon überzeugt zu sein, dass er in irgendwelchen Schwierigkeiten steckte.
Ich habe sie abgewimmelt, dachte Barrott. Als sie gegangen ist, hat sie gesagt, sie werde mich nicht weiter belästigen. Das war das Wort, das sie benutzt hat: belästigen.
Während er sich nun in seinem Stuhl inmitten des voll besetzten Dezernatbüros zurücklehnte, versuchte Barrott, die Geräusche der ständig klingelnden Telefone auszublenden. Dann zuckte er die Achseln. Was soll’s, vielleicht sollte ich einfach mal einen Blick in die Akte werfen, dachte er. Und sei es auch nur, um mich zu überzeugen, dass es sich um nichts anderes handelt als um einen Typen, der eine Zeit lang abtauchen will, ein Typ, der eines schönen Tages vielleicht als frischgebackener Dr. phil. wieder auftauchen wird, und bei der feierlichen Familienzusammenführung vergießen dann Mutter und Tochter das ein oder andere Tränchen.
Mit einem leisen Stöhnen wegen einer beginnenden Arthritis im Knie erhob er sich, begab sich ins Archiv, ließ sich die Akte MacKenzie aushändigen, kehrte damit zurück an seinen Schreibtisch und schlug sie auf. Neben dem Stapel von offiziellen Berichten und den Aussagen der Familie und der Freunde von Charles MacKenzie jr. fand sich darin ein großer Umschlag mit Fotos. Barrott zog sie hervor und breitete sie vor sich auf der Tischplatte aus.
Eine der Aufnahmen fiel ihm sofort ins Auge. Es war eine Weihnachtskarte, die die Familie MacKenzie zeigte, aufgereiht vor ihrem Weihnachtsbaum. Sie erinnerte Barrott an die Weihnachtskarte, die er selbst im Dezember verschickt hatte und auf der er ebenfalls mit seiner Frau Beth und den Kindern Melissa und Rick vor ihrem Christbaum abgebildet war. Ein Exemplar dieser Grußkarte musste immer noch irgendwo in seinem Schreibtisch liegen.
Die MacKenzies haben sich viel mehr herausgeputzt für ihr Foto als wir, dachte Barrott. Vater und Sohn trugen Smoking, Mutter und Tochter Abendkleider. Doch die allgemeine Ausstrahlung war die gleiche. Eine lächelnde, glückliche Familie, die ihren Freunden ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr wünschte. Es musste die letzte Karte gewesen sein, die sie vor dem Verschwinden ihres Sohnes verschickt hatten.
Mittlerweile war Charles MacKenzie jr. seit zehn Jahren verschwunden, und Charles MacKenzie sen. war seit dem 11. September tot.
Barrott kramte eine Weile zwischen den persönlichen Papieren in seinem Schreibtisch herum und zog schließlich die Grußkarte seiner Familie hervor. Er stützte beide Ellbogen auf dem Tisch auf und hielt die beiden Karten nebeneinander, um sie zu vergleichen. Ich habe wirklich Glück, dachte er. Rick hat gerade sein erstes Jahr in Fordham mit Auszeichnung hinter sich gebracht, und Melissa, ebenfalls eine Einserschülerin, beendet gerade das vorletzte Jahr an der Cathedral Highschool und geht heute Abend auf einen Schülerball. Beth und ich sind geradezu mit Glück gesegnet.
Ein Gedanke ging ihm durch den Kopf. Was wäre, wenn mir bei der Arbeit etwas zustieße, und Rick würde eines Tages spurlos aus seinem Wohnheim verschwinden? Wenn ich nicht mehr da wäre, um ihn aufzuspüren?
Rick würde das seiner Mutter und Schwester niemals antun, dachte er, das war einfach unvorstellbar.
Doch genau das war es, was mir Carolyn MacKenzie in Bezug auf ihren Bruder zu verstehen geben wollte.
Langsam klappte Barrott die Akte Charles MacKenzie jr. zu und ließ sie in die oberste Schublade seines Schreibtischs gleiten. Ich werde sie mir morgen durchsehen, beschloss er, und vielleicht werde ich ein paar von den Leuten aufsuchen, die damals ausgesagt haben. Es kann nicht schaden, ihnen ein paar Fragen zu stellen und zu überprüfen, ob sich ihr Erinnerungsvermögen in der Zwischenzeit vielleicht verbessert hat.
Es war jetzt vier Uhr. Zeit abzuhauen. Er wollte rechtzeitig zu Hause sein, um ein paar Fotos von Melissa in ihrem Ballkleid zu machen, zusammen mit ihrem Freund Jason Kelly. Ein ziemlich netter Bursche, dachte Barrott, aber so dünn, dass man Angst bekommt, er könnte beim geringsten Windstoß fortgeweht werden. Ich würde auch gern noch ein Wörtchen mit dem Taxifahrer reden, der die Kinder hinfahren wird. Einen Blick auf seine Lizenz werfen und ihm einschärfen, dass er unter keinen Umständen die Geschwindigkeitsbeschränkungen überschreitet. Er erhob sich und zog sein Sakko an.
Man kann noch so viele Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um seine Kinder zu schützen, dachte Barrott, während er den Kollegen einen Abschiedsgruß zurief und das Dezernatsbüro verließ, aber manchmal, egal, was man alles bedacht hat, geht eben doch etwas schief, und ein Kind wird in einen Unfall verwickelt oder Opfer eines Verbrechens.
Bitte, lieber Gott, betete er und drückte den Knopf für den Aufzug, lass nicht zu, dass uns so etwas zustößt.
7
Onkel Dev hatte Elliott Wallace von Macks Nachricht in der Kollekte erzählt, und am Montag trafen wir uns mit Elliott zum Abendessen. Eine Spur von Besorgtheit zeigte sich in seinem sonst immer gelassen und unerschütterlich wirkenden Äußeren. Elliott war Vorstandsvorsitzender von Wallace and Madison, der Investmentfirma an der Wall Street, die sich um die finanziellen Belange unserer Familie kümmert. Er war einer der besten Freunde meines Vaters, und für Mack und mich war er immer so etwas wie ein Nennonkel gewesen. Er war seit Jahren geschieden, und ich wusste, dass meine Mutter seine große Liebe war. Doch stieß sein Werben in den Jahren seit Dads Tod nur auf wenig Widerhall bei ihr, und auch das war meiner Meinung nach eine weitere Folge von Macks Verschwinden.
Sobald wir an Elliotts Lieblingstisch im Le Cirque saßen, zeigte ich ihm den Zettel mit Macks Nachricht und sagte ihm, dass ich nunmehr entschlossener denn je sei, ihn zu finden.
Ich hatte wirklich gehofft, dass Elliott mich in meinem Vorhaben bestärken würde, doch er enttäuschte mich. »Carolyn«, sagte er langsam, während er den Zettel mit der Nachricht hin und her wendete, »ich glaube nicht, dass du dich Mack gegenüber fair verhältst. Er ruft einmal im Jahr an, um euch mitzuteilen, dass es ihm gut geht. Du hast mir selbst gesagt, dass er zuversichtlich, ja, sogar glücklich und zufrieden klingt. Er reagiert sofort auf dein Versprechen – oder deine Drohung –, ihn aufzuspüren. Mit dem direktesten Mittel, das ihm zur Verfügung steht, beschwört er dich, ihn in Ruhe zu lassen. Warum hältst du dich nicht an seinen Wunsch, und, was noch viel wichtiger ist, warum lässt du zu, dass Mack immer noch einen so beherrschenden Platz in deinem Leben einnimmt?«
Eine solche Frage hatte ich kaum aus dem Mund von Elliott erwartet, und ich sah ihm an, wie viel Mühe sie ihn kostete. Seine Augen waren getrübt, und tiefe Furchen zeichneten sich auf seiner Stirn ab, als er den Blick von mir abwandte und auf meine Mutter richtete, deren Miene undurchdringlich geworden war. Ich war froh, dass wir an einem etwas abseits gelegenen Tisch saßen, wo niemand uns beobachten konnte. Ich befürchtete, dass sie Elliott auch so scharf angehen könnte, wie sie mich nach Macks Anruf angegangen war, oder, schlimmer noch, dass sie in unkontrolliertes Weinen ausbrechen könnte.
Als sie stumm blieb, sagte Elliott mit großem Nachdruck: »Olivia, du musst Mack seine Freiheit lassen. Gib dich damit zufrieden, dass er am Leben ist, fasse es als tröstlichen Umstand auf, dass er anscheinend sogar in der Nähe ist. Ich bin mir ganz sicher, dass Charley dir genau dasselbe sagen würde, wenn er hier am Tisch säße.«
Meine Mutter überrascht mich immer wieder. Sie nahm eine Gabel in die Hand und zeichnete geistesabwesend mit den Zinken etwas auf die Tischdecke. Ich hätte wetten mögen, dass es Macks Name war.
Als sie schließlich zu einer Erwiderung ansetzte, fiel ihre Reaktion auf Macks Nachricht völlig anders aus, als ich erwartet hatte.
»Seit Dev uns gestern Abend diese Nachricht von Mack gezeigt hat, denke ich allmählich ein bisschen in dieselbe Richtung, Elliott«, sagte sie. Der Schmerz war deutlich aus ihrer Stimme herauszuhören, aber es gab keine Anzeichen von Tränen. »Ich bin gestern sehr heftig gegen Carolyn gewesen, weil sie Mack so beschimpft hat. Das war nicht richtig von mir. Ich weiß, dass sich Carolyn ständig Sorgen um mich macht. Nun haben wir von Mack eine Antwort bekommen. Es war zwar nicht die Antwort, die ich erhofft hatte, aber so ist es nun mal.«
An dieser Stelle versuchte Mom zu lächeln. »Ab jetzt werde ich versuchen, ihn als jemanden zu betrachten, der sich ›unerlaubt von der Truppe entfernt hat‹, wie es beim Militär heißt. Vielleicht lebt er irgendwo in der Nähe. Wie du gesagt hast: Er hat sofort reagiert, und wenn er uns nicht sehen will, werden Carolyn und ich seinen Wunsch respektieren.« Sie machte eine Pause, dann fügte sie mit fester Stimme hinzu: »Daran will ich mich halten.«
»Olivia, ich kann nur hoffen, dass du bei dieser Einstellung bleibst«, sagte Elliott nachdrücklich.
»Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Als ersten Schritt werde ich eine Reise unternehmen. Meine Freunde, die Clarences, wollen an diesem Freitag mit ihrer Jacht zu einer Kreuzfahrt um die griechischen Inseln aufbrechen. Sie wollen mich schon eine ganze Weile dazu überreden, sie zu begleiten. Und ich habe gerade beschlossen, dass ich das tun werde.« Als ob sie die Endgültigkeit ihres Entschlusses unterstreichen wollte, legte sie ihre Gabel wieder auf dem Tisch ab.
Ich lehnte mich zurück und dachte über diese unerwartete Wendung der Dinge nach. Ich hatte vorgehabt, Elliott von meiner Verabredung mit dem Hausmeisterehepaar Kramer am Mittwoch zu berichten, was ich jetzt natürlich unterließ. Es war schon merkwürdig: Nun endlich war Mom bereit, sich mit Macks Situation abzufinden; etwas, wozu ich sie seit Jahren gedrängt hatte, wogegen ich mich jetzt allerdings wehrte. Mit jeder Stunde, die verging, war ich mehr davon überzeugt, dass sich Mack in einer äußerst schwierigen Lage befand und ganz auf sich allein gestellt war. Ich wollte bereits diese Möglichkeit zur Sprache bringen, doch dann presste ich die Lippen zusammen. Wenn Mom verreist war, müsste ich meine Nachforschungen nach Mack nicht vor ihr verbergen oder sie gar deswegen anlügen.
»Wie lange dauert die Kreuzfahrt, Mom?«, fragte ich.
»Mindestens drei Wochen.«
»Ich glaube, das ist eine großartige Idee«, sagte ich aufrichtig.
»Das glaube ich auch«, pflichtete Elliott bei. »Und nun zu dir, Carolyn. Immer noch daran interessiert, Assistentin bei der Staatsanwaltschaft zu werden?«
»Absolut«, antwortete ich. »Aber ich werde noch einen oder zwei Monate warten, bevor ich mich bewerbe. Sollte ich das Glück haben und sofort genommen werden, werde ich für eine geraume Weile keine Freizeit mehr haben.«
Der Rest des Abends verlief in angenehmer Stimmung. Mom, die blendend aussah in ihrer hellblauen Seidenbluse mit dazu passenden Hosen, lebte auf und lächelte viel. So hatte ich sie seit Jahren nicht mehr gesehen. Ihre Entscheidung, die Situation zu akzeptieren, schien ihr ihren Seelenfrieden zurückgegeben zu haben.
Auch Elliotts Stimmung hellte sich auf, während er sie dabei beobachtete. Als Kind habe ich mich manchmal gefragt, ob Elliott auch im Bett Hemd und Krawatte trug. Er achtete immer penibel auf äußere Formen, doch wenn meine Mutter ihren Charme versprühte, schmolz er sofort dahin. Er war ein paar Jahre älter als Mom, weshalb ich mir zuweilen die Frage stellte, ob er sich seine vollen schwarzen Haare tönen ließ. Er hielt sich stets tadellos aufrecht wie ein Berufsoffizier. Sein Gesichtsausdruck war normalerweise zurückhaltend, sogar abweisend, es sei denn, er lächelte oder lachte, dann nämlich klärte sich seine gesamte Erscheinung auf, und man erhielt einen kurzen Einblick auf eine spontanere Persönlichkeit, die sich hinter der Fassade unerschütterlicher Förmlichkeit verbarg.
Scherzend pflegte er über sich zu sagen: »Mein Vater Franklin Delano Wallace wurde nach Präsident Franklin Delano Roosevelt benannt, einem entfernten Cousin, der für Vater immer der große Held geblieben ist. Was meint ihr, weshalb ich den Namen Elliott trage? Nun, das war der Name, den der Präsident einem seiner Söhne gab. Man darf nicht vergessen, dass Roosevelt trotz allem, was er für die einfachen Menschen getan hat, in erster Linie ein Aristokrat war, wie er im Buche steht. Und ich fürchte, mein Vater war nicht nur ein Aristokrat, sondern auch ein ausgesprochener Snob. Wenn ich euch also manchmal übertrieben förmlich vorkomme, dann ist daran einzig und allein der Steifkragen schuld, der mich großgezogen hat.«
Als wir beim abschließenden Kaffee angekommen waren, war ich mittlerweile überzeugt, es sei besser, wenn ich Elliott gegenüber nicht einmal andeutete, dass ich weiterhin aktiv nach Mack suchen wollte. Ich erbot mich, während Moms Abwesenheit in ihrer Wohnung zu bleiben, und sie nahm dieses Angebot freudig an. Die kleine Wohnung in Greenwich Village, die ich im letzten September zu Beginn meiner Assistenzzeit bei Richter Huot bezogen hatte, war nicht so ganz nach ihrem Geschmack. Jedenfalls ahnte sie
Die Originalausgabe WHERE ARE YOU NOW? erschien bei Simon & Schuster Inc., New York
5. Auflage Vollständige deutsche Taschenbuchausgabe 01/2010 Copyright © 2008 by Mary Higgins Clark Copyright © 2008 der deutschen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlagillustration und Umschlaggestaltung: Eisele Grafik Design, München unter Verwendung eines Fotos von © Jessica Prüßmann und © Christopher Stevenson/ Getty Images
eISBN 978-3-641-10068-1
www.heyne.de
www.randomhouse.de
Leseprobe