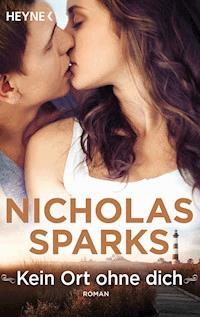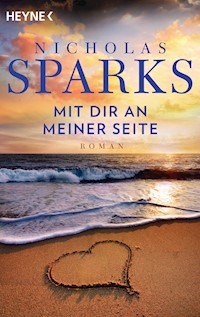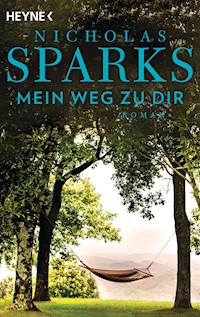10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Maggie ist noch nicht einmal 16, als sie ungewollt schwanger wird. Ihre entsetzten Eltern schicken sie zu einer alleinstehenden Tante nach Ocracoke Island in North Carolina. Die Insel erscheint Maggie so trostlos wie ihr ganzes Leben – bis sie den jungen Bryce kennenlernt. Zwischen den beiden entspinnt sich ein ganz besonderes Band. Aber ihre Liebe steht unter keinem guten Stern …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
DASBUCH
1995: In diesem Jahr ändert sich für die 16-jährige Maggie Dawes alles. Sie wird ungewollt schwanger und muss zu ihrer alleinstehenden Tante nach Ocracoke Island ziehen, einer kleinen, abgeschiedenen Insel in den Outer Banks von North Carolina. Maggie fühlt sich ungeliebt und wie eine Versagerin. Das ändert sich, als sie Bryce Trickett kennenlernt, den ihre Tante für sie als Nachhilfelehrer engagiert hat. Die beiden kommen sich sehr nahe – aber das Schicksal meint es nicht gut mit ihnen.
2019: Maggie ist eine berühmte Reisefotografin. Sie bereist die Welt und leitet eine erfolgreiche eigene Galerie mitten in New York. Doch dann erhält sie kurz vor Weihnachten eine niederschmetternde Nachricht. In dieser schrecklichen Zeit hilft ihr Mark, ein junger Mitarbeiter in der Galerie, zurechtzukommen. Und schließlich erzählt ihm Maggie von einem anderen Weihnachten vor vielen Jahren, als die Liebe ihr Leben veränderte.
DERAUTOR
Nicholas Sparks, 1965 in Nebraska geboren, lebt in North Carolina. Mit seinen Romanen, die ausnahmslos die Bestsellerlisten eroberten und weltweit in über 50 Sprachen erscheinen, gilt er als einer der meistgelesenen Autoren der Welt. Mehrere seiner Bestseller wurden erfolgreich verfilmt. Alle seine Bücher sind bei Heyne erschienen, zuletzt »Wenn du zurückkehrst«.
NICHOLAS
SPARKS
MEIN LETZTER
WUNSCH
ROMAN
Aus dem Amerikanischen
von Astrid Finke
Die Originalausgabe erscheint unter dem Titel THEWISH bei Grand Central Publishing/Hachette Book Group USA, New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2021 by Willow Holdings, Inc.
Copyright © 2021 der deutschen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Textauszug S. 139 aus: Sylvia Plath, Die Glasglocke.
Aus dem Englischen von Reinhard Kaiser. © 1963 Sylvia Plath.
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1997
Redaktion: Lüra – Klemt & Mues GbR
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München,
unter Verwendung von FinePic®, München; Mary Liz Austin, Danita Delimont / Alamy Stock Foto; anneleven / getty images; Liubomir Paut-Fluerasu / Arcangel; Neal Pritchard / Stocksy
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-22807-1V001
www.heyne.de
www.nicholas-sparks.de
Für Pam Pope und Oscara Stevick
Alle Jahre wieder
Manhattan,
Dezember 2019
Immer im Dezember verwandelte Manhattan sich in einen Stadtteil, den Maggie kaum wiedererkannte. Touristen strömten in die Vorstellungen am Broadway, drängten sich auf den Bürgersteigen vor den Kaufhäusern in Midtown, bildeten einen behäbigen Fußgängerfluss. Boutiquen und Restaurants quollen über von tütenbewehrten Kunden, Weihnachtsmusik sickerte aus versteckten Lautsprechern, sogar Hotellobbys waren mit Glitzerschmuck dekoriert. Der Baum im Rockefeller Center leuchtete vor bunten Kugeln und den Blitzen Tausender Smartphones, und der Verkehr, selbst in den besten Zeiten nicht gerade flüssig, staute sich derart, dass man häufig zu Fuß schneller war. Wobei das Gehen andere Unannehmlichkeiten mit sich brachte; oft peitschte ein eisiger Wind durch die Straßen und machte lange Unterwäsche, mehrere Fleece-Schichten und bis zum Kinn geschlossene Jackenkragen erforderlich.
Maggie Dawes, die sich selbst als von Fernweh getriebene Lebenskünstlerin betrachtete, hatte New York während der Weihnachtszeit rein theoretisch immer geliebt, im Sinne eines hübschen Postkartenmotivs. Praktisch allerdings mied sie Midtown um die Feiertage, so gut es ging. Entweder blieb sie in der Nähe ihrer Wohnung in Chelsea, oder, was die Regel war, sie floh in wärmere Gegenden. Als Reisefotografin sah sie sich manchmal weniger als New Yorkerin denn als Nomadin, die zufällig eine feste Adresse in der Stadt besaß. In einem Büchlein, das sie in ihrem Nachttisch aufbewahrte, hatte sie eine Liste von mehr als einhundert Orten erstellt, die sie noch sehen wollte, manche davon so abseitig oder entlegen, dass schon die Anreise eine Herausforderung war.
Seit sie vor zwanzig Jahren das College abgebrochen hatte, war die Liste immer länger geworden, obwohl sie durch ihre Reisen einige Ziele hatte abhaken können. Doch unterwegs waren ihr dann andere Orte aufgefallen, die ihre Fantasie beflügelten. Mit der Kamera über der Schulter hatte sie jeden Kontinent besucht, über achtzig Länder und dreiundvierzig der fünfzig Staaten der USA. Sie hatte Zehntausende Fotos gemacht, von wilden Tieren im Okavango Delta in Botsuana bis hin zu den Polarlichtern in Lappland. Es gab Bilder, die sie auf dem Inka-Pfad aufgenommen hatte, andere von der Skelettküste in Namibia und weitere von den Ruinen Timbuktus. Zwölf Jahre zuvor hatte sie Tauchen gelernt und zehn Tage lang die Meeresflora und -fauna in Raja Ampat dokumentiert; vor vier Jahren war sie in Bhutan zum berühmten Taktshang, auch Tigernest genannt, gewandert, einem in die Felswand gebauten buddhistischen Kloster mit Panoramablick auf den Himalaja.
Andere hatten Maggies Abenteuer oft bestaunt – sie allerdings hatte gelernt, dass dies ein Wort mit vielen Konnotationen war, nicht alle davon positiv. Ein gutes Beispiel dafür war das Abenteuer (so beschrieb sie es gelegentlich ihren Followern auf Instagram und YouTube), das sie momentan gerade bestritt und aufgrund dessen sie weitgehend auf ihre Galerie oder ihre kleine Zweizimmerwohnung in der West 19th Street beschränkt war, statt exotischere Orte anzusteuern. Ebenjenes Abenteuer, das hin und wieder Selbstmordgedanken weckte.
Ach, durchziehen würde sie das natürlich niemals. Die Vorstellung jagte ihr eine Heidenangst ein, und das hatte sie auch in einem ihrer vielen YouTube-Beiträge offen eingestanden. Mehr als zehn Jahre lang waren diese Videos – für eine Fotografin – ziemlich unspektakulär gewesen; sie beschrieb darin ihre Entscheidungsprozesse bei der Motivauswahl, bot zahlreiche Photoshop-Kurse an und rezensierte neue Kameras und Zubehör, normalerweise zwei- oder dreimal pro Monat. Zusammen mit ihrem Instagram-Auftritt und ihrer Facebook-Seite waren diese Videos bei Foto-Freaks schon immer beliebt gewesen und hatten gleichzeitig ihr berufliches Renommee aufpoliert.
Dreieinhalb Jahre zuvor allerdings hatte sie ganz spontan ein Video auf ihrem Kanal hochgeladen, das nichts mit ihrem Beruf zu tun hatte. Wahrscheinlich hätte sie die weitschweifige, ungefilterte Beschreibung der Angst und Unsicherheit, die sie bei der Diagnose Melanom im vierten Stadium schlagartig empfunden hatte, besser nicht gepostet. Statt jedoch, wie sie erwartet hatte, eine einsame Stimme zu bleiben, die aus der leeren Weite des Internets widerhallte, erregte sie irgendwie Aufmerksamkeit. Warum oder wie, wusste sie nicht genau, aber ausgerechnet dieses Video erzeugte erst ein Rinnsal, dann einen stetigen Strom und schließlich eine Flut an Kommentaren, Fragen und Likes von Menschen, die noch nie von ihr oder ihrer Arbeit als Fotografin gehört hatten. Da sie das Gefühl hatte, jenen, die von ihrem Zustand bewegt worden waren, eine Reaktion schuldig zu sein, postete sie ein weiteres Video bezüglich ihrer Diagnose, das noch besser ankam. Seitdem veröffentlichte sie ungefähr einmal pro Monat Beiträge dieser Art, hauptsächlich weil sie glaubte, nicht einfach aufhören zu können. In den vergangenen drei Jahren hatte sie deshalb unterschiedliche Behandlungen und ihre Auswirkungen besprochen, manchmal sogar ihre Operationsnarben gezeigt. Sie hatte über Hautreizungen durch Bestrahlung und über Haarverlust gesprochen und sich Gedanken über den Sinn des Lebens gemacht. Sie hatte sich mit ihrer Angst vor dem Sterben befasst und über die Möglichkeit eines Lebens nach dem Tod sinniert. Es waren ernsthafte Themen, dennoch – vielleicht um ihre eigene Schwermut in Schach zu halten, wenn sie so eine trostlose Materie besprach – bemühte sie sich, den Tonfall in den Videos möglichst locker zu halten. Sie nahm an, dass das unter anderem der Grund für deren Beliebtheit war, aber wer wusste das schon? Sicher war nur, dass sie irgendwie, beinahe widerstrebend, der Star ihrer eigenen Reality-Webserie geworden war, einer, die mit Hoffnung begonnen hatte und sich nun langsam auf ein einziges, unausweichliches Ende zubewegte.
Und während das große Finale immer näher kam, wuchs – vielleicht gar nicht so überraschend – ihre Zuschauerschaft noch einmal um ein Vielfaches an.
Im ersten Krebsvideo – so nannte Maggie sie im Geiste, im Gegensatz zu ihren richtigen Videos – sah sie mit einem schiefen Grinsen genau in die Kamera und sagte: »Ich hab ihn spontan sofort gehasst. Er ist mir echt an die Nieren gegangen.«
Sie wusste, dass es wahrscheinlich etwas geschmacklos war, Witze über ihre Krankheit zu machen, nur kam ihr das Ganze so absurd vor. Warum sie? Damals war sie sechsunddreißig Jahre alt, trieb regelmäßig Sport und ernährte sich einigermaßen gesund. Krebs lag bei ihr nicht in der Familie. Sie war im wolkenverhangenen Seattle aufgewachsen und wohnte in Manhattan, am übermäßigen Sonnenbaden konnte es also ebenfalls nicht gelegen haben. Sie hatte noch nie ein Solarium besucht. Nichts passte zusammen, aber genau das war die Sache mit dem Krebs, oder nicht? Krebs machte keine Unterschiede zwischen Menschen; wenn man Pech hatte, bekam man ihn einfach, und so fand sie sich nach einer Weile schließlich damit ab, dass die Frage eher lautete: Warum nicht sie? Sie war nichts Besonderes. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte es Momente in ihrem Leben gegeben, in denen sie sich für interessant oder intelligent oder gar hübsch gehalten hatte, das Wort besonders aber war ihr nie in den Sinn gekommen.
Zum Zeitpunkt ihrer Diagnose hätte sie schwören können, kerngesund zu sein. Einen Monat vorher hatte sie sich auf der zu den Malediven gehörenden Insel Vaadhoo aufgehalten, zu einem Fotoshooting für Condé Nast. Sie hatte vor, das Meeresleuchten knapp vor der Küste einzufangen, das die Wellen funkeln ließ wie einen Sternenhimmel, wie von innen angestrahlt. Meeresplankton erzeugte das spektakuläre spektrale Licht, und Maggie hatte extra Zeit eingeplant, um ein paar Bilder für persönliche Zwecke zu schießen, vielleicht, um sie in ihrer Galerie zu verkaufen.
Mit einer Kamera in der Hand war sie nachmittags an einem fast menschenleeren Strand unweit ihres Hotels unterwegs, um den Bildausschnitt für die Aufnahme zu planen, die sie gegen Abend machen wollte. Sie stellte sich einen Ansatz von Küste vor, vielleicht mit einem Felsen im Vordergrund, den Himmel und natürlich die Wellen kurz vor dem Brechen. Mehr als eine Stunde lang probierte sie bereits unterschiedliche Blickwinkel und Positionen aus, als ein Pärchen händchenhaltend an ihr vorbeispazierte. Völlig in ihre Arbeit versunken, nahm sie die beiden kaum wahr.
Kurz darauf, während sie im Sucher die Brandungszone betrachtete, hörte sie die Stimme der Frau hinter sich. Sie sprach Englisch, wenn auch mit einem deutlichen deutschen Akzent.
»Entschuldigung, ich sehe, dass Sie beschäftigt sind, tut mir leid, dass ich störe.«
Maggie senkte die Kamera. »Ja bitte?«
»Sie darauf anzusprechen ist ein bisschen unangenehm, aber haben Sie diesen dunklen Fleck auf Ihrer Schulter schon mal untersuchen lassen?«
Maggie runzelte die Stirn, verdrehte den Kopf und versuchte vergeblich, die Stelle zwischen den Trägern ihres Badeanzugs zu erkennen, von der die Rede war. »Ich wusste gar nicht, dass ich da einen dunklen Fleck habe.« Fragend kniff sie die Augen zusammen. »Und warum interessiert Sie das so?«
Die Frau, um die fünfzig, mit kurzen grauen Haaren, nickte. »Ich sollte mich erst mal vorstellen. Mein Name ist Dr. Sabine Kessel«, sagte sie. »Ich bin Hautärztin in München. Der Fleck sieht abnorm aus.«
Maggie blinzelte. »Sie meinen, wie Krebs?«
»Das weiß ich nicht«, sagte die Frau mit vorsichtiger Miene. »Aber wenn ich Sie wäre, würde ich ihn so bald wie möglich untersuchen lassen. Er kann natürlich auch harmlos sein.«
Oder eben nicht, brauchte Dr. Kessel nicht dazuzusagen.
Auch wenn die Aufnahme sie fünf Abende kostete, war Maggie mit den Rohdaten sehr zufrieden. Sie wollte sie noch intensiv digital nachbearbeiten – heutzutage entstand die echte Kunst in der Fotografie fast immer in der Nachbearbeitung –, wusste aber bereits, dass das Ergebnis fantastisch sein würde. Außerdem, und obwohl sie versuchte, sich keine Sorgen zu machen, vereinbarte sie vier Tage nach ihrer Rückkehr einen Termin bei Dr. Snehal Khatri, einem Hautarzt in der Upper East Side.
Anfang Juli 2016 fand die Biopsie statt, im Anschluss wurden weitere Tests angeordnet. Noch im selben Monat wurden im Memorial Sloan-Kettering Hospital eine MRT und eine PET durchgeführt. Als die Ergebnisse da waren, setzte Dr. Khatri sich mit Maggie ins Besprechungszimmer, wo er ihr ruhig und ernst mitteilte, dass sie ein Melanom im vierten Stadium hatte. Später an jenem Tag wurde ihr eine Onkologin namens Leslie Brodigan vorgestellt, die ihre Behandlung betreuen sollte. Nach diesen Gesprächen setzte Maggie sich zu einer eigenen Recherche an den Computer. Obwohl Dr. Brodigan ihr erklärt hatte, dass allgemeine Statistiken für die einzelne Prognose wenig zu bedeuten hatten, konnte Maggie nicht anders, als sich auf die Zahlen zu fixieren. Die Fünfjahresüberlebensrate für Patienten mit einem Melanom im vierten Stadium lag bei unter fünfzehn Prozent.
In absoluter Fassungslosigkeit drehte Maggie am nächsten Tag ihr erstes Krebsvideo.
Bei ihrem zweiten Termin erläuterte Dr. Brodigan – eine lebhafte blonde Frau mit blauen Augen, die wie die personifizierte Gesundheit wirkte – Maggie ihre Diagnose noch einmal, da sie beim ersten so überfordert von allem gewesen war, dass sie sich nur bruchstückhaft erinnern konnte. Im Wesentlichen bedeutete Stadium IV, dass der Krebs nicht nur in die Lymphknoten gestreut hatte, sondern auch in die Organe, in ihrem Fall sowohl Leber als auch Nieren. Die Tomografien zeigten, dass die Krebszellen über die gesünderen Teile ihres Körpers hergefallen waren wie eine Armee von Ameisen über Essensreste auf einem Picknicktisch.
Um es kurz zu machen: In den nächsten dreieinhalb Jahren folgte eine Therapie auf die andere, unterbrochen von kurzen Hoffnungsschimmern, die als Lichter am Ende dunkler Angsttunnel auftauchten. Die befallenen Lymphknoten sowie die Metastasen in Leber und Nieren wurden operativ entfernt. Darauf folgte Bestrahlung, was entsetzlich war, schwarze Stellen auf der Haut und unschöne Narben hinterließ. Maggie erfuhr auch, dass es unterschiedliche Arten von Melanomen gab, selbst bei jenen des vierten Stadiums, die wiederum andere Behandlungsoptionen bedingten. In ihrem Fall hieß das Immuntherapie, was ungefähr zwei Jahre lang ganz gut funktionierte und dann plötzlich gar nicht mehr. Im vergangenen April schließlich hatte sie eine monatelange Chemotherapie begonnen, die sie als schrecklich empfand, von deren Wirksamkeit sie aber überzeugt war. Denn wie konnte sie nicht wirken, wo sie doch offenbar alles andere in ihr auch abtötete?
Dieser Tage erkannte sie sich kaum noch im Spiegel. Essen schmeckte praktisch immer zu bitter oder zu salzig, weshalb sie nur schwer etwas herunterbekam und mehr als zehn Kilo abgenommen hatte, obwohl sie vorher schon zierlich gewesen war. Ihre mandelförmigen braunen Augen wirkten eingesunken und zu groß über den hervorstehenden Wangenknochen, ihr Gesicht sah eher aus wie ein mit Haut bespannter Schädel. Ihr war unentwegt kalt, weshalb sie sogar in ihrer überheizten Wohnung dicke Pullis trug. Ihre braunen Haare waren anfangs komplett ausgefallen und wuchsen mittlerweile langsam büschelweise nach, heller und so fein wie die eines Babys; sie hatte sich angewöhnt, so gut wie immer ein Kopftuch oder eine Mütze aufzusetzen. Ihr Hals war so dünn und zerbrechlich geworden, dass sie einen Schal darum wickelte, weil sie sonst erschrak, wenn sie ihn zufällig in einem Spiegel entdeckte.
Vor etwas über einem Monat, Anfang November, waren wieder CT- und PET-Aufnahmen gemacht worden, und jetzt, im Dezember, hatte sie einen Termin bei Dr. Brodigan gehabt. Die Ärztin war stiller als üblich gewesen, die Augen voller Mitgefühl. Sie teilte Maggie mit, dass die drei Jahre Behandlung die Krankheit zwar phasenweise verlangsamt, ihr Fortschreiten aber nie ganz gestoppt hatten. Auf Maggies Frage, welche anderen Therapien noch zur Verfügung stünden, kam die Ärztin sanft auf die Qualität der ihr noch verbleibenden Lebenszeit zu sprechen.
Es war ihre Art gewesen, Maggie zu vermitteln, dass sie sterben musste.
Die Galerie hatte Maggie neun Jahre vorher mit einem anderen Künstler namens Trinity eröffnet, dessen riesige, fantasievolle Skulpturen den Großteil des verfügbaren Raums einnahmen. Trinitys echter Name war Fred Marshburn, und die beiden waren sich bei einer Vernissage begegnet, jener Art von Veranstaltung, die Maggie selten besuchte. Trinity war damals bereits irrsinnig erfolgreich und spielte schon länger mit dem Gedanken an eine eigene Galerie, hatte allerdings keine Lust, sich selbst darum zu kümmern, und auch nicht vor, sich viel dort aufzuhalten. Da die beiden sich auf Anhieb gut verstanden und da Maggies Fotografien keinerlei Konkurrenz zu Trinitys Arbeit darstellten, einigten sie sich. Dafür, dass sie die Geschäfte führte, bekam sie ein bescheidenes Gehalt und konnte zudem ausgewählte Fotos ausstellen. Ihr ging es mehr um das Prestige – sie konnte erzählen, dass sie eine eigene Galerie besaß! – als um das Geld, das Trinity ihr bezahlte. In den ersten ein, zwei Jahren verkaufte sie nur wenige eigene Bilder.
Da Maggie zu der Zeit noch sehr viel auf Reisen war, durchschnittlich gut einhundert Tage im Jahr, übernahm das eigentliche Tagesgeschäft der Galerie eine Frau namens Luanne Sommers. Luanne war eine wohlhabende Geschiedene mit erwachsenen Kindern. Ihre Erfahrung beschränkte sich auf eine Amateursammler-Leidenschaft und einen Expertenblick für Schnäppchen bei Neiman Marcus. Dafür war sie gut gekleidet, zuverlässig, lernwillig und störte sich nicht daran, dass sie kaum mehr als den Mindestlohn verdiente. So, wie sie es formulierte, reichte ihr Unterhalt zwar für ein Leben im Luxus, aber schicke Mittagessen und Shoppen als einziger Lebensinhalt konnten eine Frau in den Wahnsinn treiben.
Luanne erwies sich als Naturtalent. Zu Beginn machte Maggie sie mit den technischen Elementen ihres Werks sowie der Entstehungsgeschichte jeder einzelnen Aufnahme vertraut, die häufig für Käufer genauso interessant wie das Bild selbst waren. Trinitys Skulpturen aus allen möglichen Materialien – von Leinwand, Metall, Plastik, Kleber und Farbe über Schrottplatzfunde bis hin zu Hirschgeweihen, Gurkengläsern und Dosen – waren originell genug, um lebhafte Diskussionen anzuregen. Da er ein Liebling der Kunstwelt war, gingen seine Werke ziemlich regelmäßig über den Ladentisch, trotz der exorbitanten Preise. Aber die Galerie stellte nicht viele Gastkünstler aus, weshalb normalerweise nicht allzu viel Kundenverkehr herrschte. Es gab Tage, an denen nur eine Handvoll Besucher auftauchte, und in den letzten drei Wochen des Jahres blieb die Galerie ganz geschlossen. Für Maggie, Trinity und Luanne war es ein Arrangement, das lange Zeit gut funktionierte.
Doch zwei Dinge passierten, die all das änderten. Erstens lockten Maggies Krebsvideos neues Publikum in die Galerie. Nicht die üblichen sachkundigen Liebhaber zeitgenössischer Kunst oder Fotografie, sondern Touristen aus Gegenden wie Tennessee oder Ohio, Menschen, die Maggie auf Instagram und YouTube folgten, weil sie sich ihr verbunden fühlten. Manche waren dadurch zu echten Fans ihrer Bilder geworden, viele aber wollten sie einfach nur kennenlernen oder einen ihrer signierten Abzüge als Andenken erwerben. Pausenlos klingelte das Telefon, weil Anrufer aus allen erdenklichen Landesteilen Bestellungen aufgaben, und zusätzlich wurden Werke über die Website gekauft. Maggie und Luanne hatten alle Hände voll zu tun und im vergangenen Jahr daher beschlossen, die Galerie über die Weihnachtszeit geöffnet zu lassen, weil der Besucherstrom nicht abriss. Dann erfuhr Maggie, dass sie bald ihre Chemotherapie beginnen musste, was bedeutete, dass sie monatelang nicht in der Galerie würde aushelfen können. Es war klar, dass sie einen zusätzlichen Angestellten brauchten, und als Maggie das Thema Trinity gegenüber ansprach, willigte er sofort ein. Wie das Schicksal es wollte, spazierte am nächsten Tag ein junger Mann namens Mark Price durch die Tür und bat darum, mit Maggie sprechen zu dürfen, ein Ereignis, das ihr damals beinahe als zu gut erschien, um wahr zu sein.
Mark Price war ein College-Absolvent, der gut auch als Schüler hätte durchgehen können, und anfangs dachte Maggie, er wäre ein weiteres »Krebs-Groupie«, was allerdings nur halb stimmte. Er räumte ein, durch ihre Internetpräsenz auf ihre Arbeit aufmerksam geworden zu sein – besonders gern möge er ihre Videos –, hatte aber auch schon seinen Lebenslauf dabei. Er erklärte, er sei auf Arbeitssuche, und die Vorstellung, in der Kunstwelt tätig zu werden, reize ihn sehr. Kunst und Fotografie, ergänzte er noch, ermöglichten die Vermittlung neuer Ideen, häufig mehr, als Worte es vermochten.
Trotz ihrer Bedenken, einen Fan einzustellen, setzte Maggie sich noch am selben Tag mit ihm zusammen, und es war unübersehbar, dass er seine Hausaufgaben gemacht hatte. Er wusste viel über Trinity und seine Arbeit, erwähnte eine spezielle Installation, die gerade im Museum of Modern Art ausgestellt war, und eine weitere in The New School, zog auf eine kompetente, aber unaufdringliche Art Vergleiche zu einigen späteren Werken Robert Rauschenbergs. Es überraschte Maggie nicht, dass er auch eine fundierte und beeindruckende Kenntnis ihrer eigenen Arbeit besaß. Dennoch, obwohl er all ihre Fragen zufriedenstellend beantwortet hatte, blieb ein gewisses Unbehagen; sie war sich einfach nicht schlüssig, ob es ihm tatsächlich ernst damit war, in einer Galerie zu arbeiten, oder ob er einfach nur jemand war, der ihre, Maggies, Tragödie aus nächster Nähe miterleben wollte.
Gegen Ende ihres Gesprächs erklärte sie, dass derzeit noch keine Stelle ausgeschrieben sei, was im Prinzip auch stimmte, wenn es auch nur eine Frage der Zeit war. Woraufhin er höflich fragte, ob sie dennoch bereit sei, seinen Lebenslauf entgegenzunehmen. Es war, dachte sie rückblickend, seine Formulierung gewesen, die ihn ihr sympathisch machte. »Wären Sie dennoch bereit, meinen Lebenslauf entgegenzunehmen?« Das hörte sich für sie so wohlerzogen und altmodisch an, dass sie sich ein Lächeln nicht verkneifen konnte und die Hand nach den Unterlagen ausstreckte.
Später in jener Woche lud Maggie ein Stellenangebot auf mehreren Websites im Bereich der Kunstbranche hoch und informierte einige Kollegen in anderen Galerien telefonisch, dass sie jemanden suchten. Lebensläufe und Anfragen fluteten ihren Posteingang, und Luanne traf sich mit sechs Kandidaten, während Maggie sich zu Hause von ihrer ersten Infusion erholte. Nur eine Bewerberin überstand die erste Runde, wurde aber, da sie zum zweiten Gespräch nicht auftauchte, ebenfalls gestrichen. Entnervt besuchte Luanne Maggie, um sie auf den neuesten Stand zu bringen. Maggie hatte seit Tagen ihre Wohnung nicht verlassen, lag auf der Couch und nippte an dem Fruchtsmoothie mit Eiskrem, den Luanne ihr mitgebracht hatte, eins der wenigen Lebensmittel, das sie noch hinunterwürgen konnte.
»Schwer zu glauben, dass wir niemand Qualifizierten für die Galerie finden.« Maggie schüttelte den Kopf.
»Die haben keine Erfahrung und keine Ahnung von Kunst«, schnaubte Luanne.
Hattest du früher auch nicht, hätte Maggie sagen können, schwieg aber, weil Luanne sich sowohl nicht nur als Angestellte, sondern auch als Freundin als Juwel erwiesen hatte, ein absoluter Glücksgriff. Mit ihrer herzlichen und unerschütterlichen Art war Luanne schon lange nicht mehr nur Kollegin.
»Ich vertraue deiner Einschätzung, Luanne. Fangen wir einfach noch mal von vorn an.«
»Bist du sicher, dass sonst niemand infrage kam?«
Luannes Tonfall war klagend. Aus unerfindlichen Gründen fiel Maggie in dem Moment Mark Price ein, der so höflich gebeten hatte, ihr seinen Lebenslauf überlassen zu dürfen.
»Du lächelst«, sagte Luanne.
»Nein.«
»Ich merke doch, wenn ich ein Lächeln sehe. Woran hast du gerade gedacht?«
Maggie trank noch einen Schluck von ihrem Smoothie, um Zeit zu schinden, bis sie endlich beschloss, damit herauszurücken. »Bevor wir die Stellenanzeige geschaltet haben, kam ein junger Mann vorbei.« Sie beschrieb das Gespräch. »Ich bin immer noch unsicher«, endete sie, »aber sein Lebenslauf liegt wahrscheinlich irgendwo auf meinem Schreibtisch im Büro.« Sie zuckte die Achseln. »Keine Ahnung, ob er überhaupt noch zu haben ist.«
Als Luanne sich nach dem Grund für Marks Interesse erkundigte, runzelte sie die Stirn. Sie kannte sich am besten mit der Kundschaft der Galerie aus und wusste, dass Menschen, die Maggies Videos gesehen hatten, sie häufig als Vertraute betrachteten, als jemanden, der sowohl Verständnis als auch Mitgefühl haben müsste. Oftmals wollten sie unbedingt von sich selbst erzählen, von den Leiden, die sie erduldet hatten, von ihren Verlusten. Und sosehr Maggie sie gern getröstet hätte – häufig war es zu viel für sie, andere emotional zu unterstützen, wo ihre Kraft doch kaum für sie selbst ausreichte. Luanne schirmte sie deshalb vor den aggressiveren Kontaktsuchern ab, so gut sie konnte.
»Ich seh mir den Lebenslauf mal an und spreche mit ihm«, sagte sie jetzt. »Gehen wir es einfach Schritt für Schritt an.«
Sie setzte sich mit Mark in Verbindung. Ihr erstes Treffen führte zu zwei weiteren offiziellen Vorstellungsgesprächen, davon eins zusammen mit Trinity. Luanne lobte ihn hinterher überschwänglich, aber Maggie bestand darauf, zur Sicherheit selbst noch einmal mit ihm zu reden. Es dauerte vier Tage, bis sie die Energie aufbrachte, in die Galerie zu kommen. Mark Price war pünktlich, trug einen Anzug und hatte einen dünnen Ordner bei sich. Sie fühlte sich hundeelend, während sie seinen Lebenslauf durchlas, in dem stand, dass er aus Elkhart, Indiana, stammte und wann er seinen Abschluss an der Northwestern gemacht hatte.
»Sie sind also zweiundzwanzig Jahre alt?«
»Ja.«
Mit seiner ordentlich gescheitelten Frisur, den blauen Augen und dem kindlichen Gesicht sah er aus wie ein für den Abschlussball zurechtgemachter Schüler. »Und Ihr Hauptfach auf dem College war Theologie?«
»Genau.«
»Warum?«
»Mein Vater ist Pastor«, sagte er. »Früher oder später möchte ich noch ein Theologie-Studium anhängen. Um in seine Fußstapfen zu treten.«
Sobald er das ausgesprochen hatte, stellte Maggie fest, dass sie kein bisschen überrascht war. »Warum dann das Interesse an Kunst, wenn Sie später mal als Geistlicher arbeiten möchten?«
Er legte die Fingerspitzen aneinander. »Ich war immer der Ansicht, dass Religion und Kunst viel gemeinsam haben. Beides ermöglicht Menschen, die Nuancen der eigenen Emotionen zu erforschen und Antworten darauf zu finden, was ein Werk für sie darstellt. Ihre Arbeit und die von Trinity bringen mich immer zum Nachdenken, und vor allem bringen sie mich zum Empfinden, zum Staunen. Genau wie mein Glaube.«
Obwohl es eine gute Antwort war, argwöhnte Maggie, dass Mark noch etwas verschwieg. Doch sie schob diese Bedenken beiseite und stellte ihm einige konventionellere Fragen über seine Arbeitserfahrungen und Kenntnisse in Fotografie und zeitgenössischer Bildhauerei, bevor sie sich schließlich zurücklehnte.
»Warum glauben Sie, dass Sie sich hier in der Galerie bewähren würden?«
Er wirkte ungerührt von ihrem Kreuzverhör. »Erstens mal habe ich den Eindruck, dass Ms. Sommers und ich gut zusammenarbeiten würden. Im Anschluss an das Gespräch mit ihr bin ich noch für eine Weile in der Galerie geblieben und habe, nach etwas zusätzlicher Recherche, ein paar Gedanken über die momentan ausgestellten Arbeiten niedergeschrieben.« Er beugte sich vor und streckte ihr die Mappe hin. »Ms. Sommers habe ich ebenfalls eine Kopie gegeben.«
Maggie blätterte zu einer beliebigen Seite und las ein paar Absätze über ein Foto, das sie 2011 in Dschibuti aufgenommen hatte, als das Land gerade von einer der schlimmsten Dürren seit Jahrzehnten geplagt wurde. Im Vordergrund sah man die skelettierten Überreste eines Kamels, im Hintergrund liefen drei Familien in leuchtend bunter Kleidung fröhlich lachend an einem ausgetrockneten Flussbett entlang. Am Himmel ballten sich Gewitterwolken, die sich in der untergehenden Sonne orange und rot gefärbt hatten, ein lebhafter Kontrast zu den ausgebleichten Knochen des Tiers und den tiefen Rissen in der Erde, an denen man die ausgebliebenen Regenfälle ablesen konnte.
Marks Überlegungen verrieten verblüffende technische Kenntnis und ein reifes Verständnis ihrer künstlerischen Intentionen; sie hatte einen unvermuteten Optimismus inmitten der Verzweiflung abbilden wollen, die Bedeutungslosigkeit des Menschen gegenüber der launischen Kraft der Natur, und Mark hatte diese Intentionen sehr gut zum Ausdruck gebracht.
Maggie klappte die Mappe zu, da sie wusste, dass sie den Rest nicht zu lesen brauchte.
»Sie sind sichtlich vorbereitet, und in Anbetracht Ihres Alters scheinen Sie überraschend gut qualifiziert. Darum geht es mir aber eigentlich nicht. Ich möchte trotzdem den echten Grund erfahren, warum Sie hier arbeiten wollen.«
Er furchte die Stirn. »Ich finde Ihre Fotos außergewöhnlich. Genau wie Trinitys Skulpturen.«
»Ist das alles?«
»Ich bin nicht ganz sicher, was Sie meinen.«
»Ich will offen sein.« Maggie atmete tief aus. Sie war zu müde und zu krank, hatte zu wenig Zeit, um etwas anderes als offen zu sein. »Sie kamen mit Ihrem Lebenslauf hierher, ehe wir auch nur die Stelle ausgeschrieben hatten, und Sie geben zu, dass Sie ein Fan meiner Videos sind. Das macht mir Sorgen, weil die Leute, die diese Videos gesehen haben, manchmal ein falsches Gefühl von Vertrautheit mit mir empfinden. So jemanden kann ich hier nicht arbeiten lassen.« Sie zog die Augenbrauen hoch. »Stellen Sie sich vor, dass wir uns anfreunden und tiefe, bedeutungsschwere Gespräche führen werden? Denn das ist eher unwahrscheinlich. Ich bezweifle, dass ich oft hier sein werde.«
»Das verstehe ich«, sagte er freundlich und unaufgeregt. »An Ihrer Stelle ginge es mir vermutlich genauso. Ich kann Ihnen nur versichern, dass meine Absicht ist, ein ausgezeichneter Angestellter zu sein.«
Sie traf ihre Entscheidung nicht sofort. Vielmehr nahm sie sich vor, darüber zu schlafen, und beriet sich am nächsten Tag mit Luanne und Trinity. Trotz ihrer andauernden Zweifel beschlossen sie, es zu wagen, und Mark trat die Stelle Anfang Mai an.
Glücklicherweise hatte Mark Maggie seitdem keinen Anlass gegeben, ihre Entscheidung zu bereuen. Da sie von der Chemotherapie den gesamten Sommer über mehr oder weniger außer Gefecht gesetzt war, hatte sie nur ein paar Stunden pro Woche in der Galerie verbracht, in diesen wenigen Momenten aber hatte Mark sich absolut professionell verhalten. Er begrüßte sie fröhlich, lächelte viel und nannte sie immer Ms. Dawes. Er kam nie zu spät, meldete sich nicht krank und störte sie selten, klopfte nur an ihre Tür, wenn ein seriöser Käufer oder Sammler explizit nach ihr fragte und Mark es für wichtig genug hielt, sie damit zu behelligen. Vielleicht, weil er sich das Gespräch zu Herzen genommen hatte, sprach er sie nie auf ihre neuesten Videos an und stellte ihr auch keine persönlichen Fragen. Gelegentlich verlieh er seiner Hoffnung Ausdruck, dass es ihr gut ging, was sie akzeptierte, weil er sich nicht genauer erkundigte und es damit ihr überließ, ob sie sich weiter dazu äußerte.
Außerdem machte er die Arbeit ganz hervorragend. Er behandelte Kunden höflich und charmant, lotste die Krebs-Groupies elegant Richtung Ausgang und war ein fantastischer Verkäufer, wahrscheinlich, weil er überhaupt nicht penetrant war. Er hob normalerweise nach dem zweiten oder dritten Klingeln das Telefon ab und packte die bestellten Abzüge sorgsam ein, bevor er sie verschickte. In der Regel blieb er nach Ladenschluss noch mindestens eine Stunde, um seine Aufgaben zu erledigen. Luanne war so beeindruckt von ihm, dass sie keine Bedenken hatte, den gesamten Dezember mit ihrer Tochter und den Enkeln auf Maui Urlaub zu machen, wie jedes Jahr, seit sie in der Galerie angefangen hatte.
Nichts von alledem, stellte Maggie fest, war unerwartet. Womit sie allerdings nicht gerechnet hatte, war, dass ihre Vorbehalte Mark gegenüber langsam einem wachsenden Vertrauen gewichen waren.
Wann das passiert war, konnte sie nicht genau sagen. Wie bei Wohnungsnachbarn, die regelmäßig zusammen im Aufzug fahren, hatte ihr freundlich höfliches Verhältnis sich zu einer angenehmen Vertrautheit entwickelt. Ab September, nach ihrer letzten Infusion, als es ihr langsam wieder besser ging, kam Maggie häufiger in die Galerie. Die übliche kurze Begrüßung ging nach und nach über in Small Talk und schließlich persönlichere Gespräche. Manchmal fanden diese in dem kleinen Pausenraum neben Maggies Büro statt, andere Male im Ausstellungsraum, wenn gerade keine Kundschaft da war. Hauptsächlich aber, wenn die Galerie geschlossen hatte und sie zu dritt die Bilder zum Versand vorbereiteten, die telefonisch oder über die Website bestellt worden waren. Normalerweise beherrschte Luanne die Unterhaltung, plauderte über den schlechten Frauengeschmack ihres Exmanns oder über ihre Kinder und Enkel. Maggie und Mark begnügten sich damit, ihr zuzuhören – Luanne konnte wirklich amüsant sein. Hin und wieder verdrehte einer von ihnen die Augen über etwas, das Luanne sagte (»Garantiert zahlt er dieser geldgeilen Tussi die ganzen Schönheits-OPs«), woraufhin der andere verstohlen grinste, eine heimliche Kommunikation nur zwischen ihnen beiden.
Ab und zu allerdings musste Luanne sofort nach Ladenschluss gehen. Dann arbeiteten Mark und Maggie allein weiter, und dabei erfuhr Maggie im Laufe der Zeit einiges über Mark, während er es nach wie vor unterließ, ihr persönliche Fragen zu stellen. Er erzählte ihr von seinen Eltern und seiner Kindheit, die Maggie stark an die Welt von Norman Rockwell erinnerte, samt Gutenachtgeschichten, Eishockey und Baseball und gewissenhafter Anwesenheit seiner Eltern bei jedwedem schulischen Ereignis. Er sprach auch häufig von seiner Freundin Abigail, die an der University of Chicago Wirtschaftswissenschaften studierte. Wie Mark war sie in einer Kleinstadt aufgewachsen (in ihrem Fall Waterloo, Iowa), und er hatte zahllose Fotos von ihnen beiden auf seinem Handy. Die Bilder zeigten eine hübsche, rothaarige junge Frau mit einer sonnigen, bodenständigen Ausstrahlung, und Mark erwähnte, dass er vorhabe, ihr nach ihrem Examen einen Antrag zu machen. Maggie musste lachen, als er das sagte. Warum so jung heiraten?, fragte sie. Warum nicht noch ein paar Jahre warten?
»Weil sie diejenige ist, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen möchte.«
»Woher wollen Sie das wissen?«
»Manchmal weiß man so was einfach.«
Je besser sie ihn kennenlernte, desto überzeugter war sie, dass seine Eltern genauso viel Glück mit ihm gehabt hatten wie er mit ihnen. Er war ein vorbildlicher junger Mann, verantwortungsvoll und liebenswürdig, der Gegenbeweis für die angebliche Faulheit und Verwöhntheit der Generation Y. Gleichzeitig wunderte Maggie sich über ihre wachsende Zuneigung zu ihm, und wenn nur, weil sie so wenig gemeinsam hatten. Maggies frühe Jahre waren … ungewöhnlich gewesen, zumindest phasenweise, und ihr Verhältnis zu ihren Eltern häufig angespannt. Sie selbst war völlig anders als Mark gewesen. Während er fleißig gelernt hatte und einen Abschluss mit Auszeichnung von einem renommierten College besaß, hatte sie sich in der Schule immer schwergetan und ihre weitere Ausbildung im dritten Semester abgebrochen. In seinem Alter hatte es ihr gereicht, im Jetzt zu leben und Entscheidungen spontan zu treffen, wohingegen er offenbar alles durchgeplant hatte. Hätte sie ihn als jüngere Frau kennengelernt, hätte sie sich vermutlich nicht weiter mit ihm abgebeben; zwischen zwanzig und dreißig hatte sie sich grundsätzlich für genau die falschen Männer entschieden.
Trotz allem erinnerte er sie manchmal an jemanden, den sie vor langer, langer Zeit gekannt, jemanden, der ihr einmal alles bedeutet hatte.
Als Thanksgiving vor der Tür stand, betrachtete Maggie Mark bereits als Teil der Galerie-Familie. Auch wenn ihr Verhältnis zu ihm nicht so eng wie das zu Luanne oder Trinity war, die sie immerhin schon jahrelang kannte, hatte es sich zu etwas Freundschaftsähnlichem entwickelt. Zwei Tage nach jenem Feiertag blieben sie alle vier nach Geschäftsschluss noch etwas in der Galerie sitzen. Es war ein Samstag, und da Luanne am nächsten Morgen nach Maui und Trinity in die Karibik flog, entkorkten sie eine Flasche Wein zu der Käseplatte, die Luanne rasch bestellt hatte. Auch Maggie ließ sich ein Glas einschenken, obwohl sie eigentlich weder an Essen noch an Trinken denken mochte.
Sie stießen auf den Erfolg der Galerie an, da es ihr mit Abstand bestes Jahr bisher gewesen war, und unterhielten sich dann noch eine Weile. Irgendwann überreichte Luanne Maggie eine Karte.
»Da ist ein Geschenk drin«, sagte Luanne. »Mach es erst auf, wenn ich weg bin.«
»Aber ich konnte noch gar nichts für dich besorgen.«
»Das macht überhaupt nichts. Dass es dir die letzten Monate wieder so viel besser ging, ist Geschenk genug für mich. Aber vergiss nicht, es auf jeden Fall vor Weihnachten zu öffnen.«
Nachdem Maggie ihr das versichert hatte, ging Luanne zu der Käseplatte und nahm sich ein paar Erdbeeren. Etwas abseits unterhielt Trinity sich mit Mark. Da er sogar noch seltener in der Galerie war als Maggie, hörte sie ihn die gleichen persönlichen Fragen stellen wie sie in den letzten Monaten.
»Ich wusste gar nicht, dass Sie Eishockey spielen«, meinte Trinity. »Ich bin ein Riesenfan der Islanders, auch wenn sie seit Ewigkeiten den Stanley Cup nicht mehr gewonnen haben.«
»Es ist ein toller Sport. Ich habe jedes Jahr gespielt, bis ich aufs Northwestern gegangen bin.«
»Haben die keine Mannschaft?«
»Für das College-Team war ich nicht gut genug«, gestand Mark. »Was meinen Eltern allerdings offenbar egal war. Ich glaube nicht, dass sie auch nur ein Spiel versäumt haben.«
»Kommen sie zu Weihnachten zu Besuch?«
»Nein, mein Vater hat für einige Mitglieder unserer Kirche eine Reise ins Heilige Land organisiert. Nazareth, Bethlehem, das volle Programm.«
»Und Sie wollen nicht mit?«
»Es ist ihr Traum, nicht meiner. Außerdem muss ich hier sein.«
Maggie sah Trinity in ihre Richtung schielen, bevor er sich wieder Mark zuwandte. Er beugte sich vor und flüsterte etwas, und obwohl Maggie ihn nicht verstehen konnte, wusste sie genau, was er sagte, da er wenige Minuten vorher ihr gegenüber Ähnliches geäußert hatte.
»Bitte melden Sie sich ab und zu bei Maggie, während Luanne und ich weg sind. Wir machen uns beide Sorgen um sie.«
Als Reaktion nickte Mark nur.
Trinity war hellsichtiger, als ihm wahrscheinlich klar war, andererseits wussten er und Luanne ja von Maggies Termin am 10. Dezember bei Dr. Brodigan. Und tatsächlich hatte Dr. Brodigan Maggie bei ebendiesem Termin aufgefordert, sich auf ihre Lebensqualität zu konzentrieren.
Jetzt war der 18. Dezember. Über eine Woche war seit jenem furchtbaren Tag vergangen, und Maggie war immer noch wie betäubt. Zudem hatte sie niemandem von ihrer Prognose erzählt. Ihre Eltern hatten immer geglaubt, wenn sie nur inständig genug beteten, würde Gott ihre Tochter irgendwie heilen, und ihnen die Wahrheit zu sagen verlangte ihr mehr Energie ab, als sie aufzubringen vermochte. Das Gleiche galt auf etwas andere Art und Weise für ihre Schwester; kurz gesagt fehlt Maggie einfach die Kraft. Mark hatte ihr ein paar Nachrichten geschickt, hatte sich nach ihr erkundigt, aber per Handy über ihre Situation zu sprechen kam ihr absurd vor, und noch fühlte sie sich nicht bereit, sich jemandem anzuvertrauen. Luanne oder auch Trinity konnte sie natürlich anrufen, aber wozu? Luanne hatte es sich verdient, die Zeit mit ihrer Familie zu genießen, ohne sich Sorgen um Maggie zu machen, und Trinity hatte ebenfalls sein eigenes Leben. Außerdem konnte keiner von beiden wirklich etwas tun.
Also hatte Maggie, benommen von ihrer neuen Realität, die vergangenen acht Tage entweder in ihrer Wohnung oder auf kurzen, langsamen Spaziergängen durch ihr Viertel verbracht. Manchmal starrte sie einfach nur aus dem Fenster und strich dabei abwesend über den kleinen Anhänger an der Kette, die sie immer trug; dann wieder beobachtete sie die Menschen. In ihrer ersten Zeit in New York war sie von dem unaufhörlichen Treiben um sich herum fasziniert gewesen, von den in die U-Bahnen strömenden Menschen, den Bürohochhäusern, in denen noch um Mitternacht Leute an Schreibtischen saßen. Jetzt die hektischen Schritte der Fußgänger unter ihrem Fenster zu verfolgen versetzte sie in diese Anfangstage zurück und in die jüngere, gesündere Frau, die sie damals gewesen war. Es schien ihr, als wäre seitdem eine Ewigkeit vergangen, doch gleichzeitig hatte sie das Gefühl, die Jahre wären rasend schnell vorbeigeflogen, und dieser Gegensatz machte sie in sich gekehrter als üblich. Die Zeit, dachte sie, blieb immer schwer fassbar.
Sie hatte kein Wunder erwartet – tief drinnen hatte sie immer gewusst, dass eine Heilung unwahrscheinlich war –, aber wäre es nicht großartig gewesen zu erfahren, dass die Chemotherapie den Krebs etwas gebremst und ihr ein zusätzliches Jahr oder zwei geschenkt hatte? Oder dass es eine neue, experimentelle Behandlungsmethode gab? Wäre das zu viel verlangt gewesen? Eine kleine Pause gewährt zu bekommen, bevor der letzte Akt begann?
Das war das Problem mit dem Kampf gegen den Krebs. Das Warten. So viel in den vergangenen Jahren hatte sich um das Warten gedreht. Auf den Arzttermin warten, auf die Behandlung warten, auf Besserung nach der Behandlung warten. Darauf warten, ob die Behandlung angeschlagen hatte, darauf warten, bis es ihr gut genug ging, um etwas Neues auszuprobieren. Bis zu ihrer Diagnose hatte Maggie Warten auf egal was als Ärgernis betrachtet, doch langsam, aber sicher war es zum bestimmenden Faktor ihres Lebens geworden.
Selbst jetzt, dachte sie plötzlich. Ich warte darauf zu sterben.
Draußen auf dem Bürgersteig hetzten dick eingemummelte Menschen vorbei, deren Atem Wölkchen bildete; eine lange Autoschlange kroch mit leuchtenden Rücklichtern durch die von hübschen Backsteinhäusern gesäumte Straße. Alle waren mit ihrem Alltag beschäftigt, als wäre es ein ganz normaler Tag. Für Maggie hingegen war nichts normal, und sie bezweifelte, dass es das jemals wieder würde.
Sie beneidete sie, diese Fremden, die sie nie kennenlernen würde. Sie führten ihr Leben, ohne die Tage zu zählen, die ihnen noch blieben. Und wie immer waren es sehr viele. Maggie hatte sich inzwischen daran gewöhnt, dass diese Stadt immer überfüllt war, gleichgültig, zu welcher Tages- oder Jahreszeit, was schon die einfachsten Sachen beschwerlich machte. Wenn sie Ibuprofen aus der Apotheke brauchte, gab es eine Schlange vor der Kasse; wenn sie Lust auf einen Kinofilm hatte, musste sie auch dort anstehen. Beim Überqueren einer Straße war sie unweigerlich von anderen umringt, die sich am Bordstein schoben und drängten.
Warum nur die Eile? Das fragte sie sich jetzt, neben so vielem anderen. Wie jeder bereute sie so manches in ihrem Leben, und nun, wo ihr kaum noch Zeit blieb, musste sie daran denken. Sie hatte Dinge getan, die sie wünschte, ungeschehen machen zu können; sie hatte Gelegenheiten versäumt. Über einiges davon hatte sie in einem ihrer Videos gesprochen, hatte eingestanden, dass sie mit diesen Dingen nicht im Reinen und den Antworten keinen Schritt näher war als direkt nach ihrer Diagnose.
Seit ihrem letzten Termin bei Dr. Brodigan hatte sie nicht geweint. Wenn sie nicht gerade aus dem Fenster starrte oder ihre kurzen Spaziergänge unternahm, konzentrierte sie sich auf das Banale. Sie schlief und schlief, durchschnittlich vierzehn Stunden pro Nacht. Sie bestellte online Weihnachtsgeschenke. Sie nahm ein weiteres Krebsvideoüber diese neueste Prognose auf, wenn sie es auch noch nicht hochlud. Sie ließ sich Smoothies liefern und versuchte, sie auszutrinken. Vor Kurzem war sie sogar mittags zum Union Square Café gegangen, um sich dort an der Theke etwas Leckeres zu bestellen. Früher war das eines ihrer Lieblingslokale gewesen, aber auch dieser Ausflug hatte sich als sinnlos erwiesen, weil immer noch alles, was ihr über die Lippen kam, falsch schmeckte. Eine weitere Lebensfreude, die der Krebs ihr geraubt hatte.
Jetzt war es noch eine Woche bis Weihnachten, und als es allmählich schon dämmerte, spürte Maggie das Bedürfnis, die Wohnung zu verlassen. Sie zog sich mehrere Schichten über, weil sie vorhatte, ziellos durch die Gegend zu spazieren. Sobald sie allerdings auf die Straße trat, verflog diese Laune so schnell, wie sie gekommen war. Stattdessen schlug sie spontan den Weg zur Galerie ein. Arbeiten würde sie sicherlich nicht viel, aber es wäre tröstlich zu sehen, dass alles in Ordnung war.
Die Galerie lag mehrere Straßenblocks entfernt, und Maggie ging langsam, versuchte, möglichst nicht angerempelt zu werden. Der Wind war eisig, und als sie schließlich eine halbe Stunde vor Geschäftsschluss die Tür aufstieß, zitterte sie vor Kälte. Es war ungewöhnlich voll; sie hatte wegen der bevorstehenden Feiertage mit schrumpfenden Besucherzahlen gerechnet, aber das war eindeutig ein Irrtum gewesen. Zum Glück hatte Mark offenbar alles unter Kontrolle.
Als sie eintrat, drehten sich die Leute nach ihr um, einige erkannten sie offenbar. Sorry, meine Lieben. Heute nicht, dachte sie plötzlich, winkte nur kurz und hastete in ihr Büro. Sie schloss die Tür hinter sich. Der Raum war eingerichtet mit einem Schreibtisch samt Bürostuhl und einem Einbauregal, das randvoll mit Fotografie-Bänden und Andenken von ihren Reisen war. Ein grauer Zweisitzer vor dem Schreibtisch war gerade groß genug, dass sie sich darauf einkuscheln konnte, wenn sie sich ausruhen musste. In der Ecke stand ein kunstvoll geschnitzter Schaukelstuhl mit geblümten Kissen, den Luanne aus ihrem Landhaus mitgebracht hatte und der dem modernen Büro einen Hauch von Wärme verlieh.
Nachdem Maggie Handschuhe, Mütze und Jacke auf den Tisch gelegt hatte, zog sie das Kopftuch zurecht und ließ sich auf den Bürostuhl fallen. Sie schaltete den Computer ein, sah sich aus Gewohnheit die wöchentlichen Verkaufszahlen an, die gerade in die Höhe schossen, und stellte fest, dass sie nicht in Stimmung war, sich näher damit zu befassen. Also öffnete sie einen anderen Ordner und klickte sich durch ihre Lieblingsfotos, bis sie bei einer Serie landete, die sie im letzten Januar in Ulan-Bator in der Mongolei gemacht hatte. Damals hatte sie nicht geahnt, dass es ihre letzte Auslandsreise sein sollte. Die gesamte Zeit über war es weit unter null Grad gewesen, bei einem beißenden Wind, der unbedeckte Haut in weniger als einer Minute erfrieren konnte. Es hatte einige Mühe gekostet, die Kamera am Laufen zu halten, weil die Bauteile bei so niedrigen Temperaturen zickten. Maggie erinnerte sich, den Apparat wiederholt unter ihre Jacke gesteckt zu haben, um ihn an ihrem Körper zu wärmen, aber die Fotos waren ihr so wichtig gewesen, dass sie den Elementen fast zwei Stunden lang getrotzt hatte.
Sie hatte die extreme Luftverschmutzung und ihre sichtbaren Folgen für die eineinhalb Millionen Einwohner der Stadt dokumentieren wollen. In einem Großteil der Haushalte wurde im Winter Rohkohle zum Heizen und Kochen verbrannt, was den Himmel selbst im hellsten Tageslicht verdunkelte. Es handelte sich sowohl um eine Gesundheitskrise als auch um eine Umweltkrise, und sie hatte mit ihren Bildern Leute zum Handeln bewegen wollen. Auf einer beeindruckenden Schwarz-Weiß-Aufnahme war ein schmutziges Tuch zu sehen, das die miserable Luftqualität eindrucksvoll dokumentierte. Außerdem hatte sie nach einem ausdrucksstarken Stadtpanoramabild gesucht und es schließlich gefunden: ein strahlend blauer Himmel, der abrupt in einen bleichen, ungesund gelben Dunst überging, als hätte Gott selbst eine schnurgerade Linie gezogen. Der Effekt war spektakulär, vor allem nach der stundenlangen Nachbearbeitung.
Als sie nun in ihrem friedlichen Büro dieses Foto betrachtete, wurde ihr bewusst, dass sie so etwas nie wieder machen konnte. Sehr wahrscheinlich verreiste sie nicht mehr, verließ vielleicht nicht einmal mehr Manhattan, außer sie gab dem Wunsch ihrer Eltern nach und kehrte nach Seattle zurück.
Doch auch in der Mongolei hatte sich nichts verändert. Zusätzlich zu ihrer Fotoreportage im New Yorker war auch in anderen Zeitschriften, einschließlich Scientific American und The Atlantic, versucht worden, auf die Luftverschmutzung in Ulan-Bator aufmerksam zu machen, aber wenn es überhaupt eine Änderung gab, hatte sich die Situation in den vergangenen elf Monaten sogar noch verschlechtert. Es war, dachte Maggie unvermittelt, ein weiteres Versagen in ihrem Leben, genau wie ihr Versagen im Kampf gegen den Krebs.
Diese Gedanken hätten eigentlich gar nicht miteinander verknüpft sein dürfen, aber in dem Moment waren sie es, und plötzlich spürte Maggie Tränen aufsteigen. Sie lag im Sterben, lag tatsächlich im Sterben, und schlagartig begriff sie, dass sie demnächst ihr letztes Weihnachten erlebte.
Was sollte sie mit diesen kostbaren verbleibenden Wochen anfangen? Und was bedeutete Lebensqualitätüberhaupt im Hinblick auf das reale, alltägliche Dasein? Sie schlief schon mehr als je zuvor, hieß Qualität also noch mehr schlafen, um sich besser zu fühlen, oder weniger, damit die Tage länger erschienen? Und was war mit ihren Gewohnheiten? Sollte sie einen Termin für eine Zahnreinigung vereinbaren? Sollte sie ihren Kreditkartensaldo begleichen oder eine Shopping-Orgie veranstalten? Denn was spielte es für eine Rolle? Was für eine Rolle spielte überhaupt irgendetwas?
Unzählige wahllose Gedanken und Fragen schossen ihr durch den Kopf; völlig verloren spürte sie, wie sich ihre Kehle zuschnürte, bevor sie endgültig den Tränen freien Lauf ließ. Wie lange dieser Ausbruch dauerte, hätte sie nicht sagen können, ihr fehlte jedes Zeitgefühl. Irgendwann stand sie ermattet auf und wischte sich die Augen. Als sie durch das kleine Fenster über ihrem Schreibtisch spähte, bemerkte sie, dass die Galerie leer und die Eingangstür geschlossen war. Seltsamerweise konnte sie Mark nicht entdecken, obwohl das Licht noch brannte. Sie fragte sich, wo er wohl war, bis sie ein Klopfen hörte. Selbst sein Klopfen war sanft.
Kurz überlegte sie, ob sie ihn abwimmeln sollte, bis die Anzeichen ihres Zusammenbruchs verblasst waren, aber wozu? Ihr Erscheinungsbild war ihr schon lange nicht mehr wichtig, sie wusste, dass sie selbst in den besten Momenten schrecklich aussah.
»Kommen Sie rein.« Sie zog ein Taschentuch aus der Box auf dem Schreibtisch und putzte sich die Nase.
»Hallo«, sagte Mark leise.
»Hallo.«
»Schlechter Zeitpunkt?«
»Schon okay.«
»Ich dachte mir, Sie mögen das hier vielleicht.« Er hielt ihr einen Becher hin. »Ein Bananen-Erdbeer-Smoothie mit Vanilleeis. Vielleicht hilft es ein wenig.«
Sie erkannte den Aufdruck auf dem Becher, aus dem Lokal zwei Türen weiter, und wunderte sich, woher er gewusst hatte, wie es ihr ging. Möglicherweise hatte er etwas geahnt, als sie schnurstracks in ihr Büro ging, oder er hatte sich einfach an das gehalten, was Trinity ihm aufgetragen hatte.
»Danke.« Sie nahm den Becher entgegen.
»Geht’s Ihnen gut?«
»Es ging mir schon besser.« Sie trank einen Schluck, dankbar, dass die Mischung süß genug war, um ihre ramponierten Geschmacksknospen zu reizen. »Wie lief es heute?«
»Viel los, aber nicht so schlimm wie am Freitag. Wir haben sechs Bilder verkauft, einschließlich einer Nummer 3 von Rush.«
Von jedem ihrer Fotos gab es nur fünfundzwanzig Exemplare; je niedriger die Nummer, desto höher der Preis. Das Foto, von dem Mark sprach, hatte sie zur Rushhour in der Tokioter U-Bahn gemacht, Tausende von Männern in praktisch identischen schwarzen Anzügen drängelten sich auf dem Bahnsteig.
»Auch was von Trinity?«
»Heute nicht, aber demnächst, glaube ich. Jackie Bernstein war vorhin mit ihrem Berater hier.«
Maggie nickte. Jackie hatte bereits zwei von Trinitys Werken gekauft, und er würde sich freuen, dass sie an einem weiteren interessiert war.
»Und online und telefonisch?«
»Sechs feste Bestellungen, zwei Leute wollten zusätzliche Informationen. Sollte nicht lange dauern, um alles für den Versand vorzubereiten. Wenn Sie nach Hause gehen möchten, ich komme hier klar.«
Sobald er das gesagt hatte, drängten sich neue Fragen auf: Wollte sie nach Hause? In eine leere Wohnung? Um sich in Einsamkeit zu suhlen?
»Nein, ich bleibe.« Sie schüttelte den Kopf. »Zumindest noch ein Weilchen.«
Sie merkte ihm an, dass er neugierig war, wusste aber, dass er nicht nachfragen würde.
»Sicherlich haben Sie meine Posts und Videos verfolgt«, sagte sie. »Deshalb wissen Sie wahrscheinlich ungefähr Bescheid, wie sich meine Krankheit entwickelt.«
»Eigentlich nicht. Seit ich hier arbeite, habe ich mir keine Videos mehr angesehen.«
Damit hatte sie nicht gerechnet. Selbst Luanne sah sie sich an. »Warum denn nicht?«
»Ich hatte den Eindruck, dass Ihnen das lieber wäre. Und in Anbetracht Ihrer anfänglichen Bedenken gegen meine Anstellung hier fand ich es richtiger so.«
»Aber Sie wissen, dass ich eine Chemotherapie hatte, oder?«
»Das hat Luanne erwähnt, aber ich kenne die Details nicht. Und natürlich sahen Sie bei den seltenen Malen, die Sie in der Galerie waren …«
Als er verstummte, beendete sie den Satz für ihn. »Aus wie der Tod?«
»Ich wollte sagen, etwas müde aus.«
Aber klar doch. Als ob abgemagert, grün, eingefallen und kahlköpfig durch zu wenig Schlaf erklärt werden könnte. Natürlich wusste sie, dass er nett sein wollte. »Haben Sie ein paar Minuten Zeit? Bevor Sie die Bilder verpacken?«
»Natürlich. Ich habe heute Abend nichts vor.«
Einem Impuls folgend, setzte sie sich auf den Schaukelstuhl und bedeutete ihm, auf der Couch Platz zu nehmen. »Gehen Sie nicht mit Freunden aus?«
»Das ist ein bisschen teuer.« Er machte es sich bequem. »Außerdem bedeutet Ausgehen normalerweise Trinken, und ich trinke nicht.«
»Nie?«
»Nein.«
»Wow«, sagte sie. »Ich glaube nicht, dass ich schon mal einen Zweiundzwanzigjährigen getroffen habe, der noch nie was getrunken hat.«
»Genau gesagt bin ich jetzt dreiundzwanzig.«
»Sie hatten Geburtstag?«
»Ja, aber ist ja nichts Weltbewegendes.«
Wahrscheinlich nicht, dachte sie. »Wusste Luanne davon? Sie hat mir gegenüber gar nichts gesagt.«
»Ich hab es nicht erwähnt.«
Maggie beugte sich vor und erhob ihren Becher. »Dann alles Gute nachträglich.«
»Danke.«
»Haben Sie was Schönes unternommen? An Ihrem Geburtstag, meine ich?«
»Abigail kam übers Wochenende her, und wir haben uns ein Musical angesehen, Hamilton. Waren Sie da schon drin?«
»Ja, ist eine Weile her.« Die Ergänzung aber ich werde es nicht noch mal sehen, behielt sie für sich. Noch ein Grund, nicht allein zu sein. Damit solcherlei Gedanken keinen weiteren Tränenausbruch auslösten. In Marks Gesellschaft war es irgendwie einfacher, sich zusammenzureißen.
»Ich war vorher noch nie in einer Broadway-Aufführung«, erzählte Mark. »Die Musik war toll, und was mir super gefallen hat, war das historische Element, und auch das Tanzen und einfach alles. Abigail war hin und weg, sie hat geschwärmt, dass sie so was noch nie erlebt hat.«
»Wie geht es Abigail?«
»Gut. Ihre Ferien haben gerade angefangen, deshalb ist sie vermutlich unterwegs nach Waterloo zu ihrer Familie.«
»Wollte sie nicht wieder herkommen und Sie besuchen?«
»Ach, da trifft sich die ganze Familie. Im Gegensatz zu mir hat sie eine große, fünf ältere Brüder und Schwestern, die im ganzen Land verstreut wohnen. Weihnachten ist die einzige Zeit, in der sie alle zusammen sein können.«
»Und da wollten Sie nicht mit?«
»Ich arbeite ja. Das versteht sie. Außerdem kommt sie am achtundzwanzigsten. Dann haben wir Zeit füreinander, sehen uns die Silvesterfeier am Times Square an und so weiter.«
»Werde ich sie kennenlernen?«
»Wenn Sie möchten.«
»Falls Sie Urlaub brauchen, sagen Sie Bescheid. Ein paar Tage schaffe ich sicher allein.«
So sicher war sich Maggie da eigentlich nicht, aber sie hatte das Gefühl, das Angebot machen zu müssen.
»Danke, ich sag Bescheid.«
Maggie trank noch einen Schluck von ihrem Smoothie. »Ich weiß nicht, ob ich das in letzter Zeit erwähnt habe: Sie arbeiten wirklich gut.«
»Es macht mir auch Spaß.« Er wartete, und sie wusste, es lag daran, dass er sich vorgenommen hatte, keine persönlichen Fragen zu stellen. Was bedeutete, dass sie freiwillig erzählen oder ihre Information für sich behalten musste.
»Ich hatte letzte Woche einen Termin bei meiner Onkologin«, begann sie mit, wie sie hoffte, gleichmäßiger Stimme. »Ihrer Meinung nach würde eine weitere Runde Chemotherapie mehr Schaden anrichten als nützen.«
Marks Miene wurde weicher. »Darf ich fragen, was das bedeutet?«
»Es bedeutet, keine Behandlung mehr, und die Uhr tickt.«
Er wurde bleich, als er begriff, was sie nicht gesagt hatte. »Oh … Ms. Dawes. Das ist schrecklich. Es tut mir so leid. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Kann ich irgendwas tun?«
»Niemand kann was tun, glaube ich. Aber bitte nenn mich doch Maggie. Du arbeitest lange genug hier, dass wir uns duzen können, finde ich.«
»Gern. Ist die Ärztin sich denn sicher?«
»Die letzten CTs waren nicht gut. Überall Metastasen. Magen. Bauchspeicheldrüse. Nieren. Lunge. Und da du nicht fragen wirst: Mir bleiben weniger als sechs Monate. Höchstwahrscheinlich so um die drei oder vier oder sogar noch weniger.«
Zu ihrer Überraschung füllten sich seine Augen mit Tränen. »Oh … du lieber Gott …«, stammelte er. »Hättest du was dagegen, wenn ich für dich bete? Nicht jetzt, erst zu Hause, meine ich.«
Sie konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Natürlich wollte er für sie beten, als zukünftiger Pastor. Wahrscheinlich hatte er in seinem ganzen Leben noch nie geflucht. Er war, dachte sie, ein sehr lieber Junge. Na ja, streng genommen ein junger Mann, aber …
»Das wäre nett von dir.«
Ein paar Sekunden lang schwiegen sie beide. Dann presste er mit einem leichten Kopfschütteln die Lippen zusammen. »Das ist nicht fair«, sagte er.
»Wann ist das Leben schon fair?«
»Darf ich fragen, wie es dir geht? Entschuldige bitte, wenn ich dir damit zu nahe trete.«
»Schon okay. Ich stehe ein bisschen neben mir, seit ich das erfahren habe.«
»Es muss ein unerträgliches Gefühl sein.«
»Manchmal ja. Dann wieder auch nicht. Das Seltsame ist, körperlich geht es mir besser als vorher, während der Chemo. Da gab es Momente, wo ich dachte, sterben müsste leichter sein. Aber jetzt …«
Sie ließ den Blick über das Regal schweifen, die Mitbringsel, die sie angesammelt hatte, jedes voller Erinnerungen an ihre Reisen. Nach Griechenland und Ägypten, Ruanda und Nova Scotia, Patagonien und die Osterinsel, Vietnam und die Elfenbeinküste. So viele Orte, so viele Abenteuer.
»Es ist schon merkwürdig, dass das Ende so nah ist«, gab sie zu. »Da kommen viele Fragen auf. Man überlegt, worin der Sinn des Ganzen liegt. Manchmal habe ich das Gefühl, ein wunderbares Leben gehabt zu haben, und im nächsten Moment fallen mir all die Dinge ein, die ich verpasst habe.«
»Zum Beispiel?«
»Die Ehe, als Erstes«, sagte sie. »Du weißt, dass ich nie verheiratet war, oder?« Als er nickte, sprach sie weiter. »Als Kind konnte ich mir nicht vorstellen, in meinem Alter allein zu leben. So wurde ich nicht erzogen. Meine Eltern waren sehr traditionell eingestellt, und ich bin davon ausgegangen, so zu werden wie sie.« Ihre Gedanken schweiften in die Vergangenheit ab, Erinnerungen stiegen hoch. »Wobei ich es ihnen nicht ganz einfach gemacht habe. Nicht so wie du jedenfalls.«
»Ich war nicht immer ein perfektes Kind«, widersprach er. »Ich habe auch das eine oder andere angestellt.«
»Nämlich? Irgendwas Schlimmes? Hast du dein Zimmer nicht aufgeräumt oder bist ein paar Minuten zu spät nach Hause gekommen? Nein, warte. Du bist nie zu spät nach Hause gekommen, stimmt’s?«
Er machte den Mund auf, aber da nichts kam, wusste sie, dass sie recht hatte.
»Worauf ich hinauswill, ist, dass ich mich frage, wie mein Leben sich entwickelt hätte, wenn ich einen anderen Weg gewählt hätte. Nicht nur in Bezug auf das Heiraten. Was, wenn ich mich in der Schule mehr angestrengt, das College abgeschlossen oder einen Bürojob angenommen hätte oder wenn ich nach Miami oder Los Angeles statt New York gezogen wäre? Solche Sachen.«
»Ganz offensichtlich brauchtest du das College nicht. Deine Karriere als Fotografin war fantastisch, und deine Videos und Posts über deine Krankheit haben viele Menschen berührt.«
»Das ist sehr nett von dir, aber die kennen mich eigentlich nicht. Und ist das nicht letzten Endes das Wichtigste im Leben? Von jemandem, den man sich ausgesucht hat, wirklich gekannt und geliebt zu werden?«
»Kann sein«, räumte er ein. »Aber trotzdem bleibt, was du anderen durch deine Erfahrung geschenkt hast. Es hat eine große Kraft, für manche ist es sogar lebensverändernd.«
Vielleicht lag es an seiner Ernsthaftigkeit oder an seiner altmodischen Ausdrucksweise, aber wieder musste sie staunen, wie sehr er sie an jemanden erinnerte, den sie einmal gekannt hatte. Seit Jahren hatte sie nicht an Bryce gedacht, zumindest nicht bewusst, im Gegenteil, die meiste Zeit ihres Erwachsenenlebens hatte sie versucht, die Erinnerungen an ihn zu verdrängen.
Dafür gab es aber jetzt keinen Grund mehr.
»Darf ich dich mal was Persönliches fragen?«
»Selbstverständlich.«
»Wann wusstest du, dass du Abigail liebst?«
Bei der Erwähnung ihres Namens bekam seine Miene etwas Zärtliches. »Letztes Jahr.« Er lehnte sich an das Sofakissen. »Kurz nach dem College. Wir hatten uns vier- oder fünfmal verabredet, und sie wollte, dass ich ihre Eltern kennenlerne. Also fuhren wir nach Waterloo, nur wir beide. Wir hatten unterwegs angehalten, um etwas zu essen, und sie hatte sich danach noch ein Eis in der Waffel gekauft. Draußen war es sengend heiß, und leider funktionierte die Klimaanlage im Auto nicht sonderlich gut, weshalb das Eis wild vor sich hin schmolz. Viele Leute hätten sich darüber vielleicht geärgert, aber sie kicherte nur, als wäre es das Witzigste überhaupt, und versuchte, schneller zu essen, als es schmelzen konnte. Überall war Eis, auf ihrer Nase, ihren Fingern, ihrem Schoß, sogar in den Haaren, und ich weiß noch, dass ich dachte, so jemanden möchte ich immer um mich haben. Jemanden, der über die kleinen Unannehmlichkeiten des Lebens lachen und überall Freude finden kann. Da wusste ich, dass sie die Richtige ist.«
»Hast du ihr das gleich gesagt?«
»O nein. Dazu fehlte mir der Mut. Ich brauchte bis zum letzten Herbst, um ihn endlich aufzubringen.«
»Hat sie gesagt, dass sie dich auch liebt?«
»Ja. Das war eine Erleichterung.«
»Es hört sich an, als wäre sie ein wunderbarer Mensch.«
»Das ist sie. Ich bin ein Glückspilz.«
Obwohl er lächelte, merkte Maggie ihm an, dass er immer noch aufgewühlt war.
»Ich wünschte, ich könnte etwas für dich tun«, sagte er leise.
»Hier zu arbeiten reicht völlig. Na ja, und abends länger zu bleiben.«
»Ich bin froh, hier zu sein. Was mich nur interessieren würde …«
»Na los.« Sie machte eine Geste mit dem Smoothie. »Frag, was du willst. Ich hab nichts mehr zu verbergen.«
»Warum hast du nie geheiratet? Wenn du es eigentlich vorhattest, meine ich?«
»Da gab es viele Gründe. Anfangs wollte ich mich auf das Fotografieren konzentrieren, bis ich Fuß gefasst hatte. Dann war ich viel auf Reisen, dazu kam irgendwann die Galerie. Ich war wohl einfach zu beschäftigt.«
»Und du bist nie jemandem begegnet, wegen dem du all das infrage gestellt hast?«
In der folgenden Stille tastete sie unbewusst nach ihrer Kette, dem kleinen Muschelanhänger, um sich zu vergewissern, dass er noch da war. »Einmal dachte ich das. Ich weiß, dass ich ihn geliebt habe, aber der Zeitpunkt war falsch.«
»Wegen der Arbeit?«
»Nein. Das war lange vorher. Aber ich bin ziemlich sicher, dass ich nicht gut für ihn gewesen wäre. Damals zumindest nicht.«
»Das kann ich nicht glauben.«
»Du weißt nicht, wie ich früher war.« Maggie stellte den Becher ab und verschränkte die Hände auf dem Schoß. »Möchtest du die Geschichte hören?«
»Es wäre mir eine Ehre.«
»Sie ist ein bisschen lang.«
»Das sind in der Regel die besten.«
Maggie senkte den Kopf, sah die Bilder zögerlich vor ihrem geistigen Auge auftauchen. Mit den Bildern würden früher oder später auch die Worte kommen, das wusste sie.
»1995, als ich sechzehn Jahre alt war, begann ich ein geheimes Leben«, sagte sie.