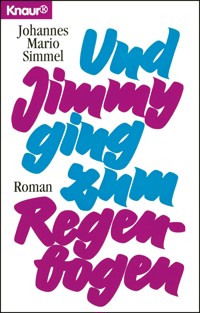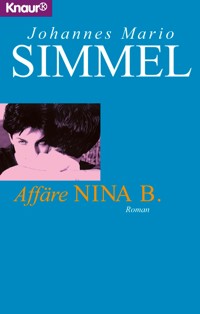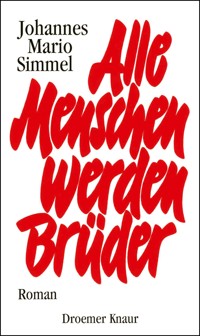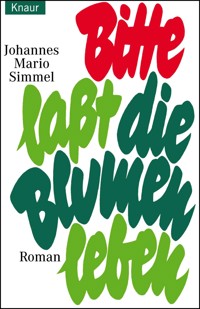4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
"Meine Mutter darf es nie erfahren!", denkt Martin. Dass er nämlich ein so schlechtes Zeugnis bekommen hat. Denn Martins Mutter ist sehr krank, und er hat Angst, sie könnte sich schrecklich aufregen und dadurch noch viel kränker werden. Deshalb reißt Martin einfach aus. Er sieht das als den einzigen Weg. Aber es ist ein falscher Weg, den - leider - jedes Jahr viele Kinder wählen. Wie falsch der Weg ist, das zeigt dieses aufregende Buch, in dem Martin auf seiner "Flucht" von einem Abenteuer ins andere gerät - zum Schluss sogar in ein lebensgefährliches.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Johannes Mario Simmel
Meine Mutter darf es nie erfahren
Ein aufregendes Abenteuer rund um ein schlechtes Zeugnis
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Das erste Kapitel
Die II B hält den Atem an – Der Lehrer hält eine Rede, und niemand bemerkt, daß Martin weint – Peter und Herbert geht es auch nicht besser – Der Neger ist an allem schuld! – Von Zeit zu Zeit müßten die Schüler die Lehrer prüfen – Sogar geschiedene Eltern haben ihr Gutes – Der blasse Martin hat einen Rekord gebrochen – Es ist kein reines Vergnügen, einen Straßenbahnführer zum Vater zu haben – Martin sieht einen ›Onkel Doktor‹ und muß sich erinnern – Doktor Gerber zieht einen jungen Mann ins Vertrauen – Jede Aufregung ist Gift – Es ist nicht leicht, gut zu lügen – Bei meinem Zeugnis kann nichts passieren! – Um Gottes willen, vielleicht stirbt sie! – Der liebe Gott hat nichts gehört – Es gibt nur einen Ausweg – Ich weiß nicht, wohin ich gehe.
In dem großen Klassenzimmer der II B war es so still, daß man eine Stecknadel hätte fallen hören können, als der Lehrer vom Pult heruntertrat, um ein paar abschließende Worte zu sprechen. Es war genau 10 Uhr und 35 Minuten, man schrieb den 28. Juni, und draußen, vor den geöffneten Fenstern, sangen die Vögel in den Bäumen des großen Gartens der Hauptschule, und die Sonne schien. Es war ein schöner, heller Sommertag, dieser 28. Juni. Es war der Tag, an dem das Schuljahr zu Ende ging und die großen Ferien begannen.
Aber noch hatten sie nicht begonnen. Noch saßen die 27 Jungen der II B in ihren Bänken und sahen ihren Lehrer an, der zwischen ihnen auf und ab ging. Manche hatten dabei fröhliche Gesichter, andere sehr sorgenvolle. Alle Jungen waren gleich alt – zwölf Jahre. Und das mit den fröhlichen und mit den sorgenvollen Gesichtern kam daher, daß heute der Tag war, an dem es die Zeugnisse gab. Die Geschichte, die ihr nun lesen werdet, hat ein Junge dem Mann erzählt, der dieses Buch hier geschrieben hat. Eine solche Geschichte kann so oder so ähnlich jederzeit wieder passieren. Denn zu allen Zeiten ist ein gutes Zeugnis etwas zum Fröhlichsein, und ein schlechtes Zeugnis ist etwas zum Traurigsein. Was soll einer euch da viel erklären? Das wißt ihr selbst doch am besten, nicht wahr? Die letzten Minuten eines Schuljahres sind immer die aufregendsten.
»Und nun«, sagte der Lehrer, »da ihr alle eure Zeugnisse bekommen habt, ist es Zeit geworden, daß wir uns voneinander verabschieden. In zehn Minuten, wenn ihr das Haus verlaßt, tretet ihr schon in den hellen Sonnenschein eurer Ferien hinaus.«
Der helle Sonnenschein der Ferien!
Er fiel durch die großen Fenster des Schulzimmers und warf seine unruhigen Lichtkringel an die hellen Wände. Die Jungen rutschten auf ihren Bänken hin und her. Sie konnten es kaum mehr erwarten!
Aber der Lehrer war noch nicht fertig.
»In diesen Ferien«, sagte er, »sollt ihr euch alle gut erholen, damit ihr gesund und frisch seid, wenn im Herbst die Schule wieder beginnt. Die meisten von euch werden nicht mehr zu mir kommen. Sie werden in die nächste Klasse gehen, zu anderen Lehrern und zu neuen Freunden. Aber ein paar sind doch unter euch, die noch ein bißchen länger hier, bei mir, bleiben müssen.« Der Lehrer blieb stehen und lächelte. »Ich meine diejenigen, die durchgefallen sind und die zweite Hauptschulklasse wiederholen müssen. Es sind nur drei, und ich bin sicher, daß auch bei ihnen im nächsten Jahr alles viel besser gehen wird. Nicht wahr, Peter?« meinte er und strich dabei einem mageren, blondhaarigen Jungen, der vor ihm saß, über den Kopf.
»Bestimmt, Herr Nansen!« erwiderte der blonde Peter und lachte den Lehrer an. Er schien sich nicht viel daraus zu machen, daß er durchgefallen war. »Das ›Nichtgenügend‹ in Mathematik kriege ich ganz leicht wieder weg!«
Der Lehrer, der Nansen hieß, nickte.
»Wir wollen es hoffen«, sagte er und sah sich um, bis sein Blick auf zwei andere Jungen fiel, die in der letzten Bank saßen. Der eine war dick und hatte viele Sommersprossen im Gesicht, der andere war schlank und blaß.
»Na«, sagte Lehrer Nansen zu ihnen, »und auch ihr beide, Herbert und Martin, macht euch keine zu großen Sorgen. Nächstes Jahr müßt ihr eben fleißiger sein, nicht wahr?«
»Jawohl!« rief der dicke Junge mit den vielen Sommersprossen und nickte entschlossen.
Der blasse Martin neben ihm schwieg. Er saß ganz steif und still in seiner Bank und blickte vor sich hin. Langsam rann eine kleine, glitzernde Träne über seine Wange. Lehrer Nansen sah die Träne nicht. Die Träne sah überhaupt niemand. Kein Mensch bemerkte sie in der allgemeinen Aufregung dieser allerletzten Schulstunde vor den großen, den wunderbaren, den herrlichen Ferien.
Der Lehrer schritt zum Pult zurück.
»Ihr müßt alle daran denken«, sagte er, »daß wir euch hier, in der Schule, nicht quälen wollen, wenn wir euch schlechte Noten geben, sondern daß wir damit versuchen, euch zu ermahnen und euch so klug und stark und sicher zu machen, wie ihr sein müßt, wenn ihr in das Leben hinauskommt. Denn ihr lernt ja schließlich nicht für mich oder für die Schule, sondern eben für dieses euer zukünftiges Leben.« Lehrer Nansen war beim Pult stehengeblieben, drehte sich um und lächelte. »So«, sagte er, »das wäre wohl alles. Und nun geht, erholt euch, und ich wünsche euch alles Gute und Schöne für eure Ferien. Auf Wiedersehen.«
Im nächsten Augenblick brach ein unbeschreiblicher Lärm aus. Die 27 Jungen sprangen auf, riefen und lachten durcheinander und drängten nach vorn, um dem Lehrer die Hand zu geben und sich von ihm zu verabschieden.
Als die Reihe an den blassen, traurigen Martin kam, dem Lehrer Nansen »Auf Wiedersehen!« zu sagen, da klopfte ihm dieser auf die Schulter und meinte: »Na, na, Martin, halt den Kopf hoch! Es wird schon wieder besser werden!«
Martin sah zu ihm auf, versuchte mühsam, ein wenig zu lächeln, und murmelte dann bedrückt: »Ja, Herr Nansen!« Aber es klang so, als ob er es selbst nicht glaubte. Eilig schlich er aus dem Klassenzimmer. Sein schlechtes Zeugnis trug er in der Hand. Draußen, auf den Gängen des Schulhauses, rannten viele Kinder hin und her. Auch ein paar Mütter waren zu sehen, die auf ihre Söhne warteten. Es war ein ganz unglaublicher Wirbel.
Auf Martin wartete niemand.
Leise und traurig ging er zwischen den vielen glücklichen und lachenden Kindern die Treppe hinunter und hörte dabei, wie manche von ihren guten Noten in Mathematik, Geographie oder Geschichte berichteten, und wie ihre Mütter sie für diese guten Noten lobten. Ihn würde niemand loben, dachte Martin, und er fühlte, wie eine neue Träne langsam über seine Wange rollte.
Unten, im Sonnenschein vor dem Eingang zur Hauptschule, warteten Peter und Herbert auf ihn. Sie traten an seine Seite, und zu dritt gingen sie langsam weiter die Straße entlang. Schließlich brach der dicke Herbert das Schweigen.
»Also«, erklärte er, »ich kann euch sagen, mir ist die Geschichte ganz egal. Werde ich die Klasse eben wiederholen – was ist schon dabei? Hauptsache: Die Ferien sind endlich da!«
»Mir ist es auch wurscht«, sagte der blonde Peter. Er sagte es nicht ganz so wohlgemut und leichten Herzens wie der dicke Herbert, das konnte man deutlich hören, es war ihm durchaus nicht so ›wurscht‹, wie er behauptete, aber er redete tapfer weiter drauflos: »Das ›Nichtgenügend‹ in Physik war ohnehin eine Gemeinheit, an dem bin ich unschuldig, das wißt ihr alle beide – und das in Mathematik habe ich nur bekommen, weil der Neger uns so gemeine Fragen bei der letzten Schularbeit gestellt hat.« (Mit der Bezeichnung ›Neger‹ meinte er den Lehrer, das war sein Spitzname. Er hatte ihn erhalten, weil er nach den großen Ferien von der Sonne immer so dunkelbraun wie ein Neger gebrannt war.)
Der dicke Herbert nickte zustimmend.
»Klar«, sagte er, »du kannst gar nichts dafür. Man kann jeden Menschen auf ›Nichtgenügend‹ prüfen, es kommt nur auf die Fragen an. Wenn ich wollte, könnte ich dem Neger ein paar Fragen stellen, auf die er auch keine Antwort wüßte. Das sollte überhaupt eingeführt werden, daß von Zeit zu Zeit die Schüler ihre Lehrer prüfen. Dann würden sie sich bald anders benehmen, diese Neunmalgescheiten. Also mach dir nichts draus, Peter. Nur die Lehrer sind schuld. Deine Eltern werden das bestimmt begreifen.«
»Hoffentlich«, sagte der blonde Peter. Er schien nicht sehr davon überzeugt zu sein.
»Sicherlich«, rief Herbert. »Meinem Alten werde ich dasselbe erzählen! Der glaubt mir alles. Er ist ohnehin immer auf Reisen, und im Grund ist es ihm ganz einerlei, ob ich ein Jahr länger in die Schule gehe oder nicht. Im Gegenteil! Der ist froh, wenn er sich nicht um mich zu kümmern braucht.«
»Na, und deine Mutter?« fragte Peter. Martin sagte gar nichts, er trottete stumm und wie abwesend neben seinen beiden Freunden her, und ihre Stimmen klangen wie aus weiter Ferne an sein Ohr.
»Du weißt doch, meine Eltern sind geschieden«, sagte der dicke Herbert stolz. »Meine Mutter lebt in England. Der brauche ich überhaupt nichts von meinem Zeugnis zu sagen.«
Der blonde Peter marschierte ein paar Schritte weiter, ohne zu sprechen, dann verkündete er: »Mir ist es lieber, meine Eltern sind nicht geschieden und regen sich alle beide auf über mein Zeugnis.« Er nickte zur Bestätigung seiner Worte mit dem Kopf. »Nicht, daß ich mich besonders darauf freue«, sagte er noch aufrichtig, »aber ich glaube doch, daß es mir lieber ist.«
»Mir war es zuerst auch lieber«, meinte Herbert versonnen, »aber dann habe ich mich daran gewöhnt, daß meine Mutter fort ist und mir nur manchmal Briefe schreibt, und jetzt kann ich bloß sagen: Alles hat sein Gutes! Sogar geschiedene Eltern.«
Der blasse, magere Martin schwieg noch immer, und sein Schweigen begann den dicken Herbert zu beunruhigen. Er stieß ihn freundschaftlich mit dem Ellbogen an und erkundigte sich: »Und was ist mit dir los? Hast du vielleicht die Sprache verloren, bloß weil der Neger dir zwei ›Nichtgenügend‹ gegeben hat?«
Martin wollte antworten, aber es ging nicht gleich. Er mußte zuerst seine Lippen befeuchten. Dann sagte er heiser: »Nicht zwei. Drei!«
Darauf folgte ein verblüfftes Schweigen.
»Bum«, sagte der blonde Peter endlich ergriffen, »drei«?
»Mhm«, sagte Martin traurig. »Eines in Mathematik, eines in Deutsch und eines in Geographie.«
»Da bist du ja noch tüchtiger als ich«, meinte der dicke Herbert ehrfürchtig. »Ich habe gedacht, ich halte den Rekord.«
Martin schwieg und sah auf das Straßenpflaster.
»Der Neger ist eben ein Hund«, sagte der blonde Peter hilfreich. (Es fiel ihm gar nicht auf, was für einen komischen Ausspruch er da von sich gab.)
Der blasse Martin schüttelte den Kopf.
»Nein«, sagte er, »der Neger kann nichts dafür. Ich selber bin daran schuld. Ich allein.« Und er nickte ein paarmal wie zur Bestätigung.
»Aber wieso denn?« Herbert regte sich auf. »Du bist doch sonst ein ganz gescheiter Bursch! Du bist doch kein Trottel!«
»Nein«, sagte Martin, »das stimmt.«
»Na also! Wie hast du es dann fertiggebracht, drei ›Nichtgenügend‹ zu bekommen?«
»Wie hast du es fertiggebracht?« erkundigte sich Peter.
»Bei mir war das etwas anderes«, erwiderte Herbert gereizt, »bei mir war es eine Gemeinheit vom Neger.«
Martin zuckte müde die Achseln.
»Ich weiß nicht, wie ich es fertiggebracht habe«, sagte er mutlos. »Es ist nicht so, daß ich nicht begreife, was ich lernen soll. Ich begreife es sehr gut. Ich verstehe alles, was der Neger uns erzählt, wirklich! Aber dann, wenn er mich fragt, dann habe ich auf einmal alles, was ich gewußt habe, vergessen.«
»Mir geht es genauso«, behauptete Peter. »Aber das glaubt einem ja kein Mensch.«
»Es ist doch eine Gemeinheit«, entschied der dicke Herbert und blieb stehen. Er wies auf das Haus gegenüber. »Hier wohne ich«, meinte er und gab den beiden anderen die Hand. »Also lebt wohl und laßt es euch gutgehen!« Er sah zu einem Fenster im dritten Stock seines Hauses empor und runzelte die Stirn. »Hoffentlich muß mein Alter gerade wieder verreisen«, sagte er hoffnungsvoll. »Dann geht es einfacher. Und schneller.«
Damit verließ er seine Schulfreunde.
Peter und Martin setzten ihren Weg fort.
»Der hat ein Gemüt wie ein Fleischerhund«, sagte Peter nach einer Weile und schüttelte bewundernd den Kopf. Jetzt, da Herbert verschwunden war, schien er es langsam auch ein bißchen mit der Angst vor dem Nachhausekommen zu kriegen.
»Bei ihm ist alles anders«, meinte Martin bedrückt. »Um ihn kümmert sich ja sein Vater kaum.«
Peter sah Martin von der Seite an.
»Na«, sagte er, »und dein Vater kümmert sich um dich?«
»Sooft er Zeit dazu hat«, erwiderte Martin. »Er ist Straßenbahner und muß viel arbeiten.«
»Schaffner oder Zugführer?«
»Zugführer«, sagte Martin.
»Und deine Mutter?«
Martin seufzte.
»Das ist es ja gerade«, sagte er kummervoll.
»Was ist es ja gerade?«
»Meine Mutter ist immer zu Hause«, sagte der blasse Martin leise und sah den andern dabei nicht an. »Meine Mutter liegt im Bett. Sie ist krank, verstehst du?«
Peter nickte ergriffen.
»Ich verstehe«, sagte er leise. »Meine Mutter ist gesund, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wie du dich mit deiner kranken Mutter fühlen mußt.«
»Es ist scheußlich«, sagte Martin.
Danach gingen sie ein langes Stück, ohne miteinander zu sprechen.
»Wenn ich wenigstens nur ein ›Nichtgenügend‹ bekommen hätte«, meinte Martin dann. »Das wäre auch nicht schön gewesen, aber immerhin – so etwas kann passieren! Aber drei … drei ›Nichtgenügend‹ sind eine Katastrophe. Sie wird Fieber kriegen.«
»Wer wird Fieber kriegen?« erkundigte sich der blonde Peter überrascht. Er verstand nicht gleich.
»Meine Mutter«, erklärte ihm Martin. »Sie kriegt leicht Fieber.«
»Hm«, sagte der blonde Peter.
Er wußte nicht recht, was er sonst sagen sollte.
Martin nahm sich zusammen.
»Ich rede immerzu von mir«, meinte er, »und dabei geht es dir doch genauso.«
»Ach was!« Peter winkte mit einer Hand ab. »Nicht genauso. Meine Leute sind wenigstens gesund. Die können den Schrecken leichter ertragen. Sie werden ihn auch gleich bekommen.«
»Wer wird was bekommen?« fragte Martin. Jetzt war er es, der nicht verstand.
»Meine Leute ihren Schrecken«, informierte ihn Peter. Er blieb stehen und zeigte auf ein Haustor. »Hier wohne ich ja«, sagte er und gab Martin die Hand.
»Leb wohl«, sagte Martin.
»Du auch«, sagte Peter.
»Und viel Glück!« rief Martin ihm nach.
Der blonde Peter nickte.
»Ich kann’s brauchen!« rief er. Als er die andere Seite der Fahrbahn erreicht hatte, drehte er sich noch einmal um und brüllte: »Viele Grüße an deine Mutter!«
»Danke!« brüllte Martin zurück. Ein paar Passanten drehten sich nach den beiden um und schüttelten die Köpfe. Martin ging allein weiter.
Er ging langsam, er setzte Schritt vor Schritt. Er war tief in Gedanken versunken.
Viele Grüße an seine Mutter …
An seine Mutter …
Martin schluckte schwer, während er weitertrottete. Das zerdrückte Unglückszeugnis hielt er noch immer in der Hand. Es war sehr heiß. Er schwitzte.
Seine Mutter …
Martin schloß die Augen.
Was würde seine Mutter sagen?
Er blieb stehen. Vor sich sah er die große Fensterscheibe eines Spielwarengeschäftes. Er starrte sie an. In der Auslage erblickte er Puppen, Teddybären, Bälle, Autos und eine komplette große Spielzeugeisenbahn. Aber alle diese herrlichen Dinge interessierten Martin im Augenblick nicht. Was ihn interessierte, war klein und unscheinbar und stand ganz hinten in der Auslage. Was ihn interessierte, war eine Puppe, die als ›Onkel Doktor‹ angezogen war. Die Puppe trug einen schwarzen Anzug, eine Brille und eine schwarze Tasche in der Hand und war gerade damit beschäftigt, einer anderen Puppe – einem kleinen Mädchen – in den Hals zu sehen.
Dieser ›Onkel Doktor‹ nahm Martins ganze Aufmerksamkeit gefangen, während er so, im hellen Sonnenlicht, vor dem Spielzeugladen stand. Denn dieser ›Onkel Doktor‹ erinnerte ihn an einen anderen, an einen echten Onkel Doktor, und an ein Gespräch, das er mit diesem echten Onkel Doktor geführt hatte, vor gar nicht langer Zeit …
Das war gestern abend gewesen.
Zu Hause.
Der echte Onkel Doktor hieß Gerber. Er war gekommen, um die kranke Mutter zu untersuchen, wie er dies seit langem tat. Martin kannte Doktor Gerber gut. Er saß in der kleinen, sauberen Küche, während die Mutter untersucht wurde. Sein Vater war nicht zu Hause. Der machte Dienst auf der Straßenbahn und kam erst gegen Abend.
Martin saß beim Fenster der gemütlichen Küche, sah in den kleinen grünen Park hinaus und hörte undeutlich die Stimmen der beiden Erwachsenen, der Mutter und des Arztes, die aus dem Nebenzimmer zu ihm drangen.
Dann, endlich, kam Doktor Gerber in die Küche.
Martin sprang auf und sah ihn angstvoll an.
Der Arzt schloß die Zimmertür hinter sich.
»Wie geht es ihr?« fragte der Junge leise.
Der Arzt setzte sich auf einen Schemel und zog Martin zu sich.
»Nun paß einmal auf«, sagte er freundlich, »dein Vater ist nicht hier, und deshalb muß ich mit dir sprechen.« Er war schlank, mit einem gütigen Gesicht und einer funkelnden Brille. »Du bist doch schon ein großer Mann, nicht wahr?«
Martin nickte.
»Wie alt bist du denn?«
»Im August werde ich dreizehn«, sagte Martin.
»Na, da bist du ja schon beinahe ganz erwachsen«, meinte Doktor Gerber.
»Ja«, sagte Martin. Und dann fragte er: »Wie geht es meiner Mutter?«
»Nicht besonders gut«, sagte Doktor Gerber.
Martin erschrak. Doktor Gerber bemerkte es.
»Es ist nicht notwendig, zu erschrecken«, meinte er und klopfte dem Jungen auf den Rücken. »Deine Mutter ist nicht mehr so krank wie vor sechs Monaten. Im Gegenteil: Sie ist auf dem Wege zur endgültigen Genesung.« Er räusperte sich. »Aber siehst du, eben dieser Weg zur Genesung ist ein besonders gefährlicher Weg.«
»Wieso?« fragte Martin.
»Nun«, sagte der Arzt, »jetzt ist der Körper deiner Mutter mit der Krankheit endlich fertig geworden, nicht wahr? Aber es war ein langer und schwerer Kampf, und der Körper ist deshalb auch vollkommen erschöpft. Deine Mutter ist sehr schwach. Ich habe dir hier ein Medikament aufgeschrieben, das sie nehmen muß.« Er gab Martin ein Blatt Papier. »Doch mit der Medizin allein ist es nicht getan«, fuhr Doktor Gerber fort. »Was deine Mutter jetzt am allermeisten braucht, das ist absolute, vollkommene, hundertprozentige Ruhe.«
»Ich verstehe«, sagte Martin.
»Das habe ich gewußt«, sagte Doktor Gerber. »Du bist ein kluger Junge. Du wirst dafür sorgen, daß deine Mutter diese Ruhe hat, gelt?«
»Ja, Herr Doktor«, sagte Martin.
»Nur Ruhe, sonst nichts, verstehst du? Keine Aufregungen!« Doktor Gerber hob eine Hand. »Aufregungen sind Gift für sie. Sag das auch deinem Vater.«
»Ja, Herr Doktor.«
»Wenn deine Mutter sich jetzt aufregt«, sagte der Arzt, »dann kann sie wieder Fieber und einen Rückfall bekommen. Aber das wäre dann kein gewöhnlicher Rückfall. Denn wie ich schon sagte: Der Körper deiner Mutter ist völlig kraftlos vom Kampf mit der Krankheit. Einem neuen Anfall wäre er vielleicht nicht mehr gewachsen. Wenn sie sich jetzt aufregt, kann alles umsonst gewesen sein, was wir getan haben, um sie zu heilen. Es ist gar nicht abzusehen, was geschieht, wenn sie sich jetzt aufregt.«
Martin sah den Arzt fest an.
»Ich werde dafür sorgen, daß sie Ruhe hat, Herr Doktor«, sagte er.