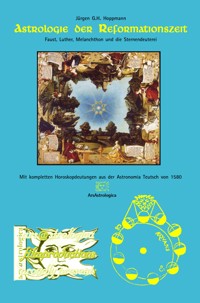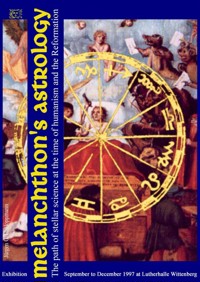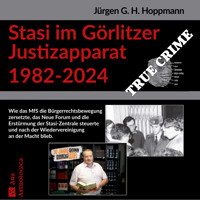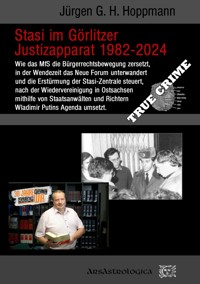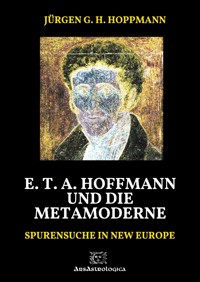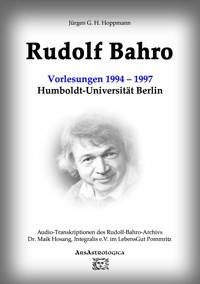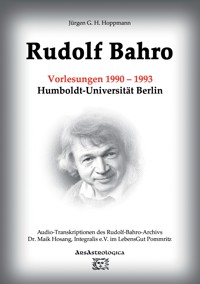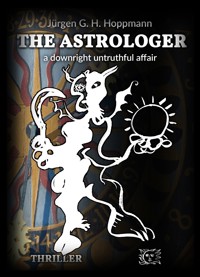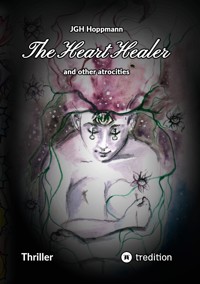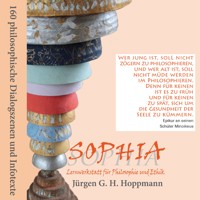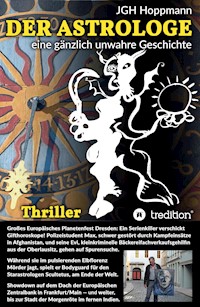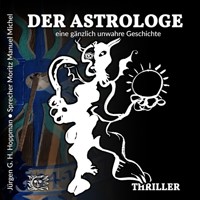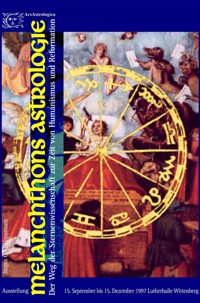
14,95 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bookmundo
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit Beiträgen von Olivia Barcley, Dr. Friederike Boockmann, Prof. Dr. Reimer Hansen, Dr. Helmut Hark, Prof. Dr. Irmgard Höß, Otto Kammer, Heinrich Kühne, Dr. Günther Mahal, Bernd A. Mertz, Prof. Dr. Wolf-Dieter Müller-Jahncke, Dr. habil. Günther Oestmann, Dr. Rüdiger Plantiko, Dr. Krzysztof Pomian, Dr. Karl Röttel, Dr. Ralf T. Schmitt, Dr. Christoph Schubert-Weller, Prof. Dr. Manfred Schukowski, Dr. Gabriele Spitzer, Prof. Dr. theol. Dr. theol. h.c. Reinhart Staats, Dr. Ingeborg Stein, Felix Straubinger, Dr. Martin Treu, Pater Dr. Gerhard Voss, Prof. Dr. phil. Wolfgang Wildgen, Dr. Edgar Wunder, Prof. Dr. phil. Wolfgang Wildgen, Prof. Dr. Paola Zambelli und Arnold Zenkert
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
MELANCHTHONS ASTROLOGIE7
MARTIN TREU: Zum Geleit8
EDELTRAUD WIEßNER: Vorwort11
A. d. Hrsg.:12
I - Causa Materialis: Die Sternenwissenschaften13
WOLF-DIETER MÜLLER-JAHNCKE: Magister Philippus und die Astrologie eine kleine Zitatensammlung14
Literaturhinweise:15
Anm.d.Hrsg.:15
HEINRICH KÜHNE: Wittenberg und die Astronomie17
Anmerkungen:20
Literatur:21
A. d. Hrsg.:21
EDGAR WUNDER: Melanchthons Verhältnis zu Horoskopen - eine Beurteilung aus heutiger wissenschaftlicher Sicht22
Anmerkungen / Literatur:25
A. d. Hrsg.:26
GÜNTHER OESTMANN: Das Astrolabium, ein universelles Mess- und Recheninstrument27
Anmerkungen:29
A. d. Hrsg.:30
RÜDIGER PLANTIKO: Die Horoskope Luthers und Melanchthons in der Deutung durch Lucas Gauricus32
Anmerkungen:36
A. d. Hrsg.:37
ARNOLD ZENKERT: Die Arachne von Görlitz - Dokument der Astrologie38
Das Zifferblatt der ARACHNE39
Die alte Sonnenuhr an der Peterskirche41
Anmerkungen:42
A. d. Hrsg.:42
MANFRED SCHUKOWSKI: Astronomische Monumentaluhren in Kirchen - Indikatoren für mittelalterliche Mentalitäten43
Anmerkungen:45
Literatur:46
A. d. Hrsg.:46
IRMGARD HÖß: Georg Spalatin (1) und die Astrologen (2)47
Anmerkungen:50
A. d. Hrsg.:50
GÜNTHER MAHAL: Kannte Melanchthon Faust? Anfragen an eine ungewisse Semantik52
weitere Literaturhinweise:54
A. d. Hrsg.:55
II - Causa Formalis: Himmlische Künste56
JÜRGEN G.H. HOPPMANN: Astrologische Ikonografie in Werken von Botticelli, Dürer, Cranach und Schaffner57
Die Venus Botticellis59
Dürers MELENCOLIA I60
Cranachs Astrologenportrait62
Ikonografie im modernen Kontext64
Anmerkungen:65
A. d. Hrsg.:67
BERND A. MERTZ: Leonardo da Vincis Abendmahl68
Die Dreizehn68
Das Bild69
A. d. Hrsg.:75
KARL RÖTTEL: Religionspolitische und astronomische Themen in Hans Holbeins »The Ambassabors«76
1. Historischer Kontext76
2. Bildkomposition77
3. Das Mathematikbuch »Kaufmannsrechung«77
4. Besonderheiten im Rechenbuch78
Literatur:78
Anm d. Hrsg.:79
OTTO KAMMER: Eine neue Melanchthonbüste zum Jubiläumsjahr80
A. d. Hrsg.:82
INGEBORG STEIN: Musikalischer Ausdruck kosmologischer Ordnungen im Werk von Heinrich Schütz83
Anmerkungen86
A. d. Hrsg.:87
III - Causa Efficiens: Horoskopie im Christentum88
MARTIN TREU: »Heillos und schäbig« Martin Luthers Verhältnis zur Astrologie Melanchthons89
Anmerkungen:91
A. d. Hrsg.:91
REINHART STAATS: Noch einmal: Luthers Geburtsjahr 148492
A. d. Hrsg.:96
PAOLA ZAMBELLI: Martin Luther - der Komet ist des Teufels97
Anmerkungen:100
A. d. Hrsg.:106
FELIX STRAUBINGER: Astrologie und Christentum in der Renaissance107
A. d. Hrsg.:111
KRZYSZTOF POMIAN: Astrologie als naturalistische Theologie der Geschichte (1)112
Anmerkungen:118
A. d. Hrsg.:119
GERHARD VOSS: Der Niederaltaicher Horoskopstein121
Anmerkungen:124
Literatur:124
A. d. Hrsg.:125
CHRISTOPH SCHUBERT-WELLER: Gott und die Sterne - zum Verhältnis von Astrologie und Christentum im Wandel der Geschichte126
Omina und Prodigia126
Christliche Astrologie im Hochmittelalter127
Wissenschaft; Glaube; Astrologie128
Anmerkungen:129
Anm. d. Hrsg.:129
HELMUT HARK: Der Traum-Glaube Melanchthons130
Anmerkungen und Literatur zu Melanchthon:133
A. d. Hrsg.:133
IV - Causa Finalis: Nachfolger und Wirkungsgeschichte134
FRIEDERIKE BOOCKMANN: Wittenberger Gelehrte im Leben von Johannes Kepler135
I. Astronomie und Mathematik an der Universität Wittenberg135
II. Keplers Mysterium Cosmographicum auf copernicanischer Grundlage136
III. Kepler, Brahe und die Apologia contra Ursum137
IV. Kepler und Jessenius138
V. Kepler, Jöstelin und Rhodius139
Literatur:140
A. d. Hrsg.:141
REIMER HANSEN: Wittenberg, Tycho Brahe und sein astronomisches Weltsystem142
I142
II143
Literatur:145
A. d. Hrsg.:146
WOLFGANG WILDGEN: Giordano Bruno in Wittenberg147
Eigenes Zeugnis147
Wissenschaftliche Tätigkeit an der Leucorea147
Verhältnis zu Astronomie und Astrologie148
Literaturhinweise:149
A. d. Hrsg.:150
GABRIELE SPITZER: Leonhard Thurneysser zum Thurn Arzt, Astrologe und Drucker im Berlin des 16. Jahrhunderts151
Literaturhinweis:152
A. d. Hrsg.:152
OLIVIA BARCLAY: William Lillys Schriften und das Bedürfnis nach traditioneller Astrologie154
Anm. d. Hrsg.:162
RALF T. SCHMITT: Der Wittenberger Meteoritenforscher Chladni – 200 Jahre nach Melanchthons Tod etabliert sich die naturwissenschaftliche Meteoritenforschung163
Anmerkungen:164
A. d. Hrsg.:165
Ausstellungskatalog - Beschreibung der Exponate166
1 Causa materialis: Die Sternenwissenschaften167
1.1 An der Raumdecke167
1.2 Objekte im Raum167
1.3 Objekte in Vitrinen168
1.4 Bücher in Vitrinen171
1.5 Drucke neben der Tür179
1.6 Drucke an der Wänden179
1.7 Texte an den Wänden181
2 Causa formalis: Himmlische Künste183
2.1 An der Raumdecke183
2.2 Objekte im Raums183
2.3 Objekte in Vitrinen183
2.4 Bücher in Vitrinen185
2.5. Drucke neben der Tür185
2.6 Drucke an den Wänden185
3 Causa efficienz: Horoskope im Christentum190
3.1 An der Raumdecke190
3.2 Objekte im Raum190
3.3 Objekte in Vitrinen190
3.4 Bücher in Vitrinen192
3.6 Drucke an den Wänden194
3.7 Text an der Wand197
4 Causa finalis: Nachfolger und Wirkungsgeschichte198
4.1 An der Raumdecke198
4.2 Objekte im Raum198
4.3 Objekte in Vitrinen200
4.4 Bücher in Vitrinen207
4.6 Drucke an den Wänden207
Experimentalraum in der Krypta214
0.1 An der Raumdecke214
0.2 Objekte im Raum214
0.3 Objekt an der Wand215
0.4. Objekt auf dem Boden216
Anhang217
Leihgeber218
Danksagungen225
Bislang vom Herausgeber erschienen228
In Vorbereitung229
ArsAstrologica.com229
MELANCHTHONS ASTROLOGIE
Der Weg der Sternenwissenschaft zur Zeit von Humanismus und Reformation
Jürgen G. H. Hoppmann (Hrsg.)
Katalog zur Ausstellung vom 15. September bis 15. Dezember 1997 im Reformationsgeschichtlichen Museum Lutherhalle Wittenberg – durchgesehene und nach aktueller Rechtschreibregelung überarbeitete Textausgabe
für Hans Hoppmann
© 2021 ArsAstrologica, Krischelstraße 13, 02826 Görlitz
Erstauflage 1997 Verlag Clemens Zerling, Berlin
E-Book-Ausgabe 2021 ISBN 978-9403630908
Buchsatz und Gestaltung: ArsAstrologica
MARTIN TREU: Zum Geleit
Anlässlich seines 500. Geburtstages hat die neuere Melanchthonforschung erheblichen Nachdruck auf die Tatsache gelegt, dass der »Praeceptor Germaniae« weit mehr war als der Systematiker der lutherischen Theologie. Sein Arbeitsgebiet erstreckte sich auf die lateinische, griechische und hebräische Philologie, auf die Geschichtsschreibung und die Poesie. Zunehmende Beachtung in der Wissenschaft gewannen auch Melanchthons Bemühungen um die Mathematik und die Astronomie. Im Schnittbereich dieser beiden Wissenschaftsbereiche lag für den Wittenberger Professor ein weiteres Tätigkeitsfeld, das heute allerdings als keinesfalls unumstritten gelten kann: Die Astrologie.
Umstritten war sie schon zu Melanchthons Zeiten. Gerade Martin Luther hielt nichts von der Sternendeutung und äußerte dies auch drastisch. Trotzdem tolerierte er Melanchthons Bemühungen zumindest. Umgekehrt konzentrierte sich Melanchthon wiederum auf eine Astrologie als christlicher Wissenschaft. Denn auch wenn in Zeiten des Renaissance-Humanismus der Astrologie neue Impulse zuflossen, so gab es doch spätestens seit der Hochscholastik eine theologische Tradition, die die Sternendeutung als durchaus vereinbar mit dem christlichen Glauben verstand.
Nach biblischem Weltverständnis bildete der Sternenhimmel einen Teil der guten Schöpfung Gottes, die auf den Menschen ausgerichtet war. Der Mensch wiederum als Ebenbild Gottes konnte durchaus als »kleine Welt« verstanden werden, die im Zusammenhang mit der »großen« des Kosmos stand. Abgewehrt werden musste nur die Gefahr eines blind waltenden Schicksals, das dem Menschen keinen Handlungsraum bot und das gleichzeitig die theologische Einsicht von der Allmacht Gottes einschränkte. In diesem Rahmen versuchte Melanchthon seinen eigenen Weg zu gehen, wenn er meinte, dass die Sterne eine Neigung vermittelten, aber keinen Zwang.
Das Fortwirken der Astrologie im deutschen Protestantismus ist ein komplexes, wenig aufgearbeitetes Thema. Spätestens seit der Aufklärung steht sie unter dem Verdikt der Scharlatanerie oder bestenfalls des Selbstbetruges. Dazu will wenig passen, dass bis heute selbst seriöse Tageszeitungen Horoskope abdrucken. Zwar glauben nach einer neueren Umfrage lediglich 4 Prozent der Bevölkerung an deren Richtigkeit, jedoch vermögen andererseits nur 40 Prozent der Befragten mit absoluter Sicherheit zu behaupten, dass es mit der Astrologie ganz und gar nichts auf sich habe (Studie des BAT-Institutes 1997).
Die Ausstellung »Melanchthons Astrologie« kann und will diese heutigen Zahlen nicht kommentieren. Ihre Aufgabe ist es vielmehr, die Verhältnisse in der Zeit von Reformation und Konfessionalisierung zu dokumentieren. Dem weiß sich auch der vorliegende Begleitband verpflichtet. Die dabei auftretenden inhaltlichen und methodischen Schwierigkeiten waren jedoch so beträchtlich, dass man eigentlich auf den provisorischen Charakter des Unternehmens schon im Untertitel hinweisen müsste. Ausstellung und Begleitband stellen einen ersten Versuch dar, sich auf vielfältige Weise dem Thema zu nähern. Bildlich gesprochen, kann nicht eine durchgearbeitete Topografie geboten werden, sondern nur eine erste Umrissskizze, der weitere Detailarbeiten folgen müssen. Trotzdem scheint das Thema wichtig genug und das dazugehörige Material in seiner Anschauung von so erheblicher Bedeutung, dass diese erste Aufschlussbohrung gewagt werden musste. In bisher einmaliger Weise bedurfte es dazu der Hilfe von außen.
Ohne Jürgen G. H. Hoppmann wären weder Ausstellung noch Begleitband zustande gekommen. Als Kurator des Projektes hat der Berliner Astrologe und Physiotherapeut sich unermüdlich um »Melanchthons Astrologie« bemüht und mancherlei Widerstände überwunden. Zurecht steht daher sein Name auf dem Begleitband als Herausgeber. Zu danken ist aber auch der langjährigen Leiterin des Wittenberger Melanchthonhauses, Edeltraud Wießner, die die Kontakte nach Berlin knüpfte und das Fundament für eine fruchtbare Zusammenarbeit legte. Die Fülle der Leihgeber erforderte einen eigenen Abschnitt (vgl. Danksagungen S.108ff.). Ohne sie wie auch die Sponsoren wäre die Ausstellung nicht zu realisieren gewesen. Besonderen Dank verdienen die 28 Beiträger des vorliegenden Bandes. In ihrer Unterschiedlichkeit, ja Disperatheit, verkörpern sie idealtypisch die Herausforderungen und Probleme des Themas. Nicht zufällig kommen im Begleitband Verfechter wie Bekämpfer der Astrologie ebenso zu Wort wie renommierte Fachwissenschaftler und Amateure. Dies entspricht dem Sachstand der »Sternenwissenschaft« im 16. Jahrhundert und seinen Wirkungen. Den Kontroversen innerhalb des Sammelbandes werden sich zweifellos Kontroversen bei den Lesern anschließen. Dies ist durchaus beabsichtigt, solange klar bleibt, was im folgenden zu lesen ist: Ein Zwischenbericht, eine Momentaufnahme auf dem Weg zu besserem Verständnis und abschließendem Urteil. Mehr nicht, aber auch nicht weniger.
Jürgen G. H. Hoppmann wird in einem Ende 1997 erscheinenden Buch unter dem Titel »Astrologie der Reformationszeit«, Clemens-Zerling-Verlag, Berlin, seine Erfahrungen aus dem Ausstellungsprojekt für die gegenwärtige Astrologie nutzbar machen. Dessen Lektüre sei hier ausdrücklich empfohlen, nicht zuletzt deswegen, weil der Kontrast die Zielstellung unseres Vorhabens verdeutlicht.
In einem Brief an Veit Dietrich in Nürnberg vom Oktober 1543, der sich mit dem Abendmahlsstreit zwischen Luther und den Schweizern befaßte, kam Melanchthon zu dem Schluss, dass als letzter Grund für die Kontroverse die unheilvolle Konjunktion zwischen Mars und Saturn verantwortlich sei. Aber genau deswegen müßten fromme und gelehrte Leute versuchen, die Einflüsse der Sterne abzumildern, um das Gespräch nicht abreißen zu lassen (CR5, 209). Mag man auch mit Luther Zweifel an der Analyse haben, das Ziel dürfte sich auch heute als erstrebenswert darstellen.
Wittenberg, im Juli 1997
MARTIN TREU Direktor der Lutherhalle und des Melanchthonhauses
EDELTRAUD WIEßNER: Vorwort
»Wie wäre es, wenn die Kenntnis über die Bewegung der Himmelskörper etwa in ganz Europa unbekannt wäre? ... Den Zugang zur Vollkommenheit in der Wissenschaft eröffneten viele geistvolle und lernbegierige Männer wie Purbach, ... Cusanus, ... Regiomontanus, Copernicus. Sie haben durch ihren geistvollen Scharfsinn und ihre Findigkeit ... den ganzen Bereich der Wissenschaft erleuchtet.«
Worte eines hervorragenden Geistes, eines Mannes, der als Reformator, universaler Gelehrter und »Praeceptor Germaniae« von 1518 bis 1560 an der Wittenberger »Leucorea« wirkte und dessen 500. Geburtstag wir in diesem Jahr begehen.
Philipp Melanchthon, am 16. Februar 1497 in Bretten geboren und am 19. April 1560 in Wittenberg gestorben, ist dieser Katalog zur Sonderausstellung »Melanchthons Astrologie - Der Weg der Sternenwissenschaften zur Zeit von Humanismus und Reformation« gewidmet.
Als Melanchthon 1512 die Heidelberger Universität verlässt, um in Tübingen seine Studien fortzusetzen, kommt er in enge Berührung mit dem dortigen Professor der Mathematik und Astronomie Johannes Stoeffler und wird durch diesen maßgeblich geprägt.
Seine mathematischen und astronomischen Kenntnisse erlangte Melanchthon durch diesen Mann. Dies trifft auch auf seinen Glauben an die Astrologie zu, der sich nicht nur in seinen Briefen, sondern auch in einigen seiner Werke widerspiegelt. So setzte er sich u.a. in seiner »Initia doctrinae physicae«, die 1549 erschien, mit dem All und den Himmelskörpern auseinander. Für ihn war die Astrologie nicht nur prophezeiender Teil der astronomischen Wissenschaft, sie war auch ein Teil der Physik, wie dieses Werk Melanchthons zeigt.
Eingehend beschäftigte sich Melanchthon in seiner Wittenberger Zeit mit Ptolemäus‹ »Tetrabiblos« (Vier Bücher über die Sternenwissenschaften) und hielt zwischen 1535 und 1545 Vorlesungen darüber. Er vertritt die These, dass die Astrologie großen Nutzen für das Leben bringe und eine wahre Wissenschaft sei. So finden die Mathematiker und Astrologen Georg Joachim Rheticus und Erasmus Reinhold an der Wittenberger Universität Melanchthons volle Unterstützung und Förderung. Erasmus Reinhold verfaßt sogar die Geburtstagshoroskope von Melanchthons Kindern. Solche »nativitates«, wie man sie damals bezeichnete, wurden auch von Melanchthon für seine Freunde, Studenten und Verwandten erstellt. Sein intensives Studium der Astrologie ermöglichte ihm, die Konstellation der Sterne zu beurteilen und entsprechende Ableitungen zu treffen. So trat Melanchthon selbst nie eine Reise an, ohne zuvor die Sterne befragt zu haben. Da sein Geburtshoroskop aussagte »meide das Wasser«, ist er nie einer Einladung und auch Berufung (z.B. nach Dänemark oder England) gefolgt, die die Überquerung großer Wasser erforderte.
Der Autor der Ausstellung, Herr Jürgen G. H. Hoppmann, hat es durch seine internationalen Verbindungen zu Astrologen und Wissenschaftlern verstanden, Autoren für seinen Katalog zu gewinnen und Exponate für die Ausstellung zu beschaffen.
Mögen die Sonderausstellung und der Katalog dazu beitragen, dass einmal der Aspekt der Astrologie im Leben Melanchthons stärker in den Vordergrund gerückt, und so dem Besucher und Leser nicht nur die Person, sondern auch die Zeit, in der er lebte, uns rein menschlich näher gebracht wird.
A. d. Hrsg.:
Die Diplomhistorikerin Edeltraud Wießner war über zwei Jahrzehnte Museumsdirektorin, zuerst des Stadtgeschichtlichen Museums und ab 1978 bis Ende 1993 des Melanchthonhauses Wittenberg. Danach war sie bis Ende 1996 Kustos dieser Einrichtung. Von ihr herausgegeben wurden Teil 1 bis 5 der Schriftenreihe des Stadtgeschichtlichen Museums Wittenberg. Bezogen auf das Ausstellungsthema ist besonders der zweite Band interessant: Die weisse Frau im Wittenberger Schloss - Sagen und Geschichten aus dem Kreis Wittenberg, Wittenberg 1970.
I - Causa Materialis: Die Sternenwissenschaften
WOLF-DIETER MÜLLER-JAHNCKE: Magister Philippus und die Astrologie eine kleine Zitatensammlung
Das erste, was von einem Rang und erster Gewichtung ist, ist nämlich [die Astronomie], von der wir gewissermaßen die Zeit der Umläufe der Sonne und des Mondes und der anderen Sterne, deren Stellung untereinander und wie sie die Erde ansehen, erlernen. Das andere aber [die Astrologie], durch welches wir die Veränderungen, die in den Körpern entstehen, die aus den Stellungen der Gestirne herrühren, erfahren wir durch die natürlichen Qualitäten der Gestirne. (Unum, quod primum ordine est, et potestate, quo deprehendimus quodlibet tempore motus Solis et Lunae et aliorum siderum, eorumque positus inter sese, aut spectantes terram. Alterum vero, quo mutationes, quae efficiuntur in corporibus, quae congruunt ad illos positus, consideramus per naturales qualitates siderum. (1)
... da ich ja diesen wunderbaren Zusammenklang der himmlischen Körper mit dem Unteren bewundere, mahnt mich diese Ordnung und Harmonie, dass die Welt nicht zufällig geschaffen worden sei, sondern nach göttlichem Willen. (... cum hunc mirificum consensum corporum coelestium et inferiorum contemplor, ipse me ordo et harmonia admonet, mundum non casu ferri, sed regi divinitus.) (2)
Und so glaube ich, dass es eine uralte Wahrheit ist, dass die Anzeichen der Änderungen in der unteren Materie oft von der Stellung des Gestirns abhängen. Dies glauben einige mehr, andere weniger. (Et arbitror vetustissimam hanc fuisse Sapientiam, insignes materiae inferioris mutationes multas referra ad Siderum positus, qua in re alii plura, alii pauciora scrutati sunt.) (3)
Es ist aber wahr, dass durch die Stellung der Gestirne die Temperamente gelenkt und verändert werden. (Verum est autem, stellarum positu gubernari et variari temperamenta.) (4)
... Vor 60 Jahren ließ mir mein Vater das Horoskop stellen. Er besorgte es bei dem pfälzischen Mathematiker und hochbegabten Mann Hassfurt, seinem Freund. In dieser Vorhersage wurde beschrieben, dass mein Weg nach Norden gefährlich sein werde und dass ich Schiffbruch im baltischen Meer erleiden werde. Ich habe mich oft gewundert, warum ich, nahe den Hügeln des Rheins geboren, im arktischen Ozean eine Gefahr fürchten sollte. Aber ich wollte nicht hingehen, wenn ich nach Britannien oder Dänemark gerufen wurde, denn ich fürchtete das Schicksal, auch wenn ich kein Stoiker bin. (..., Ante sexaginta annus meus pater describit Genethliam; curavit a Palatini Mathematico viro ingenioso Hasfurto, amico suo. In ea praedictione scriptum est, intinera me ad Boream periculosa habiturum esse, et me in mare Baltico naufragium facturum esse. Saepe miratus sum, cur mihi ratio in collibus Rheno vicinis praedixerit pericula in Arcto Oceano. Nec volui eo accedere vocatus in Britanniam et in Daniam. Metuo tamen fata, etiamsi non sum Stoicus.) (5)
Philipp an Schöner. Die Geburtsstunde Luthers, die Philo untersucht hat, verwandelt Carion auf die neunte Stunde. Die Mutter aber sagte, Luther sei in der Hälfte der Nacht (aber ich glaube, dass sie sich getäuscht hat), geboren worden. Ich selbst bevorzuge eine andere Nativität und diese bevorzugt auch Carion, obgleich sie unangenehm ist, wegen des Ortes des Mars und der Konjunktion in den Häusern [um] 5°, welche eine große Konjunktion mit dem Aszendenten darstellt. Übrigens, in welcher Stunde auch immer er geboren ist, diese wunderbare Stellung im Skorpion kann keinen streitbaren Mann hervorbringen. (Philippus ad Schonerum Genesim Lutheri quam Philo inquisiuit transtulit Carion in horam 9. Mater enim dicit Lutherum natum esse ante dimidium noctis {sed puto eam fefelli}. Ego alteram figuram praefero et praefert ipse Carion Etsi quoque haec est mirrifica propter locum Mars et Saturn in domos 5° quae habet coniunctionem magnam cum ascendente Caeterum quacunque hora natus est hac mira Saturn in Scorpio non potuit non efficere uirum acerrimum.) (6)
Literaturhinweise:
(1) CR (Corpus Reformatoricum), Bretschneider, C.G. (Hrsg.), Schleswig 1852, S. 10-11 (2) CR 10 (1842), S. 263 (3) Initia doctrinae physicae, Philipp Melanchthon, Wittenberg 1578, S. 9 (4) Melanchthon (wie Anm. 3), S. 82 (5) CR 9 (1842), Sp. 188-189 (6) Cod. Monac. lat. 27003, Bayerische Staatsbibliothek
Anm.d.Hrsg.:
Prof. Dr. Wolf-Dieter Müller-Jahncke, langjähriger Kurator des Deutschen Apotheken-Museums in Heidelberg, leitet seit Juli 1997 ein privates Forschungsinstitut zur Pharmaziegeschichte. Hinzuweisen sei auf folgende seiner Publikationen: Magie als Wissenschaft im frühen 16. Jahrhundert, Marburg 1973; Astrologisch-magische Theorie und Praxis in der Heilkunde, Wiesbaden 1984; Kostbarkeiten aus dem Deutschen Apotheken-Museum, Berlin 1993; Philipp Melanchthon und die Astrologie -Theoretisches und Mantisches. In: Melanchthonpreis Melanchthons Initia-Manuskript 3, Stefan Rhein (Hrsg.), Bretten 1997
HEINRICH KÜHNE: Wittenberg und die Astronomie
Im Gegensatz zu Martin Luther hat sich Philipp Melanchthon zeit seines Lebens mit Astronomie und Astrologie beschäftigt. Schon bei seiner Geburt ließ sein Vater ein Horoskop stellen, dasselbe tat der Humanist anlässlich der Geburt seiner Kinder. Planetenläufe, Kometenerscheinungen, Sonnen- und Mondfinsternisse versuchte er zu deuten. Da ist es wirklich erstaunlich, wie unter den damaligen Verkehrsverhältnissen die ersten Mitteilungen über die Forschungsergebnisse von Nicolaus Copernicus bis in das kleine Wittenberg gelangten. Die zahlreichen Studenten aus allen Ländern Europas verlangten sicherlich von ihren berühmten Lehrern darüber Auskunft und ihre Stellungnahme. Es ist bekannt, welche abweisende Haltung Luther dazu nahm und sich allein als ›Theologe äußerte. Melanchthon übernahm mit der astrologischen Meinung des Ptolemäus auch dessen geozentrisches ›Weltbild‹. Damit stellte er sich ebenfalls zunächst gegen die neuen Erkenntnisse des Domherrn in Frombork (Frauenburg).
Zu mehreren mathematischen und astronomischen Büchern schrieb Melanchthon das Vorwort, hier sei nur an Ausgaben des Ptolemäus, Purbach (Peuerbach), Schöner, Stifel, Regiomontanus und andere erinnert. In seiner Antrittsrede »Praefation in arithmeticen« aus dem Jahre 1536 sagt Georg Joachim von Lauchen, der sich nach seiner Heimat Rhaeticon (Vorarlberg) Rheticus nannte, bescheiden, dass er nur auf wiederholte Anregung seiner Lehrer Vorlesungen halten würde und die zweite Professur der Mathematik an der Alma mater angenommen hätte. (1)
Rheticus (1514-1576) hatte, bevor er endgültig nach Wittenberg kam, hier und in Zürich studiert. Dann hielt er sich in Nürnberg auf, wo er in Johann Schöner (1477-1547) einen sachkundigen Astronomen und Lehrer fand. Für ihn hatte Melanchthon eine zusätzliche zweite Professur für Mathematik beim Senat durchgedrückt, er war 23 Jahre alt, als er diese Stelle übernahm. Für seinen Lieblingsschüler hatte Melanchthon einen längeren Urlaub erreicht, sodass dieser die Reise zu Copernicus nach Frombork antreten konnte. Irgendwie lockte es den großen Humanisten sicherlich, mehr über die neue Lehre des Domherrn zu erfahren, keiner war besser dazu geeignet als der junge Mathematiker.
Rheticus machte den Umweg über Nürnberg und besuchte noch kurz seinen ehemaligen Lehrer Johann Schöner. In Frombork wurde der junge Gelehrte von Copernicus herzlich begrüßt: Hier blieb er nun, abgesehen von einem kurzen Zwischenaufenthalt in Wittenberg 1540, fast zwei Jahre. Aus der wissenschaftlichen Zusammenarbeit entwickelte sich schließlich eine enge Freundschaft und ein enges Vertrauensverhältnis. So kam es nach Abstimmung mit Copernicus dazu, dass Rheticus durch seine Schrift »De libris revolutionum ... Nicolai Copernici ... Narratio prima« (Erster Bericht... über die Bücher von den Umläufen ...des Copernicus), die 1540 in Danzig erschien und ein Jahr später in Basel gedruckt wurde, erstmalig der wissenschaftlichen Welt von den Forschungsergebnissen des Domherrn berichtete. Copernicus hatte sich eingehend mit der Trigonometrie beschäftigt und seine Arbeit über die ebene und sphärische Trigonometrie »DE LATERIBUS ET ANGVLIS TRIANGULORUM« wurde 1542 von dem berühmten Bibeldrucker Hans Lufft in Wittenberg gedruckt. Das vor mir liegende Original hat begreiflicherweise weder den Namen des Verlegers noch ein Signet desselben.
In diesem Zusammenhang sei an den Universitätsprofessor Titius erinnert, der in einer Gedenkrede auf Melanchthons 2oo. Todestag 1760 sagte: »In Wittenberg wurde ohne Melanchthons Rat oder Beihilfe kein Buch gedruckt.« (2)
So ist es auch nicht verwunderlich, dass das berühmte Werk von Copernicus: »De revolutionibus orbium coelestium«, das er 1515 begonnen und etwa 1530 beendet hatte, nicht in Wittenberg erschien. Erst durch die Bemühungen seiner Freunde und nicht zuletzt durch Rheticus willigte der Domherr ein, das Werk der Öffentlichkeit zu übergeben. Eine Abschrift hatte Rheticus angefertigt, wollte in der berühmten Druckerwerkstatt Wittenberg das Erscheinen durchführen lassen, doch der Senat soll es abgelehnt haben, sodass es dann in Nürnberg bei Johann Petrejus (Petreins) 1543 herauskam. Durch das Vorwort und die Veränderung des Titels durch den Nürnberger Theologen Andreas Osiander (1498-1552) wurden die Freunde des Fromborkers und nicht zuletzt auch Rheticus verärgert. Eine erzählende Darstellung gibt folgende Situation wieder: »Mit Freude bemerkte dies der Kanonikus Jerzy Donner, er beugte sich über den Kranken (Copernicus) und sagte mit starker Stimme: ›Ich bringe dir, geliebter Doktor, eine freudige Botschaft. Von Georg Joachim Rheticus kam ein Bote und brachte das erste Exemplar deines gedruckten Werkes De revolutionibus orbium coelestium, noch fast feucht und nach Druckerschwärze duftend. Gleichzeitig hat man dein Werk an bedeutende Gelehrte in der ganzen Welt versandt.‹« (3)
Damit hatte Rheticus seine wichtigste Arbeit getan. Er hatte kein Interesse daran unter diesen Umständen in Wittenberg zu lehren und ging nach Leipzig und dann nach Krakau. Während man sich zunächst im katholischen Lager ruhig verhielt, griffen die Wittenberger das berühmte Werk an, 1541 verlangte Melanchthon sogar ein staatliches Eingreifen. Erst in seinen letzten Lebensjahren änderte er seine Meinung und erklärte: »Wie wäre es, wenn die Kenntnisse über die Bewegung der Himmelskörper etwa in ganz Europa unbekannt wäre?... Den Zugang zur Vervollkommenheit in der Wissenschaft eröffneten viele geistvolle und lernbegierige Männer, wie Peurbach, Cusanus, Regiomontanus, Kopernikus. Sie haben durch ihren geistigen Scharfsinn und ihre Findigkeit den ganzen Bereich der Wissenschaften erleuchtet.«
Auch Melanchthons Schwiegersohn, der Universitätsprofessor Caspar Peucer (1525-1602), lehnte die neue Lehre in seinem 1551 erschienenen Lehrbuch über die Astronomie glatt ab. Doch innerhalb der Gelehrten an der Alma mater war man anderer Meinung. So schrieb Mathias Lauterbach einmal an Rheticus in Leipzig: »Wir werden den Kopernikus lieben und gegen die Angriffe und die Missgunst der Übelwollenden verteidigen.« (4)
Erasmus Reinhold (1511-1553), ein Schüler von Rheticus, berechnete als Mathematikprofessor an der Wittenberger Universität neue Planetentafeln, die auf der copernicanischen Grundlage fußten. Sie erschienen 1551 unter der Bezeichnung »Prutenicae tabulae coelestium motuum« (»Preußische Tafeln der Himmelsbewegungen«). Sie wurden so genannt, weil Herzog Albrecht von Preußen (1490 - 1568) die Herausgabe und den Druck finanzierte. 1571 und 1584 kamen weitere Veröffentlichungen heraus, sie beherrschten bis zu Kepler die rechnende Astronomie.
Tycho Brahe (1546-1601) kam nach Wittenberg, um sein Studium hier fortzusetzen, das er in Leipzig begann und nach seinem Fortgang von Wittenberg in Rostock fortsetzte. 1599 kam er noch einmal hier her und wohnte im Melanchthonhaus in der Collegienstraße, bis er seine Reise nach Prag zu Kaiser Rudolf II. antrat. Auf über seine wissenschaftliche Arbeit in Prag und der seines Mitarbeiters Johannes Kepler (1571-1630), des berühmten Entdeckers der Urgesetze der Planetenbewegung hier einzugehen, würde zu weit führen. Soviel sei hier erwähnt, dass der berühmte Astronom bei der Besetzung einer Stelle als Mathematikprofessor hier zur engeren Wahl stand. 1611 heißt es in einem Bericht: »Wenn dann Johannes Keplerus, der uns sonst seiner Geschicklichkeit halben berühmt, nicht zu erlangen« (ist) 5. Vermutlich hat das Oberkonsistorium in Dresden, das das Mitspracherecht hatte, Kepler abgelehnt.
Giordano Bruno (1548-1600) war 1575 aus dem Kloster in Neapel geflohen und kam, nachdem er in Genf ins Gefängnis geworfen worden war, über Marburg nach Wittenberg. Von 1586 bis 1588 hielt er an der Wittenberger Universität Vorlesungen ab, wobei er sich als überzeugter Anhänger der Copernikanischen Lehre gab. Bei seinem Fortgang von der Elbestadt verfasste er ein langes Gedicht, worin er den hohen Stand der Bildung an der Alma mater pries und die Studenten aus allen Ländern Europas, die er hier vorfand, nannte. In seinen Büchern stellte er eine Anzahl Thesen auf, die seiner Epoche vorauseilten und erst durch spätere astronomische Entdeckungen bestätigt wurden. Mit ihm wurde das heliozentrische System aus einer zunächst isolierten astronomischen Lehre zum Ausgangspunkt einer neuen Naturphilosophie.
Inzwischen waren die Wittenberger Gelehrten eifrig bemüht, auf den Festungswällen von einer Beobachtungsstelle aus Himmelsbeobachtungen durchzuführen. 1587 erregte das den Unwillen des Festungskommandanten, der erreichte, dass der sächsische Kurfürst Christian I. (15861591) bestimmte, dass sich die Astronomen einen anderen Platz für ihre Beobachtungen suchen sollten. Anstelle von Kepler nahm man Ambrosius Rhode. Er war ein Schüler und Mitarbeiter Brahes gewesen und hat es verstanden, die Gedanken seines Lehrers an der Leucorea erfolgreich fortzusetzen. Ein interessanter Gelehrter war der Professor der Mathematik, Johann Prätorius (1537 - 1616), er war ein direkter Gegner der Astrologie und des Kometenaberglaubens. Eine gewisse Bedeutung hatte der Gelehrte Valentin Otto, der hier nur kurze Zeit war, doch das große trigonometrische Werk von Rheticus vollendete. Erwähnen sollte man Johann Friedrich Weidler, dessen Geschichte der Astronomie bis in unsere Zeit von größtem Wert war.
Ernst Florens Friedrich Chladni (1756 - 1827), Jurist und Physiker, sammelte Meteoriten in ganz Europa und wies nach, dass sie kosmischen Ursprungs sind. Aus einer Pechschwelerfamilie stammte Johann Gottfried Galle, der in der Dübener Heide geboren wurde und von 1812 bis 1910 lebte. Er besuchte das Wittenberger Gymnasium, studierte in Berlin und entdeckte, nachdem er von dem französischen Astronomen Lerrier wichtige Unterlagen erhalten hatte, am 23. September 1846 den Planeten Neptun.
Abschließend möchte ich das Zeiss-Kleinplanetarium mit 44 Sitzplätzen erwähnen, das in der hiesigen Rosa-Luxemburg-Schule am l. September 1987 eingeweiht wurde 6. Ferner hat der rührige Berliner Musikalienverleger Rolf Budde unter großen Mühen und unter Einsatz erheblicher finanzieller Mittel den Wiederaufbau (ab 1995, Anm. d. Hrsg.) eines turmähnlichen Sternwartenhäuschens veranlasst, so wie es einst der Wittenberger Universitätsprofessor Johann Jacob Ebert (1737-1805) auf seinem Grundstück Bürgermeisterstraße 16 in Wittenberg errichtet hatte.
Anmerkungen:
(1) C.R.XI.284 (2) Memoria Melanthonis. Wittenberg 1760 (3) Ludvrik Hieronimus Morstin: Polnischem Boden entsprossen. In: »POLEN« Nr. 2. Warschau 1973 (4) Gerhard Harig: Die Tat des Kopernikus. Leipzig/Jena/Berlin 1965, S.5o (5) J. Chr. Grohmann: Annalen der Univ. Wittenberg. Meißen 1801, S. 192 (6) »Freiheit«, Kreisausgabe Wittenberg vom 25.8.1987
Literatur:
• J.Jordan/O.Kern: Die Universitäten Wittenberg-Halle vor und bei ihrer Vereinigung. Halle 1917 • W.Friedensburg: Geschichte der Universität Wittenberg, Halle 1917 • W.Friedensburg: Urkundenbuch der Universität Wittenberg. Teil II. Magdeburg 1927 • G.Harig: Die Tat des Kopernikus. Leipzig/Jena/Berlin 1965 • J.Adamczewski: Polnische Kopernik-Städte, Warschau 1972 • J.Adamczewski: Mikolaj Kopernik und seine Epoche: Warschau 1972 • H.Wußing: Nicolaus Copernicus -Leben und Wirken. In: Wissenschaft und Fortschritt. Nr. 2. Berlin 1973 • S.Wollgast / S. Marx: Johannes Kepler. Leipzig/Jena/Berlin 1976 • O.Heckmann: Copernicus und die moderne Astronomie. In: Nova Acta Leopoldina. NF. Bd. 38, Nr. 215. Halle 1981
A. d. Hrsg.:
Der Historiker Heinrich Kühne leitete jahrzehntelang das Stadtgeschichtliche Museum im Melanchthonhaus Wittenberg. Von seinen zahlreichen Publikationen seien hier nur die aktuellesten genannt: Die Geschichte des Hauses Bürgermeisterstraße 16 und seiner Bewohner in Wittenberg, Wittenberg 1994 - Vom Wittenberger Rechtswesen, von Scharfrichtern und ihren Tätigkeiten, Wittenberg 1995.
EDGAR WUNDER: Melanchthons Verhältnis zu Horoskopen - eine Beurteilung aus heutiger wissenschaftlicher Sicht
Die Entstehung moderner wissenschaftlicher Disziplinen ist mit vielen Ausscheidungsprozessen verbunden, bei denen mythische und magische, teleologische und geschichtsphilosophische, sowie andere vorwissenschaftliche und spekulative Elemente hinter sich gelassen werden. Als Beispiele sind die Lösung der Astronomie von der Astrologie, der Chemie von der Alchemie, oder auch - im 20. Jahrhundert - der Psychologie von der Psychoanalyse zu nennen.
Philipp Melanchthon steht an einem historisch interessanten Punkt im Loslösungsprozess der Astronomie von der Astrologie, der wenige Jahrzehnte vorher erstmals massiv von Pico de Mirandola angestoßen und vorangetrieben wurde. Dabei ging es - im Unterschied zur Spätantike - nicht darum, die Astrologie aus religiösen Gründen zu dämonisieren und zu verdammen, sondern es gelang zunehmend zu zeigen, dass ihr die wissenschaftliche Grundlage fehlt. Als ein Vertreter neoscholastischen Denkens musste sich Melanchthon in diesem Streit mit einer gewissen Zwangsläufigkeit auf die konservative Seite schlagen und die Astrologie ebenso wie das überholte heliozentrische Weltbild gegen die Angriffe der Kritiker verteidigen.
500 Jahre später ist dies nur noch aus wissenschaftshistorischer Perspektive interessant. Inhaltlich sind die von Melanchthon in dieser Sache vertretenen Positionen mit Recht schon lange auf dem Müllhaufen der Geschichte gelandet. Doch während die letzten Vertreter heliozentrischen Denkens im 19. Jahrhundert endgültig ausgestorben sind, hat die Astrologie im 20. Jahrhundert als »gesunkenes Kulturgut« (1) eine unvermutete Wiederauferstehung gefeiert: als Pseudowissenschaft jenseits jeglicher wissenschaftlicher Anerkennung, als religioides Surrogat in Reaktion auf die Individualisierungsschübe der Moderne und der daraus entstehenden Sinnkrise. (2)
Freilich sollte man nicht übersehen, dass weder die heutige Astronomie noch die aktuelle Astrologie mehr sonderlich viel mit ihren Erscheinungsformen zur Zeit Melanchthons zu tun haben. Die Astronomie ist seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zur Astrophysik mutiert und behandelt heute Fragen, die für Melanchthon undenkbar bzw. unbeantwortbar und als nicht der Astronomie zugehörig erschienen wären.
Die moderne Astrologie ist - nachdem Mitte des 19. Jahrhunderts astrologisches Denken beinahe vollständig von der Bildfläche verschwunden war - dagegen weitgehend ein Kind der Theosophie, eine von Helena Petrowna Blavatsky (1831-1891) ins Leben gerufene okkult-spirististische Geheimlehre, in deren Rückenwind und Nachfolge die astrologische Wiederbelebung erst denkbar und ohne deren Hintergrund viele Charakteristika der heutigen Astrologie überhaupt nicht verständlich wären.
Sowohl die objektiv bestehende als auch die subjektiv empfundene Distanz zwischen Astronomen und Astrologen könnte heute kaum größer sein. Wenn nämlich Astrologen von einem Zusammenhang zwischen »Oben und Unten«, von einer »Einbettung des Menschen in den Kosmos« sprechen, dann muss Astronomen auffallen, dass der ihnen bekannte, reale Kosmos im Horoskop überhaupt nicht vorkommt. Tierkreiszeichen und Häuser sind willkürliche menschliche Setzungen, die keine physische Entsprechung in den Weiten des Alls haben. Die Astrologen interessieren sich auch nicht für die Planeten als reale Himmelskörper, ihre Entfernung, Zusammensetzung, Größe oder auch für die von ihnen ausgehenden Kraftfelder. Das einzige, was für Astrologen relevant ist, sind die von Menschen erdachten Planeten-Symbole und ihre Assoziationen zu antiken Planeten-Gottheiten und ihren Mythen. Die Rede vom Zusammenhang zwischen »Oben und Unten« ist aus astronomischer Sicht somit schon allein deshalb irreführend und eine Farce, weil das »Oben«, der real existierende Kosmos, im Horoskop überhaupt nicht vorkommt. Stattdessen findet der Astronom im Horoskop als vermeintlichen »Kosmos« ein irreales, willkürlich zusammengeschustertes Zerrbild vor, das mit dem erfahrbaren Universum kaum etwas zu tun hat. Erklärbar ist diese ideologische Erstarrung der Astrologie nur durch ein kontinuierliches Ignorieren beinahe sämtlicher neuer astronomischer Erkenntnisse seit den Zeiten Melanchthons, als die Erde noch im Mittelpunkt der Welt und die Entfernungen der Gestirne nicht bekannt waren, die Planeten als physische Himmelskörper noch nicht vorstellbar und die Astronomie auf bloße Mathematik reduzierbar war. »Kein Naturwissenschaftler sagt«, so der bekannte Astronom Joachim Herrmann (3), »dass wir Menschen isoliert, ohne Beziehung zum Weltall leben. Aber gerade die wirklich nachgewiesenen Zusammenhänge (z.B. Gezeiten, Sonnenaktivität) sind gar nicht von Astrologen gefunden und erklärt worden und spielen auch im astrologischen Lehrsystem überhaupt keine Rolle. Die Welt ist komplizierter, aber auch faszinierender aufgebaut, als Astrologen vorgeben«. In Wirklichkeit sei die Astrologie »eine staubtrockene, papierene Angelegenheit, die nichts mit der Mannigfaltigkeit des Universums und der menschlichen Psyche zu tun hat«. Und was die Idee der kosmisch-irdischen Lebenseinheit betreffe, so der Astronom Robert Henseling (4), hätten diese die Astrologen »weder erarbeitet noch gepachtet«. Das astrologische Lehrsystem sei »nicht ein angemessener Ausdruck dieser Idee, sondern ein gehaltloser, karikierender Mißbrauch dieser Idee«.
Sich gegen die von astronomischer Seite geübte Kritik immunisierend, aber durchaus auch in Kenntnis dessen, dass an »eine astronomische Begründung der Astrologie derzeit kaum im Ansatz zu denken ist«, so der Astrologe Schubert-Weller (5), wird von astrologischer Seite her nicht weniger harsch geantwortet. So stellt z.B. der langjährige Vorsitzende des Deutschen Astrologen-Verbands, Peter Niehenke (6), kategorisch fest: »Die Naturwissenschaft hat zur Frage der Gültigkeit der gen. Die Astronomie am allerwenigsten!«. Nicht nur sind also Astronomen und Astrologen unterschiedlicher Ansicht, sondern ihnen fehlt bereits eine gemeinsame Gesprächsbasis, auf der man überhaupt noch streiten könnte.
Auch das in der Tradition von Ptolemäus stehende Bestreben Melanchthons, die Astrologie im Sinne von kausalen Gestirnseinflüssen als einen »Teil der Physik« zu begründen, so seine Abhandlung Oratio de dignitate astrologiae (7), die er 1535 durch seinen Schüler Jakob Milich an der Wittenberger Universität vortragen ließ, gerade diese Vorstellung ist heute restlos überholt. Nicht nur Astronomen und andere Naturwissenschaftler stellen heute fest, dass solche postulierten astrologischen Gestirnseinflüsse im Rahmen der mittlerweile gut bekannten Naturgesetze keinen Platz haben bzw. sogar im groben Widerspruch zu ihnen stünden (8), sondern auch Astrologen wie z.B. Peter Niehenke (9) geben offen zu, dass der Versuch, die Astrologie »physischkausal aufzufassen, unvereinbar ist mit der Art, wie Astrologie praktisch betrieben wird«.
Neben diesem »Erklärungsnotstand« entscheidend sind schließlich noch viele Hunderte seit 1908 durchgeführte empirisch-statistische Überprüfungen, die vor allem von Psychologen durchgeführt wurden und für die Astrologie zu vernichtenden Resultaten führten (vgl. Anm. 10 zur Übersicht). Spätestens hier wird deutlich, dass die Ablehnung der Astrologie bei Weitem nicht nur eine Sache der Astronomie oder der Naturwissenschaften ist, sondern ebenso vehement durch die wissenschaftliche Psychologie erfolgt, die ihm Rahmen ihrer Untersuchungen zahlreiche psychologische Mechanismen identifizieren konnte, die vermeintlich positive subjektive »Erfahrungen« zugunsten der Astrologie hervorbringen und sie als paranormales Überzeugungssystem stabil halten. (11)
Das war zu Zeiten Melanchthons nicht anders. Auf den Punkt gebracht hat das Urteil der modernen Wissenschaften der Publizist Ludwig Reiners (12): »Astrologie ist nichts anderes als eine nachweislich falsche Theorie zur Erklärung nachweislich nicht vorhandener Tatsachen«. Eine ähnliche Sprache findet sich in zahlreichen öffentlichen Stellungnahmen verschiedener astronomischer Fachgesellschaften, wie beispielsweise 1996 in der Erklärung des Rates deutscher Planetarien (RDP) (13), in der die Astrologie schlicht als »Aberglaube und Ersatzreligion« bezeichnet wird.
Sofern nun moderne Astrologen versuchen sollten, unter Berufung auf den Praeceptor Germaniae Horoskopen neue Legitimität zu verschaffen, eine Legitimität, die sonst nirgends mehr zu gewinnen ist, dann ist dies nicht sonderlich schwer als unhistorisches und interessengeleitetes Denken zu erkennen. Vor allem aber tragen solche auf längst historisch gewordene Autoritäten gestützte »Versöhnungsversuche« mit der modernen Wissenschaft allzu deutlich scholastischen Charakter, weshalb sie von vornherein zum Scheitern verurteilt und als Wunschdenken zu betrachten sind.
Was können uns die astrologischen Neigungen des Philipp Melachthon heute noch sagen? Bei seiner Begründung der Astrologie hat Melanchthon in seinem Werk initia doctrinae physicae (14) im wesentlichen drei Argumentationslinien verfolgt. Erstens berief er sich auf die Philosophie des Aristoteles und setzte damit Autoritäten an die Stelle eines erfahrungswissenschaftlichen Zugangs. Dies ist ein Weg, der uns heute für immer versperrt sein sollte. Zweitens versuchte er, eine Autorität der Bibel auch in naturkundlicher Hinsicht ins Feld zu führen. Damit hat er, wie Knappich (15) richtig betont, nicht zuletzt in theologischer Hinsicht seinen Schülern ein schlechtes Beispiel gegeben. Schließlich berief er sich drittens auf diverse vorwissenschaftliche, subjektive und unkontrollierte »Erfahrungen«, die auch schon seinen damaligen Zeitgenossen, nicht zuletzt Luther, als suspekt erschienen. Ein schönes Beispiel ist seine noch 1535 in der von ihm verfaßten Oratio de dignitate astrologiae enthaltene Behauptung, ein Einfluss der Gestirne auf das Wetter sei durch die für 1524 aufgestellten Sintflut-Prophezeiungen belegt (vgl. 16).
Den Untiefen und Gefahren der subjektiven Erfahrung (17), im Gegensatz zur Empirie, stand Melanchthon noch durchaus unkritisch gegenüber, er ließ sich treiben und ängstigen von seiner astrologischen Vorstellungswelt, und erwies sich dabei im Gegensatz zu vielen Zeitgenossen auch nicht als lernfähig angesichts seiner eigenen zahlreichen astrologischen Fehlprognosen. Wo könnte dies besser zum Ausdruck kommen als in einer von Luthers Tischreden aus dem Januar 1537: »Es schmerzt mich, dass Philipp Melanchthon so der Astrologie anhängt, weil man sich sehr über ihn lustig macht. Denn er lässt sich leicht von den Himmelszeichen beeinflussen und in seinen Gedanken zum Besten halten. Es hat ihm oft gefehlt, doch ist er nicht zu überzeugen. Als ich einst von Torgau kam, ziemlich krank, sagte er, es sei nun mein Schicksal zu sterben. Ich habe nie geglaubt, dass es ihm so ernst ist« (18). Wollten wir aus all dem wirklich eine Lehre für die heutige Zeit ziehen, so könnte Philipp Melanchthon geradezu als Musterbeispiel dafür dienen, wie wir uns der Astrologie nicht nähern sollten.
Anmerkungen / Literatur:
(1) Bender, H. (1973): Verborgene Wirklichkeit. Walter, Olten, S. 227. (2) Wunder, E. (1995): Astrologie - alter Aberglaube oder postmoderne Religion? In: Kern, G., Traynor, L.: Die esoterische Verführung. Alibri, Aschaffenburg. (3) Herrmann, J. (1995): Argumente gegen die Astrologie. Skeptiker 8 (2), S. 49. (4) Henseling, R. (1939): Umstrittenes Weltbild. Reclam, Leipzig, S. 330. (5) Schubert-Weller, C. (1993): Spricht Gott durch die Sterne? Claudius, München, S. 108. (6) Niehenke, P. (1985): Astrologie - Das falsche Zeugnis vom Kosmos? Meridian 6/85, S. 5. (7) Melanchthon, Philipp: CR (Corpus Reformatoricum), Bretschneider, C.G. (Hrsg.), Schleswig 1852, S. 262. (8) Kanitscheider, B. (1989): Steht es in den Sternen? Universitas 44 (4), S. 330. (9) Niehenke, P. (1994): Astrologie - Eine Einführung. Reclam, Stuttgart, S. 233. (10) Dean, G., Mather, A., Kelly, I.W. (1996): Astrology. In: Stein, G.: Encyclopedia of the Paranormal. Prometheus, Amherst/New York. (11) Wunder, E. (1994): Von der psychologischen Astrologie zur astrologischen Psychose. Astronomie + Raumfahrt 31 (23), S. 19. (12) Rat deutscher Planetarien (1996): Die Sterne (13) Reiners, L. (1951): Steht es in den Sternen? Paul List, München, S. 191. (14) Melanchthon, Philipp: Initia doctrine Physicae, Wittenberg 1578. (15) Knappich, W. (1967): Geschichte der Astrologie. Klostermann, Frankfurt, S. 203. (16) Müller-Jahncke, W.-D. (1985): Astrologisch-magische Theorie und Praxis in der Heilkunde der frühen Neuzeit. Franz Steiner, Stuttgart, S. 229. (17) Wunder, E. (1997): Subjektive Erfahrung Chance oder Gefahr? In: Köbberling, J.: Zeitfragen der Medizin. (18) Luther, Martin: Tischreden, 3. Band, Nr. 3520. Hermann Böhlaus Nachfolger, Weimar 1914, S. 373.
A. d. Hrsg.:
Der Soziologe Edgar Wunder ist Redaktionsleiter der Zeitschrift »Skeptiker« und bei der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften (GWUP) sowie der Vereinigung der Sternfreunde (VdS), dem größten astronomischen Verband im deutschsprachigen Raum, zuständig für Astrologie.