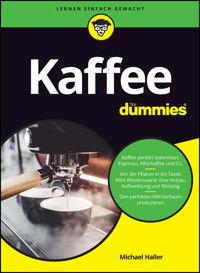Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UTB GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Recherchieren war noch nie so wichtig – und so kompliziert – wie im Zeitalter des Internets. Alles Wissen dieser Welt scheint verfügbar. Doch was ist tatsächlich neu, was zuverlässig? Der Schlüssel heißt "methodisches Recherchieren" und findet sich in diesem für Studierende komplett überarbeiteten Klassiker der Journalistenausbildung. Die grundlegenden Methoden und Theorien des Recherchierens in einem Band, unabhängig von Kanal oder Medium und zeitlos gültig.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
utb 4655
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Böhlau Verlag · Wien · Köln · Weimar
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto
facultas · Wien
Wilhelm Fink · Paderborn
A. Francke Verlag · Tübingen
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Nomos Verlagsgesellschaft · Baden-Baden
Ernst Reinhardt Verlag · München · Basel
Ferdinand Schöningh · Paderborn
Eugen Ulmer Verlag · Stuttgart
UVK Verlagsgesellschaft · Konstanz, mit UVK / Lucius · München
Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen · Bristol
Waxmann · Münster · New York
Michael Haller
Methodisches Recherchieren
8., komplett überarbeitete Auflage
UVK Verlagsgesellschaft mbH · Konstanz
mit UVK/Lucius · München
Michael Haller, Prof. Dr. phil. leitet die Journalismusforschung an der Hamburg Media School und ist Beirat in mehreren Einrichtungen der Journalistenweiterbildung. Bis zu seiner Emeritierung hatte er den Journalistik-Lehrstuhl an der Universität Leipzig inne. Zuvor war er Journalist und arbeitete u. a. viele Jahre beim SPIEGEL, anschließend als Ressortleiter bei der ZEIT.
Online-Angebote oder elektronische Ausgaben sind erhältlich unter www.utb-shop.de.
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
(Auflage 1–7 unter dem Titel »Recherchieren« erschienen, © UVK Verlagsgesellschaft) 1. Auflage 1983 2. Auflage 1987 3. Auflage 1989 4. Auflage 1991 5. Auflage 2000 6. Auflage 2004 7. Auflage 2008
© UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz und München 2017 Einbandgestaltung: Claudia Wild, Konstanz eBook-Produktion: Pustet, Regensburg
UVK Verlagsgesellschaft mbH Schützenstr. 24 · 78462 Konstanz Tel. 07531-9053-0 · Fax 07531-9053-98www.uvk.de
UTB-Band Nr. 4655ISBN 978-3-8252-4655-6 (Print)ISBN 978-3-8463-4655-6 (ePUB)
Vorwort
Wenn die Verhältnisse unübersichtlich werden, dann erklärt man dies in den Sozialwissenschaften bevorzugt mit Ausdifferenzierung. Man folgt der Denkweise der Biologen, nach dem Motto: vom Einzeller zum hochkomplexen Organismus. Dieser Weg scheint auch für Geisteswissenschaftler geläufig, zumal in der Regel viele kluge Menschen etwas beizutragen wissen, wenn jemand etwas gesagt hat, und weitere kluge Menschen das, was gesagt wurde, ihrerseits erweitern möchten.
So geschah es auch mit dem Thema »Recherchieren«. Seit der ersten Auflage dieses Handbuchs vor 33 Jahren hat sich viel getan: Neue Medien entstanden, Ausbildungswege wurden geschaffen, Redaktionen umstrukturiert und das Internet in den Alltag integriert. Viele neue Publikationen bieten dementsprechend ausdifferenzierte Hilfestellung an: Recherchieren für Einsteiger oder für Profis, für Storytelling, für Onliner, für Dokumentare, für Investigative, für Data-Spezialisten und so weiter.
Dieser Trend war für viele Spezialisten hilfreich. Er führte aber auch dazu, dass man mitunter den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. In Seminaren, Workshops und Arbeitsgruppen wurde ich häufiger mit der Frage konfrontiert, ob man im Web oder im Archiv oder mit Big-Data jeweils ganz unterschiedlich recherchieren müsse. Oder ob es generell richtige Verfahrensweisen gäbe.
Die gibt es natürlich. Und darum dient diese 8. Auflage vor allem dem Ziel, den Wald und nicht die einzelnen Bäume zu beschreiben: Was ist methodisches Recherchieren und wie wendet man es an? Sie ist keine Fortschreibung der bisherigen Auflagen, sondern eine komplette Neubearbeitung des Themas. Damit richtet sie sich nicht nur an Journalisten, sondern an alle, die den Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis des Recherchierens kennenlernen, verstehen und handhaben wollen.
Indem dieses Buch den Wald beschreibt und dabei das wuchernde Unterholz außer Betracht lässt, übergeht es kurzlebige Medientrends und vorübergehende Spezialisierungen. Tatsächlich soll es nicht weiter ausdifferenzieren, vielmehr rekonstruieren.
Sofern diese Neuauflage den damit intendierten Zweck, ein Grundlagenbuch zu sein, erfüllt, ist dies auch Sonja Rothländer, der Fachlektorin meines Verlags geschuldet. Sie kam mit dem Vorschlag, das journalistische Handbuch größeren Zielgruppen, insbesondere den Studierenden der Medienstudiengänge zugänglich zu machen und unterstützte das Projekt mit guten Vorschlägen und viel Geduld. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken.
Hamburg, im September 2016
Michael Haller
Einleitung
Abstrakt, kurz, bündig: Die Hauptmerkmale der Recherche in theoretischer Hinsicht
Allgemeine Definitionen
Der Begriff »Recherchieren« geht etymologisch auf das französische Wort chercher (=suchen, sich bemühen), dieses auf das spätlateinische circare (=umkreisen, durchstreifen) zurück. Gegen Ende des 17. Jh. wurde dieses Wort aus dem Französischen (re-chercher=aufsuchen; wiederfinden; zurückführen) in die gehobene deutsche Behördensprache übernommen.
Im Alltag bezeichnet man mit Recherche neu zu schöpfendes Wissen, das auf dem Wege des Ermittelns, Sammelns und Auswählens gefunden und erschlossen wurde (überwiegend aus Dokumenten, Datenbanken oder Befragungen). In der Fachwelt bezeichnet Recherchieren ein methodisches Verfahren, um Aussagen über äußere Vorgänge (=Informationen) systematisch zu beschaffen, zu prüfen und zu beurteilen. Abstrakt-allgemein definiert, bezeichnet Recherchieren ein Verfahren zur Rekonstruktion erfahrbarer, d. h. sinnlich wahrgenommener Wirklichkeit mit den Mitteln der Sprache. Auf die mit der Sprache verbundenen Implikationen komme ich zurück.
1. Wiederfinden: Systematisches Vorgehen
Das Ermitteln, Sammeln und Auswählen ist eine auf einen Gegenstand oder ein Sachgebiet gerichtete Arbeit. Sie dient der
Wissensmehrung
und kann sich auf ganz unterschiedliche Objekte (Personen, Handlungen, Dokumente) wie auch Ressourcen beziehen. Umgangssprachlich ist dann von Recherche die Rede, wenn Wissensbestände durch Nutzung mehrerer Quellen (meist sind es Informanten, Datenträger und -banken) erschlossen werden. Zum Beispiel die mehrstufige Suche oder Verifizierung einer Telefonnummer, das Auffinden eines Dokuments vermittels mehrerer Auskunftsstellen oder das Ermitteln und gezielte Befragen eines Sachverständigen.
Recherchieren ist ein
zielgerichtetes Vorgehen
, indem entweder ein gegebenes Wissensziel (die fehlende Information, das Dokument, die Expertenmeinung) erlangt oder eine Entsprechung gefunden werden soll (zum Namen die Telefonnummer, zum Ereignis das genaue Datum, zur Problemlage die Beurteilung des Experten). Oder, als Drittes, indem zu einem angenommenen Sachverhalt oder Vorgang – sei es als Behauptung, sei es in der Form einer Hypothese – die entsprechenden Informationen als Belege gesucht und ggf. beschafft werden.
Im Alltag wird der Weg zum Rechercheziel meist mit Hilfe
narrativer Verfahren
beschritten (Erfahrung, Versuch-Irrtum, Nachahmung, intuitives Handeln). Der Sucherfolg hängt demgemäß mitunter von Zufällen, aber auch vom Erfahrungswissen und von der Findigkeit des Suchenden ab. Dies trifft weithin für die Informationssuche im Internet zu.
Systematische Recherchen wurden für Datenbank-Nutzungen (physische und digitale Datenspeicher) entwickelt. Es handelt sich dabei um
Suche-Finde-Strategien
(
Document Retrieval
), die der Logik des fraglichen Archivsystems und der Indexierung seiner Dokumente angepasst sind. Vereinfacht gesagt: Über Suchwörter (Query) werden die Textwörter (Deskriptoren und Terms) in den Dateien gefunden und das gefundene Dokument erschlossen. Die ältesten, bekanntesten Retrieval-Ordnungen sind das Dezimalsystem (z. B. Textgliederungen) und das Alphabet (z. B. Telefonbuch), gefolgt von hierarchisch strukturierten Schlagwortsystemen. Seit dem Aufbau digitaler Datenarchive, weiter mit der Programmierung sogenannter Suchmaschinen (Robots) für das World Wide Web gibt es Retrievalsysteme für Volltext-Datenbanken mit standardisierten Leistungskriterien für das Indexieren (DIN 31623). Ihre für das Rechercheziel wichtigsten Gütekriterien betreffen
Recall
(Vollständigkeit) und
Precision
(Genauigkeit der gefundenen Dokumente). Die – in Bezug auf die Suchfrage – informatorische Nützlichkeit des gefundenen Dokuments wird
Relevanz
genannt. Die Analyse großer Datenmengen (»Big-Data«) verwendet demgegenüber statistische Verfahren, um Sachverhalte, Trends oder Zusammenhänge (Korrelationen) zu ermitteln.
Die systematische Informationssuche in der digitalen Welt ist darauf aus, möglichst alle für die Fragestellung relevanten Informationen bzw. Dokumente zu sammeln und nach dem Grad ihrer Relevanz zu ordnen bzw. zu hierarchisieren (z. B. die für das Ranking der Treffer maßgeblichen Kriterien zu definieren). Demnach ist der Rechercheertrag abhängig sowohl von der
Genauigkeit
der Suchwörter und Suchstrings (was genau suche ich mit welcher syntaktischen Struktur – und was schließe ich aus meiner Suche aus?) als auch von der Datenbank (wie: Indexierung, Stemming, Tolkenisierung) sowie die
Zuverlässigkeit
der Suchinstrumente, etwa: Nach welchen Relevanzkriterien listet die Suche-Finde-Software (Retrieval) ihre Treffer? Was findet sie – und was kann sie auf Grund ihres Algorithmus nicht finden?
2. Neues herausfinden: Methodisches Vorgehen
Im Unterschied zum oben beschriebenen Vorgehen zielt das methodische Recherchieren auf Aussagen, die ohne dieses Verfahren
inexistent, unbekannt oder im Verborgenen
blieben (geheim, vertraulich, verschwiegen usw.). Müssen hierzu Widerstände überwunden werden, spricht man im Journalismus ggf. von
investigativer Recherche
(entstammt dem Englischen: »Investigation« steht für Nachforschung, Untersuchung, Ermittlung). Meistens handelt es sich um Entscheidungen oder Vorgänge (Prozesse, Abläufe) oder auch um eine Situation oder Begebenheit, über die noch nichts oder fast nichts gewusst wird. Die Recherche zielt demgemäß auf die
(Re-)Konstruktion
des Geschehenen, im Weiteren auf die
Einordnung
(Sachzusammenhang) und gegebenenfalls
Interpretation
des Geschehenen (Sinnzusammenhang). Dabei sollte die Recherche keinem inhaltlich vorgegebenen Ziel folgen, sondern
ergebnisoffen
angelegt sein.
Ausgangspunkt des methodischen Recherchierens ist entweder eine
Annahme
(=Hypothese über einen tatsächlichen Handlungs- oder Wirkungszusammenhang) oder
Aussagen
über einen Vorgang oder einen Sachverhalt (=Informationen über stattgehabte Vorgänge), deren Status noch ungeklärt ist. Einen je spezifischen Status haben Behauptungen (=nicht belegte Aussagen über Sachverhalte), Kolportagen (=Aussagen über Dritte, die in bestimmter Weise gehandelt haben sollen) oder Beurteilungen (=in ein moralisches Bezugssystem eingebettete Sachaussagen).
Die journalistische Recherche folgt einem
mehrstufigen, folgerichtigen Verfahren
. Den Anfang macht die Überprüfung der Ausgangsinformation mit dem Ziel, zutreffende (wahre) Aussagen zu gewinnen. In einem zweiten Schritt werden diese Informationen erweitert (insbesondere Vor- und Hergangsgeschichte mit ihren Protagonisten, analoge Geschehnisse, Einflussfaktoren, statistische Daten). Mit dem dritten Schritt werden die gesicherten Sachaussagen in einen Zusammenhang gebracht (Sachzusammenhang, Chronologie, Strukturbeschreibung). Im vierten und letzten Schritt werden die Ergebnisse – je nach Zielrichtung – zur erklärenden Beschreibung des Geschehenen oder zur Verifizierung einer Ursachen- oder Wirkungshypothese ausgewertet und vertextet bzw. erzählt.
Für die Qualität jeder Recherche ist die korrekte Beurteilung des Status der Informationen entscheidend. Sie geht davon aus, dass allein
Aussagen über Sachverhalte verifizierbar
sind. Das Prüfverfahren zielt darauf ab, Differenzen zwischen Aussagen verschiedener Sprecher (=Quellen) zu ermitteln. Sie erreicht dies über den Abgleich verschiedener Sachaussagen (insb. Zeugen und Akteure). Wenn zwischen den Aussagen unterschiedlicher, voneinander unabhängiger Quellen Unstrittigkeit hergestellt ist, gilt die fragliche Aussage in Bezug auf ihren Aussagegegenstand als wahr (verfiziert).
Intersubjektive Verifikationen
sind an den Konsens gebunden, dass geeichte Messverfahren und Codes gelten sollen (wie: Zeitmessung, Orts- und Raumkoordinaten, Identitätsmerkmale von Subjekten und Handlungsorten). Muster einer komplett überprüfbaren Aussage: »Am Donnerstag, 17. Februar dieses Jahres betrat um 16.15 Uhr Ortszeit der 45-jährige Fritz-Jürgen Meier den Schalterraum der Sparkassen-Filiale Klosterstern in Hamburg.«
Von der intersubjektiven Überprüfung ausgeschlossen bleiben Aussagen über Motive (=Unterstellungen), über Wirkursachen (=Deutungen) und Werturteile (=Meinungen). Diese Aussagen haben den Status von Versionen, Erklärungen, Begründungen. (Nicht zu verwechseln mit Aussagen über Werturteile Dritter: Diese haben als Zitate wiederum Tatsachencharakter).
Im Unterschied zu dem im 1. Abschnitt definierten Typ schließt das methodische Recherchieren auch Feldarbeit ein.
Feldrecherchen
sind zur konkreten Beschreibung von Situationen, zur Prüfung von Behauptungen durch Augenschein sowie für Face-to-Face-Befragungen (Interviews) unerlässlich. Umstritten sind spezielle Verfahren der Feldrecherche (wie: Experimente, Verwendung einer falschen Identität, Täuschung oder Nötigung von Informanten). Zu den Methodenproblemen der Feldrecherche gehört die Frage der Gültigkeit singulärer Beobachtungen: Ist die ermittelte Situation einmalig, zufällig oder typisch (=pars pro toto)?
Die Feldrecherche kann zwar Fakten beibringen und verifizieren. Sie muss aber den
erklärenden Zusammenhang konstruieren
, denn die komplexe Wahrnehmung erlebter Wirklichkeit – und so auch deren Beschreibung – verbleibt im Subjektiven. Hier gelten als Qualitätsmerkmale: Berücksichtigung auch inhomogener Beschreibungen (=verschiedene Perspektiven und Positionen), Plausibilität des Sinnzusammenhangs, Einbezug der Beteiligten (Akteure und Betroffene).
Theoretisch formuliert, konstruiert das methodische Recherchieren einen Ereignis- und/oder Handlungszusammenhang, um einen bis dahin verborgenen oder unbekannten Ausschnitt gesellschaftlicher Realität darzustellen und zu plausibilisieren. Die in diesem Zusammenhang beschafften faktischen Aussagen müssen zutreffend (wahr) sein. Gelingt der Nachweis nicht, ist der Status der Aussagen (ihre Versionen) kenntlich zu machen.
3. Öffentlichkeit: Rechtfertigungsgründe (Legitimation)
Im medialen Kontext dient das Recherchieren der Veröffentlichung möglichst zutreffender Aussagen über Vorgänge von allgemeinem Interesse. Werden Informationen gegen Widerstände beschafft und veröffentlicht, so ist dies begründungsbedürftig. In den meisten Demokratien gibt es die (je Staat unterschiedlich weit gefasste) rechtliche Gewährleistung der Informationsfreiheit. Investigative Rechercheverfahren legitimieren sich darüber hinaus durch das normative Konzept der informationsoffenen, demokratisch verfassten Gesellschaft, die staatsunabhängig über das aktuelle Geschehen aufgeklärt sein will; diese informatorische Aufklärung gilt als Voraussetzung, um als Staatsbürger politisch handeln zu können (=Demokratiepostulat). Zuerst in England und den USA, im Fortgang des 20. Jh. auch auf dem europäischen Kontinent wurde den journalistischenMedien die entsprechende Funktion zugeschrieben, zusätzlich zur Berichterstattungsaufgabe auch verborgene Vorgänge und Ereignisse von allgemeiner Bedeutung ans Licht zu bringen. In den angloamerikanischen Staaten wird diese Rolle gemeinhin »Watchdog« genannt, in Deutschland spricht man von der »öffentlichen Aufgabe«, die der Recherchierjournalismus wahrnimmt (Näheres Seite 70).
Anwendungsbereiche
In modernen Gesellschaften findet die Recherche insbesondere Anwendung
im politischen System (Parlamentarische Dienste und staatliche Organe wie insbesondere Nachrichtendienste),
in der Kriminalistik,
in den Geisteswissenschaften,
in der gesellschaftswissenschaftlichen Forschung,
im Journalismus,
als Dienstleistung insbesondere für Finanz und Wirtschaft sowie Public Relations.
a) Geheim- und Nachrichtendienste: Sie sind die vermutlich ältesten Einrichtungen, die Recherche systematisch betreiben, um Informationen über mutmaßlich staatsgefährdende Vorgänge und Entscheidungen fremder Staaten zu erlangen. Vor allem in autoritären Staaten zählte und zählt auch die Personenüberwachung im eigenen Lande zum Aufgabenbereich solcher Dienste (wie: Ministerium für Staatssicherheit in Zeiten der DDR). Die Rechercheverfahren der Nachrichtendienste sind ein Mix aus den Typen a. (Archiv) und b. (Feldrecherche), wobei im digitalen Zeitalter ein großes Gewicht auf das Sammeln, Speichern und periodische Auswerten personenbezogener Datenbestände gelegt wird. Mitunter folgt die Informationsbeschaffung auch narrativen Mustern (wie: physische Beobachtung) und nutzt Techniken abseits der Legalität. Nicht zuletzt, weil Nachrichtendienste oftmals in einem (weitgehend) rechtsfreien Raum agieren (Geheimnisverrat, Bestechung, Eindringen in die Privatsphäre usw.), haftet ihnen der Ruch des Abenteurertums, gelegentlich auch des Kriminellen an – Merkmale, die für das Prinzip Recherche unspezifisch sind.
b) In der Welt der Kriminalistik folgt die Recherche notabene meist dem Typ Feldrecherche (wie: Spurensuche), wobei das besondere Gewicht auf Techniken der Spurenauswertung und Personenbefragung zum Zweck der rekonstruierenden Überprüfung und Sicherung von Sachaussagen liegt (wie: Fallanalyse, Hypothesenbildung, Klärung der Tatbestände, Einlösung der Hypothese durch Identifizierung der Täterschaft – vgl. Ackermann et al. 2011:149 ff.). Gegebenenfalls wird auch mit »verdeckter polizeilicher Informationserhebung« recherchiert (a. a. O. 581 ff.). Im Rechtsstaat sind (auch) Rechercheverfahren der Strafverfolger an formale Regelungen (wie: Persönlichkeitsrechte, Behördenrecht, Polizeigesetze und -verordnungen, Strafprozessordnung) gebunden.
c) Geisteswissenschaften: Insbesondere in den Geschichtswissenschaften sind narrative wie auch datenbankgestützte Recherchierweisen nach dem Typ »Wissen finden und qualifizieren« tradiert. Das Ziel der Recherche besteht im Auffinden, Identifizieren und Erschließen von sachlichen, schriftlichen und mündlichen Quellen (=Gegenstände, Texte, Zeugen, Wissensträger); die Methoden zielen auf die Bewertung der Quellen nach den Kriterien: Authentizität, Originalität und Ergiebigkeit (=Quellenwert).
In methodentheoretischer Hinsicht folgen hier die Geschichtswissenschaften einem Konzept, das analog zur Feldrecherche funktioniert: Aus den empirisch verifizierten Materialien werden Kontexte konstruiert und hermeneutisch (aus der Gegenwartsperspektive) sinnstiftend interpretiert (wie: Periodizierung in Epochen, Genese, Bestimmung von Wirkgrößen, Interdependenz der Wirkgrößen, Folgenhaftigkeit).
d) Gesellschaftswissenschaften: In der Ethnologie und den empirischen Sozialwissenschaften werden seit dem 19. Jh. Rechercheverfahren des beschriebenen Typs meist im Rahmen qualitativer Untersuchungen angewandt. Die am häufigsten gebrauchten Instrumente sind das Interview bzw. die Befragung und die Beobachtung (Schell et al. 2011:381 ff.).
Das Interview wird definiert als »planmäßiges Vorgehen mit wissenschaftlicher Zielsetzung, bei dem die Versuchsperson durch eine Reihe gezielter Fragen oder mitgeteilter Stimuli zu verbalen Informationen veranlasst werden soll« (Scheuch 1973). Im Unterschied zur Fragebogenerhebung, die auf aggregierte Daten (=Strukturaussagen) zielt, dient das persönliche Interview explorativen Zwecken, etwa, um im Rahmen von Fallstudien Ereignisse und Aktivitäten der Befragten zu ermitteln (narrative, fokussierte oder problemzentrierte Interviews). Methodentheoretisch haften dem Interview Fehlerquellen an, wie: soziale Erwünschtheit der Antwort, Konfluenz mit dem Frager, Störungen durch die Interviewsituation (Scholl 2014:209 ff.). Es wird bevorzugt für die Entwicklung von Typologien und Forschungshypothesen verwendet (Diekmann 2011:443).
Die Beobachtung erfolgt meist aus der subjektiven Perspektive des Betrachters und ist darin der journalistischen Reportagetechnik verwandt. Man unterscheidet zwischen der unbeteiligten Beobachtung (meist Test, Labor) und der teilnehmenden Beobachtung, bei der sich der Rechercheur auf den Handlungszusammenhang seines Beobachtungsobjekts einlässt (wie: Familie, Arbeitsplatz, Milieu). Diese Methode besitzt eine reiche, auf das 19. Jahrhundert zurückgehende Forschungstradition und dient im Zusammenspiel mit weiteren Instrumenten (wie: Interview) der Beschreibung komplexer Realitätsausschnitte (Näheres hierzu im 1. Buchteil).
e) Journalismus: Hier dient die Recherche in erster Linie dem Zweck, Informationen von allgemeinem Interesse zu beschaffen und zu beurteilen, die ohne diese Verfahren nicht preisgegeben, mithin nicht bekannt würden. Die journalistische Recherche muss darum oftmals Weigerungen oder gar Widerstände auf Seiten der Quellen und Urheber überwinden.
Ihre Verfahren folgen dem Öffentlichkeitsprinzip (Journalisten stehen Zeugnisverweigerungsrecht sowie weitreichende Informationsrechte gegenüber Behörden zu). Sie finden ihre Grenzen vor allem im Schutzanspruch privater Personen (insbesondere Privatsphäre) und den übergeordneten Interessen öffentlicher Institutionen (wie: Geheimhaltung zum Schutz Dritter, Prozessrecht zur Verfahrenssicherung, Staatsschutz).
Ihre auf Offenlegung gerichtete, offensive Vorgehensweise ist durch die Landespresse- und Landesmediengesetze legitimiert (insbesondere durch die dort genannten Informationsrechte und die Funktionszuweisung, Kritik und Kontrolle zu üben) sowie durch einschlägige Urteile des BVerfG über die »öffentliche Aufgabe« der Presse (sinngemäß in den Staatsverträgen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks).
In methodischer Hinsicht beginnt ein journalistisches Rechercheverfahren mit der Vorrecherche (=Einschätzung und Prüfung der Ausgangsinformation oder Ausgangshypothese, Auswertung des Archivs nach Maßgabe des aktuellen Themenaspekts). Die Hauptrecherche baut auf den Befunden der Vorrecherche auf: sie rekonstruiert den Hergang und zeigt den Wirkungszusammenhang auf, anschließend beschreibt und qualifiziert sie auf der Deutungsebene die Rolle der Akteure (=zweistufiges Verfahren).
Bei der Recherche komplexer Themen (Beispiele: Wie wirkt sich die Rentenreform aus?, Bildungsnotstand: Sind die Schulen schuld?, Wem hilft die Psychotherapie?) wird mit einem Methodenmix nach Art der sozialwissenschaftlichen Enquête verfahren. Manch umfangreicher Report (zum Beispiel eine Titelgeschichte des Spiegel, Seite 3 der Süddeutschen Zeitung, Dossier der Zeit oder Reports in den Wirtschaftsmagazinen) stützt sich auf methodenkomplex organisierte Ermittlungen.
Wenn solche Ermittlungen zudem enthüllenden Charakter haben (indem sie von Akteuren geheimgehaltene Informationen über Normenverstöße publik machen), spricht man von investigativer Recherche in Anlehnung an das investigative reporting im US-Journalismus.
Im journalistischen Handwerk unterscheiden wir drei Haupttypen der Recherche:
Die Ereignisrecherche (Aufklärung eines Ereignisses oder Ereignisablaufs durch Faktenüberprüfung unter Einbezug der Beteiligten),
Die Themenrecherche (oft als
Thesenrecherche
oder
Trendrecherche
mit dem Ziel, Geschehnisse oder Entwicklungen im Zusammenhang erklären und begründen zu können),
Die Inside-Enthüllung: Ein Informant (im Englischen:
Whistleblower
) liefert interne Informationen, die vom Rechercheur nachkonstruiert werden müssen, um ihren Wahrheitsgehalt sicherzustellen.
Zu den mehr oder weniger umstrittenen Vorgehensweisen gehören: die verdeckte Recherche (=seine Identität nicht zu erkennen geben), das Rollenspiel (=eine andere Identität vortäuschen, bekannt als sogenannte Wallraff-Methode), der Kauf von Dokumenten oder exklusiven Informationen (sogenannter Scheckbuch-Journalismus).
f.) Recherche-Dienstleistungen: In den informationsoffenen, nachmodernen Gesellschaften hat sich das Recherchieren auch als Profession etabliert. Berufsrechercheure (Researcher) führen im Auftrag und auf Rechnung ihrer Kunden Abklärungen durch. Vor allem in Finanz und Wirtschaft sind kommerzielle Researcher tätig, die über Internet und in Datenbanken den Geschäftsgang von Unternehmen oder die Solvenz von Privatpersonen abklären. Eine besondere Form der Auftragsrecherche ist die Thesendokumentation (=Beibringen von Belegen und Fallbeispielen, um eine vorgegebene Hypothese untermauern zu können).
Diese Verfahren finden sich in der Wirtschaft, insbesondere im Auftragsfeld der Public Relations, nach den Mustern: Der Aufsichtsratsvorsitzende verlangt Beispiele für die Innovationskraft des Unternehmens, die Geschäftsführung eines Dienstleisters möchte mit Hilfe von Konkurrenz- und Marktanalysen ihr Markenprofil verwerten, der Projektleiter möchte die Forschungsergebnisse in einen nutzwertigen Zusammenhang gestellt sehen, usw.
Die Auftragsrecherche folgt der vorgegebenen Zielsetzung und versucht, möglichst überzeugende Aussagen und Daten beizubringen, um die vorgegebene These zu stützen. Methodenkritisch gesehen sind solche Verfahren auf die Durchsetzung einer partikularen Sichtweise angelegt: Aussagen, die der These zuwiderlaufen, werden ausgeblendet, Informationen, die das angestrebte Ziel in Frage stellen, gelten als weniger relevant. Kritiker dieser – gelegentlich auch im Journalismus anzutreffenden – Verfahren sprechen von der Vorgaben-, mitunter auch Vorurteilsbestätigungsrecherche.
Zur Theorie der Recherche
Unsere oben genannte Definition lautete:
Recherchieren ist ein Verfahren zur Rekonstruktion erfahrbarer, d. h. sinnlich wahrgenommener Wirklichkeit mit den Mitteln der Sprache.
In diesem Satz stecken mehrere theorieträchtige Annahmen. Diese möchte ich mit wenigen Stichworten erläutern.
Zunächst zum Wirklichkeitsbegriff: Im Zusammenhang mit Recherche sprechen wir von der realen Wirklichkeit. Als real werden solche Entitäten bezeichnet, die von verschiedenen Menschen unabhängig voneinander als tatsächlich vorhanden wahrgenommen werden, die demzufolge keine Illusionen und keine Fiktionen sind.
Zur Sinnlichkeit: Indem die reale Wirklichkeit sinnlich wahrgenommen wird, handelt es sich um eine – in Bezug auf den Betrachter – äußere Realität (»externer Realismus« nach Searle 2004:39 ff.). Selbstbezügliche Reflektionen, sei es Denken über das Denken (Welt der formalen Logiken, Erkenntnistheorien) oder Denken über die eigenen Empfindungen (Welt der Persönlichkeitspsychologie) sind nicht Themen der Recherche. Deren Gegenstände und Verfahren gehören zur Welt der Empirie.
Die Sprache: Die Rechercheergebnisse beschreiben den untersuchten Realitätsausschnitt nicht mit musischen oder bildlichen Mitteln. Selbst Fotografien liefern keine adäquate und hinreichend eindeutige Beschreibung (Orts- oder Zeitangaben und die Identität der abgebildeten Personen leistet oftmals nur der Bildtext). Der Bildausschnitt zeigt eine kontextlose Situation. Allein die Sprache mir ihrer Begrifflichkeit und syntaktischen Logik liefert eine intersubjektiv nachvollziehbare und insofern überprüfbare Beschreibung realer Wirklichkeit nach Maßgabe definierter Referenzen (Searle 1983:34 ff.; Davidson 1993: 40 ff.). Unter sprachtheoretischem Blick leisten dies solche propositionalen Aussagen in dreierlei Hinsicht:
Die semantische Dimension
gibt Aufschluss über die logische Beziehung der Aussage zum Gegenstand (dass eine eindeutige Beziehung besteht, steht nicht in Frage). Qualitätskriterien der Recherche betreffen diesen logischen Zusammenhang, insbesondere: Wahrheit, Vollständigkeit, Quellentransparenz. Zur Semantik ist auch die Verwendung des Materials (inkl. Fotos und Video) zu zählen, etwa als Belege, Beweise, Exempel, als Episode oder Erlebnis (=Erzählung). Das maßgebende Qualitätskriterium ist hier die
Glaubwürdigkeit
.
Die pragmatische Dimension
soll den Zusammenhang herstellen zwischen Aussageinhalten und Adressaten: Der Rechercheur beschafft, prüft und selektiert Aussagen auch entsprechend seiner Kenntnis des Publikums (wie: Soziodemografie, formale Bildung). Indem er dies tut, wählt und bestimmt er den informatorischen Status der recherchierten Aussagen: Sachverhalt, Behauptung (These), Redewiedergabe (Zitate) sowie Interpretation bzw. Deutung. Als Qualitätskriterien der Recherche gelten hier
Richtigkeit (Logik)
und
Plausibilität (Evidenz)
.
Die syntaktische Dimension
ist intentional auf Wirkung gerichtet. Der Rechercheur gewichtet und strukturiert die recherchierten Aussagen nach Maßgabe größtmöglicher Verständlichkeit (Modalitäts-Modus »Sei klar!« nach Griece 1979:51). Dabei berücksichtigt er den für sein Auditorium verbindlichen Kommunikationskontext (wie: der Wissens- oder Forschungsstand, weithin existierende Vorstellungen über Vorgänge, kulturelle Normen und Werte, Zeitgeschichte als gemeinsamer Erfahrungsgrund). Die recherchebezogenen Qualitätskriterien sind hier im wissenschaftlichen Diskurs die Anschlussfähigkeit, im publizistischen Feld sind sie eher strittig (Beispiele: Wahrung der Persönlichkeitsrechte, Moralität in der Werbung, persuasive Strategien).
Die Medienwissenschaften und das Thema Recherche
Die von den Medienwissenschaften in den vergangenen Jahrzehnten vorgetragenen Erwägungen zu einer Theorie der Recherche sind karg (vgl. Welker 2012:266 f.). Der Grund ist darin zu sehen, dass sich das Theorieinteresse auf den sozialen Kontext der Medienaussagen richtete, während die Einflussgrößen der redaktionellen Aussagenproduktion meist mediensystemisch, medienökonomisch oder als Managementthema betrachtet wurden (vgl. »Synopse von Journalismuskonzepten« in: Löffelholz 2016:52 f.).
Die wenigen, für die journalistische Recherche fruchtbaren Theorieansätze zielen in zwei Richtungen. Die eine hat die Funktion derMedien im Allgemeinen und die Rolle des Journalismus im Besonderen zum Gegenstand (für den Bereich Politik vgl. Jarren/Donges 2011:79 ff.). Die andere interessiert sich für den schon erwähnten Zusammenhang zwischen unseren Wirklichkeitsbildern und der medialen Aussagenproduktion; sie thematisiert demnach Fragen der Wahrnehmung.
Mit dem Komplex »Medienfunktion« hat sich die Journalistik im Gefolge der Sozialwissenschaften befasst. Unter der in den 1990er-Jahren verbreiteten systemtheoretischen Perspektive (Journalismus als »soziales System«) besitzt die journalistische Recherche indessen keine Bedeutung, sondern gehört zum Arsenal journalistischer »Berichterstattungsmuster«, mit denen Themen aus der Umwelt aufgegriffen (selektiert), bearbeitet und der Umwelt wieder dargeboten werden (Rühl 1980 und 2011; Weischenberg 1995: 111 ff.): Journalismus unter Einschluss der Recherche wird hier als eine Art (Wieder-)Aufbereitungsanlage (miss)verstanden.
Für uns ergiebiger sind die in den 1960er-Jahren von den Politikwissenschaften angestellten demokratietheoretischen Erwägungen; sie folgten dem oben beschriebenen normativen Sinn des öffentlichen Interesses (unter der Bedingung der Medienfreiheit) und führten zum Konzept der »deliberativen Öffentlichkeit« (Bessette 1980 und 1994; Habermas 1994:18 ff. und 1996; Bohman 1998). Diesem Konzept zufolge ist der öffentliche Diskurs der Raum, in welchem der politische Informations- und Meinungsaustausch stattfindet und sich vernünftige Argumente durchsetzen (mögen). Die am Diskurs beteiligten Bürger sollen sich an wohlbegründeten Argumenten orientieren und so zu politischer Handlungsfähigkeit finden. Auf diesem öffentlichen Forum funktioniert der Qualitätsjournalismus pointiert gesagt als Inkubator, indem er Fakten beschafft, Meinungen prüft, bündelt und gewichtet. Auch wenn die Theoretiker die informatorische Eigenleistung des Journalismus übersehen und vom zugelieferten »Rohstoff« sprechen (Habermas 2008:175), so gehört die Recherche doch zum Instrumentarium des kritischen Journalismus, der die Argumente der Machtträger prüfen, faktengestützte Einwände erarbeiten und in den Diskurs beibringen soll.
In wahrnehmungstheoretischer Hinsicht geht die Kommunikationswissenschaft der Frage nach, unter welchen Prämissen und Gegebenheiten die Medien Wirklichkeit konstruieren – und ob deren Konstruktionen andere Wirklichkeitsbilder erzeugen, als man sie aus dem Alltagsleben kennt. Die Antwort ist seit Walter Lippmann (»Public Opinion« 1922) einfach: Selbstverständlich erzeugen die Medien ein anderes, nämlich medienspezifisch vermitteltes Bild realer Wirklichkeit als etwa die dem Kausalitätsdenken verpflichteten Naturwissenschaften, als das Rechtssystem oder die Religionen – und deutlich anders als die individuelle Wahrnehmung der Lebenswelt.
Die journalistischen Medien konstruieren reale Wirklichkeitsausschnitte nach Verfahren und Regeln, die nichts mit Fiktion, Lüge und Irreführung, sondern mit funktionsdefinierten Nutzungszwecken im Prozess öffentlicher Kommunikation zu tun haben. Sie tun dies vor allem um
komplizierte, undurchschaute Vorgänge klar und durchschaubar zu machen, um sie zu verstehen (=Reduktion von Komplexität);
das Folgenhafte vom Belanglosen zu trennen und nachvollziehbar zu machen (= Selektionsleistung);
auf Missstände, Gefahren und Risiken im Zusammenleben der Menschen hinzuweisen, also Normabweichungen besonders herauszustellen (= Signal-/Alarmfunktion);
die in der Gesellschaft wirksamen Leitbilder und Denkweisen bei Normenkonflikten öffentlich zur Diskussion zu stellen (= Diskursfunktion).
Dies sind normativ zu verstehende Medienfunktionen, die direkt oder indirekt nur durch Recherchierarbeit zu erfüllen sind. Ich komme im letzten Abschnitt des folgenden Buchteils auf sie zurück.
Erster Teil: Die Geschichte des Recherchierens
Übersicht
Seit dem 19. Jahrhundert fasst man Verfahren, um den Dingen auf den Grund zu gehen, mit dem Wort »Recherchieren« zusammen. Ihre Entstehung reicht weit zurück bis ins hohe Mittelalter. Sie ist eng verbunden mit der Entwicklung der empirischen Sozialforschung. Deren Methoden dienten zu verschiedenen Zeiten verschiedenen Zwecken: Nicht immer ging es um Wissenserwerb und Aufklärung. Es gab auch Phasen, da prägten politische Ziele und normativ begründete Zwecke die Vorgehensweisen.
Empirische Sozialforschung ist die Klammer, die die Welt der Wissenschaft mit der des Journalismus’ verbindet. Im Schnelldurchgang erzählt dieser einführende Teil des Buchs von den vielen hierbei unternommenen Versuchen der Sozialforschung, den Experimenten und den zahllosen Kontroversen. Sie führten im Laufe von vielen Jahrhunderten dazu, dass wir heute wichtige Merkmale der sozialen Wirklichkeit wissenschaftlich beschreiben und verstehen können.
Die wissenschaftliche Recherche: Es begann mit Big-Data
Was ist (systematisch gedacht) der Ausgangspunkt einer Recherche: die gezielte Nachfrage oder eine neue Information über Vorgänge oder einen Sachverhalt? Wohl eine rein rhetorische Frage, denn das eine ist vom andern nicht trennbar. Und ein Drittes gehört auch noch dazu: das Verwertungsinteresse des neugierig Fragenden – sei es, um einen Zusammenhang zu erkennen, sei es, um sich einen Wissensvorsprung zu sichern oder um Nutzwerte zu gewinnen.
Unter historischem Blickwinkel begann das systematische Recherchieren mit dem gezielten Sammeln von Informationen; dabei war neben Neugier zumeist die Verwertungsabsicht ausschlaggebend. Wie viele Menschen z.B. zum Herrschaftsgebiet gehören, wie groß die Lehensflächen sind, wie viele Fuhrwerke durchs Stadttor fahren: An solchen Datenerhebungen hatten die Machthabenden ein Interesse, sei es, um Steuern einzutreiben, Soldaten zu rekrutieren oder Gebiete zu annektieren und zu sichern. Oder um Trends zu erfassen. Im späten Mittelalter wurden in England Statistiken über Pesttote angelegt, um zu erkennen, ob eine neue Epidemie bevorstand und sich der König rechtzeitig in Sicherheit bringen könnte. Für den Kriegsminister in Frankreich war es bedeutsam, ob die Eheschließungen und so auch Geburten im Lande hinreichend zunahmen. Und in vielen Hansestädten dienten die Reiseberichte der Kaufleute zusammen mit der Buchführung dem Zweck, den künftigen Absatz ihrer Handelswaren prognostizieren zu können. Solches Wissen war nur über gezielte Informationsbeschaffung und -auswertung zu gewinnen: durch zweckdefiniertes Recherchieren.
Die »Domesday Books«
In der empirischen Sozialforschung gilt das Jahr 1085 als Beginn der recherchierten Statistik (vgl. Schnell et al., 2011:14): Knapp zwei Jahrzehnte nach seinem Sieg über die Angelsachsen wollte Wilhelm der Eroberer sein Land einschließlich Menschen und Tieren rein quantitativ erfassen. Seine »Kommissare« nahmen in den Verwaltungsgebieten (»shires«) die dortigen Regierungschefs (»shire reeves«) zur Seite und innerhalb von zwei Jahren wurden Dörfer und Städte (insgesamt mehr als 13.000), Burgen und Landsitze, Kirchen und Klöster aufgesucht. Sie befragten die Lehensnehmer nach Größe und Wert ihres Besitzes, nach ihren Mitbewohnern inklusive Dienern und Leibeigenen, nach ihren Anteilen am Wald, an Fischteichen und Getreidemühlen.
Sämtliche Informationen wurden zusammengetragen, die Besitzansprüche in Gerichtssitzungen ausgehandelt und in lateinischer Sprache in Folianten – den später sogenannten »Domesday Books« (Bücher von ewiger Gültigkeit) festgehalten. Es war eine systematische Registrierung der königlichen Hoheits- und Lehensgebiete (Staatsgrundbuch) mit allen für die Kriegs- und Steuerabgaben relevanten Wirtschaftsinformationen (Fleming 1998:11ff.).
Den Protokollen und Berichten zufolge wurden verschiedene Rechercheverfahren eingesetzt. In heutiger Terminologie ausgedrückt, waren es leitfadengestützte Interviews und halbstandardisierte Fragebögen. Zudem erfolgten Datenauswertungen (archivierte Aufzeichnungen etwa in den Kirchen), Quellen- und Registeranalysen sowie investigative Befragungen, deren Informationsziel dank der brutal in Szene gesetzten royalen Autorität zügig erfüllt wurden: Die Befragten wurden stets unter Eid gesetzt und im Falle von Falschaussagen hart bestraft (vgl. Berner 1983; Fuchs 1987; Holt 1993).
Die Geburtsstunden der Empirie
Es ist kein Zufall, dass in den folgenden Jahrhunderten vor allem in England sich das Interesse an empirischer Datenerhebung, man könnte sagen: an »Big-Data« entfaltete. Es fügte sich in die philosophische Tradition der Empiristen mit ihrem Vordenker Francis Bacon (1551–1626), dessen Kritik am »scholastischen Denken« mit seiner realitätsfremden Ideenwelt sehr einflussreich war. Bacon wollte demgegenüber jede Erkenntnis als Abbild der Natur und jede Wissenschaft auf dem Boden der Empirie abgestützt und durch ihre Nützlichkeit gerechtfertigt sehen (»Novum organum scientiarum« 1620). Mit dieser Sicht verband sich die Überzeugung, dass die Forscher das politische und soziale Leben im Lande quasi naturwissenschaftlich durchleuchten sollten. Ihr Ziel war es, mit Hilfe statistischer Befunde (in der damaligen Sprache: »politische Arithmetik«) die innewohnenden Gesetzmäßigkeiten abzubilden. Dabei sollte Forschung nicht als Selbstzweck betrieben werden, sondern als wissensreiche Dienstleistung für die öffentliche Verwaltung und für die staatliche Macht, die gesichert und ausgedehnt werden sollte auch über fremde Länder und Völker (Klein 1984).
Für die forscherische Herangehensweise an die Phänomene – und damit auch für die Rechercheverfahren – bedeutete Bacons Ansatz so etwas wie eine kopernikanische Wende: Man solle nicht von Überzeugungen, Ideologien und Theorien ausgehen und deren Wahrheit deduktiv anhand aufgesammelter Beispiele und Fälle belegen. Dies sei Scholastik und führe in die Irre. Man müsse vielmehr die Natur durchschauen, denn auch die Menschen, und damit auch die von ihnen konstruierten sozialen Gebilde, seien Teil der Natur. Deshalb solle man die Phänomene quantitativ untersuchen, ordnen und vermessen, um die ihnen innewohnenden Regelmäßigkeiten auf induktivem Wege zu erschließen. Bacon erkannte allerdings auch, dass induktiv gefundene Gesetzmäßigkeiten ihrerseits hypothetischer Art sind. Denn eine erkannte Gesetzmäßigkeit ist bereits hinfällig, wenn ein Gegenbeispiel gefunden oder über ein Experiment erzeugt wird – eine Überlegung, die im 20. Jahrhundert in der wissenschaftstheoretischen Diskussion (Geltung bzw. Falsifikation von Theorien) von Karl Popper und dem sog. kritischen Rationalismus neu durchdacht wurde.
Beide Stoßrichtungen (Ermittlung des Durchgängigen und des hierzu Anderen, Befremdlichen) prägen seither die Strategie der Rechercheverfahren.
Die Zukunft planbar machen: Statistik-Recherche
Die Geschichte der empirischen Sozialforschung nennt die Statistiker John Graunt (1620–1674) und dessen Freund Sir William Petty (1623–1687) sowie Edmond Halley (1656–1742) als die großen Entdecker der quantitativen Recherche (vgl. Kern 1982:28ff.). Anhand von Geburts- und Sterbelisten, untergliedert nach Altersgruppen, Geschlecht und Wohnadressen, wurden Regelhaftigkeiten ermittelt und Trendanalysen versucht, mit dem Ziel, allgemeingültige Aussagen über Lebenserwartungen, Heiratsalter, Suizidraten, Verläufe von Epidemien usw. zu machen. Damit waren durchaus handfeste Interessen verbunden: Informationen über Risiken (insbesondere in Bezug auf Seuchen) oder über potenzielle Absatzmärkte für den Warenhandel herauszufiltern. Als erste soziographische Studie gilt die von Petty 1672 publizierte Abhandlung »Political Anatomy of Ireland«, die anhand von Beobachtungen, Fallstudien und Datenanalysen – also induktiven Verfahren – zu generellen Aussagen gelangte (Zeisel 1975:113f.; Berner 1983:90f.). Über seine um Objektivität bemühte Recherchiermethode schrieb Petty u.a.:
»Anstatt nur vergleichende und überschwängliche Worte und Argumente des eigenen Geistes zu gebrauchen, wähle ich als einen Versuch der politischen Arithmetik [...] den Weg, mich in Zahl-, Gewichts- oder Maßbezeichnungen auszudrücken; mich nur sinnfälliger Beweise zu bedienen; nur solche Ursachen in Betracht zu ziehen, welche ersichtlich in der Natur der Dinge selbst ruhen; jene Ursachen dagegen, welche von den wechselnden Meinungen, Neigungen, Leidenschaften einzelner Menschen abhängen, andern zu überlassen.« (Übers. John 1884:185, zit. nach Kern 1982:29).
Zwei mit diesem Verfahren verbundene Probleme waren den »Arithmetikern« (noch) nicht bewusst: erstens die infrage stehende Validität der Datenbasen (beispielsweise bei den Sterberegistern die Tabuisierung mancher Todesursachen) und zweitens der Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität: Statistisch hergestellte Zusammenhänge wurden gerne ursächlich erklärt und ausgedeutet – ein Problem, das man heute bei so mancher datenjournalistischen Recherche wiederfindet.
»Observations«: Die Faszination der großen Zahl
Als Meilenstein der sozialempirischen Recherche gilt unter Sozialwissenschaftlern die von Petty und Graunt erarbeitete empirische Studie »Observations« (von Graunt 1662 unter folgendem Titel publiziert: »Natural and Political Observations upon the Bills of Mortality, chiefly with Reference on the Government, Religion, Trade, Growth, Air, Disease etc. of the City of London«). Mit ihr sollte nach Maßgabe der Bacon‘schen Experimentalwissenschaft die Regelhaftigkeit sozialer Lebensverhältnisse recherchiert werden (vgl. Kern 1982:29ff.). Wichtigstes Material waren die in den Londoner Kirchenbüchern seit 1603 wöchentlich registrierten Geburts- und Todesfälle. Die sublokal nach Kirchgemeinden gegliederten Totenlisten wurden auch zur Ermittlung von Pestepidemien genutzt. Doch die beiden Statistiker wollten mehr: Mit Hilfe vergleichender Datenanalysen fanden sie heraus, dass die Sterberaten entgegen gängiger Ansicht keineswegs von der Gottgläubigkeit der Menschen, sondern von äußeren lokalen Gegebenheiten und den dort herrschenden Lebensverhältnissen (u. a. Hygiene) beeinflusst wurden. Sie erkannten auch, dass bei den Neugeborenen mehr als die Hälfte männlichen Geschlechts waren, dass sich aber (in friedlichen Zeiten) bis zum Erwachsenenalter das Verhältnis ausgeglichen habe und beiden Geschlechtern dieselben Heiratschancen offen stünden. Übrigens folgerten die Verfasser daraus in der Art einer Beweisführung, dass die Monogamie die einzig richtige und so auch die natürliche und gottgewollte Lebensform sei (vgl. Hull 1899).
Diese Deutung ist insofern aufschlussreich, als man daran die unzureichende Methode des induktiven Verallgemeinerns nachvollziehen kann, eine riskante Denkweise, der man auch im Journalismus begegnet. Zur Begründung der von Petty und Graunt entdeckten Verschiebungen ließen sich ja verschiedene Thesen aufstellen, z.B. die hohe Wochenbettsterblichkeit, die mit Hilfe anderer Statistiken über Todesfälle (Häufigkeiten) von Frauen und Männern zwischen 15 und 30 Jahren quasi im Gegenzug hätte überprüft werden können.
Datenrecherche für den Absatzmarkt
Im Unterschied zum deutschsprachigen Raum entfaltete sich in England bereits im Laufe des 17. Jahrhunderts eine marktförmige Wirtschaft, in der die Agrargüter nicht primär an Lehensherren geliefert, sondern über die Märkte abgesetzt wurden; in der die Produkte der Manufakturen im Wettbewerb standen und in der der Warenhandel internationalisiert und über Banken zwischenfinanziert war: der große Trend zur Subsistenz, für dessen Steuerung strukturierende Daten (nach Hegel »Realabstraktionen) benötigt wurden. Demgegenüber funktionierte die damalige Ökonomie in den deutschen Ländern noch ohne Marktregulation, weil die feudalen Herrschaften ihre Gebiete als Selbstversorgungseinheiten bewirtschafteten und mit anderen Feudalen Tauschbeziehungen meist auf Naturalienebene unterhielten. An der Erzeugung strukturierender Daten bestand kaum Interesse. Es fehlten demnach in den deutschsprachigen Regionen die gesellschaftlichen wie auch ökonomischen Voraussetzungen für datenbasierte Recherchen. Erst im 19. Jahrhundert (im Fortgang der Industrialisierung, der rasanten Verstädterung, der aufbrechenden sozialen Konflikte und dem Ausbau staatlicher Verwaltungsbürokratien) wurden die Grundlagen für statistische Datenrecherchen geschaffen.
Statistikrecherchen im Frühkapitalismus
In England, wo dieser Prozess deutlich früher im Gange war, wurden bereits im 18. Jahrhundert Untersuchungen über die Lage der Bauern und die der britischen Landarbeiter angefertigt. Sie entsprachen dem, was mit der Etikette »soziale Wissenschaften« gemeint war. In der Folge entstand an den Universitäten wie auch in Bürgervereinen eine sich rasch verbreitende statistische Bewegung, die mit ihren Datenrecherchen die im Fortgang der Industrialisierung unübersichtlich gewordenen sozialen Verhältnisse erfassen und aufklären wollte. Aus Sicht der Wissenschaftshistoriker haben sie die moderne empirische Sozialforschung begründet (vgl. Cullen 1975).
Die Initiative ging von politisch liberalen, dem Unternehmertum zugewandten Bürgergruppen aus (»statistical societies«), die Studien zur Erforschung der Alltagswelt von Industriearbeitern auf den Weg brachten. Sie wollten die zerstörerischen Effekte des Manchesterkapitalismus erfassen und durch geeignete Maßnahmen, vor allem durch Sozialgesetze abbremsen. Mit erstaunlich methodenkomplex angelegten Recherchen (»cross-examination«) – etwa Beobachtungsbögen, standardisierte Item-Listen, Leitfäden für die Befragung der Betroffenen – wurde die Welt der Arbeiter durchleuchtet. Die abgefragten Themen reichten vom Lesestoff über den religiösen Glauben, die Ausstattung der Küche, Art und Umfang der sanitären Einrichtung bis zur Anzahl der Personen pro Bett (»overcrowing«) (Marsh 1982:14f.). Kennzeichnend für die bürgerliche Perspektive dieser »social surveys« war jedoch, dass »das Thema Arbeitslöhne weitgehend ausgeklammert wurde. Als Grund für die pathologischen Zustände wurde entsprechend die Verstädterung, nicht aber das Fabriksystem verantwortlich gemacht« (Schnell et al. 2011:18).
Die Faszination der Datenrecherche erfasste auch Privatgelehrte, Volkskundler und Historiker, im Bestreben, ihre Befunde mit Hilfe statistischer Verfahren zu objektivieren. In den 1830er-Jahren blühten in verschiedenen Städten Englands Geschichtsvereine und Historikerkommissionen auf, die Informationen über Herkunft, Arbeitsformen und Lebensweisen der Menschen ihrer Region beschafften. Hinzu kam die Feldforschung von (oft selbsternannten) Sprachkundlern und Archäologen, die mit Spaten und Strichlisten die Überbleibsel vergangener Kulturen sortierten; von Historikern, die nach kulturprägenden Konstanten fahndeten, um den Nationenbegriff mit Inhalt zu füllen, und von Volkskundlern, die darauf aus waren, massenhafte Verhaltensmuster fremder Ethnien als deren rassische Eigenheiten auszuweisen.
Die »Manchester Statistical Society«
Unter all diesen Aktivitäten gilt die Gründung der Manchester Statistical Society