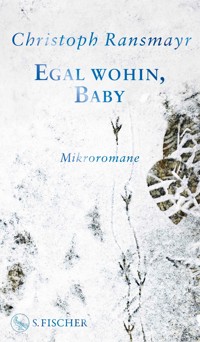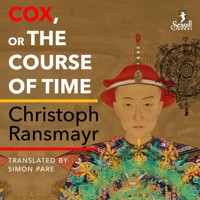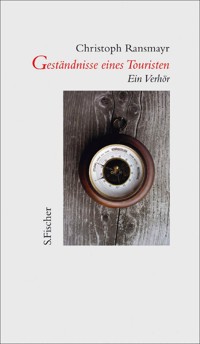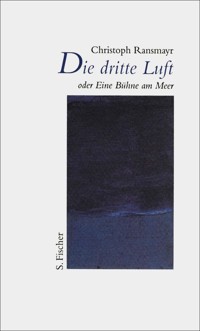9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Christoph Ransmayrs gewaltiger Roman über die Zeit nach dem großen Krieg und die allmähliche Verfinsterung des Blicks. Moor, ein verwüstetes Kaff im Schatten des Hochgebirges. Zwischen Ruinen, Geröll und Eis begegnen sich drei Menschen: Bering, der »Schreier von Moor«, Ambras, der »Hundekönig« und Lily, die »Brasilianerin« – drei in ihrer Zeit Gefangene, die versuchen, aus dem Labyrinth einer mörderischen Nachkriegswelt zu fliehen. »Der Friede von Oranienburg« ist der Name für die Jahre und Jahrzehnte nach einem großen Krieg. Aber dieser Name bezeichnet keine Epoche des Wiederaufbaus, sondern eine der Sühne, der Vergeltung und Rache. Nach dem Willen der Sieger sollen die geschlagenen Feinde aus den Ruinen ihrer Städte und Industrien zurückkehren auf die Rübenfelder und Schafweiden eines vergangenen Jahrhunderts. Drei Menschen begegnen sich im Moor, einem verwüsteten Kaff an einem See im Schatten des Hochgebirges. Ambras, der »Hundekönig« und ehemaliger Lagerhäftling, wird Jahre nach seiner Befreiung Verwalter jenes Steinbruchs, in dem er als Gefangener gelitten hat. Verhasst und gefürchtet haust er mit einem Rudel verwilderter Hunde im zerschlissenen Prunk der Villa Flora. Lily, die »Brasilianerin«, die Grenzgängerin zwischen den Besatzungszonen, die vom Frieden an der Küste des fernen Landes träumt, lebt zurückgezogen in den Ruinen eines Strandbades. An manchen Tagen aber steigt sie ins Gebirge zu einem versteckten Waffenlager aus dem Krieg, verwandelt sich dort in eine Scharfschützin und macht Jagd auf ihre Feine. Und Bering, der »Vogelmensch«, der Schmied von Moor: Er verlässt sein Haus, einen wuchernden Eisengarten, um zunächst Fahrer des Hundekönigs zu werden, dann aber dessen bewaffneter, zum Äußeren entschlossener Leibwächter. Doch in diesem zweiten Leben schlägt ihn ein Gebrechen, ein rätselhaftes Leiden am Auge, dessen Namen er in einem Lazarett erfahren soll: »Morbus Kitahara», die allmähliche Verfinsterung des Blicks.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Christoph Ransmayr
Morbus Kitahara
Roman
Über dieses Buch
Christoph Ransmayrs gewaltiger Roman über die Zeit nach dem großen Krieg und die allmähliche Verfinsterung des Blicks.
Moor, ein verwüstetes Kaff im Schatten des Hochgebirges. Zwischen Ruinen, Geröll und Eis begegnen sich drei Menschen: Bering, der Schmied, Ambras, der »Hundekönig« und Lily, die »Brasilianerin«.
»Der Friede von Oranienburg« ist der Name für die Jahre und Jahrzehnte nach einem großen Krieg. Aber dieser Name bezeichnet keine Epoche des Wiederaufbaus, sondern eine der Sühne, der Vergeltung und Rache. Nach dem Willen der Sieger sollen die geschlagenen Feinde aus den Ruinen ihrer Städte und Industrien zurückkehren auf die Rübenfelder und Schafweiden eines vergangenen Jahrhunderts. Drei Menschen begegnen sich im Moor, einem verwüsteten Kaff an einem See im Schatten des Hochgebirges. Ambras, der »Hundekönig« und ehemaliger Lagerhäftling, wird Jahre nach seiner Befreiung Verwalter jenes Steinbruchs, in dem er als Gefangener gelitten hat. Verhasst und gefürchtet haust er mit einem Rudel verwilderter Hunde im zerschlissenen Prunk der Villa Flora. Lily, die »Brasilianerin«, die Grenzgängerin zwischen den Besatzungszonen, die vom Frieden an der Küste des fernen Landes träumt, lebt zurückgezogen in den Ruinen eines Strandbades. An manchen Tagen aber steigt sie ins Gebirge zu einem versteckten Waffenlager aus dem Krieg, verwandelt sich dort in eine Scharfschützin und macht Jagd auf ihre Feine. Und Bering, der »Vogelmensch«, der Schmied von Moor: Er verlässt sein Haus, einen wuchernden Eisengarten, um zunächst Fahrer des Hundekönigs zu werden, dann aber dessen bewaffneter, zum Äußeren entschlossener Leibwächter. Doch in diesem zweiten Leben schlägt ihn ein Gebrechen, ein rätselhaftes Leiden am Auge, dessen Namen er in einem Lazarett erfahren soll: »Morbus Kitahara», die allmähliche Verfinsterung des Blicks.
»Ransmayr ist ein eigenwilliger, unerbittlicher und unzeitgemäßer Schriftsteller, der vielleicht mehr mit Joseph Conrad und Jack London gemein hat als mit der neuen gesamteuropäischen Fabuliererei.« Times Literary Supplement
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: Nach Ideen von Christoph Ransmayr und Klaus Meyer
Coverabbildung: Karl Blossfeldt, ›Eisenhutspross‹
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 1995
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403208-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Für Fred Rotblatt und [...]
1 Ein Feuer im Ozean
2 Der Schreier von Moor
3 Ein Bahnhof am See
4 Das Steinerne Meer
5 Stellamour oder der Friede von Oranienburg
6 Zwei Schüsse
7 Das Schiff in den Dörfern
8 Der Hundekönig
9 Die Große Reparatur
10 Lily
11 Die Brasilianerin
12 Die Jägerin
13 In der Finsternis
14 Musik
15 Keep movin’
16 Ein Konzert im Freien
17 Das Loch
18 Im Zwinger
19 Eine lachende Frau
20 Spielzeug, Stillstand und Verwüstung
21 Offene Augen
22 Ein Anfang vom Ende
23 Der Krieger
24 Unterwegs nach Brand
25 Töten
26 Das Licht von Nagoya
27 Morbus Kitahara
28 Ein Vogel in Flammen
29 Wut
30 Hund, Hahn, Aufseher
31 Auf und davon
32 Muyra oder die Heimkehr
33 Auricana
34 Das Feuer im Ozean
Für Fred Rotblatt und in Erinnerung an meinen Vater Karl Richard Ransmayr
1Ein Feuer im Ozean
Zwei Tote lagen schwarz im Januar Brasiliens. Ein Feuer, das seit Tagen durch die Wildnis einer Insel sprang und verkohlte Schneisen hinterließ, hatte die Leichen von einem Gewirr blühender Lianen befreit und ihnen auch die Kleider von ihren Wunden gebrannt: Es waren zwei Männer im Schatten eines Felsüberhanges. Sie lagen wenige Meter voneinander entfernt in menschenunmöglicher Verrenkung zwischen Farnstrünken. Ein rotes Seil, das die beiden miteinander verband, verschmorte in der Glut.
Das Feuer loderte über die Toten hinweg, löschte ihre Augen und Gesichtszüge, entfernte sich prasselnd, kehrte im Sog der eigenen Hitze noch einmal wieder und tanzte auf den zerfallenden Gestalten, bis ein Wolkenbruch die Flammen in die eisengraue Asche gestürzter Quaresmeirabäume zurücktrieb und schließlich alle Glut in das feuchte Herz der Stämme zwang. Dort erlosch der Brand.
So blieb ein dritter Leichnam von der Einäscherung verschont. Weitab von den Überresten der Männer lag eine Frau unter Luftwurzeln und schaukelnden Trieben. Ihr schmaler Körper war von Schnabelhieben zerhackt, ein Fraß schöner Vögel, war zernagt, ein Labyrinth der Käfer, Larven und Fliegen, die diese große Nahrung umkrochen, umschwirrten, umkämpften: ein Flor aus seidig glänzenden Flügeln und Panzern; ein Fest.
Der Pilot eines Vermessungsflugzeuges, das in diesen Tagen über der Bahia de São Marcos dröhnende Schleifen zog und vor aufziehenden Sturmwolken immer wieder nach dem Cabo do Bom Jesus abdrehte, sah auf jener felsigen, kaum zehn Seemeilen vor der Atlantikküste umbrandeten Insel die Bänder des Buschfeuers dahin und dorthin verlaufen, einen rauchenden, verrückten Weg durch die Wildnis. Der Landvermesser überflog die Verwüstung zweimal und schloß dann einen von atmosphärischem Rauschen gestörten Funkspruch mit jenem Eintrag, der auf seiner Karte unter dem Namen der Insel stand: Deserto. Unbewohnt.
2Der Schreier von Moor
Bering war ein Kind des Kriegs und kannte nur den Frieden. Wann immer die Rede von der Stunde seiner Geburt war, sollte er daran erinnert werden, daß er seinen ersten Schrei in der einzigen Bombennacht von Moor getan hatte. Es war eine regnerische Aprilnacht kurz vor der Unterzeichnung jenes Waffenstillstandes, der in den Schulstunden der Nachkriegszeit nur noch Der Friede von Oranienburg hieß.
Ein Bombergeschwader zog damals nach der adriatischen Küste ab und warf den Rest seiner Feuerlast über dem See von Moor in die Finsternis. Berings Mutter, eine Schwangere mit geschwollenen Beinen, trug eben einen Sack Pferdefleisch vom Anwesen eines Schwarzschlachters. Das weiche, kaum ausgeblutete Fleisch lag schwer in ihren Armen und zwang sie zu einer Erinnerung an den Bauch ihres Mannes – als sie über den Platanen am Seeufer eine ungeheure Faust aus Feuer zum Himmel steigen sah, und noch eine … und ließ den Sack auf dem Feldweg zurück und begann wie von Sinnen auf das lodernde Dorf zuzulaufen.
Die Hitze des größten Brandes, den sie je gesehen hatte, versengte ihr schon Augenbrauen und Haare, als aus einem schwarzen Haus plötzlich zwei Arme nach ihr griffen und sie in die Tiefe eines Kellers zerrten. Dort weinte sie, bis ihr ein Krampf den Atem nahm.
Zwischen schimmeligen Fässern brachte sie dann ihren zweiten Sohn um Wochen zu früh in eine Welt, die in das Zeitalter der Vulkane zurückzufallen schien: In den Nächten flackerte das Land unter einem roten Himmel. Am Tag verfinsterten Phosphorwolken die Sonne, und in Schuttwüsten machten die Bewohner von Höhlen Jagd auf Tauben, Eidechsen und Ratten. Aschenregen fiel. Und Berings Vater, der Schmied von Moor, war fern.
Noch Jahre später sollte dieser Vater, taub für die Schrecken der Geburtsnacht seines Sohnes, seine Familie mit der Beschreibung jener Leiden ängstigen, die er, er in diesem Krieg ertragen hatte. So trocknete Bering jedesmal die Kehle aus, und seine Augen brannten, wenn er wieder und wieder hörte, sein Vater habe als Soldat solchen Durst gelitten, daß er am zwölften Tag einer Schlacht sein eigenes Blut trank. Es war in der libyschen Wüste. Es war am Paß von Halfayah. Dort hatte die Druckwelle einer Panzergranate den Vater ins Geröll geworfen. Und als ihm in der Glut dieser Wüste plötzlich ein rotes, seltsam kühles Rinnsal über das Gesicht lief, schob der Vater den Unterkiefer vor wie ein Affe, schürzte die Lippen und begann zu schlürfen, verstört und voll Ekel zuerst, dann aber mit wachsender Gier: Diese Quelle würde ihn retten. Er kehrte mit einer breiten Narbe auf der Stirn aus der Wüste zurück.
Berings Mutter betete viel. Auch als der Krieg mit seinen Toten von Jahr zu Jahr tiefer in die Erde sank und schließlich unter Rübenfeldern und Lupinen verschwand, hörte sie in Sommergewittern noch immer das Donnern der Artillerie. Und in manchen Nächten erschien ihr die Heilige Maria wie damals und flüsterte ihr Prophezeiungen und Nachrichten aus dem Paradies zu. Wenn Berings Mutter nach dem Erlöschen Mariens ans Fenster trat, um das Fieber der Erscheinung zu lindern, sah sie das lichtlose Ufer des Sees und ein hügeliges Brachland, das in schwarzen Wogen auf noch schwärzere Bergketten zurollte.
Berings Brüder waren beide verloren; tot der eine, der jüngere, ertrunken im See von Moor, als er im eisigen Wasser einer Bucht nach Zähnen tauchte, nach der versenkten, von Rotalgen und Süßwassermuscheln überwachsenen Munition einer versprengten Armee, nach kupfernen Projektilen, die er mit Steinen von den Patronenhülsen geklopft, durchbohrt und wie Fangzähne an einer Schnur um den Hals getragen hatte. Verloren auch der andere, der ältere, ein Auswanderer irgendwo in den Wäldern des Staates New York. Die letzte, Jahre zurückliegende Nachricht von ihm, eine Ansichtskarte, zeigte den Hudson River, dessen graue Flut immer auch die Trauer über den Ertrunkenen wieder wachrief.
Wenn Berings Mutter am Todestag ihres ertrunkenen Sohnes ein Gebinde blauer Anemonen und in Holznäpfe eingegossene Wachslichter im See aussetzte, dann trieb stets auch ein Licht für die Polin Celina davon, die ihr in der Bombennacht beigestanden war.
Celina, eine aus Podolien verschleppte Zwangsarbeiterin, hatte sich damals in den Erdkeller eines brennenden Weingutes geflüchtet und Berings Mutter mit in die Sicherheit gezerrt. Sie hatte der schreienden, von plötzlichen Wehen überfallenen Schmiedin zwischen Eichenfässern ein Lager aus Säcken und feuchter Pappe bereitet und dann das Neugeborene mit einem Schürzenband und ihren Zähnen abgenabelt und mit Wein gewaschen.
Während aus der Oberwelt allein das Krachen und die Erschütterungen der Einschläge in die von Unschlittkerzen kaum erhellte Tiefe drangen, hielt die Polin Mutter und Kind in ihren Armen, betete laut zur Schwarzen Madonna von Tschenstochau und trank dazu mehr und mehr schlecht vergorenen Wein, bis sie zwischen Stoßgebeten und Litaneien Gericht zu halten begann über die vergangenen Jahre:
Der Feuersturm dieser Nacht sei die Strafe der Madonna, daß Moor seine Männer in den Krieg geworfen und in schrecklichen Armeen nach Szonowice, ja bis an das Schwarze Meer und nach Ägypten habe ziehen lassen, Vergeltung dafür, daß ihr Bräutigam Jerzy an den Ufern des Bug als Lanzenreiter gegen Panzer stürmen mußte und dann von den Laufketten … seine schönen Hände … sein schönes Gesicht …
Fürstin des Himmels!
Strafe für das verglühte Warschau und für den Steinmetz Bugaj, der mit seiner ganzen Familie und Nachbarschaft auf den Holzplatz der Köhlerei von Szonowice getrieben wurde; ihr eigenes Grab mußten sie dort schaufeln,
Madonna, Trösterin der Betrübten!
Rache für die entehrte Schwägerin Krystyna,
Du Zuflucht der Sünder!
und für den Kürschner Silberschatz aus Ozenna … Zwei Jahre hatte sich der Unglückliche in einer Kalkgrube versteckt gehalten, bis man ihn verriet und fand und in Treblinka für alle Ewigkeit in den Kalk warf,
Königin der Barmherzigkeit!
Sühne! für die Asche auf der polnischen Erde und für die zerstampften Wiesen Podoliens …
So klagte und weinte die Polin Celina noch, als es in der Oberwelt längst totenstill geworden und Berings Mutter vor Erschöpfung eingeschlafen war.
Die Männer von Moor, flüsterte Celina in die winzigen Fäuste des Säuglings, die sie wieder und wieder an ihren Mund drückte und küßte, die Männer von Moor hätten sich gegen die ganze Welt erhoben – und diese Welt werde nun in ihrer Wut wie das Jüngste Gericht mit allen Lebenden und Toten über die Felder heranstürmen, Engel mit Flammenschwertern, Kalmücken aus den Steppen Rußlands, Horden friedloser Seelen, die ohne den Trost der Kirche aus ihren sterblichen Hüllen geschlagen worden waren, Gespenster …! Und polnische Ulanen, rasend auf ihren Pferden, und von Patronengurten und Bajonetten klirrende Juden aus dem Heiligen Land und alle, die nichts mehr zu verlieren und keinen anderen Glauben zu gewinnen hatten als den an die Rache,
Amen.
Die Zwangsarbeiterin Celina Kobro aus Szonowice in Podolien war schließlich das erste Opfer in Moor, das vier Tage später unter den Kugeln eines siegreichen, über das Dorf hereinbrechenden Bataillons starb. Es war ein Mißverständnis. Ein schreckhafter Infanterist verwechselte die vermummte Gestalt der Polin, die ein Pferd durch die Dunkelheit führte, mit einem Heckenschützen, einem flüchtenden Feind, schrie zweimal vergeblich in einer unverständlichen Sprache Halt und Alarm – und schoß.
Schon der erste Feuerstoß traf Celina in Brust und Hals und verwundete das Pferd. Celina hatte dem Ackergaul die Nüstern zugebunden und seine Hufe mit Putzlappen umwickelt, um das herrenlose Tier in aller Stille aus dem überrannten Dorf ins Versteck einer Fichtenschonung zu führen und so vor der Beschlagnahme oder Schlachtung zu retten; der Gaul war ihre Beute. Er sprang lahmend in die Nacht davon, während Celina auf moosigen Steinen lag und die näherkommenden Sturmschritte des Infanteristen nur noch als den fernen, seltsam feierlichen Lärm ihres Todes wahrnahm: ein Blätterrauschen, ein Brechen von Zweigen, ein tiefes, abgrundtiefes Atmen – und endlich jenen unterdrückten Schrei, einen Fluch des Schützen, nach dem jedes Geräusch erstarb und für immer an die Stille zurückfiel.
Celina wurde am nächsten Morgen unter den verkohlten Akazien der Bahnstation neben einem Mineur aus dem Moorer Steinbruch begraben, einem kriegsgefangenen Georgier, der wenige Stunden nach dem Einmarsch der Sieger an seinem Hunger gestorben war.
Schon in den ersten Wochen nach ihrem Tod schienen nicht nur Celinas Prophezeiungen aus Berings Geburtsnacht, sondern noch ihre geheimsten Racheträume aus den Jahren ihrer Verschleppung wahr zu werden:
In Moor wurden Bürger aus ihren Häusern gejagt. Die Höfe von geschlagenen Parteigängern des Kriegs brannten. In Moor mußten ehemals gefürchtete Aufseher aus dem Steinbruch jede Demütigung schweigend ertragen; zwei von ihnen pendelten am siebenten Tag nach der Befreiung, es war ein kalter Freitag, an Drahtseilen im Wind.
In Moor wurden Hühner und magere Schweine als bewegliche Ziele über den Platz der Helden und rußige Felder gejagt und zur Übung der Scharfschützen getötet und das Aas den Hunden überlassen – im hungernden Moor … und alle plötzlich verjährten Ehrenzeichen, Orden und Heldenbüsten sanken, in Fahnen und abgestreifte Uniformen gewickelt, zum Grund von Jauchegruben hinab oder verschwanden auf Dachböden, in Kellerverstecken, auch im Feuer und in hastig geschaufelten Erdlöchern. In Moor herrschten die Sieger. Und was immer an Klagen über diese Herrschaft in der Kommandantur vorgetragen wurde – die Antworten und Bescheide der Besatzungsarmee waren zumeist nur eine böse Erinnerung an die Grausamkeit jenes Heeres, in dem Moors Männer gedient und gehorcht hatten.
Es waren zwar nicht die Reiter des Jüngsten Gerichts, die auf lehmverkrusteten Packpferden durch das Dorf zogen, und aus Panzerluken und von den offenen Verdecks der Truppentransporter starrten nicht die Racheengel und Gespenster aus Celinas Prophezeiung herab – in der zur Kommandantur verwandelten Gemeindestube bezog aber, als erster einer Reihe fremder Befehlshaber, ein Oberst aus Krasnojarsk Quartier, ein flachsblonder Sibirer mit wäßrigen Augen, der die Getöteten seiner eigenen Familie nicht vergessen konnte, unter schweren Träumen stöhnte und auf alles, was sich während der scheinbar regellos verhängten Ausgangssperren in Moors Gassen und Gärten bewegte, schießen ließ.
Der Krieg war vorüber. Aber das von allen Schlachtfeldern so weit entfernte Moor sollte allein im ersten Jahr des Friedens mehr Soldaten sehen als in den eintönigen Jahrhunderten seiner bisherigen Geschichte. Dabei schien es manchmal, als würden in dem von Gebirgen umschlossenen Moorer Hügelland nicht bloß die Aufmarschpläne der Strategen vollzogen, sondern als müßte ein ebenso monströses wie verworrenes Manöver die gesammelte Macht der Welt ausgerechnet an diesem entlegenen Ort vorführen: Auf den zerwühlten Feldern und Weinrieden Moors, auf leeren Güterwegen und jeden Schritt verschlingenden, morastigen Wiesen überlagerten und durchkreuzten sich in diesem ersten Jahr die Besatzungszonen sechs verschiedener Armeen.
An der Kartenwand der Kommandantur erschien das Moorer Hügelland nur noch als ein Schnittmusterbogen der Kapitulation. Immer neue Verhandlungen zwischen rivalisierenden Siegern bestimmten und verzerrten die Demarkationslinien, verfügten Täler und Straßenzüge aus der Gnade des einen in die Willkür des nächsten Generals, teilten Kraterlandschaften, versetzten Berge … Und schon die Konferenz des nächsten Monats beschloß wieder alles anders und neu. Einmal geriet Moor für zwei Wochen in ein plötzlich aufklaffendes Niemandsland zwischen den Armeen, wurde geräumt – und wieder besetzt. Auch das Beringsche Gehöft blieb von flüchtigen Grenzen eingeschnürt und war doch niemals mehr als eine armselige Beute, die rußige Schmiede, der leere Stall, eine Schafweide, Brachland.
Waren es in den ersten beiden Wochen des Waffenstillstandes allein die Sibirer des Krasnojarsker Obersten gewesen, die Moor in ihrer Gewalt hatten, so marschierte nach ihrem Abzug eine marokkanische Batterie unter französischem Befehl in das Dorf. Es wurde Mai, aber das Jahr blieb kalt. Die Marokkaner schächteten zwei in den Ruinen des Moorer Sägewerks versteckte Milchkühe, entrollten Gebetsteppiche auf dem Pflaster vor der Kommandantur, und zum ungläubigen Entsetzen von Berings Mutter schlug kein Blitz aus dem Blau des Himmels, als ein Afrikaner die Madonna der Friedhofskapelle von ihrer vergoldeten Holzwolke schoß.
Die Batterie blieb bis in den Sommer. Dann rückte ein Regiment schottischer Highlanders nach, gälische Scharfschützen, die mindestens einmal die Woche den Jahrestag einer anderen unvergessenen Schlacht mit Flaggenparaden, Dudelsackmusik und schwarzem Bier feierten – und schließlich, die wenigen bestellten Felder waren schon abgeerntet und lagen nun wieder so dunkel und kahl wie alles Land im Frost, löste eine amerikanische Kompanie die Highlanders ab, und das Regime eines Majors aus Oklahoma begann.
Major Elliot war ein eigensinniger Mann. Er ließ an die Eingangstür der Kommandantur einen Garderobenspiegel schrauben und fragte jeden Bittsteller oder Beschwerdeführer aus den besetzten Gebieten, wen oder was er vor seinem Eintreten in diesem Spiegel gesehen hätte. War er wütend oder schlecht gelaunt, wiederholte er eine Abfolge immergleicher, bohrender Fragen so lange, bis der Bittsteller endlich beschrieb, was der Kommandant hören wollte – einen Schweinsschädel, Borsten und Klauen einer Sau.
Mit Major Elliot sollten aber nicht nur seltsame Strafen über Moor kommen, Demütigungen, die von den Besiegten schließlich als unbegreifliche Verrücktheiten hingenommen wurden, sondern auch eine spürbare Erleichterung: An die Stelle der wilden und regellosen Rache befreiter Zwangsarbeiter oder durchziehender Truppen trat nun das Standrecht einer siegreichen Armee. Im ersten Friedenswinter verging kaum ein Tag, an dem nicht wenigstens eine neue Vorschrift gegen das drohende Chaos erlassen wurde, Gesetze gegen Plünderer, Saboteure oder Kohlendiebe. Ein dürrer, von Baseball und deutschen Dichtern des neunzehnten Jahrhunderts begeisterter Sergeant übersetzte Paragraph um Paragraph der neuen Strafbestimmungen in eine seltsame Kanzleisprache und schlug sein Werk dann an das Schwarze Brett der Kommandantur.
Während das Dorf seiner Geburt mit jedem Tag armseliger wurde, lag Bering in zerschnittene Fahnen gewickelt in einem Wäschekorb, der von einem Deckenbalken pendelte, lag und schrie, ein magerer, von der Krätze geplagter Säugling, lag in seiner nach Milch und Speichel riechenden Hilflosigkeit – und wuchs. Sollte Moor zugrunde gehen, der Sohn des in der Wüste verschollenen Schmieds wurde mit jedem Tag zäher. Er schrie und wurde gestillt, schrie und wurde getragen, schrie und wurde von der Schmiedin, die viele Nächte am Pendel seines Korbes durchwachte und dabei die Madonna um die Heimkehr ihres Mannes anflehte, geküßt und auf den Armen gewiegt. Als ob ihn jeder Kontakt mit der Erde in Schrecken versetzte, ertrug der Säugling keinen festen Ort und tobte mit offenen Augen, wenn seine Mutter ihn erschöpft aus dem Korb und zu sich ins Bett nahm. Wie sehr sie ihn auch zu besänftigen versuchte und auf ihn einsprach, er schrie.
Es war dunkel in Berings erstem Jahr. Die beiden Fenster seiner Kammer blieben bis tief in den Frieden von Oranienburg vernagelt: Wenigstens dieser Raum, der einzige im Haus des Schmieds, der nach der Bombennacht von Moor ohne Mauerrisse und Brandspuren war, sollte vor Plünderern und schwirrenden Eisensplittern sicher sein. In den Feldern lagen immer noch Minen. So schaukelte, schwebte, segelte Bering durch seine Dunkelheit dahin und hörte aus der Tiefe unter sich manchmal die brüchigen Stimmen dreier Legehennen, die in der Bombennacht aus dem brennenden Stall der Schmiede gerettet und schließlich mit aller wertvollen Habe in die unversehrte Kammer geschlossen worden waren.
Das Kollern und Scharren dieser Hühner in ihrem Drahtkäfig war in Berings Dunkelheit stets lauter als das Getöse der ausgesperrten Welt. Selbst das Dröhnen der auf den Wiesen manövrierenden Panzer drang durch die Bohlen der Vernagelung nur dumpf und wie aus großer Ferne an die Schaukel des Säuglings. Bering, ein Fliegender unter gefangenen Vögeln, schien die Hühner zu lieben – und hielt manchmal sogar in seinem verzweifelten Schreien inne, wenn eines der Tiere plötzlich ruckend und blinzelnd seine Stimme erhob.
Wenn seine Mutter von Gehöft zu Gehöft und manchmal tagelang über die Dörfer ging, um Schrauben, Hufnägel und schließlich selbst das im Keller versteckte Schweißgerät der Schmiede gegen Brot, Fleisch oder ein Glas schimmeliger Marmelade einzutauschen, hielt Berings Bruder Wache, ein eifersüchtiger, jähzorniger Halbwüchsiger, der das schreiende Bündel haßte. Ratlos vor Wut zerriß der Bruder Insekten, Nachtfalter und Schaben, die er aus der Wandtäfelung scheuchte, zupfte Fadenbeinchen, eines nach dem anderen, aus den Panzern von Käfern, warf die Verstümmelten den Hühnern unter dem Korb des Säuglings zum Fraß vor und versetzte das Geflügel nach solchen Fütterungen mit einer Kerzenflamme in Panik. Reglos lauschte Bering dann den Stimmen der Angst.
Noch Jahre später bedurfte es bloß eines Hahnenschreis, um in ihm rätselhafte Empfindungen wachzurufen. Oft war es ein melancholischer, ohnmächtiger Zorn, der keinen bestimmten Gegenstand hatte und ihn doch mehr als jeder tierische oder menschliche Laut mit dem Ort seiner Herkunft verband.
Berings Mutter glaubte an ein Zeichen des Himmels und trug den Hühnerkäfig entsetzt aus der Kammer, als der Säugling an einem verschneiten Morgen im Februar nach einer Stunde der Ruhe und des gebannten Zuhörens wieder zu schreien begann – und seine Stimme dem Krächzen eines Huhnes glich: Der Schreier kollerte wie eine Legehenne! Der Schreier ruderte mit den Armen, streckte verkrampfte weiße Fingerchen wie Krallen aus seinem Korb. Und hob er nicht auch ruckend den Kopf?
Der Schreier wollte ein Vogel sein.
3Ein Bahnhof am See
In jenem dürren Herbst, in dem der Schmied von Moor aus Afrika und der Kriegsgefangenschaft heimkehrte, konnte Bering etwa drei Dutzend Wörter aussprechen, schrie aber mit größerer Begeisterung mehrere Vogelstimmen erkennbar nach, war ein Huhn, war eine Türkentaube, war ein Kauz. Man schrieb das zweite Jahr des Friedens.
Die auf eine Feldpostkarte gekritzelte Nachricht von der bevorstehenden Ankunft des Vaters hatte die Schmiede verwandelt: Die Mauerrisse waren von einem Flüchtling aus Mähren für einen Laib Brot verputzt und gekalkt worden – und endlich standen auch die vernagelten Fenster von Berings Kammer wieder offen. Der Lärm der Welt drang nun ungemildert auf ihn ein. Er schrie vor Schmerz. Das Gehör, sagte der Mährer, während er mit einem kalktriefenden Besen Brandspuren übertünchte, das Kind habe zu empfindliche Ohren. Das Kind höre zu fein.
Bering schrie untröstlich wie je – und es war tatsächlich, als ob er sich in die eigene Stimme flüchtete, wie zum Schutz in seine Stimme … tatsächlich, als ob ihm das eigene Schreien erträglicher und weniger schrill und schneidend wäre als das Getöse der Welt vor den offenen Fenstern. Aber schon lange bevor er seinen ersten Schritt in diese Welt getan hatte, schien der Schreier gefühlt zu haben, daß einem Feinhörigen die Stimme eines Vogels eine weitaus bessere Zuflucht bot als das rohe Gebrüll eines Menschen: Zwischen den Tiefen und Höhen des tierischen Gesangs lag alle Geborgenheit und Ruhe, nach der man sich in einem geborstenen Haus sehnen konnte.
Als der mährische Flüchtling die Schmiede verließ, kalkweiße, kaum getrocknete Räume, blieben darin ein Geruch von fauligem Wasser – und ein besänftigtes Kind zurück. Berings Mutter war dem Rat des Mährers gefolgt, hatte ihm für zwei Gläser Schnaps Wachspfropfen abgekauft, von denen er behauptete, sie seien aus den Tränen der Kerzen von Meteora geformt, den heilkräftigen Kerzen der Felsenklöster von Meteora! – und betäubte nun ihrem Sohn damit die Ohren, wann immer er schrie.
Der Schmied von Moor kam mit einem von der Ruhr verseuchten Transport am Tag des Erntedankfestes. In den Ruinen des Bahnhofs am See erwartete eine drängende Menschenmenge die Freigelassenen. Auf den Bahndämmen herrschte eine böse Unruhe. Gerüchte aus der großen Umgebung des Sees behaupteten, daß dieser Transport der letzte Zug bleiben sollte, der Moor vor der Stillegung der Eisenbahnlinie erreichen würde.
Es war ein wolkenverhangener Tag, auf dem Land lag der erste Rauhreif, und die Kälte stank nach dem verbrannten Stroh der Felder. In der Oktoberstille war das näherkommende Stampfen der Dampfmaschine schon lange zu hören, als über den Pappeln am Karpfenteich endlich die ersehnte Rauchfahne erschien und auf den See zukroch.
Bering, ein mageres, kaum achtzehn Monate altes Kind an der Hand seiner Mutter, war tief in der Menge, unsichtbar zwischen Beinen, Mänteln – und Schultern, die sich über ihm zusammenschlossen und wieder voneinander lösten, und hörte das Keuchen der Maschine doch vor allen anderen und lauschte gebannt. Was sich da näherte, war ein rätselhafter, nie gehörter Atem.
Der Zug, der schließlich im Schrittempo in das zerbombte Gemäuer des Bahnhofs einfuhr, bestand aus geschlossenen Viehwaggons und glich auf den ersten Blick jenen Elendszügen, die in den Kriegsjahren mit Zwangsarbeitern und gefangenen Feinden vollgepfercht zumeist im Morgengrauen in den Steinbruch von Moor gerollt waren: das gleiche Stöhnen aus dem Inneren der Waggons, als dieser Zug auf das Abstellgleis am Ufer geschoben wurde und dort am Prellbock mit einem metallischen Krachen zum Stillstand kam. Der gleiche Gestank, als die Schiebetüren endlich offenstanden. Nur hatten diesmal keine uniformierten, schwerbewaffneten Aufseher und keine brüllende Feldpolizei an den Bahndämmen Stellung bezogen, sondern nur einige gelangweilte Infanteristen aus der Kompanie Major Elliots, die das Schauspiel der Ankunft ohne Einsatzbefehl verfolgten.
Mit dem Stillstand des Zugs kam, fuhr plötzlich Leben in die Menge. Hunderte von ihrem jahrelangen Warten erlöste Menschen umdrängten diesen Zug, als wäre er ein ungeheures, endlich zur Strecke gebrachtes Tier. Aus ihrem Gemurmel wurde ein lautes Stimmengewirr, ein Geschrei. Die meisten von ihnen waren nicht weniger zerlumpt und abgezehrt als die Freigelassenen, die nun ohne Gepäck aus den Waggons taumelten und ihre Hände gegen das Licht schützend vor die Augen hoben. Ein Dickicht aus Armen wogte ihnen entgegen, ein Einerlei aus Gesichtern, in der Blendung kaum zu erkennen. Zerrupfte Blumen und Fotos, Bilder von Verschollenen, wurden ihnen wie Trümpfe in einem Kartenspiel gegen den Tod entgegengestreckt, Namen und Bitten zugerufen, Beschwörungen:
Hast du den hier gesehen, meinen Mann!
Meinen Bruder gesehen, kennst du den
Ist er bei euch
Er muß bei euch sein
Ihr kommt doch aus Afrika
… ein Geschiebe und Drängen, bis diejenigen, die sich schon gefunden haben, sich stammelnd liebkosen oder wortlos halten, endlich die ersten gemeinsamen Schritte aus dem Krieg tun – und gleich wieder um sich schlagen, um unter den ersten in der Ankunftshalle zu sein, die ohne Dach ist. Dort soll es Brot geben.
Unter dem offenen Himmel dieser Halle steht Major Elliot mit hängenden Armen neben dem Sekretär von Moor, dahinter eine Blechmusikkapelle ohne Uniformen, die auf ein Zeichen des Sekretärs die Melodie eines langsamen, alten Liedes spielt und erst dann einen Marsch. Der Kapelle ist anzuhören, daß viele ihrer Bläser fehlen. Nur eine einzige Klarinette. Und kein Flügelhorn.
Dann wird es still. Wer dort unter zwei Fahnen eine Rede hält, ist vom Bahnsteig schon nicht mehr zu erkennen. Zwei Lautsprecher an hölzernen Stangen tragen die Worte weit über Geleise und Köpfe hinweg auf den See.
Willkommen … Heimat in Trümmern … Zukunft … und Mut fassen!
Wer hat jetzt noch Ohren für Worte. Bering fühlt nur den Schmerz von sich überlagernden schrillen Tönen aus den Lautsprechern, die er für den Klang einer einzigen häßlichen Stimme hält.
Nach dem Verstummen des Redners noch einmal Musik, das dünne Singen einer Zither und dahinter ein Akkordeon, wie es in den Wirtsstuben der Vorkriegszeit zu hören war; dann eine Sängerin, die zweimal absetzen muß, weil sie schluchzt oder niest, es ist nicht zu erkennen.
Musiker, Sänger, Redner und selbst Major Elliot werden schließlich von der Menge geschluckt. Die Willkommensfeier ist zu Ende. Jetzt erst wird an die Armseligen aus den Waggons Brot und Milchpulver verteilt, eine Wochenration; der Sekretär führt Listen und unterzeichnet Formulare. Einige der Beschenkten können sich nicht mehr auf den Beinen halten, krümmen sich, sinken in die Knie. Endlich darf jeder gehen, wohin er will, zum erstenmal seit Jahren wieder, wohin er will. Aber wohin?
Wie verloren im Tumult steht die Schmiedin, an der einen Hand Bering, an der anderen den Bruder, der zornig ist wie immer, aber aus Furcht vor den Drohungen der Mutter stillhält. Auch von Bering kommt kein Laut. Der Atem der Maschine braust ihm noch in den Ohren.
Die Schmiedin hat kein Foto hochgehalten. Die Schmiedin ist mit ihren Söhnen in der Menge dahin und dorthin geschoben, gedrängt worden, und jede Richtung war ihr recht. Sie hat ja gewußt, hat um alles in der Welt glauben wollen, daß sie diesmal nicht vergeblich zwischen den schwarzen Mauern des Moorer Bahnhofes warten wird. Sie hat Blumen mitgebracht, Berings Bruder hält sie in seiner Faust. Es sind Zyklamen von der Uferböschung am Wasserwehr.
An beiden Händen die Söhne, kann sich die Schmiedin nicht durch die Menge kämpfen wie die anderen. Sie und er sind niemals aufeinander zugelaufen, sondern stets zögernd und oft mit Scham und verlegen aufeinander zu. Dann hat der Krieg die Sanddünen Nordafrikas zwischen ihnen angeweht und ein ganzes Meer zwischen ihnen gestaut. Sie kennen sich ja kaum.
Aber wie früher muß die Schmiedin auch diesmal auf ihn warten. Tief in der Menge muß sie warten und sich auf die Zehenspitzen stellen und Ausschau halten, bis ihre Augen im kalten Seewind schmerzen und Tränen über ihr Gesicht laufen.
Sie weiß nicht, daß sie weint, sie hört nicht, daß sie den Namen des Schmieds aufsagt, wieder und wieder, einen Spruch, eine Formel. Bering ist an ihrer Seite wie betäubt von der ersten Menschenmenge seines Lebens und von dem rasenden Puls, den er an jener Hand spürt, die ihn hält.
Nach der Verteilung des Brots war der Kampf um die Heimkehrer leichter, ja heiter geworden, kleine, verschlungene Gruppen lösten sich aus dem Gewühl, schon wurde gelacht, Pferdefuhrwerke fuhren an, auch ein Lastwagen. Elliots Soldaten entwanden einem grölenden Kutscher eine verbotene Fahne und zerrissen sie, stießen den Mann in ihren Jeep. Kaum jemand kümmerte sich darum. Nur der lehmverkrustete, zottige Hund des Verhafteten umsprang kläffend das Fahrzeug, schnappte nach den Feinden seines Herrn und ließ erst ab, als ihm einer der Soldaten den Kolben seines Sturmgewehrs auf den Schädel schlug.
Unermeßlich,
unermeßlich die Zeit, die vergehen muß, bis die Schultern und die Köpfe im Himmel über Bering verfliegen und die Menge lichter wird. Als ob der keuchende, nun zur Ruhe gekommene Atem Raum geschaffen hätte, wird Bering an der Hand der Mutter plötzlich fortgezogen und sein Bruder mit ihm.
Jetzt endlich kann auch die Schmiedin vorwärts, dorthin, wo noch viele Gestalten grau in grau zusammenstehen und sich nicht vermischt haben mit den Wartenden. Zweimal glaubt sie das verlorene Gesicht schon entdeckt zu haben, das vertraute, das sich dann zweimal in ein fremdes verwandelt, bis nach einer Ewigkeit, keine drei Meter von ihr entfernt, der Schmied vor ihr steht. Jetzt nimmt ihr der eigene Herzschlag alle Kraft, und sie spürt, daß sie schon auf die Vergeblichkeit gefaßt war.
Der Schmied ist ein dünner Mann, der so plötzlich stehengeblieben ist, daß ihm ein Nachkommender in den Rücken fällt. Er hält dem Anprall stand und schaut sie an. Einen Bart hat er. Schwarze Flecken hat er im Gesicht. Sie hat ihn so und doch ganz anders in Erinnerung. Die Narbe auf der Stirn kennt sie aus einem Feldpostbrief. Aber jetzt erst erschrickt sie darüber. Was war das für ein Krieg, in dem er so lange verschollen war und aus dem er nun so zurückkehrt? Sie weiß es schon nicht mehr. Die halbe Welt ist mit Moor zugrundegegangen, das weiß sie, und auch, daß mit der Polin Celina und den vier Kühen des Hofes die halbe Menschheit in der Erde und im Feuer verschwunden ist, Heilige Maria! Aber er ist der einzige von allen Verschwundenen, der sie jemals in den Armen gehalten hat. Und er ist zurückgekommen.
Die Söhne fürchten sich. Der Bruder will sich an den da nicht mehr erinnern, und Bering hat ihn noch nie gesehen. Die Söhne klammern sich an die Hände der Mutter, die nun keinen Arm frei hat wie die anderen, die Glücklichen in der Ruine des Bahnhofs.
So starren sie sich an, die Söhne den furchtbaren Fremden, der Fremde die Mutter, der Fremde den Bruder, der Fremde Bering. Jeder ist still. Und dann macht der Fremde jenen Schritt, der Bering den Mund aufreißt zu einem Schrei des Entsetzens. Der dünne Mann zeigt auf ihn, ist mit zwei langsamen Schritten bei ihm, greift nach ihm mit beiden Händen, hebt ihn aus der Nähe der Mutter, hebt ihn zu sich hoch.
Bering spürt, daß in diesem Mann der Atem sein muß, den er aus der Ferne gehört hat. Und jetzt hat er die Narbe auf der Stirn des Schmieds vor sich, die Wunde, die den da wohl so keuchend und dünn gemacht hat, und schreit in der Augenhöhe des Vaters um Hilfe, schreit Worte, die der Mutter in seinem Rücken sagen sollen, was an dem da schrecklich ist, schreit
Blutet!
schreit
Stinkt!
und windet sich in den Armen des dünnen Mannes und weiß, daß ihm kein Wort helfen wird. Die Mutter ist nur ein Schatten tief hinter ihm. Drei Atemzüge, vier schwebt er so und fühlt plötzlich ein Zerren, das sein Geschrei zerreißt und ein Hämmern, das ihm die Fetzen seiner Stimme hoch in den Kopf schlägt, und hört aus seinem eigenen Mund endlich wieder die andere, die schützende Stimme, die ihn durch die Dunkelheit seines ersten Jahres trug: Und beginnt in den Armen des Vaters zu gackern!, rasend zu gackern, ein panisches Huhn, das mit den Armen, den Flügeln schlägt, ein zu Tode geängstigter Vogel, den der dünne Mann endlich nicht mehr zu halten vermag. Flatternd stürzt er der Erde entgegen.
4Das Steinerne Meer
Drei Wochen nach der Heimkehr des Schmieds stand der Freiheitszug immer noch vor dem Prellbock. Durch die offenen Schiebetüren der Viehwaggons wehte ein Gestank nach Urin und Scheiße, und im fauligen Stroh gurrten Tauben; sie wurden von Flüchtlingen, die entlang des Bahndamms lagerten, mit Steinschleudern und Netzen gejagt. In den tiefen Spurrinnen der Straße zum See
blinkte in diesen Tagen das erste Eis, Hausierer schlugen an Fensterläden und Türen, aber selbst hinter dem herabgelassenen Rollbalken des Moorer Kolonialwarenladens pendelten nur dürre Lavendelsträuße in der Zugluft – und Major Elliot bewilligte ein Bittgesuch des Schmieds und überließ dem Freigelassenen bis auf weiteres ein Schweißgerät aus den Beständen der Armee.
Den ersten Blitzen und dem Feuerschein aus der wiedereröffneten Schmiede folgten ohrenbetäubende Hammerschläge auf Wagendeichseln, Stallgitter und Windfahnen, auch ein rotglühender, eiserner Eichenzweig, die erste Bestellung eines neugegründeten Veteranenvereins, wand sich auf dem Amboß. Der Schmied führte Selbstgespräche, jammerte im Schlaf, begann aber im Lärm seiner Arbeit manchmal unvermittelt zu singen, Strophen von Soldatenliedern und Lalala, während Bering immer noch an seinem Sturz aus den Armen des Vaters litt. Ein Turban aus Lazarettbandagen ließ sein Gesicht winzig und erst recht als das eines Vogels erscheinen.
Der Schmied nahm an diesem fleckigen Kopfverband seines Sohnes aber nur Erinnerungen an seine Zeit in der Wüste wahr und erzählte Geschichten von Wanderdünen, die aufgeriebene Konvois unter sich begruben, beschwor am Küchentisch wehende Felder aus Sandfontänen, die sich als die Vorboten eines Sturms in einer einzigen Sekunde erhoben und gleich wieder hinlegten und dabei klangen, als fielen Nadeln gegen eine Erde aus Glas … Und er beschrieb Oasen, in denen eine Karawane Zuflucht fand, bevor die trübe Sonne in den Sandwolken erlosch.
Aber wie sehr er sich auch bemühte, seiner Familie die Wüste zu erklären, und dabei die Grimassen eines Dromedars oder das Lachen von Hyänen nachzuahmen versuchte – Bering blieb über den dünnen Mann im Bett seiner Mutter so entsetzt, daß er wochenlang weder ein Wort sprach noch einen Vogellaut über die Lippen brachte.
Der Zug, mit dem der dünne Mann gekommen war, neun Waggons und eine Tenderlokomotive, stand wie ein aus dem Streckennetz geratener, von allen Behörden und Kommandanturen vergessener Irrläufer Woche um Woche in den Ruinen des Bahnhofs von Moor und sollte seine Endstation schließlich nie mehr verlassen:
Es war an einem wolkenlosen Frosttag, als eine Kolonne amerikanischer Pioniere aus dem Tiefland anrückte und mit der Demontage der Geleise begann. Wie zum Zeichen einer besonderen Strafe fielen die ersten Hammerschläge auf ein Stellwerk, das unter den Zwangsarbeitern des Steinbruchs als Das Kreuz von Moor berüchtigt gewesen war. Dieses Kreuz – eine zwischen Taubnesseln, Pfefferminze und Brombeergestrüpp verborgene Weiche – hatte in den Kriegsjahren alle an das Moorer Ufer rollenden Züge in weiße und in blinde geteilt:
Weiße Züge hatten auch im Krieg die gleichen Passagiere wie im Frieden an den See gebracht – Kurgäste mit pfeifendem Atem, fette Gichtpatienten, Fischmarktfahrer an jedem Dienstag und Pendler aus dem Tiefland. Mit der Dauer ferner Schlachten waren dazu mehr und mehr Fronturlauber gekommen und schwerverwundete Offiziere, die unter den Sonnenschirmen des Grand Hotels die letzten Tage ihres Lebens in gestreiften Liegestühlen verbrachten. Vor weißen Zügen war die Weiche stets nach rechts geschlagen, was weiß war, rollte ein sanftes Gefälle hinab zur Endstation Bahnhof Moor.
Blinde Züge erreichten diesen Bahnhof nie. Blind, das bedeutete: ohne Fenster, bedeutete: ein Zug ohne Beschilderung und Hinweis auf Herkunft und Ziel. Blind, das waren die geschlossenen Güter- und Viehwaggons der Gefangenenzüge. Allein auf den Plattformen, in den Bremserhäuschen und manchmal auf den rußigen Dächern waren Menschen zu sehen, Aufseher, Soldaten. Vor solchen Zügen klirrte die Weiche nach links. Dann rollten auch sie abwärts, an ein staubbedecktes Ufer, das undeutlich in der Ferne lag. An das Ufer des Steinbruchs.
Aus dem Gestänge des zerschossenen Wachturms am Stellwerk war ein schöner Blick auf den See. Noch Jahrzehnte später und als ein Gefangener Brasiliens sollte Bering die Erinnerung an diesen Blick für das Bild seiner Herkunft halten: Ein grüner Fjord schien dort in der Tiefe zu liegen, ein von Lichtreflexen sprühender Meeresarm. Oder war es ein Strom, der sich im Verlauf von Äonen in den Felsengrund gegraben hatte und nun besänftigt durch die Schluchten seiner eigenen Beharrlichkeit kroch? Zwischen bewaldeten Abhängen und kahlen Lehnen wand sich dieser See tief ins Gebirge, bis er in einer schroffen, weglosen Einöde an die Felsen schlug.
Über die Weite des Wasserspiegels hinweg betrachtet, erschienen bei klarem Wetter die Terrassen des Steinbruchs nur als helle, ungeheure Stufen, die aus den Wolken ans Ufer hinabführten. Und hoch oben, irgendwo über dem Scheitel dieser Riesentreppe aus Granit, hoch über den Staubwolken der Sprengungen, den eingesunkenen Dächern des Barackenlagers am Schotterwerk und den Spuren aller Qualen, die am Blinden Ufer des Sees erlitten worden waren, begann die Wildnis:
Mächtiger als alles, was aus Moorer Sicht von der Welt zu sehen war, erhob sich über dem Steinbruch das Gebirge. Jeder Geröllstrom, der aus den Eisregionen herabfloß und sich im Dunst verlor, jede Kluft und von Dohlen umschwärmte Öffnung einer Schlucht führte tiefer in ein Gesteinslabyrinth, in dem sich alles Licht in aschgraue Schatten und blaue Schatten und Schatten in den vielen Farben der anorganischen Natur verwandelte. Auf der Kartenwand der Kommandantur war der über Gipfelzeichen und mäandrierende Höhenlinien hingeschriebene Name des Gebirges rot umrandet: Das Steinerne Meer. Verboten, unwegsam und an seinen Pässen vermint, lag dieses Meer zwischen den Besatzungszonen, ein kahles, unter Gletschern begrabenes Niemandsland.
Wenn die Regenschauer eines atlantischen Tiefs den Blick über den See trübten, waren die Berge mit ihren bis tief in den Sommer überdauernden Schneefeldern manchmal von einer Unwetterfront kaum zu unterscheiden. An solchen Tagen zerrann das Steinerne Meer zu einer konturlosen Barriere aus Felsen, Wolken und Eis – und unauslöschlich in Berings Erinnerung stand an diese Barriere geschrieben:
HIER LIEGEN
ELFTAUSENDNEUNHUNDERTDREIUNDSIEBZIG TOTE
ERSCHLAGEN
VON DEN EINGEBORENEN DIESES LANDES
WILLKOMMEN IN MOOR
Über fünf aufgelassene Abbaustufen des Granitbruchs, über fünf unregelmäßige, monströse Zeilen, hatte Major Elliot diese Inschrift von zwangsverpflichteten Steinmetzen und Maurern hinsetzen, errichten! lassen: Jeden Buchstaben groß wie einen Menschen. Jeden Buchstaben als freistehende, gemauerte Skulptur aus den Trümmern des Barackenlagers am Schotterwerk, aus den Fundamenten der Wachtürme und den Stahlbetonsplittern eines gesprengten Bunkers … So hatte Elliot nicht nur eine aufgegebene Halde des Steinbruchs am See, sondern das ganze Gebirge in ein Denkmal verwandelt.
Natürlich versuchten sich die Bewohner von Moor, Leys und Haag und des ganzen Ufers gegen die Schrift im Steinbruch zu wehren – mit Protestbriefen, Unschuldsbeteuerungen, auch einem dünnen Demonstrationszug über die Seepromenade – und selbst mit Sabotage: Zweimal brachen die Arbeitsgerüste um die Lettern unter angesägten Stangen, und auch die unerträgliche, über eine Länge von fast vierzig Metern hingesetzte Zahl der Toten wurde in einer Nacht wieder unleserlich geschlagen.
Aber Elliot war der Kommandant. Und Elliot war zornig und stark genug, seine Drohung wahr zu machen und für jeden weiteren Sabotageakt Felswände, Hügel oder Häuserzeilen mit neuen und schlimmeren Anklagen beschriften zu lassen. Und so standen die gemauerten Lettern im Steinbruch schließlich groß, roh, weiß gekalkt, weithin sichtbar, standen in Reih und Glied wie Moors verschollene Soldaten, standen wie die Kolonnen der Zwangsarbeiter beim Zählappell, wie die Sieger unter den gehißten Flaggen ihres Triumphes. Und welche Schreckenszahl auch immer sie überlieferten, unbezweifelbar blieb, daß im Geröll und in der von Fichten- und Kiefernwurzeln durchwachsenen Erde am Fuß der Schrift die Toten des Barackenlagers am Schotterwerk lagen.
Elftausendneunhundertdreiundsiebzig: Die beschlagnahmten Sterbebücher des Lagers, endlose Namenslisten in einer Handschrift, die einem Ornament aus Messerklingen glich, hielt Elliot im Tresor der Kommandantur unter Verschluß und ließ sie daraus in der Zeit seines Regimes nur jeweils an den Jahrestagen des Friedensschlusses von Oranienburg hervorholen, das erste Mal aber in jenen Tagen, in denen die Buchstaben im Steinbruch errichtet wurden. Von Militärpolizei bewacht, lagen die Sterbebücher damals eine ganze Woche lang aufgeschlagen in einer Glasvitrine am Dampfersteg zur Schau, und an den Peitschenlampen der Uferpromenade knallten schwarze Fahnen im Wind.
Als am letzten Tag dieser Ausstellung die Pionierkolonne anrückte, das Kreuz von Moor zerschlug und den Bahndamm in einen leeren, nutzlosen Wall zurückzuverwandeln begann, verschloß Berings Mutter ihrem feinhörigen Sohn die Ohren mit Wachs: Der Klang von Ketten und aus ihrer Verankerung gerissenen Schienensträngen hallte weit über das Kaff und sein Ufer hinaus.
Von diesem Geklirr und dem Läuten der Hammerschläge alarmiert, versammelten sich innerhalb einer Stunde Hunderte Menschen am Bahndamm. Und es kamen immer mehr. Bis in so entlegene Dörfer wie Leys oder Haag waren die Rauchsäulen der Scheiterhaufen zu sehen, in denen die geteerten Holzschwellen von Moors wichtigster Verbindung ins Tiefland und zur Welt verbrannten.
Die empörte Menge drohte den Soldaten mit Fäusten und schrie ihnen Fragen zu, Verwünschungen. Jetzt, so kurz vor dem Winter, erfüllten sich die schlimmsten Gerüchte von der Stillegung der Eisenbahnlinie. Stillegung! Moor auf eine Schlammstraße zurückgeworfen! Moor abgeschnitten von der Welt.
Ungerührt rissen die Pioniere Schienenstrang um Schienenstrang aus dem Damm und wuchteten den Schrott auf Waggons, die dann ein Stück weiter vom See fortgezogen wurden. So kroch ein Lastenzug ins Tiefland, der seine Geleise mit sich nahm.
Moors Empörung und Ratlosigkeit schienen den Trupp bloß zu erheitern: Trotz der Kälte streiften einige Soldaten ihre Uniformjacken und Hemden ab wie zu einer sommerlichen Schwerarbeit und stellten so ihre Tätowierungen zur Schau: tintenblaue Adlerköpfe und Vogelschwingen auf Oberarmen und Schultern, blaue Nixen, blaue Totenschädel und gekreuzte Flammenschwerter.
Einer der Tätowierten antwortete auf das Geschrei und Geschimpfe der Menge, indem er zwei Brecheisen zu einer Schere übereinanderschlug und dann in dem schmäler und schmäler werdenden Raum zwischen seinem Trupp und den Uferbewohnern – zu tanzen begann. Er stampfte im Kreis, verfiel in einen jammernden Gesang und tat in einer grotesken Pantomime, als durchschnitten ihm Scherenklingen den Hals. Den Blick unverwandt auf die Zuschauer gerichtet, steigerte er seinen Jammergesang zu einem rhythmischen Geschrei, in dem die Moorer ihre eigene Sprache gebrochen wiedererkannten: Rübeab-Rübeab-Rübeab!
Be-be-ab, Be-be-ab, begannen drei, vier Kameraden des Tänzers zu skandieren und schlugen mit ihren Spitzhacken, Schaufeln und Hämmern den Takt.
Plötzlich flog ein Stein durch die Luft. Und noch einer. Und in der nächsten Sekunde ließ die Wut über diese tätowierten Nackten einen Hagel aus Dammschotter aufschwirren und auf die Soldaten niederprasseln. Aber noch im Augenblick, in dem die ersten Steine aufschlugen, feuerte ein wachhabender Sergeant Warnschüsse aus seiner Maschinenpistole über die Köpfe hinweg.
In der jähen Stille, die dem Nachhall dieser Garbe folgte, waren nur noch die Schritte des Kommandanten zu hören: Major Elliot war von der Plattform eines Waggons gesprungen, hatte den Sergeant zur Seite gestoßen, trat nun zwischen die verstummte Menge und die zum Gegenangriff bereiten Tätowierten und begann zu brüllen. Schrie – und schrie etwas von einem Anfang, von einem ersten Schritt … und wieder und wieder ein seltsam klingendes Wort. Es war ein nie gehörter Name: Stellamour.
5Stellamour oder der Friede von Oranienburg
Bering war sieben, als er seine Vogelstimmen verlor. Es geschah während eines staubigen Schauspiels, das Major Elliot Stellamour’s Party nannte und viermal jährlich im Steinbruch abhalten ließ: Zwischen Granitblöcken und in den Ruinen des Barackenlagers am Schotterwerk sollte Moor lernen, was die Hitze eines Hochsommertages oder der Frost eines Januarmorgens für einen Gefangenen bedeutet, der die Jahreszeiten unter freiem Himmel ertragen muß.
Es war an einem Augusttag, an einem Tag wie in der Wüste, als Berings Vater im Verlauf einer solchen Party unter einer zentnerschweren Traglast zu Fall kam und dann auf dem Rücken lag und vergeblich versuchte, wieder auf die Beine zu kommen.
Der Anblick seines strampelnden Vaters brachte den Siebenjährigen so sehr zum Lachen, daß er sich schließlich wie in einem hysterischen Spiel neben diesem großen Käfer am Rand eines Grundwassertümpels wand und kreischte und um sich schlug, bis ihm ein Wachsoldat mit einem Apfel den Mund stopfte.
Wann immer der Sohn des Schmieds nach diesem Lachkrampf Zuflucht in Hühnerställen oder im Schatten auffliegender Vogelschwärme suchte, pfiff, gurrte und krächzte er nur noch wie ein Mensch, der ein Huhn, eine Drossel oder eine Taube bloß nachzuahmen versucht – und war doch nie wieder die Vogelstimme selbst. Was ihm aber auch nach diesem Verlust blieb, war die Fähigkeit, noch die seltensten Vögel und Irrgäste der Seeregion an einem einzigen Schrei zu erkennen: Alpensegler, Eisvogel, Elfenbeinmöwe und Kornweihe, Seidenreiher, Singschwan, Trauerbachstelze, Wellenläufer, Zwergammer … – mit ihren Namen füllte Bering in seinen Schuljahren die leergebliebenen Spalten eines ausgedienten Auftragsbuchs der Schmiede.
Stellamours Bildnis, das Porträt eines lächelnden, kahlen Mannes, prangte damals in allen Größen an Plakatwänden, Hoftoren und manchmal auch als haushohes Wandgemälde an der Feuermauer einer ausgebrannten Fabrik oder Kaserne:
Der Richter und Gelehrte Lyndon Porter Stellamour im Lehnstuhl vor einer Bücherwand in heiteren Farben …
Stellamour im weißen Smoking zwischen den Säulen des Capitols in Washington …
und Stellamour im Buschhemd und mit beiden Armen aus dem Strahlenkranz der amerikanischen Freiheitsstatue winkend …
Stella-
Stella-
Stellamour
Hoher Richter Stellamour
Aus Poughkeepsie im blühenden Empire State
Empire State New York …
wurde damals als Refrain einer seltsamen Hymne – halb Schlager, halb Kinderlied – bei Flaggenparaden und Festversammlungen von gemischten Chören gesungen. In ungeheizten, zugigen Schulzimmern mühsam buchstabiert, dann mit Kreide auf Schiefertafeln gekratzt und schließlich mit Füllhaltern auf holziges Papier mehr graviert als geschrieben, war Stellamours Name längst unauslöschlich im Gedächtnis einer neuen Generation bewahrt. Selbst über den Toreinfahrten wiederaufgebauter Wassermühlen und neugegründeter Rübenkompanien wehten Transparente mit aufgenähten Sprüchen des Richters:
Auf unseren Feldern wächst die Zukunft
Aber auch:
Du sollst nicht töten
Seit den Tagen, in denen Major Elliots Pioniere die Bahnlinie ins Tiefland zerschlagen hatten und Moor aus den Fahrplänen verschwunden war, hatten die Bewohner der Besatzungszonen in einem langen Prozeß der Demontage und Verwüstung allmählich begriffen, begreifen müssen, daß Lyndon Porter Stellamour nicht bloß irgendein neuer Name aus dem Heer und Regime der Sieger war, sondern der einzige und wahre Name der Vergeltung.
Moor erinnerte sich noch gut und selbst nach all den Jahren noch immer nicht ohne Empörung an den Tag, an dem Elliot die Uferdörfer zum erstenmal in geschlossenen Kolonnen in den Steinbruch befohlen hatte: Nicht allein diese verfluchte Schrift, deren Wortlaut längst die Runde um den See gemacht hatte, sollte an diesem Tag enthüllt werden, sondern vor allem – so hieß es zumindest auf den Flugblättern und Plakaten dieser ersten Party – Stellamours Friedensplan. (Es hieß auch, daß Anwesenheitslisten geführt würden und jedem, der diesem Fest ohne triftigen Grund fernbliebe, die Strafen der Militärgerichtsbarkeit drohten.)
Also kroch zur befohlenen Stunde eine vielgliedrige, ebenso haßerfüllte wie eingeschüchterte Prozession auf den Steinbruch zu: Angeführt von Sekretären, die von der Armee an die Stelle der alten, in Erziehungslagern verschwundenen Bürgermeister und Gemeinderäte gesetzt worden waren, wanderten die Bewohner des Seeufers über den toten Bahndamm, holperten mit Pferdefuhrwerken und Ochsengespannen über die schmale Schotterstraße am Fuß des Damms oder ruderten in Zillen und brüchigen Kähnen über den See. Es war eine murmelnde, gedemütigte Gesellschaft, in der die Mutigsten gerade noch hinter vorgehaltener Hand zu flüstern wagten, der Kommandant sei nun endgültig verrückt geworden.
Kein Zweifel, so herrschte nur ein Verrückter: Die schwarzen Mauern des Barackenlagers am Schotterwerk, die zerrissenen Stacheldrahtspiralen und rostigen Panzersperren waren wie zu einem Gartenfest geschmückt. Von Förderbändern und geknickten Rohrleitungen pendelten Lampions, bemooste Granitblöcke trugen Gebinde aus Metallblumen und Eichenlaubkränze, die der Schmied in den Tagen davor aus einer Rolle Walzblech hatte schneiden müssen, und von einem aus dem Grundwasser ragenden Kranarm hingen Girlanden.
»Krepieren soll er«, sagte der Schmied, während er sein Boot an der Mole des Steinbruchs festmachte, und spuckte ins Wasser.
»Behüte uns vor ihm«, hauchte Berings Mutter und küßte ein Medaillon der Schwarzen Madonna.
Wo immer Elliot an diesem Tag in seinem Jeep oder am Bug eines Patrouillenbootes erschien, wurden ihm böse Zeichen in den Rücken gemacht. Aber als die Dämmerung die Lampions zum Leuchten brachte und auf den fünf beschrifteten Stufen des Steinbruchs mannshohe Fackeln entzündet wurden, standen die Dörfer doch in langen, schweigenden Reihen und starrten auf die verhüllte Schrift, starrten auf grellbunte Stoffbahnen in den Farben des Kriegs:
Zusammengenäht aus Hunderten Tüchern und Fetzen, Uniformhemden, rußigen Tarnplanen und Moors alten Fahnen, blähten sich diese Bahnen im Wind und sprangen und rollten wie Brecher über die gemauerten Lettern hinweg.
Hier liegen elftausendneunhundertdreiundsiebzig Tote. Für Bering, der in dieser Stunde unter den Leuten von Moor stand und jeden Akt der Enthüllung begeistert verfolgte und nichts wußte vom Sinn der Schrift, sahen die rollenden Stoffbahnen aus, als irrten darunter Menschen umher und suchten mit erhobenen Armen einen Weg ins Freie, einen Weg zurück in die Welt.
Aber dann war es doch nur der Kommandant, der vor die Verhüllung und in den Lichtkegel eines Scheinwerfers trat und wortlos ein Zeichen gab. Jetzt sanken die Tücher in den nassen Sand und in die Pfützen und schlugen dort noch eine Zeitlang nach, bis sie vollgesogen endlich still lagen.
Die Kolonnen schwiegen. Es waren mehr als dreitausend Versammelte, aber zu hören waren nur der See, die Windstöße, das Prasseln der Fackeln. Weiß gekalkt, weithin sichtbar, ungeheuer, schwebte die Schrift über den Köpfen und warf taumelnde, wirre Schatten in den Kessel des Steinbruchs.
Der Kommandant schlenderte vor den gemauerten Buchstaben des WILLKOMMEN auf und ab, vom L über das K zum O und M und wieder zurück, und der Lichtkegel folgte ihm. Plötzlich wandte er sich den Kolonnen zu, schwenkte einige trichterförmig zusammengerollte Papierblätter in seiner Faust, als wollte er Fliegen verscheuchen, und schrie: »Zurück! Zurück mit euch! Zurück in die Steinzeit!«
Verständnislos, müde vom langen Weg und vom langen Stehen, starrten die Kolonnen zu der gestikulierenden Gestalt empor und begriffen nicht, daß, was ihnen mit Elliots Stimme aus einem Dutzend an Ästen und Masten festgebundenen Lautsprechern entgegenplärrte, Stellamours Botschaft war.
Jetzt strich Elliot seine Blätter glatt, die sich, kaum losgelassen, immer wieder einrollten, hob sie endlich dicht vor seine Augen und begann, die Paragraphen eines Friedensplanes mit einer solchen Geschwindigkeit abzulesen, daß die Kolonnen nur Satzfetzen, Fremdworte – vor allem aber die Beschimpfungen und Kommentare verstanden, mit denen Elliot seinen förmlichen Ton immer wieder unterbrach:
Gesindel! … Feldarbeit … Heuschober statt Bunker … knackte und rauschte es aus den Lautsprechern … keine Fabriken mehr, keine Turbinen und Eisenbahnen, keine Stahlwerke … Armeen von Hirten und Bauern … Erziehung und Verwandlungen: aus Kriegstreibern Sautreiber und Spargelstecher! Und Jaucheträger aus den Generälen … zurück auf die Felder! … und Hafer und Gerste zwischen den Ruinen der Industrie … Krautköpfe, Misthaufen … und auf den Trassen eurer Autobahn dampfen die Kuhfladen und wachsen im nächsten Frühjahr Kartoffeln …!
Elliot brach seine Rede nach einer dem Paragraph 22 folgenden Suada ebenso plötzlich und wütend ab, wie er sie begonnen hatte, zerknüllte die Blätter des Friedensplanes und warf sie dem Nächststehenden, es war seine Ordonnanz, vor die Füße.
An diesem Abend beschlossen weder Blechmusik noch Hymnen die Versammlung. Die Kolonnen mußten in der Stille stehen und stehen, bis auch die letzte Fackel niedergebrannt war und die gekalkte Schrift fahl in die Dunkelheit ragte. Erst dann entließ der Kommandant die Dörfer hinaus in die Nacht.
In der folgenden Woche wurde das Kraftwerk am Fluß stillgelegt; die Turbinen, auch die Transformatoren des Umspannwerks, rollten gemäß Paragraph 9 des Friedensplanes auf russischen Armeelastwagen davon. Aber die schwerbewaffneten Posten der Demontage versahen diesmal leichten Dienst: Aus Moor kam kein Protest.
Wer keinen Dieselgenerator im Schuppen oder Keller seines Hofes betrieb, der zündete an den Abenden wieder Petroleumlampen und Kerzen an. Die Straßen und Gassen wurden finster zur Nacht. Nur auf dem Appellplatz und um das Schwarze Brett der Kommandantur flackerten unruhige Glühbirnenkränze.
Eines Morgens stapften zwei Soldaten durch den Schnee und den Hügel zur Schmiede hinauf und forderten in Stellamours Namen das Schweißgerät zurück. Nicht einmal Berings Mutter erfuhr, womit der Schmied die beiden bestach, damit sie schließlich mit einem Stück Schrott wieder abzogen und das Gerät in einem Kellerversteck des Hauses zurückließen.
Der Schmied hockte in diesen Tagen oft vor seinem verstockten, vogelnärrischen Sohn und sprach ihm die Namen von Werkzeugen vor, wurde aber neben seiner Rosenkranz um Rosenkranz betenden Frau immer einsilbiger und fand längst auch im Gasthaus am Dampfersteg keine Freunde mehr.
Unaufhaltsam glitt Moor durch die Jahre zurück. Die Schaufenster des Kolonialwarenladens und der Parfümerie erloschen. Um den See wurde es still: Motoren, die nicht beschlagnahmt und davongeschafft worden waren, verstaubten. Treibstoff war so kostbar wie Zimt und Orangen.
Allein im Umkreis von privaten Offiziersquartieren und Kasernen, in der warmen Nähe der Armee, war immer Licht genug, spielten in den Samstagnächten Bands und Jukeboxes an allen Tagen und herrschte an nichts Mangel. Und doch war schon im Lauf eines einzigen Jahres zu sehen, daß die rückwärts gleitende Zeit selbst in diesen Reservaten einer entschwindenden Gegenwart Spuren hinterließ: Die Mannschaftsstärken nahmen ab. Zug um Zug wurde ins Tiefland kommandiert. Zurück blieben kalte Häuser und Soldaten, die ihre Wachsamkeit verloren: Sie duldeten einen armseligen Schleichhandel, der einen armseligen Schwarzmarkt belieferte; sie sahen manchmal über gefälschte Stempel auf Pässen und Passierscheinen hinweg und sahen teilnahmslos zu, als die ersten Auswanderer die Kaffs verließen. Aber was auch geschah, stets lächelte Stellamours Antlitz von den Wänden der Amtszimmer, von Litfaßsäulen und Plakaten herab, das Bildnis des kahlen und gerechten Mannes.
Major Elliot allerdings blieb unerbittlich. Die Lettern der Großen Schrift mußten nach jeder Schneeschmelze frisch gekalkt werden, und immer noch viermal im Jahr, jeweils im Oktober, im Januar, im April und im August, wurden die Uferdörfer zu Stellamour’s Party in den Steinbruch befohlen und standen in langen Reihen zwischen Grundwassertümpeln und turmhohen Wänden aus grünem Granit. Anstatt den Dingen ihren Lauf und die Schrecken der Kriegsjahre allmählich blaß und undeutlich werden zu lassen, erfand Elliot für diese Parties immer neue Rituale der Erinnerung. Dabei schien der Kommandant auch selbst jener Vergangenheit verfallen zu sein, an die er immer und immer wieder zu rühren befahl.
Während seiner Sprechstunden saß Elliot wie ein Buchhalter des Feuers zwischen Stapeln versengter oder angekohlter Aktenordner und Kanzleibücher, und nicht nur jeder Bittsteller oder Beschwerdeführer, sondern mittlerweile ganz Moor wußte, daß dies die aus der Glut geretteten und beschlagnahmten Aufzeichnungen der Zwangsarbeit waren, Namenslisten, Zahlenkolonnen, Kubaturen, Strafregister, schwärzliches Papier, das nichts anderes enthielt als die Geschichte des Barackenlagers am Schotterwerk.
Im Januar jenes Jahres, in dem Bering seine Vogelstimmen verlieren sollte, entdeckte Elliot unter diesen Akten eine Mappe mit Fotografien. Es waren vom Löschwasser gefleckte Momentaufnahmen der Tortur des Lagerlebens, Häftlinge in gestreiften Drillichanzügen, Häftlinge im Steinbruch, Häftlinge strammstehend vor ihren Baracken … Und über diesem Album erfand Elliot eine Pflicht, die ihn weit über die Grenzen seines Kommandobereichs hinaus unvergeßlich machte:
Er begann, die Bilder als Vorlagen für gespenstische Massenszenen zu nehmen, die er im Verlauf einer Party von den Bewohnern des Seeufers nachstellen – und von einem Regimentsfotografen festhalten ließ. Die Bilder mußten sich gleichen. Gemäß den Häftlingsklassen, die Elliot in den geretteten Akten verbucht fand, bestand er dabei auch auf einer wirklichkeitsgetreuen Kostümierung und befahl den Statisten aus Moor, sich als Juden, als Kriegsgefangene, Zigeuner, Kommunisten oder Rassenschänder zu verkleiden.
Kostümiert als die Opfer jener geschlagenen Herrschaft, für die Moors Männer in den Untergang gezogen waren, mußten die Uferbewohner schon zur nächsten Party in gestreiften Drillichanzügen mit aufgenähten Nationalitätsabzeichen, Erkennungswinkeln und Davidsternen vor imaginären Entlausungsstationen Schlange stehen, mußten als polnische Fremdarbeiter oder ungarische Juden vor einem ungeheuren Granitblock mit Hämmern, Keilen und Brechstangen posieren – und mußten vor den Grundmauern der zerstörten Baracken zu ebensolchen Zählappellen antreten, wie Elliot sie in seinem Album abgebildet sah.
Aber Elliot war nicht grausam. Er bestand nicht darauf, daß seine Statisten wie die Gestalten auf einem der stockfleckigen Fotos halbnackt im Schnee standen, sondern bot für die Dauer der Pose sogar Decken und ausgediente Militärmäntel an; Kinder und Alte durften während des Arrangements in Zelte. Allein die Stunden des Appells, die ungeheuerliche, eisige, unerträgliche Zeit, die über dem Plärren von Kommandos, von Nummern und Namen verstrich, diese Ewigkeit, blieb auch jetzt keinem der Angetretenen erspart. Über der Nachstellung dieser Szenen vergingen die Parties im Januar und im April.
Zum Sommerfest, am Tag, an dem Berings Vater schließlich wie ein Käfer auf dem Rücken lag und strampelte, befahl der Kommandant die Erinnerung an ein Bild, das an seinem unteren, weiß gezackten Rand auch einen mit Bleistift geschriebenen Titel trug: Die Stiege.
Auf dem Foto waren Hunderte und Aberhunderte gekrümmter Rücken zu sehen, ein langer Zug von Häftlingen, auf jedem Rücken eine hölzerne Trage, auf jeder Trage ein großer, zum Quader gehauener Stein.
Die Häftlinge schleppten ihre Last in Marschordnung eine breite, in den Fels geschlagene Treppe hinauf, die von der Sohle des Steinbruchs über vier Abbauebenen bis zu seinem im Nebel verschwindenden Rand emporführte. Diese Stiege, die den Krieg, die Befreiung und Zerstörung des Lagers und auch die ersten Jahre des Friedens unbeschadet überstanden hatte, war so steil und unregelmäßig, daß sie auch ohne Last nur mit Mühe zu überwinden war.
Moor kannte diese Treppe gut. Denn obwohl es in den ersten Verhören unter Elliots Kommando zu den am heftigsten geleugneten Tatsachen gehörte, wußte mittlerweile doch jeder am See, daß die meisten der Toten im Massengrab am Fuß der Großen Schrift auf dieser Treppe gestorben waren: erschlagen von der eigenen Last, gestorben an Erschöpfung, an den Schlägen, Tritten und unter den Schüssen der Aufseher. Wehe, wer auf dieser Treppe gestürzt und auch nur einen Herzschlag lang liegengeblieben war.
Aber Elliot war nicht grausam. Elliot verlangte auch diesmal nur den äußeren Schein und zwang keinen seiner Statisten, einen der echten, zentnerschweren Steinquader, die wie Denkmäler ausgestandener Todesqualen immer noch am Fuß der Treppe verstreut lagen, auf sein Traggestell zu wuchten. Elliot wollte nur, daß sich die Bilder glichen und bestand nicht auf dem unerträglichen Gewicht der Wirklichkeit.
Wer immer es wollte, durfte also mit dem Einverständnis des Kommandanten Attrappen tragen, aus Pappmaché, Karton oder zusammengekleisterten Lumpen bloß nachgebildete Steine, ja, Elliot duldete auch noch leichteres und federleichtes Material! – zu Steinen gefaltetes Zeitungspapier, steingraue Kissen …
Nur die Stiege war so steil, so breit und lang wie auf dem Bild. Und die Hitze war groß.
Es waren der Schmied von Moor und noch zwei andere, die an diesem Sommertag zu stolz oder zu verstockt blieben, um Erleichterungen anzunehmen und ihre Last bloß vorzutäuschen.
Als Elliot das Kommando zum Anfangen gab, wälzte der Schmied einen der großen Steinquader auf seine Trage, band ihn fest, nahm das Gewicht auf den Rücken, stand taumelnd auf und stieg mit der Kolonne wohl dreißig oder mehr Stufen empor. Und wurde dann doch langsamer und langsamer, bis das entsetzliche Gewicht ihn nach hinten zog, ihn auf die Fersen zwang und in den leeren Raum, den die Nachsteigenden schon umgingen, stürzen ließ.