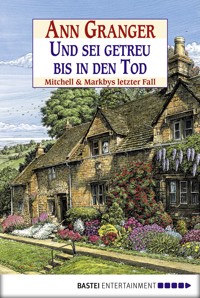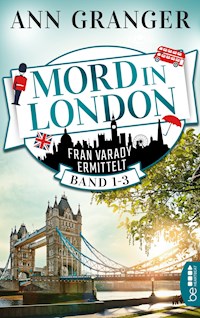
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Britische-Cosy-Krimis
- Sprache: Deutsch
Eine Wohlfühl-Krimi-Reihe mit einer starken und ungewöhnlichen Protagonistin: Ann Granger bietet mit der Fran-Varady-Serie Spannung mit sympathischen Figuren und typisch englischem Flair.
Nur der Tod ist ohne Makel
Die Sterne stehen nicht günstig für die angehende Schauspielerin Fran Varady: Sie hat keinen Job, London ist teuer und demnächst soll sie auch noch ihre Wohnung verlieren. Zu allem Überfluss findet sie eines Abends ihre Mitbewohnerin Terry erhängt in ihrem Zimmer. Fran beginnt Nachforschungen anzustellen und gerät selbst in tödliche Gefahr ...
Denn umsonst ist nur der Tod
Als Fran Varady dem Obdachlosen Albie einen Kaffee spendiert, erzählt der ihr, eine Entführung beobachtet zu haben. Die Polizei nimmt Albie nicht ernst, aber Teilzeitschnüfflerin Fran beschließt, der Sache nachzugehen. Wenig später wird der Mann tot aufgefunden ...
Die wahren Bilder seiner Furcht
Um sich über Wasser zu halten, jobbt Fran Varady in einem kleinen Eckladen in London. Eines Tages stürmt ein aufgeregter Kunde in den Shop und bittet sie, die Toilette benutzen zu dürfen. Stunden später wird der Mann dort tot aufgefunden - ermordet. Er hat eine mysteriöse Filmrolle bei sich und eine kurze Notiz mit der Bitte um ein Treffen mit Fran. Diese beginnt wieder einmal auf eigene Faust zu ermitteln und gerät schon bald in Teufels Küche ...
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1422
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Reihe
Über die Autorin
Titel
Impressum
Band 1 – Nur der Tod ist ohne Makel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Fußnoten
Band 2 – Denn umsonst ist nur der Tod
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Band 3 – Die wahren Bilder seiner Furcht
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Über die Reihe
Fran Varady ist eine junge mittellose Schauspielerin in London. Eigentlich ist sie auf der Suche nach einem Job – stattdessen gerät sie immer wieder in Verbrechen hinein. Daher ermittelt sie nebenbei als Privatdetektivin ohne Lizenz und klärt mit ihrer optimistischen und zupackenden Art eine ganze Reihe von Mordfällen auf.
Band 1 – Nur der Tod ist ohne Makel
Die Sterne stehen nicht günstig für die angehende Schauspielerin Fran Varady: kein Job, das Geld ist knapp, London teuer und demnächst soll sie auch noch ihre Wohnung verlieren. Zu allem Überfluss findet sie eines Abends ihre Mitbewohnerin Terry erhängt in ihrem Zimmer. Die schöne, unnahbare Terry war nicht sehr beliebt in der Hausgemeinschaft, doch ihr Tod schockiert alle. Fran beginnt Nachforschungen anzustellen und gerät bald selbst in tödliche Gefahr …
Band 2 – Denn umsonst ist nur der Tod
Als Fran Varady dem Obdachlosen Albie einen Kaffee spendiert, ahnt sie noch nicht, dass sie sich damit eine Menge Ärger einhandelt. Denn der dankbare Mann erzählt ihr, eine Entführung beobachtet zu haben. Die Polizei nimmt den Obdachlosen nicht ernst, aber Teilzeitschnüfflerin Fran beschließt, der Sache nachzugehen. Wenig später wird der Mann tot aufgefunden, und Fran steht am Anfang eines gefährlichen Rätsels …
Band 3 – Die wahren Bilder seiner Furcht
Um sich über Wasser zu halten, jobbt Fran Varady in einem kleinen Eckladen in London. Eines Tages stürmt ein aufgeregter Kunde in den Shop und bittet sie, die Toilette benutzen zu dürfen. Stunden später wird der Mann dort tot aufgefunden – ermordet. Er hat eine mysteriöse Filmrolle bei sich und eine kurze Notiz mit der Bitte um ein Treffen mit Fran. Diese beginnt wieder einmal auf eigene Faust zu ermitteln und gerät schon bald in Teufels Küche …
Über die Autorin
Ann Granger war früher im diplomatischen Dienst tätig. Sie hat zwei Söhne und lebt heute mit ihrem Mann in der Nähe von Oxford. Bestsellerruhm erlangte sie mit der Mitchell-und-Markby-Reihe und den Fran-Varady-Krimis.
Weitere Reihen der Autorin:
Mitchell & Markby
Martin & Ross
Jessica Campbell
ANN GRANGER
MORD INLONDON
FRAN VARADY ERMITTELTBAND 1-3
Aus dem Englischen von Axel Merz
beTHRILLED
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe von »Nur der Tod ist ohne Makel«:
Copyright © 1997 by Ann Granger, Titel der englischen Originalausgabe: »Asking for Trouble«
Für die deutschsprachige Ausgabe: Copyright © 2002/2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Für die Originalausgabe von »Denn umsonst ist nur der Tod«:
Copyright © 1997 by Ann Granger, Titel der englischen Originalausgabe: »Keeping bad Company«
Für die deutschsprachige Ausgabe: Copyright © 2003/2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Für die Originalausgabe von »Die wahren Bilder seiner Furcht«:
Copyright © 1998 by Ann Granger, Titel der englischen Originalausgabe: »Running scared«
Für die deutschsprachige Ausgabe: Copyright © 2005/2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Für diese Ausgabe:Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven von © kukurikov/Getty Images; © audioundwerbung/Getty Images; © Sasiistock/Getty Images;
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-0342-0
be-ebooks.de
lesejury.de
Band 1Nur der Todist ohne Makel
Kapitel 1
Der Mann vom städtischen Wohnungsamt kam am Montagmorgen. Er stellte uns Vorladungen zu, jedem eine eigene.
»Alles genau nach Vorschrift!«, verkündete er mit einer Stimme, die schrill klang vor Nervosität. Er war nicht besonders alt, besaß lockiges Haar und ein rundliches Puttengesicht und gab im Übrigen sein Bestes, um Autorität auszustrahlen, doch man bemerkte seine aufkeimende Panik.
Ich kann bis heute nicht glauben, dass er wirklich Angst vor uns hatte. Sicher, wir waren in der Überzahl, aber wir waren für ihn keine Fremden. Er und eine Anzahl seiner Kollegen waren schon früher hier gewesen. Wir hatten sie damals immer wieder ausgesperrt, sodass sie zum Fenster heraufschreien mussten, um mit uns zu reden. Doch an diesem Tag hatten wir ihn reingelassen. Es war der Tag der Entscheidung. Wir wussten es, und er wusste, dass wir es wussten. Geistreiche Unterhaltungen zwischen Bürgersteig und Fenstersims waren nicht länger angebracht. Es war ein eigenartig wortkarges Ende eines sehr lang geführten Disputs.
Dennoch beobachtete er uns misstrauisch, als fürchtete er, wir könnten die Vorladungen in einem letzten Protest zerreißen. Squib nahm seine aus dem Umschlag und drehte sie um, als erwartete er, dass auf der Rückseite etwas geschrieben stünde. Terry schob ihre achtlos in die Tasche ihrer Strickjacke. Nev sah einen Augenblick lang drein, als wollte er sich weigern, die Vorladung entgegenzunehmen, doch schließlich resignierte er. Ich nahm meine und sagte: »Danke für gar nichts.«
Der Beamte räusperte sich. »Ich werde morgen bei Gericht sein, zusammen mit dem Anwalt der Gemeinde, und einen Antrag auf sofortige Räumung stellen. Wir gehen davon aus, dass er genehmigt wird. Wir sind bereit, Ihnen Zeit bis Freitag einzuräumen, um alternative Wohnmöglichkeiten zu finden. Doch die Angelegenheit ist nun vor Gericht und geht ihren Weg. Es hat also keinen Zweck, mit mir zu diskutieren! Diskutieren Sie morgen mit dem Richter, wenn Sie wollen. Aber es wird Ihnen nichts nützen.«
Er war immer noch in der Defensive, auch wenn sich niemand die Mühe machte, ihm zu antworten. Wir hatten von Anfang an gewusst, dass wir verlieren würden. Trotzdem, das Bewusstsein, dass wir draußen waren, klumpte uns die Mägen zusammen. Ich wandte mich ab und starrte aus dem Fenster, bis ich meine Gesichtsmuskeln wieder unter Kontrolle hatte.
Es war einer von jenen schiefergrauen Vormittagen, die aussehen, als würde es jeden Augenblick anfangen zu regnen, auch wenn der Regen dann noch bis zum Abend auf sich warten lässt. Eine dichte Wolkendecke drückte die Autoabgase und all die anderen Gerüche hinunter in die Straßen. Man konnte sogar den Geruch von gebratenem Fleisch und Zwiebeln aus der Wild West Hamburger Bar wahrnehmen, die zwei Straßen weiter lag.
Ich hatte mich an jenem Morgen nicht besonders gut gefühlt, bereits vor dem Eintreffen unseres Besuchers, denn ich hatte am vorangegangen Freitag meinen Job verloren. Der Manager hatte herausgefunden, dass meine Adresse »rechtswidrig« war, und das war alles. »Rechtswidrig« bedeutete, dass ich gegenwärtig in einem besetzten Haus wohnte.
Obwohl unsere Besetzung genau genommen illegal war, hatte niemand uns daran gehindert, in ein leer stehendes – und allem äußeren Anschein nach besitzerloses – Haus zu ziehen, und inzwischen wohnten wir so lange dort, dass wir ein Gefühl von Dauerhaftigkeit entwickelt hatten. Mehr noch, wir hatten ein Ziel. Wir nannten uns die Jubilee Street Creative Artists’ Commune, auch wenn keine unserer Arbeiten geeignet gewesen wäre, eine Subvention aus städtischen Mitteln oder der Nationalen Lotterie zu gewinnen. Doch zwischen dem endgültigen Absturz in die Tiefe und der Eingliederung in die Normalität planten wir gewaltige Karrieren, geboren in der Anonymität der Jubilee Street, ganz gleich, wie unsere individuellen Geschicke aussehen mochten. Wir täuschten uns selbst auf jede nur erdenkliche Weise. Träume schlagen die Wirklichkeit eben jeden Tag aufs Neue.
Übrigens muss ich Squib aus unserem großen Karriere-Szenario ausklammern. Squib lebte konsequent von einem Tag zum anderen und trug nicht einmal den Ansatz eines Plans mit sich herum. Jedenfalls nichts, wovon irgendeiner von uns je gehört hätte.
Nev hatte Pläne. Sie kamen daher in Form einer zwanzigseitigen Synopse für seinen großen Roman, der in seiner Länge wohl Krieg und Frieden Konkurrenz machen würde. Tag für Tag schrieb er unermüdlich auf einer alten mechanischen W.-H.-Smith-Schreibmaschine vor sich hin. Noch heute frage ich mich manchmal, ob er seinen Roman je beendet hat.
Squib war Pflastermaler. Er konnte alles kopieren. Manche werden sagen, dass seine Malerei nicht das Schöpferische zur Kunst besitze, weil er nichts Eigenes erschaffe, doch sie haben nicht gesehen, was er mit einer Kiste voller Kreide und ein paar sauberen Platten auf einem Gehweg alles bewerkstelligen konnte. Alte Meister, von brauner Firnis und Zeit zu Museumsstücken degradiert, erwachten unter Squibs geschickten Händen zu neuem Leben. Sie sprachen so beredt zu den Passanten, dass manche wegen der Lebendigkeit der Kreidegesichter unter ihren Füßen sichtlich aus der Fassung gerieten. Einmal kam ein Kunstkritiker vorbei und begeisterte sich derart für Squibs Arbeiten, dass er davon sprach, ihn der ganzen Welt vorzustellen, ein Zwischenfall, der Squib richtiggehend peinlich war. Die Vorstellung, vom Establishment vereinnahmt zu werden, versetzte Squib in derartige Panik, dass er sich mit seiner Schachtel Kreide davonstahl und eine Zeit lang in der Provinz das Pflaster bemalte, bevor er es für sicher genug hielt, nach London zurückzukehren.
Was mich anging, ich klammerte mich noch immer an meinen Kindheitstraum, Schauspielerin zu werden. Das Leben war mir irgendwie in den Weg gekommen. Ich war am College in einem Kurs in Dramatik durchgefallen. Seither hatte sich mir die Rolle des Bühnen- und Bildschirmstars, abgesehen von einigen Auftritten beim Straßentheater, irgendwie entzogen. Ich hoffte noch immer, es eines Tages zu schaffen. Kurzfristig war ich voll und ganz damit beschäftigt, mich über Wasser zu halten. Und ein Auge auf die beiden anderen zu haben.
Wir drei waren als Erste in das Haus gezogen. Kurze Zeit später hatte sich Declan zu uns gesellt, ein kleiner drahtiger Bursche mit wirrem, schulterlangem Haar und einem gutmütigen, elfenhaften Gesicht. Er war an beiden Armen stark tätowiert; auf einem prangte eine Furcht erweckende Schlange, auf dem anderen ein Herz Jesu. Er erinnerte sich daran, wie er sich das Herz hatte eintätowieren lassen, doch wie die Schlange auf seinen Arm gekommen war, wusste er angeblich nicht mehr. Er sei eines Morgens mit einem gewaltigen Kater aufgewacht, und da wäre sie gewesen und an seinem Arm emporgekrochen. »Ich dachte im ersten Augenblick, ich hätte ein Delirium tremens«, sagte er. Manchmal streckte er seinen Arm vor sich aus und betrachtete die Schlange nachdenklich. Ich glaube, es beschäftigte ihn wirklich.
Declan war als Rockmusiker ohne Band zu uns gestoßen. Sein früherer Lead-Gitarrist war beim Proben in einem Kirchensaal durch einen elektrischen Schlag gestorben.
»Die Haare standen dem armen Kerl zu Berge«, erzählte Declan in trauriger Verwunderung. »Gott sei seiner Seele gnädig, aber es war ein verdammt lustiger Anblick. Bis wir merkten, dass er tot war, versteht ihr? Das machte uns schlagartig nüchtern. Wir standen herum und versuchten, uns an Wiederbelebungsmaßnahmen zu erinnern, während wir auf den Notarzt warteten. Obwohl wir sehen konnten, dass er hinüber war. Zu allem Übel war auch noch der Verstärker durchgebrannt und wir hatten nicht die Kohle, um einen neuen zu kaufen. Ausgerechnet in diesem Augenblick, man soll es nicht glauben, kam irgend so ein Spinner hereingerannt und brüllte uns an, dass im ganzen Haus die Sicherungen rausgeflogen wären. Wir wurden so stinkwütend, weil er keinen Respekt für den Toten zeigte, dass der Drummer und ich den Kerl packten und aus dem Fenster warfen. Es war kein tiefer Sturz, und er konnte den Sturz abfangen. Trotzdem wurden wir wegen tätlichem Angriff verknackt.«
Declan spielte Bass, und ein Bassist braucht eine Gruppe.
Ein wenig später waren Lucy und ihre beiden Kinder eingezogen. Lucy war keine Künstlerin. Sie war vor ihrem gewalttätigen Ehemann weggerannt und hatte vorübergehend in einem heruntergekommenen Frauenhaus ein paar Straßen weiter Zuflucht gefunden. Ich hatte mich eines Tages mit ihr unterhalten, während ich bei Patel’s, dem Gemüseladen an der Ecke, bediente. Sie kaufte Karotten für die Kinder zum Knabbern. Rohe Karotten stecken voller Vitamin C, sind frei von der Sorte Säuren, die Löcher in den Zahnschmelz fressen, und obendrein billiger als die meisten anderen Früchte.
Lucy suchte eine Wohnung, in der sie bleiben konnte, und einen Job. Das Frauenhaus war überfüllt, und sie hatte das Gefühl, dass sie es dort nicht mehr länger aushielte. Die Handfläche ihrer linken Hand war schlimm vernarbt; ihr Mann hatte ihre Hand während eines Streits auf eine rot glühende Herdplatte gedrückt, weil sein Essen nicht rechtzeitig fertig gewesen war. Die Narben hatten die Beweglichkeit ihrer Hand eingeschränkt, und sie waren hässlich. Lucy wusste es und erzählte jedem, der danach fragte, dass sie sich selbst verbrannt habe und dass es ein Unfall gewesen sei. Eines Abends, nachdem sie bei uns eingezogen war, hatte sie mir die Wahrheit gestanden. Ich hatte mich erstaunt gezeigt, dass sie so lange bei ihm geblieben war und so viele Misshandlungen erduldet hatte.
»Es ist nicht einfach, wegzugehen, wenn man zwei Kinder hat«, hatte sie geantwortet.
Sie war erst gegangen, nachdem er angefangen hatte, die Kinder ebenfalls zu schlagen. Sie sagte, er habe ein Problem mit Alkohol. Meiner Meinung nach hatte er ein Problem mit dem Kopf. Doch Lucys Geschichte hatte mir wieder einmal gezeigt – falls ich da je auch nur den leisesten Zweifel gehabt hätte –, wie wertvoll meine Unabhängigkeit war.
Was das Haus angeht, es stand allein am Ende einer aus roten Ziegelsteinen erbauten Reihenhaussiedlung. Es war älter als die übrigen Häuser, unserer Meinung nach frühe viktorianische Epoche, und es musste einstmals in einem großen Garten gelegen haben. Vom Garten war nicht mehr viel übrig, ein verwilderter Dschungel hinter dem Haus und ein von Unrat übersäter schmaler Streifen zwischen der Hausfront und dem Bürgersteig. Es gab noch Löcher, wo einstmals die Pfosten eines Geländers gestanden hatten, doch das Geländer selbst war lange verschwunden. Das Haus hatte eine schmutzig weiße Stuckfassade, die an manchen Stellen abbröckelte, einen von Säulen gesäumten Vordereingang, Schiebefenster mit Stuckrahmen und ein mit Feuchtigkeit vollgesogenes Kellergeschoss. Als es noch neu gewesen war, muss es einladend und prachtvoll ausgesehen haben. Heute war es wie die zerzauste alte Landstreicherin unten an der Straße: nicht mehr im Einklang mit der Welt ringsum und nur noch zusammengehalten von Schmutz und improvisierten Instandsetzungsversuchen. Trotzdem, wir waren bereit gewesen, die Mühe auf uns zu nehmen und etwas daraus zu machen.
Unglücklicherweise war es nicht erlaubt. Innerhalb weniger Wochen wurden wir von der Stadt (der das Grundstück gehörte) informiert, dass das Haus im Rahmen irgendwelcher Umstrukturierungsmaßnahmen abgerissen werden solle. Die Pläne seien bereits verabschiedet, und daran lasse sich nichts mehr ändern. Wir hatten die Stadt bei unserer Besetzung gebeten, einen regulären Mietvertrag mit uns abzuschließen, doch die Behörde hatte unser Ansinnen ignoriert. Jetzt flatterte ein ganzer Strom von Verlautbarungen in Beamtenkauderwelsch durch den Briefschlitz, und die Stadtwerke schalteten den Strom ab für den Fall, dass wir immer noch nicht begriffen hätten. Immerhin hatten wir noch Wasser; vielleicht hatten sie es nicht für nötig befunden, uns das Wasser ebenfalls abzudrehen, weil die ganze Sache nun vor Gericht ging.
Nev schlug vor, dass wir versuchen sollten, das Haus auf die Liste architektonisch interessanter Objekte setzen zu lassen. Wir schrieben English Heritage an und den National Trust. Sie bedankten sich für unsere Briefe, doch das Haus sei nicht interessant genug, und sie wollten es nicht.
Einer nach dem anderen zogen die Menschen aus den angrenzenden Reihenhäusern aus und ließen nichts als leere, mit Brettern vernagelte Hüllen zurück. Wir hielten durch wie Legionäre in einem Wüstenfort.
Die Geschichte entwickelte sich zu einem Machtkampf zwischen uns und den tobenden Randalierern, als die sich die Offiziellen der Stadt immer mehr entpuppten.
Die Unsicherheit führte dazu, dass wir immer weniger wurden. Die Stadt, gefangen in der eigenen Schlinge, verschaffte Lucy und ihren beiden Kindern, von denen eines unter Asthma litt, eine neue Wohnung. Auch Declan verschwand, und niemand wusste, wohin. Er erwähnte etwas von einer Band, die einen Bassisten suche. Eine Woche zuvor waren zwei zwielichtige Typen an der Tür gewesen und hatten nach Declan gefragt, daher vermuteten wir, dass er in irgendwelchen Schwierigkeiten steckte. Doch wer von uns steckte nicht in Schwierigkeiten? Wir stellten keine persönlichen Fragen.
Terry hingegen war neu hinzugekommen. Eine kleine, depressive Gestalt mit dunkelblondem Haar, das in der Mitte gescheitelt war und zu beiden Seiten ihres verkniffenen kleinen Gesichts herabhing wie die langen Ohren eines Spaniels. Ihr Auftauchen fiel mit dem Abstellen des Stroms zusammen, sodass sie für mich gleich von Anfang an die Verschlechterung unserer Situation symbolisierte. Es war herzlos von mir, so zu denken, und doch, wie sich herausstellen sollte, absolut zutreffend.
An jenem Montagmorgen hatte ich eigentlich geglaubt, dass die Dinge nicht mehr schlimmer werden könnten – bis zu jenem Augenblick, an dem wir unsere Vorladungen erhalten hatten. Der Manager der Verpackungsabteilung des Versandhandels, wo ich gearbeitet hatte, besaß die üblichen Vorurteile gegen Hausbesetzer, und er hatte mich nicht schnell genug feuern können. Es hatte nicht das Geringste mit meiner Arbeit zu tun – abgesehen von der Tatsache, dass sie langweilig und schlecht bezahlt war. Ich war nie zu spät gekommen oder früher gegangen. Ich hatte nie etwas kaputt gemacht oder aus Versehen einen falschen Artikel eingepackt oder einem Kunden zum Scherz etwas vollkommen Unangebrachtes geschickt. Doch seiner Ansicht nach war ich »in Bezug auf die Lebensumstände nicht ehrlich« gewesen, und »die Firma hat ihre Politik«.
Ich hätte diesen Job nicht angenommen, wenn ich einen anderen bekommen hätte. Ich verdiente kaum mehr als den Sozialhilfesatz, und die Bedingungen, unter denen wir arbeiteten, glichen denen in den Büchern von Dickens. Trotzdem, es war besser als gar keine Arbeit. Jetzt war ich arbeitslos, rein technisch betrachtet (und praktisch bald ebenfalls) ohne Wohnsitz, und ich hatte die Nase von alledem gestrichen voll.
Unser Schweigen schien den Mann von der Stadt noch mehr aus der Fassung zu bringen, denn er fügte hastig hinzu: »Hören Sie, Sie müssen wirklich bis Freitag draußen sein, sonst wird man Sie gewaltsam entfernen lassen! Die Polizei wird bereitstehen, und es wäre keine gute Idee, auf das Dach zu klettern oder sich anzuketten oder sich mit den Füßen in Beton zu stellen. Es würde alles nur noch schlimmer machen.«
Wir sahen ihn nur schweigend an. Eine Bemerkung wie diese war keiner Antwort würdig. Nicht einmal Squib wäre auf so einen Gedanken gekommen.
»Jeder, der auf das Dach klettert, würde geradewegs hindurchbrechen«, sagte Nev. »Das soll doch wohl ein Scherz sein!«
Ich empfand ein wenig Mitleid für unseren Besucher, also fragte ich ihn, ob wir ihm eine Tasse Tee anbieten könnten. Wir hatten gerade welchen gemacht. Nev hatte ein Feuer im Kamin angezündet. Das Holz stammte von einer alten Gartenbank, die er hinter dem Haus gefunden hatte. Über dem Feuer hing ein Wasserkessel an einem Haken, der in den Bogen des Kaminrosts eingeschraubt war.
Declan hatte den Rost repariert, als er noch bei uns gewesen war. Es war zu dem Zeitpunkt gewesen, als man uns den Strom abgestellt hatte. Er meinte, seine Großmutter in Irland hätte ihr ganzes Leben lang auf diese Weise gekocht, mit einem Kessel am Haken über dem Kaminfeuer, und sie hätte eine dreizehnköpfige Familie satt kriegen müssen. Declan steckte voller derartiger Geschichten. Sicher war die Hälfte davon erfunden, doch man wusste einfach nie, was der Wahrheit entsprach und was nicht.
Wir kochten nicht all unsere Mahlzeiten im Kessel. Wir besaßen einen Gasherd, der mit Flaschen betrieben wurde. Doch das Gas kostete Geld, und so benutzten wir den Kaminkessel und das offene Feuer, wann immer es sich einrichten ließ.
Der Mann von der Stadt lehnte mein Angebot ab, doch seine Nervosität schien ein wenig zu verfliegen. Stattdessen plusterte er sich nun auf, und ich bereute mein Mitleid mit ihm. »Wir haben Ihnen mehrfach geschrieben und erklärt, was geschehen wird. Wir haben die Frist mehrfach verlängert. Wir haben alles getan, um die Sache vernünftig zu regeln. All diese Häuser hier werden abgerissen. Die anderen stehen bereits leer. Die Bewohner waren vernünftig und sind ausgezogen. Nur Sie sind geblieben. Wir haben Ihnen alles wieder und wieder erklärt, bis uns die Luft weggeblieben ist. Sie müssen unsere Schreiben erhalten haben.«
»Das weiß ich alles«, antwortete ich in, wie ich hoffte, extrem höflichem und vernünftigem Ton. »Wir verstehen die Position der Stadt, doch sehen Sie die Sache auch einmal von unserem Standpunkt. Wir sind obdachlos. Oder werden es zumindest sein, wenn Sie uns auf die Straße setzen. Wird die Stadt uns Wohnungen verschaffen?«
»Das können wir nicht«, sagte er müde. »Wir haben keine Wohnungen. Mrs. Ho und ihre Kinder hatten Vorrang. Von den restlichen vier von Ihnen sind Sie, Miss Varady, die Einzige, die behaupten kann, eine Verbindung mit der Gemeinde zu haben, und selbst das wäre eine mehr als dünne Begründung. Wir können Sie auf die Liste setzen, mehr geht beim besten Willen nicht. Für die anderen drei sind wir nicht verantwortlich. Sie müssen es wohl oder übel auf dem privaten Wohnungsmarkt versuchen.«
»Kein privater Vermieter würde uns nehmen! Außerdem könnten wir die Miete gar nicht bezahlen, die er verlangen würde! Hören Sie, wir halten das Haus sauber«, fuhr ich fort. »Wir feiern keine wilden Partys und machen auch sonst nichts, was Sie nicht auch tun würden. Wir lassen keine anderen Leute hier pennen. Wir sind wirklich gute Mieter. Oder wir wären es zumindest, wenn Sie uns Miete zahlen lassen und uns einen regulären Vertrag geben würden. Das ist alles, worum wir bitten. Was ist denn daran falsch?«
»Das Haus wird innerhalb der nächsten sechs Monate abgerissen. Es ist baufällig. In einem nicht bewohnbaren Zustand. Der Strom wurde abgeschaltet.« Er sah nicht aufgebracht oder unfreundlich aus, nur müde. »Wir haben das alles in unseren Schreiben erklärt, wieder und wieder. Sie haben unsere Briefe doch gelesen, oder?«
In diesem Augenblick verdarb Squib alles, indem er sagte: »Wir haben damit unser Feuer angezündet. Hat eine Menge Streichhölzer gespart.«
Der Beamte des Wohnungsamtes lief rot an. Er schimpfte über so viel Unvernunft, und dann stieg er in seinen Wagen und fuhr davon. Gerade rechtzeitig. Während er im Haus gewesen war und mit uns geredet hatte, konnte ich durch das Fenster ein paar Kinder sehen, die um seinen schicken neuen Fiesta herumstreunten. Noch ein paar Minuten länger und sie wären im Wagen gewesen. Er hätte nur noch einer Abgaswolke hinterhergesehen, während sie mit quietschenden Reifen davongebraust wären.
Nachdem unser Besucher gegangen war, hielten wir Kriegsrat. Wir wussten selbstverständlich, dass wir das Haus räumen mussten. Wir wussten nur nicht, wohin wir gehen sollten. Der Sommer neigte sich dem Ende zu, und keiner von uns verspürte Lust, auf der »Platte« zu wohnen, jetzt, wo es anfing, kälter zu werden. Außerdem war das Leben in einem Haus, selbst wenn das Dach einsturzgefährdet und das Treppenhaus von Trockenfäule befallen war wie bei unserem, wesentlich weniger gefährlich. Wie der Beamte gesagt hatte – wir besaßen keinen Anspruch auf behördliche Hilfe.
Terry setzte sich auf die nackte Treppe, wickelte eine Haarsträhne um den Finger und wartete darauf, dass jemand einen Vorschlag machte, damit sie ihn kritisieren konnte. Sie war Weltmeisterin im Quengeln, drückte sich vor jeder Hausarbeit und stellte sich an, wenn sie ihren Anteil zum Haushaltsgeld beisteuern sollte. Ich sah sie an und wünschte, sie würde verschwinden und Declan statt ihrer wäre hier. Declan konnte wenigstens Dinge reparieren und war angenehme Gesellschaft.
Wünsche sind gefährlich. Manchmal gehen sie in Erfüllung, und dann muss man mit den Folgen leben.
Terry hatte meinen missmutigen Blick bemerkt und sah augenblicklich klein und hilflos aus. Darin war sie unglaublich gut. Mit dieser Masche hatte sie auch bei uns Unterschlupf gefunden. Ich war die Schauspielerin in unserer Truppe, doch diese Frau hatte ihre Berufung verfehlt, glauben Sie mir. Sie spähte durch ihren Vorhang aus Haaren und sagte pathetisch: »Ich hab keinen anderen Platz, wo ich hingehen könnte.«
»Keiner von uns hat einen anderen Platz!«, schnappte ich.
Wir standen auf und gingen in das große Wohnzimmer, wo der Kamin stand. Alle setzten sich und starrten mich an wie hoffnungsvolle Welpen. Jeder hielt seinen Becher Tee in der Hand. Jeder hatte seinen eigenen Becher, und wir tranken niemals aus dem Becher eines anderen. Es war ein ungeschriebenes Gesetz in diesem Haus.
»Was sollen wir tun, Fran?«, fragte Nev auf eine vertrauensselige Weise, die alles nur noch schlimmer machte.
Es hing letztendlich immer alles an mir. Das Dumme war nur, ich hatte keine Ideen mehr. Ich musste etwas sagen. Sie erwarteten es von mir. Also sagte ich: »Wenn wir einen alten Lieferwagen auftreiben könnten, könnten wir am Straßenrand wohnen.«
»Dann penne ich lieber in einem Hauseingang!«, sagte Squib aufgebracht. »Ich habe diesen New-Age-Scheiß ausprobiert. Löcher graben, bevor du kacken kannst, und die ganze Nacht irgendwelche blöde Folkmusic hören. Nein danke!«
»Da hat er irgendwie nicht ganz Unrecht«, pflichtete Nev ihm bei. »Im Sommer mag es ja in Ordnung sein, aber im Winter macht es absolut keinen Spaß.«
»Außerdem würde die Polizei uns immer wieder vertreiben«, warf Terry ihre übliche Handvoll Einwände in die Runde. »Es ist grauenhaft in einem Zelt, wenn es regnet! Zelte sind niemals dicht. Man tut einfach alles, um irgendwohin zu kommen, wo es trocken ist. Ich weiß es, ich hab’s schon mal gemacht.«
»Mir gefällt es hier«, sagte Nev melancholisch. »Hier in diesem Haus.«
Squib zog seine Wollmütze vom Kopf und sah hinein. Vielleicht hoffte er, dort eine Idee zu finden. Er fand keine, also fuhr er sich mit der Hand über den kahl geschorenen Schädel und setzte die Mütze sorgfältig wieder auf.
»Mir nicht«, sagte Terry. »Hier gibt es Ratten.«
»Ratten gibt es überall«, sagte Squib. »Ratten sind in Ordnung. Ich hatte mal ein paar wirklich nette Ratten als Haustiere. Eine weiße, die ich in meiner Manteltasche rumgetragen habe. Sie hat mich nie gebissen, nicht ein einziges Mal. Ich hab sie einem Typ in einem Pub verkauft. Er hat mir einen Fünfer dafür gegeben. Er war ziemlich sauer hinterher. Schätze, die Ratte hat ihn gebissen, als er mit ihr zu Hause angekommen war. Sie hat andere Leute gebissen. Mich nie. Tiere mögen mich.«
Das stimmte. Terry murmelte: »Kein Wunder, wenn man stinkt wie ein Bauernhof. Die Tiere glauben, er ist einer von ihnen.« Der mürrische, unzufriedene Ausdruck auf ihrem Gesicht wurde intensiver. Sie hatte sich in eine alte Strickjacke gewickelt, die sie ständig trug, und sie schmollte. Die Jacke war dreckig und abgetragen, aber ich hatte einmal das Etikett darin gesehen, und es war eine sehr teure Marke. Ich hatte eine Bemerkung deswegen fallen lassen, und Terry hatte prompt zurückgegiftet, dass die Jacke aus dem Oxfam-Laden stamme. Ich hatte ihr damals nicht geglaubt, und ich glaubte ihr immer noch nicht. Jetzt überlegte ich, ob sie die Jacke vielleicht gestohlen hatte. Sie neigte dazu, lange Finger zu machen, auch wenn sie nicht so dumm war, sich jemals an etwas zu vergreifen, das mir oder Nev gehörte. Wir besaßen wahrscheinlich nichts, das sie interessierte. Nur ein vollkommen Verrückter hätte irgendetwas von Squib angefasst. Der Hund hätte ihn in Sekundenschnelle gepackt. Selbst wenn der Hund nicht aufgepasst hätte, luden Squibs Siebensachen nicht zu einer Untersuchung ein.
Wie ich schon sagte, wir stellten einander keine persönlichen Fragen. Wenn man verzweifelt genug ist, illegal in einem für den Abriss vorgesehenen Haus voller Trockenfäule und ohne elektrischen Strom zu wohnen, dann braucht man einen Unterschlupf, wo man bleiben kann. Was man nicht braucht, sind dumme Fragen. Früher oder später erzählten die meisten ja doch das eine oder andere über sich. Nicht so Terry. Sie hatte nicht ein Wort gesagt. Woher auch immer sie kommen mochte, sie war nicht in Armut aufgewachsen. Man konnte es merken. Was mich noch nachdenklicher machte wegen der alten Strickjacke.
Wir redeten den ganzen Morgen über unser Problem, doch wir fanden keine Lösung. Die Diskussion endete in einem Streit – nicht über das, was wir tun sollten, sondern über Squibs Hund.
Terry meinte, er habe Flöhe. Er kratzte sich tatsächlich ständig.
Über Squib durfte man sagen, was man wollte, nicht jedoch über seinen Hund. Es war ein eigenartig aussehendes Tier mit einem stehenden und einem geknickten Ohr und krummen Beinen. Squib hatte den Hund auf einer Müllhalde gefunden, als er noch ein Welpe gewesen war. Er dachte, jemand hätte den Hund ausgesetzt, weil er ein Kümmerling war, das schwächste Tier in einem Wurf. Squib hatte sich des Welpen angenommen, und er war zu einem großen, starken Tier herangewachsen, bis auf die krummen Beine. Es war ein netter Hund, freundlich zu jedermann, außer wenn er Squibs Sachen bewachte. Wir alle mochten ihn, mit Ausnahme von Terry. Terry mochte niemanden.
Als sie nun anfing, Squibs Hund zu beleidigen, sagte Squib ihr ein paar passende Worte. Bald darauf war der schönste Streit im Gange, und ich verlor die Geduld. Ich versuchte im Haus eigentlich stets, meinen Jähzorn zu zügeln, denn wenn einer anfängt zu brüllen, fangen alle an. Doch wir diskutierten ja bereits, und irgendwie war Terrys Gejammer der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Ihre Kritik am Haus hatte geschmerzt. Wir hatten sie bei uns aufgenommen, und sie hatte nichts anderes im Sinn, als uns deutlich zu machen, dass es unter ihrem gewohnten Standard lag.
»Ach, leck mich doch am Hintern!«, brüllte ich, nur dass ich nicht »Hintern« sagte. »Niemand hat dich gebeten, bei uns einzuziehen! Wir haben dich bei uns aufgenommen, und ich glaube nicht, dass es seitdem einen einzigen Tag gegeben hat, an dem du nicht von morgens bis abends gejammert hast! Wir haben alle unsere Probleme! Du bist nicht besser und nicht schlechter dran als jeder andere von uns.« Das Etikett in ihrer alten Strickjacke kam mir in den Sinn, und ich fügte hinzu: »Ich kenne deine Sorte! Wenn ihr erst genug habt, geht ihr einfach dahin zurück, wo ihr hergekommen seid!«
Sie wurde kreidebleich im Gesicht, warf ihre Spanielohren in den Nacken und zischte: »Halt die Klappe, Fran! Du weißt überhaupt nichts über mich! Du schubst uns immer nur rum, das ist alles! Tu dies, tu das! Du gibst die Befehle, und wir müssen springen, richtig? Nun, du irrst dich! Ich springe nicht! Das ist es, was dir nicht passt! Du benimmst dich wie eine Oberschwester! Das hier ist eine Kommune, und alle haben die gleichen Rechte, klar? Jeder hat gleich viel zu sagen! Nur weil Nev ein nervöses Wrack ist und Squib nichts im Schädel hat, überlassen sie dir das Denken und das Reden, und du bildest dir ein, du könntest das Gleiche für mich tun und mich ebenfalls herumkommandieren! Vergiss es, und zwar schnell!«
In ihrer Stimme lag eine Boshaftigkeit, wie ich sie bis dahin nicht von ihr gehört hatte, doch es war nicht ihr Ton, der mich schockierte. Es war die Anschuldigung an sich. Ich hatte mich nicht als dermaßen dominant gesehen, als jemand, der andere herumschubste. Diese Vorstellung gefiel mir nicht und drängte mich in die Defensive.
»Ich kommandiere niemanden herum! Ich versuche nur, mich nützlich zu machen! Es wäre gar nicht schlecht, wenn du es auch mal versuchen würdest! Selbst Squib macht sich nützlich!«
Squib blickte überrascht auf; er war keine Komplimente gewöhnt. Es schien das erste für ihn gewesen zu sein. »Danke, Fran«, sagte er.
»Wir müssen zusammenhalten«, sagte Nev nervös. »Wir dürfen uns jetzt nicht streiten!«
»Du, Squib und ich, wir waren zusammen – sie ist später dazugekommen, und sie kann meinetwegen jederzeit verschwinden!«, kreischte ich. Ich war immer noch stinkwütend auf sie, wütender noch als vorhin, weil sie mich verletzt hatte. Ich bin nicht stolz auf diese Geschichte. Ich hätte sie nicht so angreifen dürfen. Sie hatte Recht, als sie sagte, ich wüsste überhaupt nichts über sie.
Zurückblickend weiß ich gar nicht mehr genau, wie Terry überhaupt zu uns gekommen ist. Ich glaube, Lucy hat sie angeschleppt. Anfangs habe ich mich gefragt, ob Terry vielleicht nur deswegen bei uns geblieben ist, weil sie scharf war auf Declan, der zu der Zeit noch bei uns gewohnt hatte. Ich glaube, er mochte sie vielleicht auch ein wenig. Doch das hielt ihn nicht davon ab, zu verschwinden. Wenn Sie mich fragen, es war besser so für ihn. Andererseits habe ich Terry von Anfang an nicht gemocht. Es wäre sinnlos, so zu tun, als ob. Aber ich habe bestimmt nicht gewollt, was dann passiert ist. Keiner von uns dürfte das gewollt haben.
All das geschah Montagmorgen. Wir hatten nicht mehr viel Zeit, und so machten Nev und ich uns am Nachmittag auf den langen Weg nach Camden, um ein Haus anzusehen, von dem er gehört hatte. Nur um zu sehen, ob es dort Platz gab für uns. Doch als wir ankamen, war alles leer und vernagelt, also hatte die Stadt schon geräumt und die Bewohner vertrieben. Schade, die Gegend war besser als die, aus der wir kamen. Wir gingen nach Camden Lock und alberten herum und trafen ein paar Leute, die wir kannten und die wir fragen konnten.
Squib war mit seinem Hund hinauf nach West gegangen. Er hatte seine Kreide und eine Ansichtskarte von El Grecos Himmelfahrt der Jungfrau Maria mitgenommen und suchte wahrscheinlich nach einer geeigneten Stelle auf einem Bürgersteig. Er konnte es sich nicht leisten, Zeit zu verschwenden, wegen des schlechter werdenden Wetters.
Terry hatte nicht gesagt, womit sie den Tag verbringen würde, und wir hatten sie nicht gefragt. Ich schätze, keiner von uns erwartete, dass sie etwas Nützliches machen würde, beispielsweise eine neue Behausung für uns finden.
Vermutlich sollte ich nicht so schlecht über jemanden reden, der tot ist. So etwas macht man nicht. Man sagt nette Dinge über die Toten, oder sie kommen zurück und verfolgen einen. Ich weiß, dass es so ist, weil Terry mich verfolgt hat. Wahrscheinlich wegen all der bösen Dinge, die ich über ihre Zeit bei uns gesagt habe, ganz zu schweigen von dem, was ich nach … nun ja, was ich nach dem, was passiert ist, gesagt habe.
Zurück zum Montag. Nev und ich kehrten recht spät aus Camden zurück. Ein paar Leute hatten uns zum Essen eingeladen. Sie waren Vegetarier, genau wie Nev, deswegen gab es nur Bohnen, aber es schmeckte trotzdem, heiß und schön scharf, auch wenn ich wusste, dass ich später dafür würde bezahlen müssen.
Als wir zurückkamen, war im Haus alles still. Es war dunkel, weil sie uns den Strom abgestellt hatten. Wir benutzten Kerzen. Doch abgesehen von der Leere und dem gewohnten Gestank nach Trockenfäule war da noch etwas anderes. Es war irgendetwas Fremdes, ein Eindruck, ein undefinierbares Gefühl. Ich wusste gleich, ich wusste einfach, dass jemand im Haus gewesen war, der nicht zu uns gehörte. Ein Fremder. Ein komplett Fremder, jemand, der überhaupt nicht in unseren Kreis gehörte, und auch niemand von der Stadt. Außerdem lag ein schwacher Duft nach Parfüm in der Luft, irgendein Eau de Cologne. Ich hab mal in einem Drogeriemarkt gearbeitet. Ich kenne Eaux de Cologne. Ich kann teure von billigen unterscheiden. Was ich da im Haus roch, das war ein teures. Eins von der Sorte, die sich in der Weihnachtszeit gut verkauft.
Diese Duftspur hier in unserem Flur machte mich wütend. Ich dachte, dass Terry wahrscheinlich schon wieder auf Diebestour gewesen sei. Ich hatte ihr jedes Mal gesagt, dass sie es lassen solle. Möglich auch, dass sie mehr Geld hatte, als sie vor uns zugab, und sich das Zeug einfach kaufte. Diese Eaux de Cologne riechen offen gestanden an einer Frau besser als an einem Mann, meiner Meinung nach. Jedenfalls, wenn Terry Geld hatte, dann redete sie nicht darüber. Sie gab es für irgendwelchen Plunder aus oder für Hochglanzmagazine, die Sorte, in der gezeigt wurde, wie man aus seiner Doppelhaushälfte etwas machte, das Sendezeit bei Hello! bekommen könnte. Und das zu einer Zeit, da wir Eimer unter das Loch im Dach stellten und von nichts als Brot und Billigmargarine lebten.
Ich erwähnte den Parfümgeruch gegenüber Nev, doch er meinte, er könne nichts riechen, weil die Trockenfäule alles überdecke. Das andere Gefühl, dass jemand Fremdes, ein Außenstehender, im Haus gewesen sein könnte, behielt ich für mich. Es war nicht einfach zu erklären. Lucy hatte es mit dem Paranormalen gehabt, und sie hätte wahrscheinlich gesagt, dass ich ein natürliches Medium sei. Ich glaube nicht an diese Art von Hokuspokus. Denke ich jedenfalls. Hätte ich in jenem Augenblick erklären müssen, was ich fühlte, so kann ich im Nachhinein nur sagen, wahrscheinlich die Gefahr gespürt zu haben. Wäre ich ein Höhlenmensch gewesen, hätte wohl draußen vor dem Eingang ein großes Mammut gelauert. Nur dass es in unserem Fall nicht draußen vor dem Eingang war, sondern drinnen bei uns.
Wir gingen in das Wohnzimmer und zündeten das Kaminfeuer wieder an, denn es war kalt geworden. Keiner von uns sagte ein Wort, doch wir beide dachten, dass es nächste Woche ein gutes Stück kälter sein würde – und die Chancen standen nicht schlecht, dass wir im Freien schlafen mussten, bis wir ein neues Haus gefunden hatten, wo wir bleiben konnten.
Nach einer Weile kam auch Squib mit dem Hund nach Hause; er hatte vier Dosen Lager mitgebracht und außerdem ein Paket Würstchen, die er über dem Feuer grillte. Eine Eisenschaufel diente ihm als Pfanne.
Die Würstchen rochen köstlich. Fett spritzte aus der Schaufel in die Flammen und ließ sie rot und gelb auflodern. Es war sehr gemütlich, und wir waren glücklich. Als die Würstchen fertig waren, knusprig und braun gebraten, bot Squib uns welche an. Man konnte über Squib sagen, was man wollte – er teilte immer. Nev lehnte dankend ab, weil er überhaupt kein Fleisch aß, und ich lehnte ab, weil mir die Bohnen noch im Magen lagen, die wir am Nachmittag gegessen hatten. Außerdem wusste ich, dass Squib wahrscheinlich den ganzen Tag lang noch nichts zu sich genommen hatte.
Squib legte die Hälfte der Würstchen für den Hund auf das Kaminsims, damit sie ein wenig abkühlen konnten, und fragte: »Meint ihr, Terry möchte etwas davon abhaben, wenn sie zurückkommt?«
»Warum machst du dir wegen Terry Gedanken?«, entgegnete ich. »Sie kümmert sich auch nie um uns.« Was zeigt, wie ich zu diesem Zeitpunkt von ihr dachte, denn selbst wenn ich sie nicht leiden konnte, so war sie doch eine von uns, und normalerweise hätte ich sie bestimmt nicht ausgegrenzt.
Doch sie kam in jener Nacht nicht zurück, oder wenigstens dachten wir, sie wäre nicht zurückgekommen. Wir hatten sie jedenfalls nicht gesehen.
Am nächsten Morgen war sie immer noch nicht wieder da. Squib meinte, dass sie vielleicht die Biege gemacht hätte, genau wie Declan.
»Sie hat einen anderen Unterschlupf gefunden, wo sie bleiben kann«, sagte er. »Sie hat uns sitzen lassen und ist woanders eingezogen. Nachdem die Typen von der Stadt hier waren, kann ich es ihr nicht verdenken. Es ist sinnlos, weiter hier herumzuhängen.«
Das Wissen, dass er Recht hatte und unsere Tage in diesem Haus gezählt waren, munterte uns nicht eben auf. Trotzdem war es eine Erleichterung, zu glauben, wir hätten Terry das letzte Mal gesehen. Ein hungriges Maul weniger, um das wir uns Gedanken machen mussten.
Nev schlug vor, in ihrem Zimmer nachzusehen, ob ihre Sachen verschwunden seien. Wenn es leer war, umso besser. Dann konnten wir Terry endgültig vergessen.
Wir trotteten die Treppe hinauf, alle drei, und der Hund hinterher. Der Hund war gut im Treppenhoch-und -runterrennen, trotz seiner krummen Beine. Doch draußen vor Terrys Tür begann er sich merkwürdig zu verhalten. Sein spitzes Ohr sank herab, passend zu dem zweiten, und er kauerte sich nieder und stieß ein eigenartig hohes Fiepen aus.
Squib kniete bei seinem Tier nieder und fragte, was denn los sei. Doch der Hund legte sich nur ganz hin und blickte elend drein.
»Vielleicht hat er was Falsches gefressen?«, schlug Nev vor.
Das beunruhigte Squib, der schon häufiger davon gehört hatte, dass die Hunde, die Hausbesetzern gehörten, vergiftet worden waren, noch mehr. Er hockte sich auf den Boden vor Terrys Tür und bemühte sich, seinem Hund das Maul zu öffnen, um die Zunge zu kontrollieren, während Nev und ich die Tür zu Terrys Zimmer öffneten.
Sie war doch da. Sie musste am vorhergehenden Tag im Haus geblieben sein, als wir alle weg waren. Sie war noch da gewesen, als wir zurückgekommen waren, und auch die ganze Nacht. Sie war da gewesen, als Squib unten seine Würstchen gebraten hatte, und sie war da gewesen, als ich in der Nacht wegen der Bohnen hatte aufstehen müssen.
Sie war da und hing von der Deckenlampe.
Ich erinnere mich ganz genau an den Anblick, fast als hätte mein Bewusstsein eine Fotografie davon angefertigt, die ich jederzeit hervorholen und ansehen kann. Das Zimmer muss, wie der Rest des Hauses, früher einmal wunderschön gewesen sein. Die bleiche Sonne schien durch die großen, schmalen Fenster herein, von denen eines noch immer eine Messingstange besaß, die einmal Vorhänge getragen hatte. Die Sonne streifte die Stange von unten und ließ sie leuchten, als bestünde sie aus Gold. In den Ecken der hohen Decke hingen alte Spinnweben und tote Spinnen. Ringsum verlief ein Fries aus Stuck, und genau in der Mitte der Decke befand sich eine große Stuckrosette aus staubbedeckten Eicheln und Eichenblättern. Es war nicht schwer, sich einen kunstvollen Leuchter vorzustellen, einen Kronleuchter vielleicht, der in längst vergangenen Tagen dort gehangen hatte.
Jetzt hing nichts mehr dort – außer Terry.
Sie hatte irgendetwas um den Hals, von dem sich später herausstellte, dass es die Hundeleine war. Squib benutzte sie kaum, weil der Hund sehr gut erzogen war und sich stets bei Fuß hielt. Die Leine hatte irgendwo im Haus herumgelegen, und jetzt hatte Terry sie um den Hals und baumelte daran von der Decke.
Trotz des Schocks des Augenblicks – oder vielleicht gerade deswegen – habe ich ihren Anblick in dieser Deutlichkeit im Gedächtnis behalten. Sie – oder besser das Ding, das einmal Terry gewesen war – trug abgerissene Jeans. Der Reißverschluss stand offen und gab den Blick frei auf ihren nackten Bauch. Eine beträchtliche Lücke hatte sich zwischen dem klaffenden Vorderteil der Jeans und dem unteren Rand ihres unglaublich eingelaufenen und verwaschenen T-Shirts gebildet. Ich sah ihren Brustkorb über den straff gespannten Bauchmuskeln. Ihre Füße waren nackt und malvenfarben angelaufen. Sie hatte den Ansatz einer Schleimbeutelentzündung auf dem Gelenk des linken großen Zehs, doch damit würde Terry nun niemals mehr Probleme haben.
Sie war einmal recht hübsch gewesen, genau wie das Zimmer, und genau wie bei ihrem Zimmer war nun nichts mehr davon zu sehen. Über Nacht hatte das Gewicht ihres Körpers dazu geführt, dass sich ihr Hals gestreckt hatte, und er sah nun giraffenartig aus wie bei jenen afrikanischen Stammesfrauen, deren Köpfe von einer Reihe Metallreifen gehalten werden. Die Hundeleine hatte sich grauenhaft in ihre Kehle eingeschnitten und dazu geführt, dass ihr Gesicht angeschwollen und schwarz war vom gestauten Blut. Ihr Mund stand offen, und die Zunge hing heraus, als wollte sie noch im Sterben ihre letzte Beleidigung gegen uns ausstoßen. Die Augäpfel quollen hervor und waren überzogen von dunklen Äderchen.
»Mein Gott!«, ächzte Nev. »Sie hat sich aufgehängt!«
Ich hatte keinen Grund – damals – anzunehmen, dass er sich irren könnte. Neben Terry lag ein klappriger alter Stuhl auf der Seite, nicht weit von ihren baumelnden nackten Füßen. Ich stellte mir vor, wie sie darauf geklettert war, die Leine an der Decke festgemacht hatte und dann gesprungen war.
Man stirbt nicht schnell, wenn man es so macht. Die Henker früher wussten, wie man einen Knoten machte, der dem Gehenkten das Genick brach. So, wie sie es gemacht hatte, hatte sie sich selbst erdrosselt, ein langsamer und qualvoller Tod. Ihre strampelnden Füße hatten den Stuhl umgetreten. Vielleicht hatte sie erkannt, was ihr bevorstand, und ihre Meinung geändert, hatte nach dem Stuhl getastet, um sich wieder abzustützen und den Druck von ihrer Kehle zu nehmen, in der Absicht, sich von der Hundeleine zu lösen und herunterzuklettern, verschrammt zwar, doch ein wenig klüger als zuvor.
Terry wäre nicht die Erste gewesen, die ihre Meinung in letzter Sekunde geändert hatte. Genauso wenig, wie sie die Erste gewesen wäre, die herausfinden musste, dass genau das gar nicht so einfach war. Der Tod ließ nicht mit sich spielen. Der Tod wollte ernst genommen werden. Ob Terry es nun am Ende so gewollt hatte oder nicht, der Tod hatte sie sich geholt.
Und wir standen da, mit einer Leiche im Haus und der Aussicht auf eine furchtbare Menge Ärger und Scherereien.
Kapitel 2
Nicht im Traum hätte ich mit dem gerechnet, was auf unsere grauenhafte Entdeckung folgen sollte, auch wenn ich durchaus wusste, dass uns jede Menge unwillkommener Aufmerksamkeit seitens der Behörden widerfahren würde. Die anderen beiden dachten nicht voraus; sie waren zu sehr damit beschäftigt, den Anblick der hängenden Gestalt zu verdauen. Nev rannte nach draußen, und wir hörten, wie er sich auf dem Klo erbrach. Es stellte sich heraus, dass er noch nie zuvor eine Leiche gesehen hatte. Ich schon, doch das machte es nicht einfacher für mich, Terry anzusehen.
Squib ließ seinen Hund zurück und kam ins Zimmer. Er stand den Anblick durch, doch er sah noch um einiges bleicher aus als gewöhnlich. Er besaß ständig einen verkniffenen Ausdruck, doch jetzt sah er exakt genauso aus wie die weiße Ratte, die er einst als Haustier gehalten hatte.
»Wir machen besser, dass wir von hier verschwinden!«, sagte er. Er schwitzte. Ich konnte es riechen; es stieg von ihm auf wie der Schweiß von einem gehetzten Tier. »Los, wir verschwenden nur unsere Zeit! Packen wir unsere Sachen und machen wir, dass wir hier wegkommen!«
»Sei nicht dumm«, entgegnete ich. »Die Stadt weiß alles über uns, unsere Namen, alles. Sie werden uns finden.«
»Warum hat sie es getan?«, fragte er. »Hatte sie Angst davor, dass wir auf die Straße gesetzt werden? Hey …!«, seine Augen leuchteten auf. »Das ist es, was wir diesem Arschloch von der Stadt erzählen! Wir sagen ihm, er hätte sie dazu getrieben!«
»Halt die Klappe, Squib!«, herrschte ich ihn an. Ich musste nachdenken. Niemand außer mir würde auf einen konstruktiven Gedanken kommen. Es hing wieder einmal alles an mir, wie üblich. Squib wollte in blinder Panik davonlaufen, und Nev hing über dem Lokus und kotzte, und das war wahrscheinlich auch schon alles, was die beiden beizutragen hatten. Sich um Nev und Squib zu kümmern war manchmal, als würde man auf Kinder aufpassen. Man musste alles Denken für sie mit übernehmen und ständig hinterher sein, was sie gerade wieder anstellten.
Nev kehrte vom Lokus zurück. Er sah immer noch todelend aus, doch er versuchte, sich zusammenzureißen. »Sollten wir … sollten wir sie nicht runterholen?« Seine Stimme war nur ein Flüstern und brach beim letzten Wort. »Wir sollten sie nicht so da hängen lassen. Das ist obszön.«
Es war obszön, er hatte Recht. Doch wir konnten sie nicht runterholen. Wir durften nichts anfassen. Ich erklärte es allen beiden mit Nachdruck.
Squib wirkte erleichtert. Er drängte sich nicht danach, die Tote zu berühren. Nev hingegen reagierte mit einem Ausruf der Bestürzung.
»Wir können sie nicht hängen lassen!« Seine Stimme klang wie von einem Computer produziert. Die Geräusche waren da, bildeten die richtigen Worte, doch sie klangen nicht menschlich.
Unvermittelt sprang er vor, und ohne dass ich etwas dagegen hätte unternehmen können, packte er ihre Beine. Ich weiß nicht, was er vorhatte. Vielleicht wollte er sie ohne unsere Hilfe vom Haken nehmen. Doch im gleichen Augenblick, in dem er sie berührte, taumelte er auch schon wieder entsetzt zurück und stieß einen erstickten Schrei aus.
»Sie ist ganz steif …!«
Der Leichnam, von Nevs ungeschicktem Versuch in Schwingung versetzt, begann an der Hundeleine zu rotieren wie ein groteskes Mobile. Ich sah hinauf zum Deckenhaken. Er würde nicht mehr viel länger halten, so viel stand fest. Erstaunlich, dass er überhaupt bis jetzt gehalten hatte. Die Leiche würde jeden Augenblick herunterkrachen, auch ohne unser Zutun, erst recht, nachdem sie jetzt in Bewegung geraten war.
Doch die Starre, falls Nev sich nicht getäuscht hatte, brachte mich zum Nachdenken. Ich kannte mich nicht allzu genau mit Leichenstarre aus, doch ich wusste, dass es rund zwölf Stunden bis zu ihrem Einsetzen dauerte und dass sie weitere zwölf Stunden anhielt, bevor sie nach und nach wieder verschwand, je nach den äußeren Umständen. Wenn sie richtig steif und hart war, dann musste sie irgendwann gestern Nachmittag gestorben sein. Wir mussten augenblicklich die Polizei alarmieren, oder wir würden die Verzögerung erklären müssen.
Nev war nicht in der Verfassung für weitere Einwände und nickte nur schwach.
»Ich sage, wir verschwinden!«, warf Squib halsstarrig ein. Er mochte die Polizei nicht. Sie mochte ihn nicht. Der Hund setzte sich auf, hob die Schnauze und stieß ein lautes Heulen aus, als stimmte er seinem Herrchen zu.
»Hört ihr?« Squib zeigte auf den Hund. »Sie mochte ihn nicht. Terry mochte ihn nicht. Sie hat immer gesagt, er hätte Flöhe. Er hat keine. Aber er weint um sie, seht ihr? Tiere sind besser als Menschen, das ist es, was ich denke. Tiere haben Anstand.«
»Anstand bedeutet«, sagte ich heftig, »dass wir auf der Stelle die Polizei holen.«
Wir hätten noch stundenlang weiter streiten können, doch die Entscheidung wurde uns aus der Hand genommen. Unten am Fuß der Treppe rief jemand.
Wir starrten uns an, und Panik stieg in uns auf. Ich rannte die Treppe hinunter, und man glaubt es nicht, da stand der Mann von der Stadtverwaltung wieder. Diesmal hatte er einen Kollegen bei sich, einen verschwitzten, pummeligen Burschen mit bösartigem Gesichtsausdruck.
»Wir sind noch einmal zurückgekommen, um nachzusehen, ob Sie alles für Ihren Auszug vorbereiten«, sagte der erste der beiden, »und um sicherzustellen, dass Sie zu der für heute anberaumten Anhörung erscheinen.«
Die Anhörung hatte ich ganz vergessen. Sie schien mit einem Mal völlig nebensächlich. Die beiden Beamten waren die Letzten, die wir im Augenblick hier gebrauchen konnten, und ich überlegte hektisch, wie ich sie loswerden konnte. »Wir können nicht!«, sprudelte ich hervor. »Ich meine, wir sehen uns dort. Wir machen uns gerade fertig zum Aufbruch, deswegen können Sie nicht reinkommen, nicht gerade jetzt.«
Er kam näher zur Treppe und starrte mich mit gerunzelter Stirn von unten herauf an. »Sie sind Fran, nicht wahr? Sie haben das Kommando, wie? Sie scheinen ständig für die anderen zu reden.«
Das, so erinnerte ich mich reumütig, hatte Terry mir ebenfalls vorgeworfen.
Ich redete nur deswegen für die anderen, weil sie todsicher das Falsche sagten, wenn sie sich allein überlassen waren. Ich überlegte fieberhaft, welche Antwort jetzt wohl die richtige wäre, und suchte nach einem Weg, alles zu erklären.
»Es ist etwas passiert. Eine von uns ist … hatte einen Unfall. Wir müssen Hilfe holen.«
»Was für einen Unfall?« Diesmal redete der Dicke. Er trat vor und starrte mich böse an.
»Fran?« Der jüngere der beiden sah mich besorgt an. »Brauchen Sie einen Krankenwagen?«
Mir ging durch den Kopf, dass er wohl doch kein so schlechter Kerl war. Doch ich hatte nicht die Zeit für eine Charakteranalyse.
»Drogen, jede Wette!«, giftete der andere. »Einer von denen hat sich ’ne Überdosis gesetzt! Ausgerechnet heute, an diesem verdammten Morgen! Wie lange ist er oder sie denn schon bewusstlos?«
»Wir sind keine Junkies!«, brüllte ich. »Keiner von uns!«
Das stimmte. Es war eine weitere ungeschriebene Regel im Haus. Keine Drogen. Terry hatte manchmal Cannabis, aber das war alles.
Der Fettsack prüfte schnüffelnd die Luft. »Und was ist das sonst für ein Geruch?«
»Das ist die Trockenfäule!«, fauchte ich ihn an.
Hinter mir knarrte die Treppe, und ich hörte den Hund leise knurren. Squib beruhigte das Tier mit leiser Stimme, dann wandte er sich den beiden Männern unten an der Treppe zu.
»Sie können nicht nach oben kommen«, sagte er. »Eine unserer Mitbewohnerinnen ist tot.«
Das sorgte erst recht für Aufregung. Der erste der beiden städtischen Beamten raste die Treppe hinauf wie ein Windhund, an mir vorbei und an Squib, dann stieß er Nev auf dem Treppenabsatz zur Seite. Der Hund begann zu bellen und wollte ihm hinterher, doch Squib hielt ihn am Halsband fest.
»Wo?«, brüllte der Beamte. »Sind Sie sicher?«
»Sie hat sich umgebracht!«, brüllte Squib ihm hinterher. »Sie sind schuld, Sie sind gestern vorbeigekommen und haben gesagt, dass wir verschwinden müssen! Sie wurde depressiv, und dann hat sie sich das Leben genommen!«
Der Dicke stampfte mit schweren Schritten die Treppe hinauf. Er drückte sich an mir vorbei und bedachte mich mit einem dreckigen Blick. Er litt unter Körpergeruch von der Sorte, von der nicht einmal sein bester Freund ihm etwas gesagt hätte. Die Treppenstufen knarrten. Ich hoffte, sie würden unter seinem Gewicht nachgeben, morsch von der Trockenfäule, wie sie waren, doch das taten sie nicht. Wahrscheinlich war es besser so. Sonst hätten wir zwei Tote im Haus gehabt.
»Sie ist da drin«, murmelte Nev. »Wir haben sie nicht angerührt.«
Die beiden Männer hatten die Tür zu Terrys Zimmer geöffnet. Einen Augenblick herrschte Totenstille, dann begann der Dicke zu fluchen.
Wir hörten ihn schimpfen: »Das wird ein gefundenes Fressen für die Presse!«
Der dünnere Mann sagte ihm, er solle die Klappe halten. Dann unterhielten sie sich mit gedämpften Stimmen. Wir konnten nichts verstehen. Schließlich kam der Dünne wieder aus dem Zimmer und sprach zu uns allen.
»Wir holen jetzt die Polizei. Sie bleiben hier. Lassen Sie niemanden ins Haus. Reden Sie mit niemandem darüber!« Er zögerte. »Mein Kollege Mr. Wilson hier wird bei Ihnen bleiben.«
Der Fettsack trottete zum Treppenabsatz und funkelte uns an. Er sah um einiges weniger zuversichtlich aus als noch bei seiner Ankunft. Squibs Hund begann erneut zu knurren.
Der Dicke wich ein Stück zurück. »Was ist das für ein Hund? Etwa ein Pitbull?«
»Sieht er vielleicht aus wie ein Pitbull?«, fragte ich. »Er ist ja gerade mal halb so groß!«
»Ich schätze, er hat ein wenig Staffordshire in sich«, sagte Squib stolz. »Wenn er seine Zähne erst in etwas geschlagen hat, lässt er nicht mehr los.«
»Um Himmels willen«, sagte Mr. Wilson zu seinem Kollegen, »beeil dich bloß mit den Bullen! Mach, dass du so schnell wie möglich wieder hier bist!«
Wir saßen alle unten im Wohnzimmer und warteten auf das Eintreffen der Polizei, Wilson inbegriffen. Er saß neben der Tür wie ein Gorilla, die Arme über dem Bierbauch verschränkt, und bewachte uns. Wenn er uns nicht beobachtete, dann beobachtete er den Hund.
Squib kauerte in der entgegengesetzten Ecke, die Arme um seinen Hund geschlungen, und flüsterte in sein spitzes Ohr. Der Hund drehte immer wieder den Kopf und sah seinen Herrn an. Ein oder zwei Mal leckte er ihm das Gesicht. Niemand würde behaupten können, dieses Tier sei gefährlich. Hoffte ich jedenfalls.
Nev hielt sich wacker. Er saß am Kamin, und nur das nervöse Zucken seiner Hände verriet die Anspannung, unter der er stand. Von Zeit zu Zeit blickte er mich an, wie um sich rückzuversichern. Ich lächelte ihm beruhigend zu. Es kostete mich einige Anstrengung. Mir war überhaupt nicht zum Lachen zumute. In meinem Kopf rasten die Gedanken, und ich wusste, dass ich alles sortieren musste, bevor die Polizei hier eintraf.
Sie würden uns beispielsweise wegen Terry Fragen stellen, und es gab nicht sonderlich viel, das wir ihnen hätten sagen können. Wir konnten vorschlagen, dass sie Lucy fragen sollten. Das war auch schon ungefähr alles. Ich versuchte angestrengt, mich an alles zu erinnern, was sie gesagt hatte, an jedes Wort, seit sie bei uns eingezogen war. Aber ich hatte sie nicht gemocht und nicht viel mit ihr gesprochen, wenn ich nicht musste, und das war es. Nicht eine Gelegenheit genutzt.
Sie wusste sich immer auszudrücken, wie eine junge Frau aus der Oberschicht. Sie hatte mich an die Mädchen aus der Privatschule erinnert, auf die ich gegangen war, bis mein Vater höflich gebeten wurde, mich von der Schule zu nehmen. Sicher, Terry hatte auch das Vokabular benutzt, das sie draußen auf der Straße aufgeschnappt hatte, in dem Bemühen, so wie alle anderen zu klingen. Aber es hatte nicht funktioniert. Sie hatte immer noch anders geklungen. Und dann war da diese Strickjacke mit dem teuren Etikett. Sie hatte sie bei sich gehabt, als sie zu uns gekommen war. Sie trug sie an jenem Abend, als Lucy sie mitgebracht hatte. Ich wusste, dass sie diese Jacke nicht von Oxfam hatte, auch wenn sie es behauptete. Sie hatte sie von zu Hause mitgebracht, wo auch das sein mochte.
Was ihre Freundinnen anging, ich wusste nicht einmal, ob sie welche hatte oder was sie tagsüber gemacht hatte. Die Polizei würde fragen, ob sie mit Squib oder Nev zusammen gewesen war. Mit keinem von beiden. Nev wurde im Allgemeinen mit mir in Verbindung gebracht, auch wenn unsere Freundschaft rein platonisch war. Ich war, wenn überhaupt etwas, dann Nevs Kindermädchen. Er kam nicht gut alleine zurecht. Squib hatte seinen Hund. Er brauchte keine Menschen um sich.
Declan war derjenige, den Terry gemocht hatte. Doch wir wussten nicht, wohin Declan verschwunden war, außerdem hatte er seine eigenen Scherereien. Ich wollte die Polizei nicht auf Declan hetzen. Ich hatte ihn gemocht.
Blieb die wichtigste aller Fragen: die Frage nach dem Warum. Warum hätte sie sich umbringen sollen? Ich konnte den Gedanken nicht akzeptieren, auch wenn ich sie mit meinen eigenen Augen da hängen gesehen hatte. Sie war mir weder gedrückter Stimmung noch übermäßig besorgt erschienen wegen des Räumungsbescheids, nicht mehr als jeder andere von uns. Trotz Squibs Theorie glaubte ich nicht, dass sie verängstigt genug gewesen war, um zu einem derart extremen Mittel zu greifen. Sie war wie üblich gewesen, unausstehlich und ewig mürrisch. In meinem Hinterkopf schrillten Alarmglocken los, und mir gefiel mitnichten, was sie mir zu sagen versuchten.
Ich erinnerte mich, wie sie angezogen gewesen war, als wir sie gefunden hatten, in der offenen Hose und dem zerknitterten Hemd. Ich konnte nicht verstehen, warum der Reißverschluss nicht geschlossen gewesen war. Wenn sie so herumgelaufen war, bevor sie es getan hatte, dann wäre ihr die Jeans auf den Knöcheln gelandet. Also hatte sie es, nur noch den Suizid im Kopf, eilig gehabt und sich nicht um den Reißverschluss gekümmert? Oder … – eine Idee, so grotesk sie auch klingen mochte, nahm in meinem Kopf Gestalt an: Hatte jemand anderes, während sie nicht bei Bewusstsein gewesen war, sie angezogen, voller Panik am Reißverschluss herumgefummelt und schließlich aufgegeben? Der Duft nach teurem Eau de Cologne im Haus, als Nev und ich aus Camden zurückgekehrt waren, fiel mir wieder ein, ebenso mein Gefühl, dass irgendjemand Fremdes während unserer Abwesenheit im Haus gewesen war.
Ich schob jenen unangenehmen Gedanken fürs Erste beiseite und konzentrierte mich auf etwas anderes. Die Leichenstarre. Wenn die Polizei feststellte, dass sie am gestrigen Nachmittag gestorben war, würde sie von uns wissen wollen, wo wir gewesen waren, wann wir sie das letzte Mal gesehen hatten und ob sie auf irgendeine Weise beunruhigt, verzweifelt gewirkt hatte. Kein Polizist würde unter den gegebenen Umständen wohl akzeptieren, dass wir von nichts gewusst hatten und nicht am Tatort gewesen waren, jedenfalls nicht ohne Bestätigung von dritter Seite. Wir gehören nicht zu der Sorte Leute, deren Wort man einfach so Glauben schenkt. Also benötigten wir Alibis, ganz offensichtlich.
Nev und ich konnten mit ein wenig Glück beweisen, dass wir zum fraglichen Zeitpunkt bei seinen Freunden gewesen waren und scharfes, richtig mexikanisches Chili gegessen hatten. Was Squib anging, unser Pflastermaler hatte ohne Zweifel Hunderte von Zeugen für seine Aktivitäten. Doch alle wären an ihm vorbeigegangen, ohne die gebeugte Gestalt mehr als flüchtig wahrzunehmen, die eifrig das Pflaster mit Malkreide bearbeitete. Einige hätten das, was er da malte, genauer betrachtet, doch kaum jemand hätte sich die Mühe gemacht, den Künstler in Augenschein zu nehmen.
Ich schien mich in meinem Sessel bewegt zu haben, denn mit einem Mal bemerkte ich, dass Wilson mich aus wachsamen Knopfaugen anstarrte. Er verspannte sich, als ich mich bewegt hatte, wohl weil er glaubte, dass ich Anstalten träfe, durch eine der Fensterscheiben nach draußen zu springen und über die Straße davonzurennen, wie sie es im Film tun. Er sah wahrscheinlich zu viel fern.
»Ich brauche ein Glas Wasser«, sagte Nev und stand auf.
»Sie bleiben schön da sitzen, wo Sie sind, Sonnenschein«, befahl Wilson.
»Er hat sich erbrochen!«, fauchte ich. »Bleib hier, Nev, ich hole dir Wasser.« Ich marschierte zu Wilson und baute mich vor ihm auf. »Und Sie haben nicht das geringste Recht, mich daran zu hindern!«, sagte ich. »Vergessen Sie nicht, Ihr Kollege war gestern hier, und unsere Mitbewohnerin starb unmittelbar danach.«
»Sie haben ein loses Mundwerk«, sagte er.«
»Und Sie einen fetten Bauch«, entgegnete ich.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: