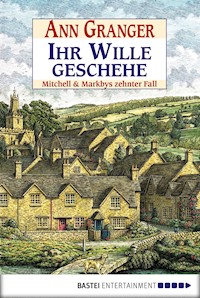9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Mitchell & Markby Krimi
- Sprache: Deutsch
Als der Obdachlose Miff Ferguson Zeuge eines Mordes wird, entbrennt zwischen ihm und dem Mörder ein gnadenloses Katz-und-Maus-Spiel. Schließlich sucht Miff Zuflucht bei seiner Tante in Weston St Ambrose. Doch als man eine zweite Leiche in einer Scheune entdeckt, wird klar: Miff schwebt nach wie vor in höchster Gefahr. Die Uhr tickt, und um den Fall zu lösen und zu verhindern, dass noch ein Mensch sein Leben verliert, müssen Inspector Jessica Campbell und Ian Carter sich erneut mit der Polizei in Bamford verbünden - und mit Mitchell und Markby ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
INHALT
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungZitatKapitel einsKapitel zweiKapitel dreiKapitel vierKapitel fünfKapitel sechsKapitel siebenKapitel achtKapitel neunKapitel zehnKapitel elfKapitel zwölfKapitel dreizehnKapitel vierzehnKapitel fünfzehnKapitel sechzehnKapitel siebzehnKapitel achtzehnKapitel neunzehnEpilogÜber dieses Buch
Als der Obdachlose Miff Ferguson Zeuge eines Mordes wird, entbrennt zwischen ihm und dem Mörder ein gnadenloses Katz-und-Maus-Spiel. Schließlich sucht Miff Zuflucht bei seiner Tante in Weston St Ambrose. Doch als man eine zweite Leiche in einer Scheune entdeckt, wird klar: Miff schwebt nach wie vor in höchster Gefahr. Die Uhr tickt, und um den Fall zu lösen und zu verhindern, dass noch ein Mensch sein Leben verliert, müssen Inspector Jessica Campbell und Ian Carter sich erneut mit der Polizei in Bamford verbünden – und mit Mitchell und Markby …
Über die Autorin
Ann Granger war früher im diplomatischen Dienst tätig. Sie hat zwei Söhne und lebt heute mit ihrem Mann in der Nähe von Oxford. Bestsellerruhm erlangte sie mit der Mitchell-und-Markby-Reihe und den Fran-Varady-Krimis. Nach Ausflügen ins viktorianische England mit den Kriminalromanen »Wer sich in Gefahr begibt« und »Neugier ist ein schneller Tod« knüpft sie mit »Stadt,Land, Mord«, dem ersten Band der Reihe um Inspector Jessica Campbell, wieder unmittelbar an die Mitchell-und-Markby-Reihe an.
Aus dem Englischen von Axel Franken
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2020 by Ann Granger
Titel der englischen Originalausgabe: »A Matter of Murder«
First published in Great Britain in 2020by HEADLINE PUBLISHING GROUP
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Gerhard Arth, Molzhain
Lektorat: Stefan Bauer
Titelillustration: © David Hopkins
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-1005-36
luebbe.de
lesejury.de
Dieses Buch ist für meinen Enkelsohn William. Viel Glück bei deinem Studium, Will, und bei allem, was du in der Zukunft unternimmst.
Verlassen Sie sich drauf, Sir, wenn ein Mann weiß, dass er in vierzehn Tagen gehängt werden soll, dann arbeitet sein Gehirn wunderbar konzentriert.
Dr. Samuel Johnson
KAPITEL EINS
Miff Ferguson lebte nun schon seit zwei Jahren auf der Straße. Nach seiner eigenen Einschätzung war er ganz gut zurechtgekommen, aber dennoch schien jeder Tag eine weitere Hürde im Hindernislauf mit Namen Überleben zu sein.
Heute dachte er über den kommenden Winter nach, der zwar noch nicht unmittelbar vor der Tür stand, aber es konnte nie schaden, vorauszuplanen. Wenn man kein festes Dach über dem Kopf hatte, konnte das Leben auf der Straße im Winter leicht tödlich enden. In letzter Zeit hatte es viel geregnet. Sein kleines Zelt, das gerade groß genug war, dass er in seinen Schlafsack kriechen und sich wie eine Schnecke zusammenrollen konnte, war bis zu einem gewissen Grad wasserdicht, dennoch bahnten sich bei Starkregen Rinnsale den Weg ins Innere. Und vor Schnee und eisigen Temperaturen würde es ihn sicher nicht schützen; falls es einen harten Winter gäbe, benötigte er einen solideren Unterschlupf. Nichts Ausgefallenes, sagte er sich, als er bei Tagesanbruch mit einem Pappbecher heißen Kaffees von einer bereits frühmorgens öffnenden Tankstelle über den Bürgersteig tappte. Das Personal dort kannte ihn. Wenn der Geschäftsführer da war, musste er für seinen Kaffee bezahlen; die Mädchen verlangten nie etwas von ihm. Eine leere Lagerhalle, das obere Stockwerk eines leer stehenden Hauses, irgendetwas mit Ziegeln und Mörtel, das war es, wonach er suchte. Es gab mehrere leere Ladenlokale in der Gegend, aber die waren in der Regel gut durch Alarmanlagen gesichert.
Obwohl es noch früh war, waren schon einige Leute unterwegs. Manche gingen zur Arbeit, andere kamen von der Nachtschicht nach Hause. Die Ladenbesitzer, vor allem die Zeitungshändler, öffneten ihre Geschäfte. Eine alte Dame war offensichtlich auf dem Weg zu einem Frühgottesdienst. Es war überraschend, wie viele Menschen auf den Beinen waren, sobald es hell wurde. Das Tolle an ihnen allen war, soweit es Miff betraf, dass sie sich im Allgemeinen gegenseitig ignorierten. Deshalb war es für jemanden wie Miff eine gute Zeit, um Möglichkeiten auszuloten.
Wenn man nachts umherstreifte, war die Wahrscheinlichkeit groß, dass irgendein Wichtigtuer zum Telefon griff und die Polizei rief. Viele Leute blieben lange in ihren eigenen vier Wänden auf. Miff spekulierte manchmal darüber, was sie taten, was sie vom warmen, bequemen und trockenen Bett fernhielt. Vielleicht saßen sie an ihren Computern, spielten Spiele, schauten Pornos oder versuchten ihr Glück in Onlinecasinos. Oder sie wurden von einem unruhigen Kind gerufen, einem hungrigen Baby, oder sie konnten nicht einschlafen und dachten, eine Tasse Tee könnte helfen. Was auch immer sie taten – und ehrlich gesagt war es Miff egal, was es war –, es bestand immer die Möglichkeit, dass einer von ihnen beschloss, zum Fenster zu gehen und auf die schattige Straße hinunterzuschauen. Eine einsame Gestalt, die dort entlangschlenderte und die Gebäude inspizierte, machte sie nervös.
Nicht dass er die Hausbewohner in irgendeiner Weise beneidet hätte. Miff hatte nicht das Verlangen, sich ihnen dauerhaft anzuschließen und in einer schicken Residenz mit Doppelverglasung und vielleicht einem ehemaligen Garten zu wohnen, der jetzt zubetoniert war, um einen Parkplatz abseits der Straße zu schaffen. Vor allem aber wollte er nicht Teil einer festen Gemeinschaft sein. Das hatte er ausprobiert, und er hatte es gehasst. Nachbarn bedeuteten, dass andere Menschen mehr über dich wussten, als sie das Recht dazu hatten. Sie beobachteten dein Kommen und Gehen. Sie fragten sich, was du beruflich machst. Sie luden dich zu einem netten, kleinen Abendessen ein, das sich als eine Einladung vor die Großinquisition entpuppte. Je weniger sie wussten, desto misstrauischer wurden sie. Es schürte das Feuer ihrer größten Angst: fallende Immobilienpreise. All das hatte Miff erlebt. All das war schließlich unerträglich geworden. Das war der Zeitpunkt gewesen, an dem Miff beschlossen hatte, wegzugehen. Bis jetzt hatte er es nicht bereut. Obwohl, um ehrlich zu sein, der letzte Winter war hart gewesen. Für den kommenden Winter würde er besser planen.
Wenn Miff sich irgendeiner Art von Lebewesen verwandt fühlte, dann den Füchsen, die im Schutz der Dunkelheit herauskamen und den Abfall nach Nahrungsresten durchstöberten. Oder den Katzen. Miff mochte Katzen und fühlte, dass er viel mit ihnen gemeinsam hatte.
Nachts hörten die Katzen auf, so zu tun, als wären sie domestizierte Miezen – Teil einer geordneten Welt –, und wurden zu wilden Wesen. Sie schlichen durch Klappen, die freundliche Hausbesitzer in ihre Hintertüren eingebaut hatten, ins Freie und verließen das Haus als gepflegte, wohlgenährte, anhängliche Familienmitglieder. Noch bevor sie das nächste Blumenbeet erreichten, verwandelten sie sich in räuberische Jäger, klein, aber schnell und rücksichtslos. Kein noch so kleines Geräusch, keine noch so kleine Bewegung entging ihnen, jeden noch so flüchtigen Geruch nahmen sie wahr, und sie verfügten über einen sechsten Sinn, der sie vor Gefahren warnte. Dann waren sie weg, vollendete Athleten, kletterten mühelos eine Mauer, einen Zaun oder einen Baum hoch und schlüpften durch enge Öffnungen, durch die ein Mensch gerade mal eine Hand stecken konnte.
Wenn eine Katze und Miff in der Dunkelheit aneinander vorbeikamen, ignorierten sie einander und gingen jeweils ihren eigenen Geschäften nach. Aber sobald ihre wilden Instinkte befriedigt waren, verwandelten sich die meisten Katzen wieder in domestizierte Miezen und trotteten in gemütliche Häuser, um den Tag zu verdösen, anders als Miff. Dennoch beneidete er sie nicht. Manchmal dachte er, dass die Katzen sich verkauft hatten, indem sie, wenn auch nur stundenweise, ein häusliches Leben akzeptierten.
Tagsüber war er immer fröhlich und plauderte mit Passanten, die anhielten, um ihm wegen seines Unglücks, obdachlos zu sein, ihr Mitgefühl auszusprechen, gelegentlich ein wenig Geld oder ein Sandwich anzubieten oder ihn manchmal wegen seiner Arbeitsscheu zu beschimpfen.
»Probieren Sie es mal aus, Kumpel!«, riet er Letzteren immer. »Versuchen Sie mal, auf der Straße zu überleben.« Meistens brummten sie irgendetwas und gingen weiter, wenn er das zu ihnen sagte.
Das einzige Mal, dass er den Kopf eingezogen und so getan hatte, als ob er schliefe, war an dem Tag gewesen, an dem er einen Kerl, mit dem er zur Schule gegangen war, entdeckt hatte, der mit dem ganzen Selbstvertrauen eines erfolgreichen Geschäftsmanns auf ihn zugestiefelt kam. Der alte Schulkamerad war an ihm vorbeimarschiert, ohne ihn zu bemerken, und Miff hatte erleichtert aufgeatmet.
Danach hatte er London verlassen und sich eine Zuflucht in Bamford in den Cotswolds gesucht, wo er es bestimmt vermeiden konnte, jemandem zu begegnen, den er kannte. Wenn sich bei seinen ehemaligen Arbeitskollegen herumgesprochen hätte, dass er auf der Straße lebte, wäre das allein schon schlimm genug. Aber wenn die Sache beim nächsten Klassentreffen bekannt würde, würde die Schulleitung seinen Namen wahrscheinlich von der Liste der Ehemaligen streichen. Seine Eltern wären gedemütigt, denn sie hatten allen erzählt, dass er als Freiwilliger in einem Flüchtlingslager an einem unzugänglichen Ort auf dem Globus arbeitete. Außerdem waren sie vorsichtshalber nach Portugal gezogen.
In Wahrheit war er wirklich am glücklichsten in der Nacht. Nachts gab es keinen Grund, sich zu verstellen. Man konnte man selbst sein. Er mied die Betrunkenen – sie waren immer unberechenbar, bei ihnen wusste man nie. Manchmal taumelten sie nach Hause und durchlebten dabei den Abend noch einmal und kümmerten sich mehr um die anderen Nachtschwärmer als um Obdachlose. Manchmal stürzten sie in einem regelrechten Knäuel aus dem Pub oder dem Klub und fielen sofort über den Ersten her, den sie entdeckten, aus Gründen, an die sie sich am Morgen nicht mehr erinnern würden. Manchmal setzte der Alkohol einen grausamen Humor frei, und ein schlafender Körper wurde zur Zielscheibe. Die Betrunkenen hasste Miff am meisten.
Natürlich sah man nachts alles Mögliche. Aber man hielt den Mund, das war klar. Er kannte einige professionelle Einbrecher vom Grüßen. Er belästigte sie nicht, und sie machten sich seinetwegen keine Gedanken.
Er hatte einen vernachlässigten Bereich der Stadt erreicht. Einst hatte es hier eine belebte Siedlung mit kleinen Produktionsbetrieben gegeben – sie waren schon lange stillgelegt. Während sich die Planer darüber stritten, was mit dem Gelände und seinen maroden Gebäuden geschehen sollte, verkam es langsam und verfiel. Regen drang durch beschädigte Dächer ein; die Fenster waren zerbrochen und lückenhaft vernagelt. Unkraut begann das Areal zu erobern, zusammen mit Wildtieren. Von Zeit zu Zeit gab es auch Menschen hier: solche, die sich den Behörden und unangenehmen Fragen entziehen wollten, und Leute wie Miff. Oder nicht ganz so wie Miff, der seinen Platz nicht mit denen teilen wollte, die eine Gefahr darstellen könnten, seien es Drogenabhängige, die sich den Schädel zugedröhnt hatten, oder Schizophrene, die der nicht vorhandenen »Betreuung in der Gemeinde« überlassen wurden.
Miff war nicht auf der Straße, weil er Drogen nahm, vor der Justiz floh oder an einer psychischen Krankheit litt. Er war hier, weil er eines Tages einfach ausgestiegen war: aus dem ständigen Konkurrenzkampf, aus den Erwartungen anderer Leute, aus der Verantwortung gegenüber anderen Personen. Er hatte nicht das erlitten, was die Ärzte einen »mentalen Zusammenbruch« nannten, sondern nur eine völlige mentale Veränderung seines Blickwinkels. Er war einfach, so erklärte er es sich selbst, aufgewacht, wie aus einem langen, beunruhigenden Traum, und hatte sich auf die Suche nach einem Ausweg gemacht.
Um auf die gegenwärtigen konkreten Ziele zurückzukommen, so hatte er diese Gegend seit einer Woche oder länger erkundet. Bis jetzt schien sie einigermaßen verlassen und so sicher zu sein, wie man es erwarten durfte. Wenn ein paar Landstreicher wie er sich über den kommenden Winter hier niederlassen würden, so störte ihn das nicht. Zu mehreren war man sicherer, vorausgesetzt, es wurden nicht zu viele. Wenn die Bewohner allerdings zu zahlreich wurden, um von zufälligen Besuchern oder Passanten ignoriert werden zu können, würde irgendein Wichtigtuer die Behörden informieren und man würde sie vertreiben. Aber er hatte diesen Ort als eine klare Möglichkeit abgespeichert.
Dennoch stellte er zu seinem Ärger fest, dass er nicht der erste Besucher an diesem frühen Morgen war. Nicht dass der erste Ankömmling am Schauplatz aus demselben Grund da war wie er selbst. Nein, der andere Besucher – wer auch immer er war – war in einem sauberen, glänzenden schwarzen BMW mit neuen Nummernschildern angekommen, der aussah, als käme er gerade aus dem Autohaus. Der Anblick dieses Wagens in dieser Umgebung war ungewöhnlich, seine Anwesenheit unerklärlich.
Er hätte sich natürlich umdrehen und den Ort schnellstmöglich verlassen müssen. Leider vertraute er ausnahmsweise nicht auf seinen Instinkt. Er blieb. Im Nachhinein fragte sich Miff manchmal, warum er nicht einfach die Flucht ergriffen hatte. Menschliche Neugierde? Oder weil er die Anwesenheit des Autos irgendwie anstößig fand? Jedenfalls hatte es hier nichts zu suchen, so viel stand fest.
Der Fahrer hatte an einer geöffneten Seitentür des Gebäudes geparkt. Miff wusste, dass die Tür normalerweise zu war und den Anschein erweckte, fest verschlossen zu sein. Er wusste aber auch, dass das lediglich eine Illusion war. Das Schloss war kaputt. Er hatte es nicht kaputt gemacht – das hatte jemand anders getan, schon vor einer Weile. Wenn man sich Zutritt verschaffen wollte, musste man nur eine Schulter an die Tür legen und kräftig drücken. Dann ließ sie sich mit einem kratzenden Geräusch gerade so weit öffnen, dass man sich hindurchzwängen konnte. Ganz ging sie nicht auf, weil dahinter ein Haufen Gerümpel gestapelt war, aber es reichte, um einen reinzulassen. Einfaches unbefugtes Betreten – so glaubte Miff, der viele verregnete Nachmittage in der örtlichen Bibliothek verbracht hatte, an denen er über solche Dinge las, zu wissen – war ein zivilrechtliches Vergehen. Wunderbare Sache, das Stadtbücherei-System. Man konnte dort mit einem Buch sitzen, und mit etwas Glück wurde man von niemandem belästigt. Unbefugtes Betreten war auch das, was der Fahrer des BMW tat, so schlussfolgerte Miff.
Woher er (der Fahrer) von der Tür wusste, konnte Miff nicht sagen. Aber der unbekannte Besucher war in der Lagerhalle: Dessen war sich Miff ziemlich sicher. Aber was machte er da drin? Nach einem Unterschlupf für den Winter suchte er wohl nicht – nicht jemand, der ein solches Auto fuhr. Aber warum schlich er hier herum und machte sich den vorangegangenen Vandalismus zunutze, um hineinzukommen?
»Verdammter Bauunternehmer!«, murmelte Miff. Hier war jemand im Morgengrauen auf Erkundungstour, um die Möglichkeiten abzuwägen, bevor er den Eigentümern des Geländes einen Geschäftsvorschlag machte. Das war Miffs Vermutung. Das hier war jemand, der das ganze klapprige Gebäude abreißen und eine Minisiedlung mit Eigenheimen hochziehen wollte oder einen Block mit Seniorenwohnungen, ein Fitnessstudio und eine Freizeitanlage mit einer Bowlingbahn und Squashcourts … Tja, alles davon war möglich oder etwas ganz anderes.
Die Neugierde zog ihn näher. Er schob sich an der schimmernden Karosserie des BMW vorbei. »Kapitalist!«, brummte Miff den leeren Fahrersitz an. »Den hungernden Armen das Wasser abgraben! Feind der Obdachlosen!« Zur Sicherheit fügte er noch hinzu: »Fossile Brennstoffe verheizen! Treibhausgase ausstoßen und die Atmosphäre verschmutzen!« Das schien ihm ausreichend, um weiterzugehen.
Er hatte die teilweise geöffnete Tür erreicht, wo er stehen blieb und lauschte. Zuerst konnte er nichts hören und fragte sich, ob, wer auch immer derjenige war, er bereits wieder gegangen war und auf dem Gelände herumstreifte. Miff hatte genauso viel Recht, hier zu sein, wie er. In Wirklichkeit hatte wahrscheinlich keiner von ihnen ein Recht, hier zu sein. Wie dem auch sei, so wie Miff es beurteilte, waren sie gleichberechtigt. Er ging näher heran und legte ein Ohr an den Spalt. Von drinnen waren keine Geräusche zu hören. Er beschloss, ein Risiko einzugehen, und schlüpfte lautlos durch die Öffnung ins dunkle Innere.
Drinnen stank es. Komisch, dachte Miff, der Geruch hatte ihn beim letzten Mal, als er hier war, nicht gestört. Jetzt schien er überwältigend zu sein; es stank nach Feuchtigkeit, Rattenurin und Verwesung – und nach einem fauligen Miasma, das sich aus allem bildete, was verrottete. Alte Friedhöfe verströmten nach starkem Regen manchmal einen ähnlichen Geruch, wenn sich die Erde in Schlamm verwandelte und auf das herabsank, was darunterlag, und übel riechende Gase aufzusteigen begannen. Jemand sollte den ganzen Ort abreißen, dachte er. Vielleicht hatte der BMW-Besitzer ja die richtige Idee, falls er tatsächlich ein Bauunternehmer auf der Suche nach einem Projekt war. Das baufällige, tote Ding, das dieses Lagerhaus war, mit Bulldozern abreißen, bis es nur noch ein Trümmerhaufen war, dann abtragen und einen Wohnblock errichten. Warum nicht?
Aber wo war er, der Fahrer des Luxuswagens? Miff zog sich in die dunkelste Ecke zurück und wartete, lauschte, hielt Ausschau nach einer Bewegung. Und sie erfolgte: ein sachtes Kräuseln in den Schatten vor ihm; ein leises Seufzen, von dem er wusste, dass es ein menschlicher Atemzug war. Der BMW-Mann war hier drin, und Miff – der verrückt gewesen sein musste, seiner Neugier nachzugeben – war mit ihm hier drin. Endlich meldete sich sein Instinkt, und er wusste, dass dies ein übler Ort war.
War ihm diese Einsicht zu spät gekommen? Wusste der Mann, dass Miff sich zu ihm gesellt hatte? Und ob er es wusste! Er konnte die Umrisse des Neuankömmlings gesehen haben, als dieser durch die Tür schlüpfte. Vielleicht hatte er einen Schritt gehört, ein Knarren, etwas so Geringfügiges, dass es kaum zu hören war, und doch, ebenso wie Miff wusste, dass der BMW-Mann da war, wusste auch der Mann von Miffs Anwesenheit.
Was jetzt?, fragte sich Miff. Einfach den Weg zurückgehen, den er gekommen war, und ganz von hier verschwinden? Die Schatten kräuselten sich wieder wie ein Seidenvorhang in einer Brise. Der BMW-Mann bewegte sich. Miffs Augen gewöhnten sich allmählich an die Dunkelheit. Die Gestalt war gedrungen, gekrümmt gewesen, aber während Miff zusah, veränderte sich diese Form. Sie wurde größer, schmaler, und ihr Atem machte mehr Geräusche, ein leiser, kratzender Ton. Der Mann war zusammengekauert gewesen und hatte sich nun zu seiner vollen Größe erhoben, etwa so groß wie Miff, der etwas weniger als ein Meter achtzig war. Er war mit etwas beschäftigt, das Anstrengung erforderte, und trotz aller Versuche, seine Atmung zu kontrollieren, konnte der Mann die rauen Stöße seiner Lunge, die zusätzliche Luft einsaugte, nicht mehr unterdrücken. Was auch immer das Objekt seiner Bemühungen gewesen war, lag zu seinen Füßen: ein anderer Umriss, der sich nicht rührte. Hatte der Mann etwas Unerwünschtes entsorgt, indem er es hier liegen ließ? Ein illegales Abladen von Müll? Eine Gewissheit verfestigte sich in Miffs Kopf: Der BMW-Mann war tatsächlich ein Eindringling. Ansonsten hätte er Miff schon längst ins Gesicht gesagt, er solle verschwinden.
Plötzlich kam Miff ein Gedanke. Vielleicht hatte der Mann ja Angst vor ihm, vor Miff. Der Mann konnte nicht damit gerechnet haben, hier zu dieser frühen Stunde noch jemanden vorzufinden. Hielt er Miff für einen Hausmeister oder Wachmann? Betrachtete er Miff als eine Bedrohung oder Herausforderung?
Miff fasste einen Entschluss. Es musste sein Tag sein, um schlechte Entschlüsse zu fassen, dachte er später. Er rief: »Ist schon gut, Kumpel, ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Ich bin nur auf der Durchreise, wie man so schön sagt!«
Was hatte ihn nur geritten, einen so plumpen Scherz zu machen?, fragte sich Miff. Weil er Angst hatte, das war der Grund.
Plötzlich bewegte sich der Mann, und zwar sehr schnell, bewegte sich auf Miff zu. Seine Gestalt wurde immer größer, wurde deutlich menschlich, mit fuchtelnden Armen, heiserem und verzweifeltem Atem. Eine ausgestreckte Hand hielt eine Art Waffe, stabförmig, aber ob aus Holz oder Metall, konnte Miff nicht erkennen.
Er wartete nicht, um es herauszufinden. Er drehte sich um und rannte zu der geöffneten Tür hinter ihm. Aber er konnte nicht durch den schmalen Spalt huschen, er musste sich durchzwängen. Er war zu zwei Dritteln im Freien und in der Freiheit – auf der Flucht –, als der Mann ihn erreichte und ihm mit der Waffe einen schmerzhaften Schlag auf die Schulter versetzte.
Miff warf sich nach vorne, stolperte und fand sich in einem Moment der Panik im Fallen wieder. Er krabbelte im Dreck, als der Mann ihn wieder erreichte. Ein weiterer Schlag traf ihn, aber er konnte gerade noch den Arm hochreißen und die volle Wucht abfangen.
Auf allen vieren kroch Miff über den Boden und schaffte es schließlich, auf die Beine zu kommen und sich umzudrehen. Für den Bruchteil einer Sekunde blickten sich die beiden an. Miff sah die Gesichtszüge, weiß, verzerrt, erfüllt von einer schrecklichen Wut und Entschlossenheit. Er dachte: Er will mich umbringen. Er will mich verdammt noch mal umbringen …
Für einen Moment gefror das Blut in seinen Adern zu Eis. Er war wie erstarrt vor Angst. Dann rannte Miff. Er rannte, wie er noch nie gerannt war. Er war schon ein paarmal in die Enge getrieben worden, schließlich lebte er ja auf der Straße. Aber noch nie hatte er um sein eigenes Leben gefürchtet. Er musste dem Angreifer entweder davonlaufen oder ihn ausmanövrieren, sonst war er, Miff, ein toter Mann.
Hier draußen im Freien war er im Vorteil. Er war mit dieser städtischen Wildnis vertraut, kannte ihre seltsamen Ecken, Sackgassen und Baulücken, und er huschte durch sie hindurch wie eine flüchtende Katze. Er hielt auf die Gegend jenseits des verlassenen Geländes zu, steuerte die Hinterhöfe der Häuser in der großen Siedlung daneben an. Miff wusste, dass er die Straßen meiden musste, denn sein Verfolger könnte zurückgehen und in sein Auto steigen und dann einfach herumfahren, bis er Miff entdeckte, und ihn dann überfahren. Aber zu Fuß, keine Chance, Kumpel!, sagte Miff im Stillen zu seinem Verfolger. Er kletterte über Zäune, warf Gartenzwerge um, krachte mit Scheppern und Getöse in einen Grill und platschte durch einen Fischteich.
Sein lautes Vorankommen war in mindestens zwei Häusern gehört worden. Die oberen Fenster wurden aufgerissen, und wütende Rufe folgten ihm. Aber die Anwesenheit von Zeugen reichte aus, um den Verfolger endgültig abzuschrecken. Miff war dankbar, als er im Schutz eines Gartenhäuschens anhielt, nach Atem ringend, mit brennender Lunge und schmerzenden Rippen, und wusste, dass er das Rennen gewonnen hatte.
*
Es war ein schlimmes Erlebnis gewesen, und er konnte es für den Rest des Tages nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Was zum Teufel hatte der andere Mann dort getrieben? Jedenfalls war er kein Bauunternehmer, der nach einem neuen Projekt Ausschau hielt, wie Miff zuerst gedacht hatte. Was war der andere Umriss gewesen, der zu den Füßen des Mannes im Halbdunkel der Lagerhalle gekauert hatte? Miffs Neugierde war noch nicht ganz befriedigt und veranlasste ihn beinahe dazu, zurückzukehren und nachzuforschen. Aber die Vernunft war stärker. Jetzt, wo er Zeit zum Nachdenken hatte, wurde ihm klar, dass er nicht nur den BMW-Mann – wie er ihn in Ermangelung eines besseren Namens bei sich immer noch nannte – identifizieren konnte, sondern dass der BMW-Mann auch Miff identifizieren konnte.
Er schaute sich im Schankraum des Pubs um, in dem er sich befand. Es war ein kleines, gewöhnliches Lokal. Die Leute, die hier abends tranken, gehörten nicht zu der Sorte, die teure Autos fuhren und Immobiliengeschäfte machten. Aber Miff ertappte sich dabei, wie er Gesichter musterte.
»Es war also ein Mädchen?«, fragte eine Stimme in der Nähe. »Die Leiche, die man gefunden hat?«
»Ja, weiß nicht, wer sie ist, ich glaube, die Polizei weiß es auch noch nicht. Jemand hat gesagt, sie ist erwürgt worden!«, kam die Antwort.
»Und in der alten Lagerhalle abgeladen?« Der Fragesteller war ein ungläubiger Thomas.
»Wenn ich es dir doch sage! Es war heute früh am Morgen und es gab Radau, ein paar Kerle rannten durch die Gärten hinter der Halle. Mehrere Leute hörten sie, manche sahen sie sogar. Einer davon ist ein Bekannter von mir. Er wollte gerade runtergehen und das Teewasser aufsetzen, als er den Tumult hörte und gerade noch rechtzeitig hinaussah, um zu sehen, wie irgendein Typ seine steinerne Venus umstieß.«
»Seine steinerne was?«, kam die skeptische Antwort.
»Venus, du weißt schon, eine von diesen Göttinnen, die ein bisschen Stoff tragen und sonst nichts. Er ist ziemlich wütend deshalb. Diese Venus ist zwar nicht aus echtem Marmor oder so, sondern aus Kunstmarmor, aber er hat dennoch zweihundert Pfund dafür bezahlt.«
»Zweihundert Pfund für eine Venus aus falschem Stein? Nicht mal aus Marmor! Der spinnt doch, dein Kumpel!«
»Na ja, seine Frau wollte sie. Und sie ist stinksauer, weil der Kopf abgebrochen ist. Wie auch immer, er rief die Polizei und meldete alles. Er war nicht der Einzige. Die Polizisten sind rausgekommen und haben sich umgesehen. Sie dachten, dass vielleicht Penner im Lagerhaus wären, und haben auch dort nachgesehen. Da haben sie dann die Leiche gefunden.«
»Na ja, man weiß ja nie, was passiert, oder?«, antwortete Thomas, am Ende doch noch überzeugt. »Hör mal, sag deinem Kumpel, dass er mal in seine Hausratversicherung gucken soll! Vielleicht ist das Zeug in seinem Garten ja mitversichert.«
Miff entschied, dass es für ihn an der Zeit war, einen unauffälligen Abgang zu machen. Draußen auf dem Bürgersteig angekommen, fühlte er sich furchtbar verwundbar. Die Polizei war auf der Suche nach einem Mörder. Miff hatte den Mörder dabei beobachtet, wie er die Leiche entsorgte. Der Mörder würde nach Miff suchen. Die Sache hatte eine grausame und unentrinnbare Logik. Wie auch immer man die Karten mischte, das Ergebnis war das Gleiche. Der Mörder hatte Miff gesehen, als er auf dem Boden herumkrabbelte. Und Miff hatte ihn gesehen. Das Bild dieses weißen, vor Wut verzerrten Gesichts hatte sich in sein Gedächtnis eingebrannt. Miffs bärtiges Gesicht und die langen, zu einem Zopf geflochtenen Haare würden in den Speicherbänken seines Angreifers abgelegt sein. Der Killer hatte keine andere Wahl, als Miff zu finden und ihn zum Schweigen zu bringen.
Er musste weg von hier. Wohin konnte er gehen? Zum Festland übersetzen und sich an die Algarve durchschlagen, um vor der Haustür seiner Eltern aufzutauchen und auszusehen wie van Gogh an einem schlechten Tag? Ausgeschlossen.
Also, wohin? Irgendwohin, wo niemand sonst auf die Idee käme, nach ihm zu suchen. Da kam ihm die zündende Idee: Er würde aufs Land fahren! Das hatten die Leute vor Jahren gemacht, wenn sie den Dingen entfliehen wollten – sie waren in ihren Kutschen auf ihre Landgüter gerattert. Also würde Miff dasselbe tun.
Der BMW-Mann würde nie auf die Idee kommen, außerhalb eines Stadtgebiets nach ihm zu suchen; die Obdachlosen waren ein Merkmal der Städte und Stadtzentren.
Miff hatte kein Landgut. Aber er hatte Familienangehörige, die im Ruhestand aufs Land gezogen waren. Er hatte schon lange keinen Kontakt mehr zu ihnen, aber soweit er wusste, lebten sie beide noch. Er würde hingehen und bei Onkel Henry und Tante Prue in dieser verschlafenen Gegend wohnen, die – wie lautete noch gleich der Name? – Weston St. Ambrose hieß. Der Ort lag in einer anderen Grafschaft, Gloucestershire, und war ein gutes Stück weg von seinem derzeitigen Aufenthaltsort. Ja, das war es, was er tun würde! Es würde Henry und Prue zwar einen Schock versetzen, wenn er auftauchte, aber sie waren nette Leute und würden ihm nicht die Tür vor der Nase zuschlagen. Jedenfalls hoffte er das. Schließlich waren sie immer anständig zu ihm gewesen, als er noch ein Kind war: nicht so anspruchsvoll und kritisch wie seine Eltern und immer gut für ein bisschen Taschengeld.
Für seine Zuflucht ihre Barmherzigkeit in Anspruch zu nehmen, würde bedeuten, zumindest vorübergehend die Unabhängigkeit aufzugeben, die er sich erworben hatte, indem er gelernt hatte, auf der Straße zu überleben. Er würde einen Grund erfinden müssen, wieso er aus heiterem Himmel dort erschien. Die Wahrheit konnte er ihnen nicht sagen. Sie würden ihm raten, zur Polizei zu gehen, sogar darauf bestehen. Aber Miff war lange genug auf der Straße gewesen, um der Polizei gegenüber misstrauisch zu sein. Er würde sich schon irgendetwas einfallen lassen. Er war ein gejagter Mann, bereit, alles zu tun, um seine Haut zu retten.
KAPITEL ZWEI
Miff verbrachte eine ruhelose Nacht im örtlichen Park. Er hatte gewartet, bis der Parkwächter seine letzte Runde gemacht hatte, denn auch wenn er sich vor dem Mann selbst hätte verstecken können, der Hund hätte ihn gewittert oder gehört. Der Hund des Parkwächters, das wusste Miff von früheren Begegnungen, war groß, muskulös und mit einem furchterregenden Gebiss ausgestattet – und Menschen wie Miff mochte er wirklich nicht. Aber nachdem der Parkwächter abgeschlossen und sich mit seinem tierischen Kumpan entfernt hatte, kletterte Miff über die Begrenzungsmauer und haute sich in dem Bereich hinter den Tennisplätzen aufs Ohr. Dort gab es einen klapprigen Unterstand, der einem Fahrradschuppen ähnelte – nur dass die Tennisspieler heutzutage nicht mehr mit dem Fahrrad, sondern mit dem Auto kamen.
Früh am nächsten Morgen, bevor die Gefahr bestand, von einem behaarten Gesicht mit Fangzähnen geweckt zu werden, das ihn anknurrte, hüpfte Miff wieder über die Mauer. Als Erstes steuerte er den nahe gelegenen Tankstellenvorplatz an, wo er sich von dem Mädchen an der Kasse einen weiteren Kaffee erschnorrte. Dann kaufte er sich an einem früh öffnenden Foodtruck am Straßenrand ein Schinkenspecksandwich. Inzwischen waren die öffentlichen Toiletten aufgeschlossen worden, und er konnte sich frisch machen. Dann, sobald sie geöffnet war, machte er sich wieder einmal auf den Weg in die Stadtbücherei.
Dieses Mal wählte Miff für seine Zwecke ein Zitatenbuch aus. Er war der Gesetzbücher ziemlich überdrüssig geworden, und die medizinischen Fachbücher waren verstörend. Er ließ sich in der Nähe eines Fensters nieder und begann, müßig darin zu blättern, die Augen auf die Seiten gerichtet, mit den Gedanken woanders. Er musste seine Flucht sorgfältig organisieren. Gut organisiert sein: Das hatte er bei seiner kurzen Tätigkeit in einer Handelsbank in der Londoner City gelernt. Er hatte sein Bestes getan, um diese Zeit der Gefangenschaft, so betrachtete er sie, aus seinem Gedächtnis zu löschen, aber die Disziplin, die ihm dort eingeimpft worden war, kam ihm jetzt zugute.
Er musste sein Aussehen ändern. Das hatte Priorität, weil es den Mörder zumindest vorübergehend durcheinanderbringen würde. Aber vor allem, weil er nicht mit seinem Haarzopf und dem buschigen Bart vor Onkel Henrys Tür auftauchen konnte. Henry und Prue waren ein altmodisches Paar. Zugegeben, sie hatten eine etwas unkonventionelle Seite, denn bei Henrys Pensionierung hatten sowohl er als auch Prue beschlossen, jeweils einen Roman zu schreiben. Miff fragte sich, ob einer von ihnen das Projekt jemals beendet hatte.
Das andere, was Miff tun musste, bevor er sich auf den Weg nach Weston St. Ambrose machte, war, sich einen Grund für seine Anwesenheit dort auszudenken. Die Blackwoods hatten bestimmt von Miffs Eltern erfahren, dass er an einem wilden Fleckchen Erde Toiletten grub, wo die Einheimischen sich seit Generationen behalfen, indem sie einfach in die Wälder gingen, wenn es nötig war. Also musste er erklären, warum er das nicht mehr machte, wie lange er schon wieder in England war und warum er seine Eltern nicht über seinen Ortswechsel informiert hatte. Wenn man eine falsche Spur legte, war es immer am besten, so viele wahre Details wie möglich einzubauen. Das hatte ihm ein Typ, der auch auf der Straße lebte, einmal gesagt. »Erzähl ihnen etwas, das sie überprüfen können!«, hatte sein Rat gelautet. »Wenn sie herausfinden, dass ein Punkt stimmt, werden sie sich nicht die Mühe machen, den Rest zu überprüfen.«
Auf der Straße zu leben war in vielerlei Hinsicht lehrreich, dachte Miff. Man lernte einige wirklich interessante Leute kennen. Vielleicht sollte er ein Buch über sie und seine eigenen Erfahrungen auf der Straße schreiben.
Ja! In seiner Aufregung hätte Miff fast das Buch mit den Zitaten fallen lassen. Heureka! Wie der alte Grieche gesagt hatte, wenn er ein Bad nahm und ihm die Antwort auf das eine oder andere Rätsel einfiel. Was Miff über aufstrebende Autoren wusste, war, dass sie dazu neigten, in Gruppen zusammenzukommen. Sie spürten einander auf und mussten den anderen Mitgliedern nicht vorgestellt werden – es genügte die Enthüllung, dass auch sie ein Buch schrieben. Henry und Prue arbeiteten wahrscheinlich immer noch an ihren Büchern. Also würde er ihnen erzählen, dass er ein Buch über Obdachlosigkeit und Entfremdung von der Gesellschaft schrieb. Ihnen erzählen, dass er ein paar Jahre lang recherchiert hatte, indem er sich unter die Obdachlosen gemischt hatte. (Nachdem er vom Latrinengraben im Dschungel zurückgekehrt war, natürlich, die Einarbeitung dieses Details durfte nicht vergessen werden.) Henry und Prue würden diese Erklärung ohne das geringste Zögern akzeptieren. Er, Miff, mochte das Buch sogar wirklich schreiben – eines Tages.
Die Bibliothekarin war zweimal beiläufig an seinem Stuhl vorbeigeschlendert und steuerte jetzt mit mehr Entschlossenheit im Blick auf ihn zu. Sie kannte ihn von früher, und ihre Toleranz gegenüber seiner Anwesenheit wurde mit jedem Besuch geringer. Miff stand auf, schwenkte das Zitatenbuch begeistert in ihre Richtung und sagte zu ihr: »Das ist ein wirklich gutes Nachschlagewerk!«
Sie nahm es ihm entschlossen aus den Händen. »Ja«, sagte sie. »Das ist es. Soll ich es für Sie wieder an seinen Platz stellen?«
»Wie überaus zuvorkommend von Ihnen!«, antwortete Miff ihr mit seinem charmantesten Lächeln, das wahrscheinlich in seiner Gesichtsbehaarung verloren ging.
Ach ja, der Bart … und der lange Zopf. Nächste Anlaufstelle: ein Friseursalon. Und nicht irgendein x-beliebiger Friseursalon. Miff wusste genau, zu welchem er gehen musste. Es war ein Herrenfriseur, der von einem Türken geführt wurde. Er hatte eine flüchtige Ladentürbekanntschaft mit dem Barbier, der ihm gelegentlich eine Tasse sehr süßen, dicken schwarzen Kaffee gab, während er Miffs Haare und Bart mit einem Anflug von frustriertem Ehrgeiz musterte. »Wenn Sie das alles mal loswerden wollen, dann kommen Sie zu mir!«
Also ging Miff zu ihm – und wurde empfangen wie ein Fürst.
»Warum jetzt?«, fragte der Barbier.
»Familie …«, erzählte Miff ihm in vertraulichem Ton. »Familientreffen, ich muss dabei sein. Großvaters Geburtstag. Fünfundneunzig Jahre alt. Aber sehr traditionsbewusst, Sie verstehen.«
Der Barbier verstand vollkommen. »Familie …«, sagte er. »Ach ja. Keine Sorge, ich richte Sie so her, dass sie sich freuen werden, Sie zu sehen!«
Nun, dachte Miff, freuen würden sie sich vielleicht nicht, aber er hoffte zumindest, dass sie nicht hysterisch reagieren würden.
Der Türke war ein kreativer Künstler. Miff musste zugeben, dass er aufrichtig beeindruckt war. Natürlich musste er einige Fragen über den fünfundneunzigjährigen Opa beantworten. Auch Miff wurde dabei sehr kreativ und verpasste dem alten Kerl eine tolle Hintergrundgeschichte, so voller waghalsiger Heldentaten, dass der Barbier ganz hingerissen war. »Ach, was für ein wunderbarer alter Herr!«
»Ja, das ist er«, stimmte Miff zu, der es selbst ziemlich bedauerte, dass er den alten Helden nie kennenlernen würde.
Es gab nur ein paar Momente, in denen sich Künstler und Kunde uneinig waren. Einer war, als der Friseur ein Streichholz anzündete und es Miff um die Ohren wedelte. Der andere betraf Miffs Weigerung, einen Schnurrbart in Betracht zu ziehen. »Ich könnte einen fabelhaften Schnurrbart machen«, meinte der Barbier wehmütig, als er Miffs Oberlippe und den Haarwuchs betrachtete, der sie zierte.
»Kein Schnurrbart«, sagte Miff mit Nachdruck. »Die Familie würde sich deswegen streiten. Sie streiten sich über alles, müssen Sie wissen.«
»Ach, Familien …«, sagte der Barbier.
Miff begutachtete sein frisch enthülltes Gesicht im Spiegel. Es war viel dünner, als er es in Erinnerung hatte, vom letzten Mal, als er es betrachtet hatte, vor dem Bart. Dort, wo die Gesichtszüge den Elementen ausgesetzt gewesen waren, sah seine Haut wettergegerbt und ein bisschen ledrig aus. Wo die Haare abrasiert worden waren, glich die Haut der eines bratfertigen Hühnchens, blass und nackt. Mit etwas Glück würden sich die unterschiedlichen Teints in ein paar Tagen angleichen. Im Moment war sein Gesicht eher verwirrend, als sähe er einen Fremden an oder jemanden, den er einmal gekannt und den er aus den Augen verloren hatte. Aber würde die Veränderung reichen, um den Mann, der ihn jagte, von seiner Fährte abzubringen? Wäre er damit auf der Straße sicher? Miff konnte es nicht mit Gewissheit sagen. Jeder konnte sehen, dass ihm kürzlich ein Bart abgenommen worden war. Der Mörder würde das bemerken. Die Rasur allein würde nicht genügen, um seine Sicherheit zu gewährleisten.
Ihm war klar, dass er für Henry und Prue ein Fremder sein würde, wenn er an ihre Tür klopfte. Vielleicht würden sie ihn erkennen, gerade so. Sie würden keine Ahnung haben, warum er da war. Er fragte sich, wie misstrauisch sie sein würden. Sie taten ihm ein wenig leid, aber nicht genug, um seinen Entschluss zu ändern. In Weston St. Ambrose wäre er sicher.
»Ihre Familie wird sich freuen, Sie zu sehen!«, sagte der Barbier mit einem strahlenden Lächeln, während er die Handvoll diverser Münzen, die Miff als Bezahlung überreichte, gnädig entgegennahm.
»Ja …«, murmelte Miff. Anfangs, ja, das mochte sein. Sobald sie merkten, dass er bleiben wollte, wären sie vielleicht nicht mehr so begeistert.
*
Familientreffen lagen in der Luft, unter anderem in Gloucestershire, wo Jess Campbell ihre Mutter Leonie besuchte, begleitet von Mike Foley. Mike hatte eine Zeit lang an der Seite von Jess’ Zwillingsbruder Simon für eine medizinische Hilfsorganisation in Afrika gearbeitet. Aber Mike war dort krank geworden, ernsthaft krank. Er war nach Großbritannien zurückgeschickt worden. Obwohl er jetzt wieder gesund war, war er offensichtlich immer noch ein Mann, der eine Krankheit durchgemacht hatte. Das Gewicht, das er verloren hatte, kehrte nur langsam zurück. Er sah viel besser aus als bei seiner Ankunft zu Hause, als Jess ihn zum ersten Mal seit Jahren wiedergesehen hatte. Sie würde den Anblick nicht vergessen, wie er vor ihrer Wohnung wartete, angelehnt an ein von seinem Onkel geliehenes Auto. Simon hatte sie gewarnt, dass sein alter Freund krank gewesen war. Dass sie eine wandelnde Vogelscheuche zu erwarten hatte, mit lose hängenden Kleidern, kantigen Gelenken und gezeichneten Gesichtszügen, hatte er ihr nicht gesagt.
Mike hatte sich inzwischen so weit erholt, dass Jess es für sicher hielt, ihn zu ihrer Mutter mitzunehmen, damit er sie über Simons Situation informieren konnte. Sie waren sich beide nicht sicher, welchen Empfang sie zu erwarten hatten.
Leonie Campbell als Bedenkenträgerin zu bezeichnen, wurde der Sache nicht gerecht: Sie hatte das Grübeln zu einer hohen Kunst erhoben. Sie machte sich Sorgen um Jess, weil ihre Tochter eine Karriere bei der Polizei gewählt hatte; und Leonie konnte nicht verstehen, warum. »Es kommt mir so – seltsam vor, Liebes«, hatte sie gesagt, als sie von der Entscheidung ihrer Tochter erfuhr. Jess hatte versucht, es zu erklären, aber ihre Mutter hatte bloß noch verwirrter dreingeblickt.
Noch mehr Sorgen machte sich Leonie wegen Simons medizinischer Arbeit: »Da draußen ist er in solcher Gefahr!« Sie wollte unbedingt aus erster Hand von Mike hören, dass alles in Ordnung war.
»Papa war in der Armee«, hatte Jess ihr ins Gedächtnis gerufen. »Die Armee ist auch keine sichere Karriere – jedenfalls entspricht sie nicht deiner Vorstellung von gefahrlos.«
»Bei deinem Vater war das etwas anderes!«, erwiderte Leonie scharf.
Deshalb hatten sie den Besuch bei ihr verschoben, bis Mike wieder einigermaßen fit war. Trotzdem lief es nicht gut.
Wenn Jess ein Wort gebraucht hätte, um ihre Mutter zu beschreiben, wäre das Wort ihrer Wahl »ordentlich« gewesen. Sie hatte immer ein gepflegtes Äußeres gehabt. Jess konnte sich nicht daran erinnern, dass ihre Mutter einmal zerzauste Haare gehabt oder den Tag ohne sorgfältig aufgetragenes Make-up oder saubere Kleidung begonnen hätte. Als Armeefamilie hatten sie in verschiedenen Unterkünften gelebt, als Jess und Simon noch jung waren. Aber jedes Haus und jede Wohnung, wo auch immer, war von Leonies Ordnungsfimmel geprägt gewesen.
Darüber hatten sie und ihr Bruder einmal diskutiert, nachdem Jess zur Polizei gegangen war. »Weißt du, was dich an einer Polizeikarriere reizt?« Simon verriet es ihr. »Dass die Polizisten mit Leuten zu tun haben, deren Leben unordentlich ist. Es sind Leute, die in einen Schlamassel geraten sind, entweder absichtlich oder aus Versehen, aber auf jeden Fall ist ihr Leben nicht mehr im Einklang mit der Gesellschaft.«
»Hey! Du bist kein Psychiater!«, hatte Jess sich verwahrt.
»Dazu muss man kein Psychiater sein. Nur ein aufmerksamer Beobachter.«
»Okay, was ist, wenn ich sage, dass du aus demselben Grund Medizin studiert hast? Menschen werden krank. Du willst sie gesund machen. Du willst sie wieder in Ordnung bringen.«
Dies hatte zu einer lebhaften Auseinandersetzung geführt, die aber freundschaftlich endete.
Jetzt saßen sie und Mike in Leonie Campbells Häuschen, wo nichts dort war, wo es nicht hingehörte, aßen Kuchen und führten gestelzte Gespräche.
»Und Sie sind sich ganz sicher, lieber Mike«, sagte Leonie Campbell zum x-ten Mal, »dass Simon nicht krank ist?« Sie beugte sich vor und musterte ihn. »Sie haben sich etwas Schreckliches eingefangen, nicht wahr? Jeder kann sehen, dass Sie furchtbar krank waren. Wenn ich daran denke, wie es da draußen sein muss, mit all diesen Krankheiten, und keine richtige Hygiene oder so was! Außerdem sind da all diese Männer mit Gewehren. In den Nachrichten war kürzlich etwas darüber zu sehen. Sie sagten, die Kämpfe dort seien wieder aufgeflammt.« Sie schauderte. »Simon muss in der gleichen schrecklichen Gefahr sein.«
»Er war gesund wie ein Fisch im Wasser, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe«, sagte Mike ihr – erneut.
»Ich mache mir nur Sorgen um ihn, verstehen Sie?«
»Oh ja, das verstehe ich gut, Mrs. Campbell.«
»Sie hätten ohne Weiteres sterben können«, fuhr Leonie fort, die es zwar gut meinte, aber, wie Jess fand, gelinde gesagt taktlos war.
»Ich bin vollständig genesen«, versicherte Mike ihr.
»Sie gehen aber nicht noch einmal dorthin, oder?«, fragte Leonie besorgt. »Nehmen Sie doch noch ein Stück von dem Biskuitkuchen!«
»Nein, wirklich, oh, danke …« Der Kuchen war wie von Zauberhand auf seinem Teller erschienen.
Jess schloss kurz die Augen. Sie besuchte ihre Mutter nicht oft genug, das gab sie unumwunden zu. Aber mit Kuchen zwangsernährt zu werden und über jedes mögliche Unglück zu diskutieren, das entweder Simon oder ihr selbst widerfahren konnte, war abschreckend. Jetzt hatte Leonie auch noch Mike, um den sie sich Sorgen machen musste. Neues Material.
Mike hatte einen Gesichtsausdruck, der Jess verriet, dass er sich darauf vorbereitete, seine Entscheidung, zu seiner Arbeit nach Übersee zurückzukehren, zu verteidigen. Das würde Leonie nicht verstehen, genauso wenig, wie sie sich mit der Hingabe ihres Sohnes an dessen gewählten Beruf arrangieren konnte. In Mikes Fall gab es überdies noch eine weitere Komplikation. Einfach ausgedrückt: Die Wohltätigkeitsorganisation hatte Bedenken, ihn wieder in das dortige Umfeld zu schicken. Sein Kampf mit der Krankheit hatte ihn verwundbar gemacht. Sie wollten ihn nicht dorthin zurückfliegen, um ihn dann später erneut in aller Eile evakuieren zu müssen. Sie hatten ihm einen Job in ihrer Londoner Zentrale angeboten. Das hatte er abgelehnt. »Ich bin kein Schreibtischhengst – ich bin Arzt!«
Ja, und zwar ein engagierter, was wiederum bedeutete, dass ihre Beziehung, seine und Jess’, gebremst verlief. Wie und wann konnte sie sich über den Punkt hinaus entwickeln, den sie jetzt erreicht hatte? Und was genau war das für ein Punkt?, fragte sich Jess. Sie sprachen nicht über die Zukunft. Sie dachten beide darüber nach, aber keiner von ihnen konnte sich aufraffen, über das Thema zu sprechen.
Leonie hatte ihre Aufmerksamkeit auf ihre Tochter gerichtet. »Es tut mir leid, Liebling, ich sollte dich fragen, wie es dir geht. Bist du immer noch entschlossen, bei der Polizei zu bleiben?«
Aus den Augenwinkeln sah Jess, dass Mike erleichtert aussah, jetzt, wo ihm Leonies Kreuzverhör erspart geblieben war. Ihre Mutter schaute sie mit einer Art verzweifelter Hoffnung an. Jess nahm sich zusammen, um fröhlich zu antworten.
»Auf jeden Fall, Mama. Ich bin bei der CID, du erinnerst dich? Es ist interessant.«
»Ist es das?«, fragte Leonie, und die Enttäuschung hallte in ihrer Stimme wider und zeigte sich in ihrer Körpersprache. Sie seufzte. »Na ja, ich hoffe, es sind nette Leute, mit denen du arbeitest. Ich meine, nicht die Kriminellen, die müssen furchtbar sein. Ich meine deine Kollegen.«
»Sie sind großartig, alle.«
»Ist Inspector Carter noch da?« Ein Hauch von Hoffnung mischte sich in die Stimme ihrer Mutter.
»Ja, er ist noch da.« Zeit, erneut einem Gesprächsthema auszuweichen. Wirklich, jedes Gespräch mit ihrer Mutter glich einem Hindernislauf! »Leider habe ich gerade Phil Morton verloren, Sergeant Morton. Ich werde ihn vermissen. Nicht, dass die anderen nicht absolut zuverlässig wären, aber Phil war außergewöhnlich gut in seinem Job.«
»Was ist denn mit ihm passiert?«, fragte Leonie besorgt.
»Nichts Schlimmes!« Jess versuchte, nicht verzweifelt zu klingen. »Er wurde befördert und auf eine andere Dienststelle versetzt.«
Ihre Mutter entspannte sich. »Oh ja, nun, ich nehme an, es ist wie bei der Armee!«
»In dieser Hinsicht ja. Sein Ersatz ist eingetroffen. Sein Name ist Ben Paget. Ich denke, er wird ins Team passen. Er ist übrigens von Bamford zu uns gekommen. Du weißt doch, ich war dort Teil des Teams zu Alan Markbys Zeiten.«
Leonies Miene erhellte sich. »Ich erinnere mich an Superintendent Markby. Hast du nicht kürzlich wieder mit ihm gearbeitet?«
»Eigentlich war das Ian Carter, nicht ich. Er ist jetzt im Ruhestand, Markby, aber er konnte der örtlichen Polizei in Bamford aushelfen. Es war ein ungelöster Fall, und es gab eine Verbindung zu einem alten Fall in Gloucestershire, an dem Ian Carter vor Jahren gearbeitet hatte. Ein Zufall, wirklich. Aber auf diese Weise habe ich etwas Aktuelles über Alan Markby erfahren und ihn wiedergesehen, ganz kurz.«
Sie sah, dass ihre Mutter verwirrt aussah, so wie immer, wenn das Gespräch auf die Polizeiarbeit kam. Jess fuhr zügig fort: »Weißt du, Mama, es tut mir wirklich leid, aber Mike und ich müssen in etwa zehn Minuten los. Ich will nicht im Verkehr stecken bleiben.«
*
»Hätte schlimmer kommen können«, meinte Mike, als sie nach Hause fuhren. »Man kann ihr nicht verübeln, dass sie sich Sorgen macht.«
»Ich verüble es ihr ja nicht. Der Fehler liegt bei mir, nehme ich an. Ich komme nicht besonders gut damit zurecht. Es ist schwer, nicht ungeduldig zu werden. Es ist falsch von mir, aber so ist es eben.«
»Sie ist einsam«, sagte Mike einfach.
Es trat eine Stille ein.
»Ja«, sagte Jess schließlich. »Ich weiß, dass sie das ist. Deswegen habe ich ein schlechtes Gewissen.«
»Ich wollte nicht andeuten, dass du dich schuldig fühlen sollst. Man kann die Probleme anderer Leute nicht für sie lösen. Versuch einfach, sie zu verstehen, das ist alles.«
»Ich verstehe sie also nicht«, brummte Jess verärgert, »ist es das, was du meinst?«
»Ich glaube, das tust du doch. Ich glaube, dass du dir, wie deine Mutter, aber auf deine eigene Art und Weise, Sorgen machst.«
Den Rest der Heimfahrt verbrachten sie in gereiztem Schweigen.
*
In Weston St. Ambrose, wohin Miff dank eines freundlichen Lastwagenfahrers gelangte, bahnte sich bereits eine andere Art von Wiedersehen an. Völlig ahnungslos von der bevorstehenden Ankunft des schwarzen Schafs der Familie, wurden Henry und Prue Blackwood gerade von Peter Posset bewirtet. Er hatte sie zu einem Glas Wein und ein paar »Knabbereien« eingeladen. Der Wein war in Ordnung, aber die Knabbereien bestanden aus einem Avocado-Dip (selbst gemacht, hauptsächlich aus Mayonnaise und pürierter Avocado, aber von Peter großspurig als »Guacamole« bezeichnet) sowie einigen Nüssen, Chips und Käsestangen, die in dem kleinen Supermarkt gekauft worden waren, der knapp zwei Jahre zuvor im Dorf aufgemacht hatte. Es gab auch einen kleinen Laib von Peters selbst gebackenem Brot. Er selbst war stolz auf seine Brotbackkünste; andere waren weniger begeistert. Zu dem Brot gab es einen Becher mit Ziegenkäse.
»Die mediterrane Ernährung«, so erzählte Peter gerne, »ist bekannt dafür, dass sie sehr gesund ist.«
Im Moment fragte sich Prue Blackwood, ob Guacamole technisch gesehen mediterran war. War sie nicht mexikanisch?
Peter war pensionierter Bankmanager. Auch er wohnte seit einigen Jahren in Weston St. Ambrose und schrieb Theaterstücke. (Er sagte gerne von sich, er sei Bühnendichter.) Bis zu ein paar unglücklichen Ereignissen im Dorf vor einiger Zeit hatte Peter immer die Treffen des Autorenzirkels von Weston St. Ambrose einberufen. Die Gruppe hatte sich aufgelöst aufgrund von Ereignissen, die so dramatisch waren, dass selbst Peter seine Feder nicht für geeignet hielt, eine Bühnenfassung daraus zu erstellen. Aber die Erinnerungen an die »unglückliche Zeit«, wie Peter sie gerne nannte, verblassten allmählich.
»Und ich glaube wirklich«, sagte er enthusiastisch, »dass es an der Zeit ist, darüber nachzudenken, unsere kleine Gruppe neu zu formieren.«
Auf diese Bemerkung folgte Schweigen.
Henry, der sich verpflichtet fühlte, die Stille zu füllen und eine Art Antwort zu geben, sagte: »Oh, nun, Peter, natürlich wäre das … sehr schön, aber es sind nur noch so wenige von der ursprünglichen Gruppe in der Gegend und …«
Posset saß mit auf seinem üppigen Bauch, das heißt auf seinem neuesten Pullover, gefalteten Händen da. Peter strickte seine Pullover gern selbst, da er von seiner Großmutter in dieser Kunst unterwiesen worden war, als er noch ein Junge war. Die Pullover hatten alle das gleiche Muster und unterschieden sich nur durch das Design des Streifens quer über der Brust. Dieser hier zeigte eine Reihe von Ankern, die durch etwas verbunden waren, das vage an ein Tau erinnerte.
Henry hatte dagesessen und das Kleidungsstück eine Weile betrachtet, während Peter darüber schwadronierte, wie vergnügt alles vor der, ähm, unglücklichen Zeit gewesen war. Warum das nautische Thema?, fragte sich Henry. Sie befanden sich nicht an der Küste. Er hatte noch nie gehört, dass der alte Posset sich für Boote interessiert hätte. Wirklich, der Kerl war ein schrecklicher Langweiler, und die Vorstellung, die Gruppe neu zu formieren …
Während Henry noch um eine Antwort auf Possets Vorschlag rang, meldete sich seine Frau zu Wort. »Ich weiß nicht, Peter«, sagte sie. »Es scheint irgendwie, nun ja, geschmacklos zu sein. Die Leute erinnern sich …«
»Die Leute«, erklärte Posset, »erinnern sich an alle möglichen Dinge, weil Dinge passieren, nicht wahr? Das bedeutet nicht, dass die kreative Kunst zum Erliegen kommt. Ganz im Gegenteil, wir sollten alle inspiriert sein! Wenn keine Dinge passieren würden, hätten wir nichts, worüber wir schreiben könnten!«
Sein strahlendes Lächeln forderte sie heraus, an seiner Logik etwas auszusetzen.
»Jetzt hör mal zu, Peter, alter Knabe«, begann Henry. »Du schlägst doch nicht etwa vor, dass wir alle – darüber schreiben sollen?«
»Nein, natürlich nicht!«, erwiderte Posset gereizt. »Aber wir schreiben doch alle noch, oder nicht? Ich jedenfalls schon. Was ist mit dir – und Prue?«
Die Blackwoods blickten beide schuldbewusst drein.
»Es ist so«, sagte Prue schließlich, »ich weiß, dass ich – und Henry – uns beide ein bisschen unwohl dabei gefühlt haben, irgendetwas nach – nach der Realität zu schreiben. Ich meine, ich schreibe Liebesromane; und schlimme Ereignisse im wirklichen Leben haben dem irgendwie einen Dämpfer verpasst. Und Henry, nun ja …« Sie blickte ihren Gatten an.
»Absolut«, sprang Henry ihr bei. »Ich schreibe Thriller und, na ja, nach allem, was passiert ist, schien es mir …«
»Geschmacklos, wie ich schon sagte«, beendete Prue den Satz für ihn.
»Was du meinst«, entgegnete Posset ihr, »ist, dass du eine ›Schreibblockade‹ hast!«
»Ach, ist es das?«, murmelte Prue kleinlaut.
»Ja! Und der Weg, darüber hinwegzukommen, ist, etwas Neues anzufangen! Ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass keiner von euch in letzter Zeit etwas geschrieben hat?«
»Ich habe es ja versucht, Peter …«
»Ich habe meine früheren Texte noch einmal gelesen«, erklärte Henry, denn er wollte nicht, dass Posset dachte, ihm, Henry, fehle es an Charakterstärke. »Ich habe sie überarbeitet.«
»Dann seid ihr also dabei!«, sagte Posset. »Ich werde eine Notiz an die Anschlagtafel im Supermarkt hängen; dort werden oft lokale Veranstaltungen angekündigt. Ich arrangiere ein Treffen und schreibe, dass alle willkommen sind. Ich schlage den ersten Mittwoch im kommenden Monat vor, und danach alle zwei Wochen mittwochs. So bleibt genug Zeit, dass das Wort die Runde macht!« Posset hielt inne, und als es keine Antwort gab, fügte er gereizt hinzu: »Das war ein kleiner Scherz! Das Wort macht die Runde!«
»Ah, verstehe, Peter«, antwortete Prue pflichtbewusst. »Sehr gut.«
»Ach du lieber Himmel …«, murmelte Henry sotto voce.
»Ich dachte auch, wir könnten uns in ›Autorengruppe‹ umbenennen, nur um uns ein wenig von den, ähm, unglücklichen Ereignissen zu distanzieren, die du erwähnt hast, Prue.«
Prue fühlte sich gemaßregelt, und zwar wegen nichts und wieder nichts. Aber Peter achtete nicht auf die Reaktionen von anderen. Für einen Dramatiker musste das ein Nachteil sein. Und zu seiner Zeit als Banker musste es fast unmöglich gewesen sein, ihn um einen Kredit zu bitten.
»Und es wird allen potenziellen Mitgliedern Zeit geben, etwas zusammenzustellen, ein bisschen was zu schreiben. Also, einverstanden?« Er strahlte sie an.
»Ja, ich denke, schon«, murmelten die Blackwoods, dieses Mal gemeinsam.
»Ich habe mit Jenny Porter telefoniert, und sie ist daran interessiert, vorbeizukommen, wenn wir wieder anfangen. Sie wäre auch heute Abend hier gewesen, aber sie musste mit dem Fahrrad zum Meadowlea Manor Seniorenheim fahren, um eine alte Freundin zu besuchen. Sie bat mich, sie auf dem Laufenden zu halten.«
Keiner seiner Besucher sagte etwas, aber sie wechselten bedeutsame Blicke.
*