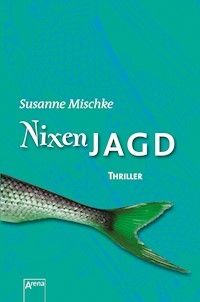4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Es geschah am helllichten Tag...ein beklemmender Krimi von Bestseller-Autorin Susanne Mischke Als ihr fünfjähriger Sohn Max plötzlich verschwindet, weint Doris dem Satansbraten keine Träne nach. Lieber schnappt sie sich Simon als Ersatzkind, einen echten Musterjungen und Sohn ihrer besten Freundin Paula. In der spießigen Kleinstadt beginnt derweil eine Hexenjagd – schließlich ist Max das zweite verschwundene Kind innerhalb kürzester Zeit …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Kriminalroman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Mordskind« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© 2019 Piper Verlag GmbH, München© der Erstausgabe Piper Verlag GmbH, München 1996, 2011Covergestaltung: FAVORITBUERO, MünchenCovermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
Motto
Der Fremde
Feindschaften
Die Forellentheorie
Theater
Faschingstreiben
Langer Donnerstag
Flieg, Paula
Premiere
Motto
Normalität ist der Nährboden für das Chaos.
Lisa Fitz
Der Fremde
Stadtkurier Montag, 3. Oktober 1994
Noch immer keine heiße Spur
(sz) – Seit nunmehr zwei Wochen wird der sechsjährige Benjamin Neugebauer vermisst. Trotz intensivster Suchaktionen, unter Einsatz von Hubschraubern und Hundestaffeln, konnte das Kind bis heute nicht gefunden werden. Auch Recherchen im familiären und sozialen Umfeld des Kindes und seiner alleinerziehenden Mutter ergaben bisher keinen Hinweis auf seinen Verbleib. Die Annahme, dass der Sechsjährige einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist, scheint sich allmählich zu bestätigen.
Wie berichtet, verließ der Junge am Montag, dem 19. September, gegen vierzehn Uhr die Wohnung seiner Mutter mit unbekanntem Ziel und kehrte am Abend nicht zurück.
Hauptkommissar Bruno Jäckle von der Kripo Maria Bronn sowie die Ermittlungsbeamten der Sonderkommission des Landeskriminalamts München gaben zu, noch keine heiße Spur zu haben.
Der achtunddreißigjährige deutschstämmige Russe, der zwei Tage nach dem Verschwinden des Kindes festgenommen worden war, befindet sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Obwohl sich der Mann, wie Zeugen bestätigten, auffallend oft in der Nähe von Schulen, Kindergärten und Spielplätzen aufgehalten hat, konnten ihm die ermittelnden Beamten keine Schuld im Zusammenhang mit dem Verschwinden des kleinen Benjamin nachweisen.
Die Bürger unserer Stadt sind äußerst beunruhigt. Es stellt sich die Frage, was Kommissar Bruno Jäckle und seine Beamten zu tun gedenken, um die Sicherheit unserer Kinder zu gewährleisten.
Die alte Bosenkowa hatte Mühe mit der leicht ansteigenden Straße, die hinaus zur Neubausiedlung führte. »Schuldenhügel« hieß die Ansammlung schmucker Eigenheime am Ziegeleiberg im Volksmund. Aber der Volksmund war ihr nicht geläufig, denn es gab wenige Menschen, die mit ihr sprachen, und wenn, dann sicher nicht über Baufinanzierungen.
So ganz passte sie nicht hierher. Sie trug schwarze, abgetragene Kleidung in mehreren Lagen übereinander, wollene Strümpfe schlotterten um ihre kurzen Vogelbeine. Ein bizarr deformierter Hut und ein schleppender Gang verliehen der Gestalt etwas Hexenhaftes. Sie lebte nicht hier. Ihre Wohnung lag im sechsten Stock eines der wenigen Hochhäuser der Stadt, anfangs lediglich hässlicher, inzwischen verkommener Bausünden aus den sechziger Jahren. Die Bosenkowa, die vom Leben noch nie viel erwartet hatte, war glücklich über ihr komfortables Zuhause. Es gab warmes Wasser, Zentralheizung und sogar ein Telefon. Ein eigenes Telefon. Nie wäre ihr der Gedanke gekommen, sich über schlecht schließende Fenster, die schimmelnde Schlafzimmerwand oder den verdreckten, ewig kaputten Aufzug zu beklagen. Nein, sie war sogar recht zufrieden. Die Rente ihres Mannes, der in einem Dorf nahe bei Minsk begraben lag, reichte, wenn auch knapp, ihr Asthma wurde regelmäßig ärztlich behandelt und war zumindest nicht schlimmer geworden, und Kolja hatte Arbeit gefunden. Er war Aushilfsgärtner beim Städtischen Friedhof. Kolja liebte Pflanzen, schon immer.
Beunruhigend war nur, dass sie ihn dort, auf dem Friedhof, nicht angetroffen hatte. Auch nicht im Gewächshaus und nicht in der Kirche des heiligen Michael, wo er manchmal ausruhte.
Blieben noch die Spielplätze. Der neue, saubere, mit den hellen Holzgeräten und dem dichten grünen Rasen lag völlig verlassen da, denn heute war ein kühler Tag. Nur vor den grauen Wohnblocks hinter dem Bahnhof sah man ein paar dunkelhaarige Kinder. Sie kickten mit einer leeren Bierdose zwischen den verrosteten Eisengeräten, die auf dem umzäunten schlammigen Gelände standen.
Die Alte war rasch an ihnen vorbeigegangen. Dunkelhaarige Kinder interessierten Kolja nicht.
Auf ihrem Weg durch die Otto-Schimmel-Straße musste sie ein paarmal stehenbleiben. Ihr Atem ging flach und rasselnd, die erschlafften Lider drückten schwer auf ihre Augen, wie feuchter Teig. Aber nun hatte sie es fast bis zum Ende geschafft. Vorbei an Reihenhäusern mit einheitlichen Eingangstüren und blühenden Vorgärten, zuletzt ein Garagenhof mit einem Basketballkorb. Auch hier war heute kein Kind zu sehen. Hinter einem Zaun aus naturbelassenem Fichtenholz nickten ihr drei Sonnenblumen zu. Sie hielten Wache vor einem einzeln stehenden, pastellblau gestrichenen Haus mit blendendweißen Fensterläden. Auf dem Wiesenstück zwischen Zaun und Haus wuchsen Spätsommerblumen in bunter Mischung, eine zusammengeklappte Wäschespinne stach in den Himmel, ein Klammersäckchen aus Leinen schwang im Wind hin und her. Die alte Frau blieb gerne vor diesem Haus stehen. Wäre sie gewandter in der Sprache gewesen, hätte sie mit einem Wort ausdrücken können, warum: Es war sein Bilderbuchcharakter. Sie freute sich an den gehäkelten Spitzengardinen hinter den Sprossenfenstern und betrachtete jedes Mal die fröhlichen Motive aus Glas und Buntpapier, die hinter den Scheiben baumelten. Auf dem Treppenabsatz stand ein grünes Kinderfahrrad, darüber, an der Tür, hingen ein Blumenkranz aus Stroh und ein ovales Schild aus gebranntem Ton: Willkommen bei Doris + Jürgen + Max Körner. Das Schild sagte ihr nicht viel, sie hatte nie richtig lesen gelernt. Aber sie wusste, dass das Fahrrad einem blonden Jungen gehörte, der aussah wie ihr Kolja, früher, vor vielen Jahren. Es gab nur ein einziges verblasstes Bild von ihm. Doch Koljas Junge hatte genauso ausgesehen, und von dem gab es Bilder, viele sogar, und bunte.
Dienstags und freitags konnte man vor diesem Haus den Duft von frischgebackenem Brot riechen, fast die ganze Straße roch dann danach. Aber heute war Montag. Langsam ging sie weiter. Eine mollige Frau im leichten Pelzmantel, sie musste gerade aus der Kapelle gekommen sein, schob einen rosafarbenen Kinderwagen vor sich her, das Kind bis zum Hals eingehüllt in Lammfell. Die Bosenkowa hatte diesen Wagen schon öfter vor einem der Reihenhäuser stehen sehen, an denen sie eben vorbeigegangen war. Das hohle Klopfen der Absätze beschleunigte sich auf Höhe der Bosenkowa. Die mollige Frau sprach mit ihrem Baby über das Essen. Genauer gesagt erzählte sie etwas von kriminellem Russenpack, das man durchfüttern müsse.
Wie sauber hier alles war, bemerkte die Bosenkowa. Sogar die Luft war besser als unten in der Stadt, obwohl es auch dort nicht viel gab, was den weißblauen Himmel nachhaltig verunreinigt hätte. Keine Fabrikschlote, kaum Industrie, die große Ziegelei am Rande der Siedlung stand leer. Nirgends Müll, die Gehsteige waren sauber gefegt. Bis auf das sehr lange Stück schräg vor ihr. Das war voller Laub. Gelbliche Blätter von einem hohen Baum, dessen Namen sie nicht kannte. Weiter oben lag ein Teppich aus Nadeln unter einer ebenso hochgewachsenen Lärche. Ein gutes Stück vom Zaun entfernt schimmerten graue Mauern geheimnisvoll durch das Laub. Das Haus war viel älter als die anderen hier, hoch gebaut, mit Vorsprüngen, Winkeln und Erkern. Obwohl es offensichtlich lange vor den anderen dagewesen war, wirkte seine Anwesenheit nun unpassend, beinahe anmaßend. Der Garten war riesig, fast schon ein Park, aber nicht so gepflegt wie die kleineren Gärten. Weit hinten, am anderen Ende des Grundstücks, lag ein kleiner See, den man von hier aus nicht sehen konnte, wegen des dichten Gebüsches am Ufer.
Das große Haus besaß als einziges keine richtige Autogarage, nur einen Holzschuppen. Die Bosenkowa, der auf ihren täglichen Wanderungen kaum etwas entging, wusste, was da drin war: ein Motorrad.
Sie musterte den Garten hinter dem hohen eisernen Tor, dessen rostige Stäbe von einer wilden Rose umflochten wurden, und wackelte im Weitergehen mißbilligend mit dem Kopf. Eine Schande, dachte sie, wie das Grundstück verkommt.
Hinter der Schimmel-Villa, wie die Einheimischen das Haus nannten, hörte der geteerte Gehsteig auf. Danach kam nur noch die kleine Marienkapelle. Sie stand seit zweihundert Jahren auf einem eigens für sie aufgeschütteten Hügel. Die Bosenkowa betrat den kühlen weißgekalkten Innenraum, kniete schwer atmend auf der vordersten Holzbank nieder und brabbelte leise, rhythmische Wörter in einer Sprache, die hier niemand verstand. Am Himmel teilten sich die Wolken, und durch das bleiverglaste Mosaikfenster an der Rückwand fiel ein goldener Streifen Nachmittagssonne auf den Altar mit der marmorblassen Maria, die ein nacktes Jesuskind auf dem Arm hielt.
Die Kapelle, die Gebete, sie waren nur der äußere Anlass für Lisaweta Bosenkowas beschwerlichen Weg aus der Stadt. Keine Mutter gesteht sich gerne ein, dass sie ihrem erwachsenen Sohn nachspioniert.
Nach einer Weile stand sie steifgliedrig auf, ging um die Kapelle und betrachtete die Aussicht. Fahle Äcker und Wiesen, Kühe wie braune Punkte in der Landschaft, nicht weit von hier ein einzelner stattlicher Bauernhof. In der Ferne dösten ein paar Dörfer, rechts der kleine Wald mit dem stillen schwarzen See, an dessen Ufer die Villa lag. Links unten die Ziegelei mit ihren blinden Fensterhöhlen, sie sollte demnächst abgerissen werden. Dahinter dehnten sich die Schrebergärten. Es waren ungewöhnlich große, unterschiedlich genutzte Grundstücke: Anbauflächen für Gemüse, Wiesen mit soldatisch aufgereihten Obstbäumen, Kartoffeläcker und eine kleine Hühnerzucht. Dazwischen lagen einige Streifen Land brach; Unkraut überwucherte halbverfallene Gartenhäuschen, Büsche, dürrbraunes Gras und hohe, gelbblühende Nachtkerzen bildeten schier undurchdringliche Oasen der Wildnis, einst von der fleißigen Nachkriegsgeneration auf neunundneunzig Jahre gepachtet, dann von den Erben vernachlässigt oder vergessen.
Ob er wieder in diesem leerstehenden Bauwagen war, den er sich zurechtgezimmert hatte? Inzwischen konnte man beinahe sagen, dass er auf dieser verwilderten Parzelle wohnte. Immer seltener kam er zu ihr nach Hause.
Ihre Augen waren noch immer sehr gut, und sie entdeckte die Stelle, wo die Dachpappe seiner Behausung schwarz durchschimmerte. Nein, dorthin würde sie nicht gehen. Es war ihr zu weit und der Weg viel zu holprig, und Kolja wäre sehr gekränkt, wenn er merkte, dass sie ihm nachging. Lieber wollte sie umkehren und auf dem Heimweg noch am Spielplatz der Siedlung, gleich neben dem Kindergarten, vorbeischauen. Wenn er da auch nicht ist, dann ist es gut, dachte sie, dann ist er in seinem Wagen oder am See.
Auf dem Spielplatz war es windig, Tropfen funkelten im nassen Laub, das Holz der Bank troff vor Nässe. Es hatte erst vor einer Stunde aufgehört zu regnen, und ab und zu kam jetzt die Sonne durch. Wie einsame Vögel hockten die beiden Frauen auf der schmalen Kante der Lehne. Wenige Meter entfernt spielten zwei kleine Jungen, aber nicht miteinander.
Für die Jahreszeit zu kühl, hatte der Wetterbericht gemeldet. Paula fröstelte. Auch Doris hatte die Schultern hochgezogen, obwohl es ihre Idee gewesen war, hierher zu kommen.
»Du siehst heute irgendwie zerknittert aus«, sagte sie zu Paula, »gab’s Ärger in der Redaktion? Hat dich dein Kollege Schulze wieder Teilzeitemanze genannt?«
»Das auch.« Ein Lächeln verflüchtigte sich auf Paulas schmalem Gesicht, ehe es richtig existiert hatte. »Hast du übrigens heute seinen tollen Artikel gelesen? Den dezenten Hinweis auf die alleinerziehende Mutter und den deutschstämmigen Russen? Aber der Clou war das mit dem Jäckle und der Sicherheit unserer Kinder.«
»So ganz unrecht hat er ja nicht«, räumte Doris vorsichtig ein. »Ich jedenfalls lasse Max nicht mehr alleine raus.«
»Darum geht’s doch gar nicht«, erklärte Paula ungeduldig. »Der Kerl sollte einen neutralen Bericht abfassen und nicht Volkes Stimme wiedergeben. Wenn er doch bloß endlich zur Bild-Zeitung ginge! Der Jäckle, der wird wieder stinksauer sein.« Paula verdrehte die Augen, dann seufzte sie: »Aber was soll’s. Über so was rege ich mich ja schon lange nicht mehr auf.«
»Dann ist es wohl wegen der Frau vom Jugendamt.«
Paula sah ihre Freundin verwundert von der Seite an.
»In der Siedlung haben die Fenster Augen und die Zaunlatten Ohren«, erklärte Doris auf ihre stumme Frage, »hast du das vergessen?«
»Wie könnte ich.« Paulas etwas zu großer Mund presste sich zusammen, dann sagte sie: »Ja, sie war schon wieder da.«
»Was will sie denn andauernd von dir?«
»Wenn ich das wüsste. Vor einem halben Jahr, kurz nach der Scheidung, kam sie zum ersten Mal. Sie hat das Haus inspiziert wie ein Rauschgifthund und gefragt, warum Simon nicht getauft sei. Es sei ihre Pflicht, hat sie gesagt, bei geschiedenen und ledigen Müttern müsse das Jugendamt nach dem Rechten sehen. Nur Verheiratete dürfen mit ihren Kindern anstellen, was sie wollen. Danach habe ich nichts mehr gehört, anscheinend hatte sie es doch gefunden, das Rechte. Und jetzt, auf einmal, steht sie schon das zweite Mal innerhalb eines Monats vor der Tür.« Eine steile Falte bohrte sich zwischen ihre dunkelgrauen Augen. »Routinekontrolle, behauptet sie.«
»Klaus?« orakelte Doris.
»Unwahrscheinlich. Er hat seit Monaten keinerlei Kontakt zu Simon. Er interessiert ihn nicht, seit er den Prozess verloren hat. Es sei denn, er will mich ärgern, aber eigentlich haben wir diese Spielchen ja längst hinter uns.«
»Du musst aufpassen«, meinte Doris, »Leute vom Jugendamt haben einen ziemlichen Einfluß vor Gericht.«
Paula durchpflügte ihr streichholzkurzes Haar mit einer nervösen Bewegung und sah zu Simon hinüber. Eine riesige schwarze Krähe ließ sich auf dem Baum neben dem Sandkasten nieder. Sie werden jedes Jahr größer, dachte Paula, und fühlte einen Kloß in der Kehle.
»Das Dumme ist«, sagte sie mit belegter Stimme, »das letzte Mal kam sie abends um acht, und ich war nicht da. Die kleine Katharina Lampert war babysitten. Sie ist doch erst vierzehn und sieht aus wie zwölf. Müssen Babysitter nicht mindestens sechzehn sein?«
»Keine Ahnung«, gestand Doris, und leise fügte sie hinzu: »Zu Max kommt sowieso niemand.«
Paula sagte nichts dazu. Sie beobachtete die beiden Jungen. Simon grub ein Loch in den nassen Sand. Ein kleines Grab, durchzuckte es Paula, ein Vogelgrab. Ärgerlich fuhr sie sich mit der Hand über die Stirn, als könne sie damit ihre Gedanken wegscheuchen. Verdammt, warum muss ich ständig solches Zeug denken? Es ist ein Loch im Sand, nichts anderes. Ein ganz normales Loch!
Max stand auf den dicken unteren Ästen einer Buche, weißblonde Locken umrahmten sein rundes, rosiges Gesicht mit den vergißmeinnichtblauen Augen. Wie eine Putte, dachte Paula, eine kleine, fette Putte, ausgeschnitten aus einer Haferbreipackung.
Max, er war in Wirklichkeit nicht dick, lediglich von kerniger Statur, kletterte höher und warf kleine Äste nach Simon, die der Wind von ihrem Ziel wegtrieb. Die Krähe erhob sich schreiend.
»Pch! Pch!« Max streckte den Arm in ihre Richtung und sandte ihr ein paar Schußgeräusche hinterher. Sein dunkelroter Anorak verschmolz nun beinahe mit dem blutroten Laub, man konnte ihn auf den ersten Blick kaum finden. War er nicht schon ziemlich weit oben? Es schien Paula an der Zeit für ein paar warnende mütterliche Worte. Sie sah Doris an, aber die hatte den Kopf gesenkt und drehte nachdenklich ihr meerblaues Halstuch in den Händen. Ihre Augen waren ebenso blau und leer.
»Wenn man nur wüsste, was der Schönhaar nicht passt«, sagte Doris schließlich in die Stille hinein, und Paula wunderte sich, dass Doris den Namen dieser Person kannte. »Simon ist doch ein ausgesprochen liebes Kind. Und du bist eine gute Mutter. Auf deine Art.«
»Auf meine Art?«
»Ich meine, du bist vielleicht nicht gerade die Vorzeigemutter aus dem Eltern-Heft.«
»Die wollte ich auch nie sein«, sagte Paula mit Überzeugung. »Auch wenn man mir das übelnimmt.« Sie wusste sehr wohl, dass die anderen Mütter über sie tratschten.
»Du bist eben nicht der Typ für die Kleinstadt«, lenkte Doris ein. »Welche dieser Mütter geht schon mit ihrem Kind allein in ein Feinschmeckerlokal, noch dazu am Abend? Und welche von denen bringt ihr Kind mit dem Motorrad in den Kindergarten?«
»Es sind die seltenen Gelegenheiten, bei denen Simon freiwillig stillsitzt.« Paula lächelte über sich selbst. Das Motorradfahren hatte Doris einmal als Paulas ›etwas kindischen Versuch, trotz Mutterschaft nicht als angepasst zu gelten‹, bezeichnet. Auf gewisse Weise hatte Doris sogar recht damit. Paulas Bestrebungen, ihre Abneigung gegenüber allem Kleinbürgerlichen auszudrücken, nahmen manchmal reichlich groteske Formen an.
Doris wies mit einer vagen Kopfbewegung in Richtung Ziegeleiberg: »Die Leute in der Siedlung finden das anstößig.«
»Willst du damit andeuten, dass mir unsere lieben Nachbarn die Schönhaar auf den Hals gehetzt haben?« fragte Paula und richtete sich wachsam auf.
Doris hob die Hände. »Nein, nein! Das nicht. Weißt du, ich glaube nicht, dass sie dich hassen. Du bist ihnen bloß ein bisschen, nun ja, unheimlich.«
»Die mir auch«, sagte Paula.
»Natürlich ist auch eine große Portion Neid dabei. Sieh dir doch diese Schuhkartons an, für die sie mühsam jede Mark zusammenkratzen. Und dann dein Haus«, Doris korrigierte sich, »vielmehr, dein Anwesen.«
»Der Haken dabei ist nur: Es gehört mir nicht.«
»Außerdem«, fuhr Doris unbeirrt fort, »verstehst du es glänzend, dich unbeliebt zu machen. Schau, Paula, diese braven Leute gehen zweimal im Jahr ins Bauerntheater, amüsieren sich den ganzen Abend schenkelklopfend, und dann kommst du daher und schreibst eine zynische Kritik darüber. Auch wenn das meist berechtigt ist«, fügte sie schnell hinzu.
Paula verteidigte sich: »Ich empfinde eben eine gewisse Verantwortung, gerade dem gutgläubigen Publikum gegenüber. Ich will nicht so ein mieser Opportunist werden wie der Schulze. Wenn ich Scheiße geboten kriege, dann schreibe ich das auch. Ich benutze natürlich ein paar Fremdwörter dafür.«
»Apropos Fremdwörter«, in Doris’ Augen blitzte es boshaft auf, »ich wette, die Hälfte deiner Leser weiß nicht mal, was Feuilleton bedeutet.«
»Das hast jetzt du gesagt!« Paula grinste. Mit Doris konnte man wunderbar über die Nachbarschaft lästern. Was Paula jedoch nicht verstand, war, dass Doris trotzdem eifrig bestrebt war, bei ebendiesen Leuten beliebt zu sein.
Seit fünf Jahren wohnten sie beide einander gegenüber, Doris und ihr Mann Jürgen waren wenige Monate nach Paula und Klaus »aufs Land« nach Maria Bronn gezogen. Anfangs verband die beiden Frauen das Gefühl, Fremdkörper in einem Netz sozialer Inzucht zu sein. Später, im Gegensatz zu Paula hatte sich Doris schnell an die Verhältnisse angepasst, wurde eine enge Freundschaft daraus.
»Und dein größtes Manko«, nahm Doris den Faden wieder auf, »du hast kein Auto und keinen Mann. Am meisten verübeln sie es dir, dass du letzteres ganz offensichtlich nicht als Defizit empfindest.«
»Gut gesagt. Hätte glatt von mir sein können.«
Während sie mit Doris sprach, sah Paula Max zu, wie er auf einem dicken Seitenast der Buche balancierte. Er hielt sich an den Zweigen über ihm. Es waren dünne Zweige, so dünn, dass sie ihn im Falle eines Sturzes kaum halten würden. Und dieser Fall wurde immer wahrscheinlicher. Vermutlich war Max entgangen, dass der Ast, auf dem er stand, keine Blätter an seinen Zweigen trug. Er war durch und durch morsch. Mit wachsendem Interesse verfolgte Paula die Kletterpartie, die in etwa fünf Meter Höhe auf feuchtglänzender Rinde stattfand.
»Sag mal«, hakte Doris nach, »vermisst du ihn wirklich nie?«
»Wen? Klaus? Nein. So wie er sich bei der Scheidung benommen hat. Weißt du nicht mehr?«
»Doch, doch«, sagte Doris rasch.
»Er wollte mich für verrückt hinstellen, nur weil ich …«
»Paula«, beschwichtigte Doris, »lass gut sein. Das ist jetzt vorbei und überstanden.«
»Ja, du hast recht«, murmelte Paula. Zwei rote Flecken brannten auf ihren blassen Wangen.
»Ich meinte nicht, ob du Klaus vermisst, sondern überhaupt einen Mann.«
»Aber klar«, gestand Paula rundheraus, »manchmal vermisse ich schon die starke männliche Hand. Wenn eine riesige Spinne in der Badewanne sitzt, die Mülltonnen rauszukarren sind, das Klo verstopft ist, oder die Dachrinne …«
»Paula, du bist einfach furchtbar!« unterbrach Doris sie kopfschüttelnd.
Dazu schwieg Paula, denn es gab Interessanteres. Ihr Blick tastete sich durch das Laub, zu Max. Er schien zu schwanken. Paula hielt den Atem an. Was ist eigentlich mit Doris, fragte sie sich. Wann schlägt endlich ihr Mutterinstinkt Alarm?
Aber Doris zwirbelte gedankenverloren ihren Schal und fixierte ihre Schuhe auf der Bank. Sie waren flach, und die abgerundeten Spitzen gaben ihrem ohnehin kleinen Fuß ein kindliches Aussehen. Sie waren aus dem einzigen Bioladen der Stadt, Doris war dort die beste Kundin. Vielleicht, spekulierte Paula, kam ihr strahlender Teint doch von den fleckigen Äpfeln und dem matschigschweren Vollkornbrot. Doris war, fünfunddreißig und hatte noch keine einzige nennenswerte Falte im Gesicht. Wenn man ihr Glauben schenken durfte, hatte sie seit ihrem sechzehnten Lebensjahr keinen Bissen Fleisch mehr zu sich genommen. Zunächst weniger aus Überzeugung – ihr Biotrip begann erst mit der Schwangerschaft –, sondern um ihre Eltern zu brüskieren, denn ihnen gehörte eine der größten deutschen Fleischgroßhandlungen.
Der rote Anorak bewegte sich langsam auf das dünnere Ende des Astes zu. Das Holz gab einen leisen, ächzenden Ton von sich. Doris hörte ihn offenbar nicht. Warum laufe ich nicht hin und hole ihn da runter? Der Gedanke streifte Paula nur flüchtig und blieb ohne Folgen. Die Darbietung war zu erregend, ein Nervenkitzel, wie bei einem Seiltänzer ohne Netz. Fällt er nicht, ist man zwar von seiner Kunst beeindruckt, aber tief im Inneren doch enttäuscht.
Der Wind fuhr energisch über den Platz, Paula schlug den Kragen ihrer Lederjacke hoch. Sie sah forschend zu Doris. Konnte ein fauliges Blatt auf einer nassen Bank so interessant sein, dass man völlig selbstvergessen darauf starrt?
Max versuchte sich umzudrehen, der Ast bog sich weit nach unten, Paula sah es aus den Augenwinkeln. Die Knöchel ihrer Hände färbten sich weiß. Soviel sie durch die Blätter erkennen konnte, ging Max in die Knie, robbte auf allen Vieren zurück und richtete sich dann wieder auf. Das tote Holz stöhnte unter seinem Gewicht.
Jedes andere Kind hätte spätestens jetzt nach seiner Mutter gerufen. Max nicht. Max würde eher wie eine madige Frucht vom Baum fallen, dessen war sich Paula sicher. Sie zwang sich, in eine andere Richtung zu sehen, während sie auf das Geräusch von splitterndem Holz und das Aufschlagen eines Körpers wartete.
Schritte scharrten über den Kiesweg, Doris und Paula fuhren gleichzeitig herum, als wären sie bei etwas Verbotenem überrascht worden. Eine schwarzgekleidete Frau näherte sich langsam. Paula nickte ihr zu, daraufhin begann die Alte etwas in ihrer Sprache zu schreien. Sie fuchtelte und deutete mit ihrer gichtverkrümmten Hand auf den Baum, ihre Gewänder flatterten auf und ab wie Krähenflügel.
Doris’ Augen richteten sich auf die Stelle im dichten Laub, wo Max wie ein umgedrehter Käfer am Ast hing.
»Wollen wir bei mir noch einen Tee zusammen trinken, auf den Schrecken?« Die Worte kamen nur widerstrebend aus ihrem Mund. Paula hatte Max nicht gerne in ihrem Haus, weil nach seinen Besuchen meistens irgend etwas repariert oder gereinigt werden musste. Aber die Reihe war an ihr, diesmal fiel ihr keine Ausflucht ein. Was sie befürchtet hatte, geschah: Doris nahm an.
»Ich finde«, sagte Paula, als sie an dem weißlackierten Tisch in der geräumigen Küche saßen und sie den Tee aufgoss, »wir sollten sie wieder allein draußen spielen lassen. Von mir aus bei uns im Garten. Du siehst ja, selbst wenn wir dabei sind, kann was passieren.«
»Ich weiß nicht«, widersprach Doris dieser etwas verqueren Argumentation, »es ist ein Unterschied, ob ein Kind vom Baum fällt …«
»Beinahe vom Baum fällt«, korrigierte Paula.
»Ja«, nickte Doris, »beinahe. Zum Glück ist diese Alte aufgetaucht.« Sie lachte ein wenig gekünstelt. »Vor lauter Quatschen habe ich gar nicht gesehen, was er da im Baum treibt. Ich bin wirklich eine Rabenmutter!«
Rabenmutter, sezierte die wortverliebte Paula sogleich den Begriff, waren Raben – wie hieß denn nur die weibliche Form? Räbin? –, waren Räbinnen also schlechte Mütter?
»Was?« fragte Doris.
Wie, was? Hatte sie ihren letzten Gedanken etwa laut ausgesprochen, ohne es zu merken?
»Es ist ja nichts passiert«, sagte Paula. Sie stand auf, um Tassen aus dem altmodischen Küchenschrank zu holen. »Wir können sie doch nicht ewig auf Schritt und Tritt beaufsichtigen.« Außerdem hasse ich diese Spielplatz-Nachmittage, grollte sie im stillen.
»Ewig nicht. Aber solange der Kerl frei herumläuft, der den kleinen Benjamin …« Doris biss sich auf die Lippen. Sie blickte Paula besorgt an. »Unsere beiden sind einfach noch zu klein. Sie würden garantiert mit jemandem mitgehen oder in ein Auto steigen, wenn der Kerl es nur raffiniert genug anstellt. Besonders dein Simon«, fügte sie hinzu, »er ist so lieb und vertrauensselig. Der spricht doch mit jedem. Das ist ja gerade so nett an ihm, aber in diesem Fall nicht ungefährlich.«
Paula pendelte mit dem Tee-Ei in der Kanne. »Ich möchte sein Vertrauen auch nicht unnötig durch irgendwelche Schauergeschichten zerstören. Er wird früh genug von selbst dahinterkommen, wie es um die Menschheit bestellt ist.«
»Dann kann es zu spät sein«, antwortete Doris mit dramatischem Tonfall. »So wie für den kleinen Benjamin. Mein Gott, diesen Kerl aus den Schrebergärten, den habe ich selbst schon an unserem Spielplatz gesehen. Wenn man sich vorstellt …« Sie verstummte, ein vielsagendes Schweigen lastete im Raum.
»Er ist harmlos. Er steht manchmal nachts vor Häusern herum und schaut den Leuten in die Fenster, weiter nichts«, wandte Paula ein. »Bei mir ist er öfter.«
»Was?«
»Er mag wohl diesen Garten.«
»Hast du das dem Jäckle gesagt?«
»Nein, warum denn? Er steht doch nur da und schaut.«
»Na, ich weiß nicht … ich hätte Angst.«
»Leute mit kleinen Ticks sind mir sympathisch.« Weil sie mir ähnlich sind, setzte Paula in Gedanken hinzu und war sich ziemlich sicher, dass Doris das gleiche dachte.
»Er steht auch auf Spielplätzen rum und schaut«, bemerkte Doris giftig, »womöglich hat sein kleiner Tick den Benjamin das Leben gekostet.«
»Es gab nicht den geringsten Beweis. Nur das Gerede der Leute. Dieses dumme, hysterische Geschwätz, mit dem sie jeden kaputtmachen, der nicht in ihr Bild von einer ordentlichen Welt passt! Ich glaube jedenfalls nicht, dass er was damit zu tun hat. Die Leute suchen bloß krampfhaft nach einem Sündenbock.«
»Die arme Mutter«, seufzte Doris. »Obwohl die familiären Verhältnisse ja nicht die besten sein sollen. Die Frau hat den Jungen ziemlich oft sich selbst überlassen. Er und seine Geschwister wurden vernachlässigt, sagen die Nachbarn.«
»Selbstverständlich kann so etwas bloß Asozialen passieren.« Paulas Ton fiel bissiger aus als gewollt.
»Nein, aber …«
»Doris«, ereiferte sich Paula, »die Frau musste ganztags arbeiten. Sie hat drei Kinder und einen Exmann, der keinen Unterhalt zahlt.« Paula hatte allmählich genug von der Geschichte. In der Redaktion war sie Thema Nummer eins, bei den Müttern ging die Angst um wie eine ansteckende Krankheit. Nun hatte das Virus offensichtlich auch die eher besonnene Doris infiziert. Paula war froh, als Simon kam und ihr Gespräch unterbrach.
»Kann ich Max meinen Schnuffi zeigen?«
»Aber der schläft doch jetzt.« Paula verteidigte die natürlichen Bedürfnisse des Goldhamsters. Schnuffi war die jüngste Errungenschaft. Irgendein Tier braucht ein Kind, hatte Paula sich von den Mustermüttern sagen lassen.
»Aber er ist wach. Er hat gerade was gefressen!« Simon war schon am Käfig, der nun den Platz auf dem Küchenschrank einnahm, wo bisher der Brotkasten gestanden hatte. Max beobachtete, wie Simon das weißbraune Tier in die Hand nahm. Die Schnurrhaare vibrierten ängstlich um die kleine rosa Schnauze.
Max zerrte an Simons Arm. »Ich will ihn auch mal!«
»Lieber nicht«, meinte Simon mit sachverständiger Miene, »er ist noch nicht so zahm.«
»Aber ich will ihn mal!« Max stampfte mit dem Fuß auf den Boden.
»Du darfst ihn mal streicheln.« Max strich dem Hamster über den Kopf, was diesen wohl erschreckte, denn er ließ ein leises Fauchen hören.
»Siehst du«, sagte Simon triumphierend, »er will nur zu mir. Er ist nämlich mein Freund.«
»Ich bin dein Freund. Der Hamster ist blöd.«
»Ist er nicht! Du bist blöd!«
»Blöder Hamster, blöder Hamster …«
»Max!« rief Doris. »Bitte, nicht so laut. Paula und ich möchten uns gerne unterhalten.«
»Simon, bring ihn wieder in den Käfig«, ordnete Paula an, »und dann spielt am besten in deinem Zimmer.« Simon murmelte etwas, das nach Protest klang, aber er gehorchte. Zum Öffnen des Deckels benötigte er beide Hände, und so setzte er Schnuffi für einen Moment auf den Küchenschrank. Den nutzte Max. Blitzschnell schloß sich seine kräftige Hand um den Hamster. Der gab einen pfeifenden Laut von sich.
»He, lass ihn los, du drückst ihn zu fest!« schrie Simon.
»Lass ihn los!« befahl Paula scharf.
»Blöder Hamster, ich bin dein Freund«, sagte Max, verzog das Gesicht zu einer beleidigten Grimasse, der Hamster machte ein schnarrendes Geräusch, dann quollen ihm schmatzend die Gedärme aus dem After. Simon stand wie versteinert und riss in ungläubigem Entsetzen den Mund auf, ebenso Paula.
Auf den spitzen Schrei seiner Mutter hin ließ Max den Hamster auf den Küchenboden fallen, ein Klumpen aus Fell und Eingeweiden, dessen Vorderbeine noch in einem letzten Reflex zuckten. Ein kleines Rinnsal hellrotes, fast wäßriges Blut sickerte über die rauhen Holzdielen. Paula wusste, dass sie diesen Anblick nie wieder vergessen würde. Simon auch nicht. Sie verlor die Beherrschung und packte Max, der ruhig dastand, am Arm, drehte ihn zu sich herum und schlug ihm zweimal mit dem Handrücken ins Gesicht. Seine Unterlippe platzte auf und begann zu bluten.
Doris sprang auf. »Paula, nicht! Du tust ihm weh! Es war sicher nicht Absicht.«
Paula stieß Max angeekelt von sich. »Schaff ihn raus«, flüsterte sie heiser, »raus mit ihm! Ich will ihn nie wieder hier sehen. Das ist kein Kind, das ist ein Monster!«
Hektisch raffte Doris ihre Sachen zusammen und schob Max vor sich her, der sich das Blut demonstrativ übers ganze Gesicht schmierte und herzerweichend vor sich hin wimmerte. Paula bugsierte den inzwischen laut heulenden Simon aus der Küche und hörte, wie die Haustür zufiel. Am ganzen Körper bebend lehnte sich Paula gegen die Wand. Dann stürzte sie ins Klo und erbrach sich.
Der Anfang war wie immer. Ihr Gesicht war eine schmerzende Masse, das fremd aussah in dem trüben Spiegel, der im langen, schmalen Flur ihrer elterlichen Wohnung hing. Die Ränder ihrer Lippen zerflossen rot, wie eine aufgeplatzte Frucht, sie schmeckte die zähe Süße des eigenen Blutes in ihrem Mund, während da drinnen, in der Küche, der Lärm andauerte. Stahlrohrstühle klapperten auf Linoleum, dazwischen Schreie und ein Geräusch, als klatsche man ein nasses Wäschestück gegen eine Wand. Sie zuckte jedes Mal zusammen, spürte den Laut mit jeder Faser ihres Körpers, ihre Ohren summten. Nach dem letzten Klatschen verstummte auch das Kreischen abrupt, und Paula fühlte sich elend und schuldig, ohne zu wissen, weshalb. Als alles ruhig war, saß ein Mann ohne Gesicht, der trotzdem ihr Vater war, vor einer stockfleckigen Tapete mit blassen Rosen zwischen schneckenförmigen Ornamenten, im Hintergrund glänzte ein schwarzes Klavier, obwohl es in jenem kahlen Raum nie ein Klavier gegeben hatte, lediglich im Speisesaal der Anstalt hatte eines gestanden. Sie atmete die Mischung aus Schweiß, Urin, Salmiak und aufgewärmtem Kaffee, ein pelziges Gefühl umgab sie wie eine Pfirsichhaut. Da war der Strick, der aus der Decke wuchs, einer weißen Zimmerdecke, höher als der Himmel. In einem anderen Raum, er hatte keine Wände, lag ihr Vater auf einem seidenen Kissen. Er wirkte mickrig, in seinem Hochzeitsanzug, mit gräßlich rosig geschminktem Gesicht. »So sieht er nicht aus«, rief Paula und zeigte auf die blauen, aufgeschwollenen Lippen. Neben ihr standen ihre Brüder. Thomas, der Jüngere, und Bernd, der immerzu das Wort »Leichengift« flüsterte. Wie stets an dieser Stelle erschien ihre Mutter, die einen Rosenkranz in ihren Händen hielt und zu ihr sagte: »Du brauchst ihm nicht nachzuweinen, Paula, er hat uns alle ins Unglück gestürzt.« Diese Worte sagte sie jedesmal. Selbst Alpträume erliegen gewissen Gewohnheiten, auch wenn Angst und Ekel dadurch nicht an Intensität verloren.
Was danach kam, war neu. Paula merkte, dass etwas sie verfolgte. Etwas Rotes, Gnomenhaftes, es ging eine unheimliche, nicht genau definierbare Gefahr davon aus. Es hatte das Wesen von Max. Sie lief auf wattigem Untergrund, wie Moder, sie sank ein, das Rot kam näher, seine Form löste sich auf, es wurde größer, tiefer, dichter, drohte sie von allen Seiten zu ersticken. Nackte rosa Krallen griffen nach ihr, und Simon sagte: »Du musst es totmachen, Mama.« Es hatte auf einmal das Gesicht von Max, Paula griff danach, spürte Widerstand, endlich greifbaren Widerstand, in einer Umgebung, in der alles andere wolkenhaft war. Es ging plötzlich ganz leicht, sie musste gar nichts tun, musste es nur töten wollen.
Dann war alles leer um sie, nur noch der Kadaver des Hamsters lag da, zuckend auf dem Küchenboden, daneben sein Gedärm, wie ein Knäuel ineinander verschlungener Regenwürmer. Nein, jetzt war es ein gelber Vogel, der da auf rauhen Holzplanken lag, und endlich kam eine kalte Schwärze und verschlang alles, das rote, gnomenhafte Wesen, den Vogel, einfach alles, und Doris stand in Paulas Küche, in einem blauen Kleid mit Fransen. Sie war wunderschön und sagte: »Los, beeil dich, Paula, wir müssen zur Premiere, wir müssen uns noch schminken.« Sie kam näher, lächelte, dann sagte sie: »Wie du aussiehst, Paula! Schnell, geh dich waschen, wir kommen sonst zu spät.« Paula lief ins Bad, das Wasser rauschte hinter dem Plastikvorhang, sie wartete davor, es dauerte immer eine Weile, bis es die richtige Temperatur erreicht hatte. Sie hörte Simon rufen: »Mama! Mama? Bist du das, Mama?«
Plötzlich zuckten grellweiße Lichtblitze auf, ätzten in die Augen, Paula taumelte gegen die Wanne und sank auf den Fußboden. Die weißen Fliesen reflektierten das Neonlicht.
Es dauerte ein paar Sekunden, ehe sie wach war, und ein paar weitere, ehe sie begriff. Simon stand in seinem rosa Schlafanzug vor ihr und rieb sich die Augen. »Mama? Ist jetzt Früh? Ist heute Kindergarten?«
Paula atmete erleichtert durch. Sie stand auf und stellte die Dusche ab. Ihr Geräusch hatte ihn wohl geweckt, sein Zimmer lag neben dem Bad. Sie nahm ihn in den Arm und brachte ihn zurück in sein Bett. »Es ist alles gut, mein Schatz, schlafweiter. Mama hat nur schlecht geträumt.« Simon schlüpfte in sein Bett und gähnte: »Gut, dass noch nicht Morgen ist. Ich bin nämlich noch nicht fertig mit Schlafen.« Paula deckte ihn zu und gab ihm einen Kuss auf sein weiches, glattes Haar.
»Mama?«
»Was ist?«
»Ich will keinen Hamster mehr. Ich will lieber einen Hund.«
Paula seufzte. »Darüber reden wir noch. Jetzt schlaf wieder. Gute Nacht.«
»Gute Nacht.«
Aus Erfahrung wusste Paula, dass sie jetzt nicht sofort wieder einschlafen konnte. Sie schlüpfte in ihren abgewetzten Männerbademantel, schlich barfuß in die Küche und setzte Wasser auf. Eine Kerze warf lange Schatten. In solchen Nächten ertrug sie kein elektrisches Licht. Während sie mechanisch die gewohnten Handgriffe verrichtete, bemühte sie sich, nicht auf den tellergroßen Blutfleck vor dem Küchenschrank zu treten, der sich feucht und schwärzlich schimmernd in die Holzdielen gefressen hatte.
Fröstelnd, die heiße Teetasse umklammernd, stand sie wenig später vor dem Fenster. Draußen war es sternklar, und als sich ihre Augen an das Dunkel gewöhnt hatten, konnte sie ohne große Mühe den Mann erkennen, der unter dem Haselnußstrauch stand und dessen bleiches Gesicht reglos auf sie gerichtet war.
In den folgenden Tagen gingen sich Paula und Doris aus dem Weg. Zwar hatte sich Paula am nächsten Vormittag telefonisch bei Doris für ihr unbeherrschtes Benehmen entschuldigt und gesagt, sie hätte das mit dem Monster nicht so gemeint, aber ein Schatten lag auf ihrer Freundschaft. Paula brachte Simon die ganze Woche über wieder selbst in den Kindergarten. In der letzten Zeit hatte das Doris für sie übernommen.
Paula erklärte Doris so diplomatisch wie möglich, Simon wolle im Moment nicht mit Max im Auto fahren und auch nicht mit ihm spielen. Das war nicht gelogen. Simon setzte das Ereignis noch immer zu, er träumte nachts schlecht, wachte auf und weinte, so dass Paula ihn zu sich in ihr Bett nahm, was sie sonst nur tat, wenn er krank war. Auch Paulas Traum kehrte einige Male wieder. In der irren Hoffnung, sich selbst betrügen zu können, schloß Paula ihre Schlafzimmertür zu und versteckte den Schlüssel auf dem Kleiderschrank. Doch die Maßnahme erwies sich als überflüssig, sie erwachte jetzt jedes Mal, kurz bevor Doris im blauen Kleid die Szene betrat.
Einmal klingelte Max, vermutlich ohne Wissen seiner Mutter, an Paulas Tür, um Simon zum Spielen zu holen. Simon versteckte sich in seinem »Nest«. Das Nest befand sich direkt vor seinem Zimmerfenster, im dichten Astwerk eines gewaltigen Knöterichs, dessen hemmungslosem Wachstum seit dem Tod des alten Schimmel vor acht Jahren niemand mehr energisch genug Einhalt geboten hatte. Die Pflanze maß annähernd zwei Meter im Durchmesser und umschlang die Vorder- und die Seitenfront des Hauses wie ein Lindwurm. Paula hatte das Gewächs ursprünglich entfernen lassen wollen, schon deshalb, weil es lästig war, im Sommer etwa alle zwei Wochen die oberen Fenster freischneiden zu müssen. Mit den trockenen Zweigen hätte man bestimmt einen Winter lang den Kamin beheizen können. Andererseits bildete das kunstvoll in sich verflochtene Dickicht eine ideale Heimstätte für zahlreiche Vogelnester, ein paar winzige braune Mäuse und einen Siebenschläfer. Das hatte Simon auf die Idee gebracht, sich dort ebenfalls ein Nest einzurichten, trotz der Verbote Paulas, die fürchtete, die abgestorbenen Aste im Innern der Pflanze könnten seinem Gewicht eines Tages nicht mehr standhalten. Doch Simon suchte weiterhin sein Nest auf, wenn er Kummer oder Streit mit Paula hatte. Oder sich vor etwas fürchtete.
Im Moment schien also etwas Distanz zu Max dringend angeraten. Aber Paula vermisste Doris schon bald, und auf längere Sicht hatte sie nicht die Absicht, die Freundschaft wegen eines toten Hamsters und eines mißratenen Görs aufzugeben.
Paula hatte wenige Freunde und noch weniger Freundinnen. Sie war kein sehr umgänglicher Typ. Die seltenen Freundschaften, die sie bisher geschlossen hatte, waren nach diversen Umzügen eingeschlafen oder bestanden nur noch aus gelegentlichen Telefonaten und Weihnachtskarten. Die Bekannten aus den gemeinsamen Jahren mit Klaus hatten sich nach der Trennung ihm zugewandt, da er zweifellos der bessere Unterhalter war, besonders wenn er seine publikumswirksam aufbereiteten Stories aus der Anwaltspraxis zum besten gab.
Am Montag, eine Woche nach dem Vorfall, tat Paula den ersten Schritt und lud Doris zu ihrer Geburtstagsfeier am Donnerstagabend ein. Nichts Großartiges. Nur ein Essen für ein paar Kollegen aus der Redaktion und zwei, drei Leute aus Paulas Theatergruppe, der Doris seit drei Jahren ebenfalls angehörte.
Nicht ohne gewisse Hintergedanken hatte Paula das Essen auf halb neun angesetzt, ziemlich spät also, damit Doris nicht etwa auf den Gedanken verfallen könnte, Max mitzubringen. Doris nahm die Einladung freudig an und verlor kein Wort über Max.
Der Nachmittag versprach trocken, wenn auch nicht sonnig zu bleiben. Paula und Simon bewaffneten sich mit diversen Gartengeräten, um sich vor Einbruch des Winters noch einmal der Wildnis rund um das alte Haus zu stellen. Simon erhielt den Auftrag, verwelkte Stengel aus dem Kräuterbeet hinter dem Haus zu rupfen, und machte sich mit wichtiger Miene ans Werk. Paula schnitt gerade lustlos an einer Heckenrose neben dem Eingangstor herum, als sie über den Gartenzaun hinweg von jener alten Frau angesprochen wurde, der Max seine Errettung von dem morschen Ast und der Hamster seinen frühen Tod verdankte. Sie trug dieselbe schwarze Kleidung wie neulich, auch den seltsamen Hut, und sah Paula aus wachen, dunklen Äuglein an. In holprigem Deutsch, mit einem strengen Akzent, beklagte sie den Zustand des Gartens, der zweifellos verwahrlost war, auch wenn Doris ihn euphemistisch »verwunschen« nannte.
»Mei Junge kann des wieder richtig mache«, erklärte sie eifrig, und ehe Paula etwas sagen konnte, winkte sie und rief mit ihrer dünnen Altweiberstimme etwas in ihrer Sprache. Russisch. Der »Junge«, ein recht kräftiges Mannsbild, stand urplötzlich hinter der Alten, die ihm gerade bis zur Brust reichte. Er hielt die Hände auf dem Rücken gefaltet, offensichtlich fühlte er sich nicht ganz wohl bei der Sache. Paula vermied es, ihn zu auffällig anzustarren. Sein Haar war filzig und falb, aber die Wangen glänzten frisch rasiert. Sehr oft schien er sich nicht zu rasieren, ein frischer Schnitt zog sich über den linken Wangenknochen. Seine Augen changierten zwischen Eisgrau und Grün. Kühle Augen, die viel sahen und wenig preisgaben. Der schmale Mund schien stets zu einem spöttischen Lächeln anzusetzen, das aber niemals zustande kam. Der Begriff »Nachtschattengewächs« ging Paula durch den Kopf. Tatsächlich sah er aus, als schliefe er zu wenig. Er mochte in ihrem Alter sein, vielleicht auch jünger. Hose und Jacke aus gutem Stoff saßen korrekt, waren aber an den Kanten und Nähten abgestoßen, die Kleidung von einem, dem es mal besser gegangen war und der nun bemüht war, gewisse Standards zu erhalten. Bei einem seiner braunen Halbschuhe hatte sich die Sohle ein wenig gelöst, so dass es aussah, als ob der Schuh Paula angrinste.
»Sie sind Gärtner?«
Er schüttelte den Kopf, eine winzige, verhaltene Bewegung nur, und trat einen Schritt auf Paula zu.
»Nicht wirklich«, sagte er, und Paula wagte nicht zu fragen, was er denn wirklich sei.
»Arbeitet auf’m Friedhof«, erklärte die Mutter. »verdient nit viel Geld damit.«
Paula zögerte. Die Alte hatte schon recht. Bald würden Massen an Laub das ohnehin schüttere Grün des schattigen Rasens ersticken, die Sträucher könnten einen Schnitt dringend gebrauchen, und sie, Paula, hatte weder Zeit noch Lust, diese Arbeit in Angriff zu nehmen. Allerdings war Paulas finanzielle Lage weniger üppig, als es nach außen hin den Anschein haben mochte. Mit ihrem Verdienst bei der Zeitung und den Unterhaltszahlungen von Klaus an Simon kam sie gerade so zurecht, an Personal war nicht zu denken. Andererseits würde Tante Lilli sicher etwas dazu beisteuern, ein Wort von Paula würde genügen. ›Wenn irgend was mit dem Haus ist, sag’s mir nur, Paulakind. Lass alles machen, was nötig ist, ich zahle das.‹ Der wahre Grund für Paulas Zögern war ein anderer.
Die alte Frau las Paulas geheime Gedanken. »Is’ wegen der Polizei? Der hat nix gemacht, ich weiß des.«
Paula gab sich einen Ruck und wandte sich direkt an ihn: »Es ist mir egal, was Sie … ich meine, Sie können gerne meinen Garten in Ordnung bringen.«
Sämtliche Runzeln im Gesicht der Alten zogen sich in die Waagerechte, der Mann sah Paula für einen kurzen Moment mit einer schier unhöflichen Direktheit an, dann kündigte sich so etwas wie ein Lächeln in seinen Augen an. Der Grund dafür war Simon, der angelaufen kam und die Besucher unverhohlen neugierig musterte. Er nickte dem Kind freundlich zu und sprach dann wenige Worte auf russisch mit seiner Mutter. Von Geld war noch keine Rede gewesen. Paula schnitt das Thema von sich aus an und bot ihm fünfzehn Mark Stundenlohn für die Gartenarbeit, was er sofort annahm. Sie hatte das Gefühl, dass er auch weniger akzeptiert hätte. Die beiden wandten sich zum Gehen.
»Da ist noch was.« Paula hatte es leise gesagt und nur zu ihm. Er drehte sich um, sie befanden sich außer Hörweite der Mutter.
»Ja?«
Paula straffte die Schultern und sah ihm in die Augen. »Sie warnen mich vorher, wenn Sie nachts um mein Haus schleichen. Damit ich mich nicht wieder so erschrecke.«
Drei Tage später, es war Donnerstag, der 13. Oktober, werkelten Paula und Simon in der Küche. Noch mehr als die Gartenarbeit liebte Simon es, mit seiner Mutter zu kochen. Sie wurden durch einen Anruf unterbrochen, dem Paula insgeheim schon den ganzen Tag entgegengehofft hatte.
»Ich wette eine Flasche Mouton-Rothschild, du hast heute morgen im Spiegel nachgesehen, ob du ein paar Falten mehr findest«, kratzte es an Paulas Ohr. Wo sich bei anderen Menschen die Stimmbänder befanden, saß bei Tante Lilli eine Schiffsschraube.
»Tante Lilli! Wo bist du?«
»In München, in meiner bescheidenen Unterkunft.« So nannte sie ihr Hundertzwanzig-Quadratmeter-Penthouse mit Blick auf den Englischen Garten. »Ich konnte es bei den alten Tatterichen in Florida nicht länger aushalten. Die reden nur von Geld und Krankheiten.«
»Tatteriche? Tante Lilli, du gehst selbst auf die Siebzig zu.«
»Na und? Und du bist seit heute vierzig. Gratuliere«, sagte sie boshaft. »Ich weiß noch gut, wie ich an meinem Vierzigsten vor dem Spiegel stand und nach Falten suchte«, sie lachte ihr kraftvolles, dröhnendes Lachen, »ich fand genug für zwei! Schließlich habe ich gelebt. Wie ist es bei dir?«
Paula seufzte. »Ich wusste nicht, dass ich so berechenbar bin. Wenn du schon in München bist, dann kannst du heute abend gleich zu meiner kleinen Feier kommen. Setz dich eine Stunde in den Zug und übernachte hier. Es gibt Bœuf-à-la-mode. Dein Rezept.«
»Vergiß das Lorbeerblatt nicht. Nein, danke, du hast sicher viel junges Volk eingeladen, da will ich nicht stören.«
»Komm mir nicht so. Du würdest sie alle in die Tasche stecken, sie wären hingerissen von dir.« Paula bemühte sich um einen leichten Ton, damit Lilli nicht merken sollte, wieviel ihr an ihrem Kommen lag.
»Lieber nicht«, wich Lilli aus. »Diese Fliegerei strengt eine alte Frau doch sehr an.«
»Fishing for compliments, was?«
›Ein andermal. Paulakind, versprochen. Was macht Simon?«
»Schneidet Karotten«, sagte Paula. Sie war ein wenig enttäuscht.
»Nicht zu viele davon, sonst wird’s zu süßlich. Übrigens, man liest nichts Gutes in der Zeitung über meine alte Heimat.«
»Nein«, stöhnte Paula, »bitte du nicht auch noch! Die ganze Stadt leidet schon an kollektivem Verfolgungswahn.«
Paula konnte Lillis sarkastisches Lächeln vor sich sehen, als sie ihre Tante sagen hörte: »Das kann ich mir denken. Solche Ereignisse wirken wie ein Tritt in einen Ameisenhaufen. Sie bringen als erstes ihre Brut in Sicherheit.«
»Das Alter schärft deine Bosheit«, revanchierte sich Paula für die Sache mit dem Spiegel. »Aber selbst du kannst dir nicht vorstellen, was ich mir in letzter Zeit für Grausamkeiten anhören muss. Lauter gerechte Strafen für den Täter, mal vorausgesetzt, es gibt überhaupt einen. Praktizierende Christen, die noch kürzlich leidenschaftlich für die Beibehaltung des Schulgebets und des Kruzifixes gestritten haben, schreien jetzt nach Wiedereinführung der Todesstrafe.«
»Ich weiß, ich habe die Leserbriefe schon studiert.«
Paula fand es rührend von Lilli, dass sie den Stadtkurier abonniert hatte, um nur ja keinen ihrer Artikel zu versäumen.
»Das waren die Harmlosen. Aus den nicht veröffentlichten könnte man ein Horrordrehbuch machen. Die Inquisition war ein Kinderspiel gegen die Phantasien des gesunden Volksempfindens. Aber noch viel schlimmer ist dieses Betroffenheitsgesülze.« Es tat Paula gut, sich einmal Luft machen zu können. Lilli war der einzige Mensch, mit dem sie in dieser Weise über die Geschehnisse reden konnte. Bei Doris, für die Muttersein der Lebensinhalt schlechthin war, stieß sie damit auf blankes Unverständnis.
»Das musst du verstehen, Paula«, erklärte Lilli, »das ist nur die geheime Erleichterung darüber, dass es nicht das eigene Kind getroffen hat. Trotzdem, paß auf deinen Jungen auf, Paula. Er ist ein Mensch, wie es nur ganz wenige gibt. Wenn er lächelt, würde sogar der Südpol schmelzen.«
»Er ist nicht immer nur lieb. Er hat durchaus seine Launen«, wehrte Paula ab.
»Die hast du auch. Und ich erst! Ist mit dem Haus alles in Ordnung?«
»Ja. Ich habe seit drei Tagen einen Gärtner.«
»Macht er wirklich den Garten, oder ist er dein Liebhaber?«
»Er macht nur den Garten, für den Rest reicht das Geld nicht. Das ist eine komische Geschichte, ich erzähle sie dir, wenn du mal kommst. Jetzt muss ich zurück an den Herd.«
»Wo die Weiber hingehören«, ergänzte Tante Lilli und legte auf. Sie hätte es nie zugelassen, dass man sie eine Emanze nannte, aber sie war die aufrechteste und zugleich die angenehmste, die Paula je gekannt hatte.
Gegen halb neun kamen die ersten Gäste: Karlheinz Weigand, Chef der Lokalredaktion des Stadtkuriers, und seine Frau Inge. Inge war eine ruhige, freundliche Frau, die sich voller Begeisterung von einer neuen Diät in die andere stürzte, deren Körper aber dennoch einem Nachfüllpack für Flüssigwaschmittel ähnelte. Sie überreichte Paula das Geschenk der Redaktion. Paula hoffte, dass es sich diesmal wenigstens für den Flohmarkt eignen würde, Sperrmüll stapelte sich bereits genug auf dem Dachboden. Sie bedankte sich artig und stopfte die mitgebrachten Blumen. seufzend in eine Vase. Schnittblumen, insbesondere Gerbera an Drähten, konnte sie genauso gut leiden wie singende Geburtstagskarten. Noch während die Weigands den festlich gedeckten Tisch bewunderten, trafen Barbara und Hermann Ullrich ein, und gleich hinter ihnen schlüpfte Doris durch die Tür.
Barbara, im kleinen Schwarzen, begrüßte Paula überschwenglich. Wie stets bei ihren seltenen Besuchen fand sie bewundernde Worte für das Haus. Die Ullrichs wohnten im Westen der Stadt, wo ›das Kapital hockte‹, wie Paula zu lästern pflegte. Wäre Lillis Vater, der alte Schimmel, weniger stur und exzentrisch gewesen – »Ich wohne bei meiner Fabrik und nirgendwoanders!« –, hätte sich die Schimmel-Villa nahtlos zwischen die dortigen Prachtbauten mit ihren großzügigen Gärten und dem alten Baumbestand eingereiht, anstatt hier, auf der proletarisch-mittelständischen Seite der Stadt ›fehl am Platze zu sein, wie eine seltene Rose zwischen Primeln und Stiefmütterchen‹, wie sich Barbara Ullrich auszudrücken pflegte.
Hermann Ullrich war zum ersten Mal zu Besuch. Interessiert blickte er sich um. »Sieh nur, Schatz, was für wunderbare Bodenfliesen«, rief Barbara, als sie sich aus ihrem Modellmantel schälte, der eine frappante Ähnlichkeit mit einer karierten Pferdedecke aufwies. Sie überprüfte ihr Make-up in dem großen rautenförmigen Jugendstil-Spiegel mit dem Goldrahmen, während Hermann ihren Mantel in Empfang nahm und Paula drei weiße Lilien reichte, die in einer Schärpe aus lila Seidenpapier arrangiert waren.
»Seit wir unsere Terrasse neu gepflastert haben, habe ich einen Blick für Bodenfliesen«, erläuterte Barbara. »Ich habe die Steine in Italien ausgesucht, schon im Frühjahr, und wisst ihr, wann sie gekommen sind? Vor drei Wochen! Als der Sommer vorbei war. Mein Hermann hat sie eigenhändig verlegt, weil natürlich auf die Schnelle kein Handwerker zu bekommen war, sie haben ja nie Zeit, wenn man sie braucht.« Sie tätschelte ihrem Hermann die Wange, offensichtlich stolz auf seine handwerklichen Fähigkeiten.
»Sie sind entsprechend holprig«, murmelte er verlegen. »Aber Barbara wollte unbedingt …« Angelockt vom Begrüßungsgeschnatter, kam Simon im Schlafanzug die Treppe herunter.
»Was ist denn hier los?« krähte er, hocherfreut über die ungewohnte Menschenansammlung.
»Ah, mein kleiner Räuber«, flötete Doris, die bis jetzt noch kaum zu Wort gekommen war, mit jener piepsigen Kinderstimme. die Paula so zuwider war, »sooo lange habe ich dich nicht gesehen.«
»Und jetzt wieder ab ins Bett mit dir«, sagte Paula zu Simon.
»Was denn, er darf nicht mitessen?« fragte Doris mit übertriebenem Entsetzen und sah Paula anklagend an.
»Er hat schon gegessen«, entgegnete Paula kurz angebunden und parierte den Blick, indem sie fragte: »Was macht denn Max? Hast du einen Babysitter für ihn gefunden?« Es mochte ein Zufall sein, doch nach dieser Frage war es ein, zwei Sekunden still in der Diele, als schienen alle auf eine Antwort zu warten.
»Er schläft schon«, antwortete Doris knapp.
Bei Paula blitzte flüchtig der Gedanke auf, dass sie gar keinen Babysitter hatte, und Barbara erging es wohl ähnlich, denn ihr vielsagender Blick begegnete dem Paulas, ehe Simon die Stille unterbrach: »He, was ist denn das? Ist das von einem Piratenschatz?« Er streckte die Hand nach Barbara Ullrichs kupfernem Ohrring aus, der Form und Größe eines chinesischen Essensgongs hatte.
»Simon!« mahnte Paula. Auf einmal wurde ihr bewusst, dass sie und ihre Gäste bereits ungehörig lange in der Diele herumstanden. Doris hielt noch immer ihr kleines Geschenk in der Hand, sicher hatte sie wieder ein Seidentuch bemalt, Hermann Ullrich hatte den Mantel seiner Frau kurzerhand selbst an die Garderobe gehängt und bewunderte nun, mangels einer anderen Beschäftigung, das Schlüsselkästchen aus Mahagoni, das neben dem Spiegel hing. Es besaß filigrane Einlegearbeiten aus Elfenbein und Schlüsselhaken aus Goldmessing in Form von Elefantenrüsseln, niemand wusste genau, aus welchen dunklen Kanälen Tante Lilli dieses Kleinod gefischt hatte. Barbara war in die Hocke gegangen und inspizierte fachmännisch die Bodenfliesen, die der alte Schimmel beim Abriss einer Kirche für ein Spottgeld erworben hatte, zu Zeiten, als man es mit dem Denkmalschutz noch nicht so genau nahm, und Simon nutzte diese Gelegenheit, um ihren Ohrring staunend durch die Finger gleiten zu lassen. Während der ganzen Zeit warteten die Weigands alleine am gedeckten Tisch. Was bin ich bloß für eine miserable Gastgeberin, sagte sich Paula und forderte ihre Gäste auf hereinzukommen. »Simon, bring bitte die Blumen in die Küche, und dann ab nach oben mit dir!«
Etwas verlegen nahm Paula Doris’ Glückwünsche und das kunstvoll verpackte, selbstbemalte Schächtelchen entgegen. Kaum hatte Doris die Hände frei, umarmte sie Simon, der prompt verlangte, von ihr ins Bett gebracht zu werden, wofür Paula dankbar war, denn so konnte sie endlich ihren Pflichten als Hausherrin nachkommen. Wäre doch Lilli hier, dachte sie mit einem Anflug von Panik, sie managt eine Garnison Gäste mit dem kleinen Finger, während ich schon bei fünf Leuten versage.
Doris und Simon arrangierten die Lilien in der Glasvase, dann verschwanden sie unter Kichern und Gewisper nach oben.
»Was für ein pfiffiges Kerlchen«, meinte Barbara, »wo hat er nur diesen Charme her?«
Paula überhörte die letzte Bemerkung zugunsten der ersten, die für Barbara einem Sprung über den eigenen Schatten gleichkam. Barbara und Hermann hatten einen Sohn gehabt, der am Down-Syndrom litt und etwa in Simons jetzigem Alter gestorben war. Das war sechs Jahre her, und seitdem ging Barbara Kindern aus dem Weg, widmete sich statt dessen mit fast religiöser Hingabe der Theaterarbeit.
Paula entschuldigte sich kurz und traf die nötigen Essensvorbereitungen, die nur durch die Ankunft des letzten Gastes, Siggi Fuchs, unterbrochen wurden. Er küsste Paula übertrieben stürmisch und überreichte ihr ein Geschenk, das sich nach Buch anfühlte.
»Sicher erzählt Doris deinem Sohn eine neue Geschichte«, meinte Barbara eine halbe Stunde später, als ihr Mann und Weigand bereits hungrig nach der Tür schielten. »Ich habe ihr neues Buch Der dicke Hamster Benjamin schon dreimal verschenkt, die Kinder meiner Schwester sind ganz wild drauf. Diese süßen Zeichnungen! Sie ist wirklich begabt.
»Ja, das ist sie«, bestätigte Paula und sah ein wenig gereizt zur Uhr. Man hätte eigentlich längst mit der Vorspeise beginnen können. Die Entenleber wurde in der Backröhre bestimmt nicht zarter, und der Feldsalat fing sicher schon an, zusammenzufallen, um dann matschig wie Froschlaich auf dem Teller zu liegen. Es dauerte jedoch weitere verkrampfte zehn Minuten, ehe Doris wieder erschien. »Tut mir leid«, sagte sie mit schuldbewusstem Augenaufschlag, »er wickelt mich jedes Mal um den Finger. Noch eine Geschichte, und noch eine …«
Paula sagte nichts dazu und beeilte sich, die Teller zu holen.
»Du siehst gut aus«, hörte sie im Hinausgehen Siggi Fuchs sagen. Meinte er sie? Nein, er sprach mit Doris, und zweifellos hatte er recht. Ihr dunkelblondes Haar war in weichen Locken um ihr dezent, aber perfekt geschminktes Gesicht arrangiert, die eleganten Augenbrauen, um deren Schwung Paula sie oft beneidete, waren frisch gefärbt, die Wimpern lang und blauschwarz, eine neue azurblaue Seidenweste ließ ihre Augen im selben Ton leuchten. Der hauchzarte Mandelduft eines Parfums, dessen Namen sie seit Jahren geheimhielt, umgab sie. Paula selbst war wenig Zeit geblieben, sich herzurichten. Mit der hastig aufgetragenen Wimperntusche und dem dunkelroten Lippenstift war ihr das eigene Gesicht jedoch bereits fremd genug, und mit ihrem kurzen Haar ließ sich nicht viel mehr anstellen, außer es zu waschen, damit es nicht allzusehr nach Küche roch.
Doris dagegen hatte das ganz große Programm durchgezogen, bemerkte Paula anerkennend, und sie wusste auch zu schätzen, dass dieser Aufwand ihr galt, denn offensichtlich nahm Doris die Einladung als Geste der Aussöhnung. Paula hatte nicht viel übrig für Frauen, die sich nur für Männer zurechtmachten.
»Ich hoffe, es schmeckt euch«, lächelte sie wenig später bei Tisch, froh, dass die Speisen nicht die befürchteten Schäden erlitten hatten. Sie hob ihr volles Glas. Doris prostete ihr zu. »Auf dich. Und auf Simon.«
Zwei Stunden danach lehnte sich Paula entspannt auf ihrem Stuhl zurück. Ihre Kochkünste hatten überzeugt, das war Tante Lillis französischer Einfluß. Hermann Ullrich entkorkte gerade die vierte Flasche Bordeaux, ebenfalls eine Empfehlung von Lilli, der unbestrittenen Expertin.