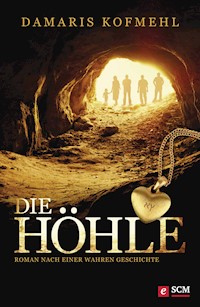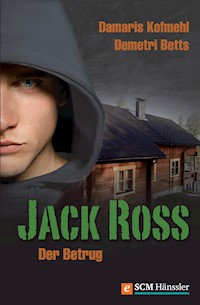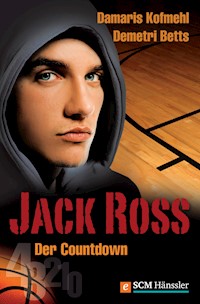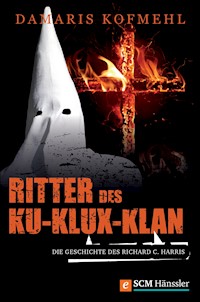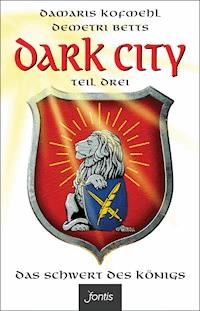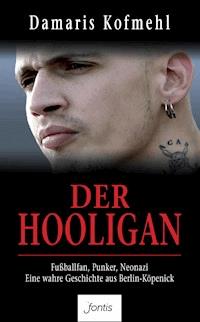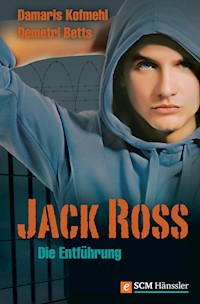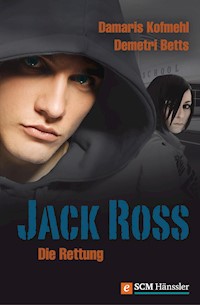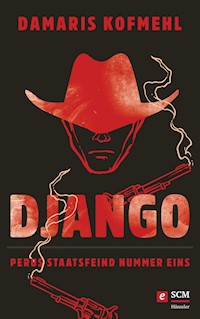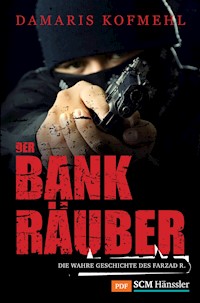16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: SCM Hänssler
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Welt ist gottlos und blutrünstig, als der junge Noah von Sklavenhändlern ins Zentrum des Bösen verschleppt wird. Nur eine Handvoll Menschen kennen noch ihren Schöpfer und Noah ist einer von ihnen. Als es kaum noch Hoffnung gibt, hört er inmitten seiner Qualen immer wieder Gottes Stimme, ein leises Flüstern in seinem Herzen ... Es zeigt sich: Wenn Gott einen Plan hat, wird er ihn ausführen. Er wird die Welt vernichten. Und sie erlösen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
SCM Hänssler ist ein Imprint der SCM Verlagsgruppe,die zur Stiftung Christliche Medien gehört, einer gemeinnützigen Stiftung,die sich für die Förderung und Verbreitung christlicherBücher, Zeitschriften, Filme und Musik einsetzt.
ISBN 978-3-7751-7564-7 (E-Book)ISBN 978-3-7751-6134-3 (lieferbare Buchausgabe)
Datenkonvertierung E-Book: Satz & Medien Wieser, Aachen
© 2022 SCM Hänssler in der SCM Verlagsgruppe GmbHMax-Eyth-Straße 41 · 71088 HolzgerlingenInternet: www.scm-haenssler.de; E-Mail: [email protected]
Die Bibelverse sind folgender Ausgabe entnommen:Neues Leben. Die Bibel, 2. Auflage 2019 © der deutschen Ausgabe 2002/2006 by SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen.
Umschlaggestaltung: Stephan Schulze, StuttgartTitelbild: Collage mit iStockmaterial von Krister Rajanda und Christopher StoltzAutorenfoto: © Nakischa ScheibeSatz: Satz & Medien Wieser, Aachen
Ich widme dieses Buch meinem guten Freundund Autorenkollegen Angelo Nero.Ich schätze unsere Freundschaft, unsereinspirierenden Gespräche über neue Buchprojekteund die vielen tollen Kinobesuche so sehr.Danke für deine Freundschaft.Und danke für deine wertvollen Anregungen zu diesem Buch.Die Überarbeitung hat sich wirklich gelohnt.
Inhalt
Über die Autorin
Vorwort
Erklärungen
Prolog
Teil 1 | Im Krater
Am Anfang …
Die Menschenjäger
Verschleppt nach Hawil
Als Sklave verkauft
Prinzessin Naama
Das Fest der Lebensreife
Erzähl mir von deinem Gott
Am sechsten Tag …
Die List der Schlange
Zu viel riskiert
Der neue König
Im Reich Ranaks
Stimme in der Nacht
Im Krater
Teil 2 | Der Auftrag
Bärenkrallen und Vogelfedern
Versuchung in Iri Sana
Ziusudra soll sterben
Der Kampf des Jahrtausends
Die entfesselten Bestien
Der Taurox
Metuschelach
Es hat begonnen
Der Auftrag
Auf nach Eden
Teil 3 | Die Flut
Das Mädchen und der Naphil
Die Arche entsteht
Unerwarteter Besuch
Ham und Anouk
Das verlorene Paradies
Begegnung mit den Cherubim
Im Tempelturm
Der weiße Löwe
Die Tiere kommen
Noahs Fragen
Die Frucht des Lebens
Der Tod des Kraterkönigs
Die Schlacht um die Arche
Die Sintflut
Die neue Welt
Nachwort
Anmerkungen
Leseempfehlungen
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Über die Autorin
DAMARIS KOFMEHL ist Bestsellerautorin und erzählt wahre Begebenheiten als True-Life-Thriller, Fantasy und Biografien. Ihre Buchrecherchen führten sie unter anderem nach Brasilien, Pakistan, Guatemala, Chile, Peru, Australien und in die USA. Sie lebte lange unter Straßenkindern in Brasilien und heute wieder in ihrem Heimatland, der Schweiz.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Vorwort
Ich glaube, dass meine Leidenschaft fürs Schreiben stark von meinem Vater geprägt wurde. Er hat meiner Schwester und mir abends vor dem Zubettgehen immer biblische Geschichten erzählt. Er war ein hervorragender Geschichtenerzähler. Wir klebten förmlich an seinen Lippen und konnten nie genug davon bekommen. Die biblischen Figuren wurden auf einmal so lebendig! Wir fieberten mit ihnen mit.
Vielleicht lese ich auch deshalb so gerne in der Bibel. Für mich lebt sie. Ich schlüpfe regelrecht in die Geschichten hinein und stelle mir vor, wie Mose, David oder Paulus wohl als Menschen gewesen sein könnten.
Der Wunsch, biblische Geschichten in Romanform niederzuschreiben, schlummert seit über einem Jahrzehnt in mir. Wieso ich so lange gewartet habe, die Idee umzusetzen, liegt daran, dass ich großen Respekt davor habe. Wir reden hier immerhin von der Bibel! Es gibt tausend Fettnäpfchen, in die man treten kann. Einerseits liegt es in der Natur des Romans, eine Geschichte auszuschmücken und sie in großen Teilen neu zu erfinden, andererseits möchte ich den biblischen Bericht nicht verfälschen. Es ist nicht leicht, beides unter einen Hut zu bringen, aber ich möchte das Wagnis eingehen. Beginnen möchte ich mit der Geschichte von Noah, die mich fasziniert, seit ich denken kann.
In enger Anlehnung an den biblischen Bericht werde ich die Story mit meiner künstlerischen Vorstellungskraft neu beleben. Der Bau der Arche und die Sintflut sind die Ereignisse, die wir aus der Bibel kennen. Mein Noah-Roman setzt viel früher ein. Die meisten Charaktere und Szenen sind frei erfunden – zwangsläufig, da einfach kaum etwas dazu in der Bibel steht – jedoch stets mit dem Bemühen, dass sie mit der biblischen Erzählung harmonisieren. Das vorliegende Buch hat also nicht den Anspruch einer historisch korrekten Wiedergabe, sondern es ist ein Roman und mein Noah ist ein fiktiver Noah.
Mein Wunsch ist es, dass die jahrtausendealte Geschichte von Noah in dir so lebendig wird, als wärst du live mit dabei gewesen. Was die Fettnäpfchen angeht, so werde ich im Nachwort noch auf das eine oder andere näher eingehen. Aber ansonsten möchte ich dich nicht länger auf die Folter spannen und einfach loslegen. Also schnall dich gut an und tauche mit mir ein in den dramatischen Bibel-Thriller: Noah!
Damaris Kofmehl
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Erklärungen
Verwendete Maße
Noahs Familie
Noah
Lamech (Sethit, also ein Nachkomme Seths) – Noahs Vater
Metuschelach – Noahs Großvater, Vater von Lamech
Jared – sechs Jahre jüngerer Bruder von Noah
Emra – acht Jahre jüngere Schwester von Noah
Kael – elf Jahre jüngerer Bruder von Noah
Noahs Söhne und Schwiegertöchter
Sem – ältester Sohn von Noah und Naama
Japhet – zweitältester Sohn von Noah und Naama
Ham – jüngster Sohn von Noah und Naama
Jerina – Frau von Sem
Luma – Frau von Japhet
Anouk – Frau von Ham
Tubal-Kains Familie
Lamech (Kainit, also ein Nachkomme Kains) – Vater von Tubal-Kain, Naama, Jabal und Jubal
Ada – Frau von Lamech, Mutter von Jabal und Jubal
Zilla – Frau von Lamech, Mutter von Tubal-Kain und Naama
Tubal-Kain – ältester Sohn von Lamech und Zilla, Bruder von Naama
Naama – Noahs Frau, Tochter von Lamech und Zilla, Schwester von Tubal-Kain
Jabal und Jubal – Halbbrüder von Naama und Tubal-Kain
Weitere Charaktere
Nachash – Schlangengöttin
Ranak – Kraterkönig, Naphil (Mehrzahl: Nephilim, furchtlose und gefährliche Riesen)
Gorgosh – Nephilimkrieger
Korab – Heerführer von König Lamech
Tiere und Drachen
Blutwolf – ein besonders großer und blutrünstiger Wolf
Dolchtiger – Säbelzahntiger
Uku – Helmkasuar
Keulenschwinger – Ankylosaurus
Kraller – Velociraptor
Saketa – Triceratops (Dreihorngesicht)
Taurox – Tyrannosaurus
Kleiner Flugdrache – Pteranodon
Großer Flugdrache (Speerschnabel) – Quetzalcoatlus
Behemot – Brontosaurus
Leviathan (Beschreibung in Hiob 40,25–41,26)
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird, und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert.
Hebräer 11,1
Prolog
Laut krachten die Wellen gegen den Schiffsrumpf. Die Schiffsbalken ächzten und knarzten im Sturm. Der Wind heulte schauerlich und jeder Donner hörte sich an, als würde der gesamte Himmel zerbersten. Eine einzelne Öllampe baumelte quietschend von der Decke und warf tanzende Schatten an die geteerten Planken.
Die Silhouetten der Tiere in ihren Käfigen wirkten gespenstisch. Man hörte ihr Schnauben und Keuchen in der Dunkelheit, jäh durchbrochen vom aufgebrachten Flattern und Krächzen der Papageien, dem hysterischen Lachen der Hyänen oder dem ängstlichen Jaulen der Wölfe. Ganz zuhinterst im Schiffsheck, zwischen Vorratskrügen und Schiffstauen, mit mehreren starken Ketten am Boden festgemacht, stand ein riesiger, mit einer dicken Stoffplane zugedeckter Käfig, aus dessen Inneren ab und zu gefährlich knurrende Laute drangen. Die Ketten rasselten jedes Mal, wenn das Schiff sich zur Seite neigte.
Es war stickig und ein penetranter Gestank nach Kot und Urin lag in der Luft. Käfig reihte sich an Käfig. Einige Käfige waren übereinandergestapelt, um Platz zu sparen. Sie waren so eng bemessen, dass die Tiere sich kaum um ihre eigene Achse drehen konnten. Ausgehungert und eingeschüchtert duckten sie sich zwischen die Bambusgitterstäbe: Leguane, Schildkröten und Krokodile, allerlei Wildkatzen, Tiger, Dachse, Paviane, Stachelschweine, Tannenzapfentiere, Wildgänse, Wüstenfüchse und Pfauen.
Ein paar kleinere Käfige mit exotischen Vögeln hingen von der Decke. Manche der Vögel hatten lange, schimmernde Schwanzfedern, riesige bunte Schnäbel oder trugen feine Federkronen, viele waren winzig klein und leuchteten in grellen Rot-, Blau- und Gelbtönen. Einige flatterten nervös herum. Manche hockten mit hängenden Flügeln in der Ecke ihres Käfigs und starrten apathisch vor sich hin, andere hangelten sich in Panik kreuz und quer an der Innenseite ihres Käfigs entlang auf der Suche nach einem Ausgang. Ein paar von ihnen versuchten, mit den Schnäbeln die Bambusstangen durchzupicken, um sich selbst aus ihrem Gefängnis zu befreien.
Noah sah ihnen wehmütig dabei zu. Es brach ihm das Herz, mitansehen zu müssen, wie sie litten und kämpften und nicht verstanden, wieso sie eingesperrt waren. Er hätte ihnen so gerne geholfen. Sie wirkten so verzweifelt und hilflos und die Geräusche des Sturms, der draußen tobte, jagten ihnen entsetzliche Angst ein. Trotz ihrer misslichen Lage und ihrer struppigen Felle und zerzausten Federkleider waren sie jedoch wunderschön. So einzigartig und vielfältig, wie der Schöpfer sie erschaffen hatte.
Ein jedes nach seiner Art, dachte Noah und ein Stich ging ihm durchs Herz. Ach, könnte ich euch doch alle befreien! Säße ich doch bloß nicht selbst in diesem schrecklichen Gefängnis!
Ein kurzer, heftiger Donnerschlag erschütterte die Luft und der Sturm zerrte das Schiff erbarmungslos hin und her. Noah klammerte sich verkrampft an die Gitterstäbe seines verrosteten Käfigs. Nie hätte er gedacht, dass er sich je in einer so ausweglosen Situation befinden würde, fern von seiner Familie, völlig allein, der Willkür brutaler Menschenhändler ausgeliefert. Seit Tagen war der Neunzehnjährige hier unten im Schiffsbauch eingesperrt, zusammen mit vielen anderen, die in der gleichen hoffnungslosen Lage waren wie er. Eng zusammengepfercht kauerten sie auf dem Boden des Käfigs, eine Schar halb nackter Menschen – Erwachsene, Jugendliche, so wie er selbst, und viele Kinder. Sie waren barfuß und ihre Kleider nichts als Lumpen. Im Gegensatz zu den gefangenen Tieren gaben sie kaum einen Laut von sich. Doch in ihrem Schweigen lag mehr Panik als in den Geräuschen der Tiere. Auch sie harrten ihres Schicksals, das nicht besser sein würde als das der Tiere.
Eine Kette rasselte, eine Luke wurde aufgeklappt und ein greller Blitz zuckte über den fahlen Himmel. Heftiger Regen prasselte durch die Öffnung in den dunklen Schiffsbauch hinab. Zwei Männer stiegen in den Schiffsrumpf. Sie trugen Lederstiefel und Kleider aus Fell und Leinen und hatten einen Topf mit Essen und einen Krug mit Wasser dabei.
»Essen fassen!«, brüllte der eine.
Die Gefangenen drängten sich ans Gitter und streckten ihre ausgemergelten Arme aus dem Käfig. Auch Noah streckte seine Hände durch die Gitterstäbe und formte sie zu einer Schale. Denn Ess- oder Trinkgefäße gab es keine. Die Männer schöpften ihnen das Essen mit einer Kelle direkt in die Hände. Hastig begannen die Gefangenen zu essen. Es war ein ekliger, zähflüssiger Brei, doch Noah war so hungrig, dass er sich alles hastig von den Fingern leckte. Als er fertig war, streckte er die Hände erneut durchs Gitter, um einen Nachschlag zu ergattern. Aber es gab keinen. Es gab nie einen und sein Hunger war längst nicht gestillt.
Als Nächstes gaben ihnen die Männer zu trinken. Auch das Wasser mussten sie mit den bloßen Händen auffangen, was bei dem schaukelnden Schiff gar nicht so leicht war. Viele verschütteten das Wasser, bevor sie überhaupt davon trinken konnten. Noah presste seine Ellenbogen ganz fest an den Körper und machte sich ganz steif, um ja nichts von dem wertvollen Wasser zu verlieren. Er war so durstig. Er hätte den ganzen Krug alleine austrinken können. Plötzlich spürte der Neunzehnjährige, wie ihn jemand an seinem zerfetzten Hemd zupfte. Es war ein kleines Mädchen von vielleicht acht Jahren. Mit stummem Flehen blickte es zu ihm hoch. Noah hatte Mitleid mit ihr.
»Hier«, sagte er und streckte ihr seine Hände hin, die er zu einer Wasserschale geformt hatte. »Trink.«
Das Mädchen beugte sich vor und schlürfte das Wasser gierig aus seinen hohlen Händen. Noahs Herz wurde schwer bei ihrem Anblick. Sie erinnerte ihn an seine jüngere Schwester. Es brach ihm schier das Herz, wenn er an sie dachte, wenn er an sie alle dachte! Wie sehr vermisste er seine Familie, seine beiden Brüder und seine Schwester und seinen Vater. Seinen Vater… oh, wie sehr vermisste er seinen Vater! Er vermisste das Arbeiten mit ihm auf dem Feld, die Gespräche mit ihm beim Essen oder die Geschichten, die er ihm und seinen Geschwistern abends beim Feuer erzählte.
Als Noah noch klein war, hatte sein Vater ihm jeden Abend vor dem Einschlafen eine Geschichte erzählt. Am liebsten hatte er die Geschichte gemocht, wie Gott Himmel und Erde und alles Leben erschaffen hatte. Damals war die Welt noch in Ordnung gewesen. Damals hatte es noch keine Bosheit gegeben, kein Leiden und keinen Schmerz.
Eine Frau neben Noah kreischte auf und taumelte zurück, als einer der Männer ihr durchs Gitter ins Gesicht griff und sie grob zurückschob.
»Weg da! Zurück!«
»Mehr Wasser! Bitte!«
»Es gibt nichts mehr!«
Die Gefangenen klebten dicht gedrängt am Gitter und streckten immer noch ihre Hände aus dem Käfig, doch die Männer schlugen sie mit den Schöpfkellen, traten mit ihren Stiefeln nach ihnen. Jemand stolperte und riss ein paar Gefangene mit sich. Auch Noah stürzte. Er rappelte sich wieder auf, wühlte sich durch das Chaos aus Leibern und bahnte sich einen Weg in den hinteren Teil des Käfigs, wo er für sich alleine war. Mit angewinkelten Beinen hockte er sich in die Ecke, schlang seine Arme um die Knie und versuchte, die Geräusche, den Sturm, den Gestank und die ganze trostlose Situation für einen Moment auszublenden.
Ach, was gäbe er darum, wieder bei seiner Familie zu sein! Ob er sie jemals wiedersehen würde? Die Sehnsucht nach ihr war auf einmal unglaublich stark. Noah schloss die Augen und versuchte, irgendeine schöne Erinnerung in sich wachzurufen, um sich daran festzuklammern. Seine Gedanken warfen ihn zurück in seine Kindheit, zurück zu seinem Vater, wie er an seinem Bettlager auf dem Boden saß und ihm eine Geschichte erzählte.
Das Weinen und Klagen der Gefangenen um Noah herum wurde immer leiser und auf einmal verstummte es ganz. Dann war alles still.
Und aus der Stille heraus hörte Noah eine ihm wohlvertraute Stimme.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Teil 1
Im Krater
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Am Anfang …
»Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.«
Noah schaute auf und blickte seinen Vater unter der kuscheligen Felldecke hervor mit großen Augen an. Im flackernden Lichtschein der Öllampe saß sein Vater Lamech neben seinem Bettlager auf dem fest gestampften Boden ihrer Hütte und erzählte ihm wieder einmal die Geschichte, die schon sein Vater ihm und dessen Vater seinem Vater erzählt hatte. Von Generation zu Generation war sie weitergereicht worden, über mehr als tausend Jahre hinweg. Es gab keine Geschichte, die Noah lieber hörte. Sie war so geheimnisvoll und so majestätisch und unbegreiflich. Und Vater war ein meisterhafter Geschichtenerzähler.
»Am Anfang … war nichts«, sagte er mit seiner tiefen Bassstimme und legte seine kräftige Hand über Noahs Augen. »Kein Leben. Kein Licht. Kein Oben. Kein Unten. Nur Dunkelheit und Leere und Chaos. Es brodelte und zischte in der Tiefe. Es war unheimlich und schauerlich. Trostlos und wild. Es donnerte und krachte, es ächzte und stöhnte aus zerklüfteten Spalten und furchterregenden Abgründen. Die Erde war nichts als eine plumpe Masse, ein wertloser, öder Klumpen mitten im Nichts. Mitten in der schwärzesten Finsternis, die du dir vorstellen kannst. Versunken in tiefen Fluten von Wasser, die die Erde umschlangen. Alles war chaotisch miteinander verwoben, bedrohlich und düster. Ein einziges Tohuwabohu. Doch über dem Chaos, über den tiefen Wasserfluten schwebte der Geist Gottes wie ein Adler, sanft und ruhig. Und eine majestätische Stimme, wie die eines Königs, der einen Palast erbauen will, sprach aus dem Nichts: ›Es werde Licht!‹«
Lamech hob die Hand von Noahs Augen. Der Junge blinzelte und blickte in das gütige Gesicht seines Vaters. »Und es wurde Licht.« Noahs Herz pochte heftig. Ein kindliches Staunen lag in seinen nussbraunen Augen, während sein Vater weitersprach.
»Aber das Licht, das entstand, war nicht das Licht der Sonne. Es war ein ganz anderes Licht, viel herrlicher und strahlender als die Sonne. Es kam aus Gott selbst, denn Gott, unser Schöpfer, ist Licht, und wo sein Licht aufleuchtet, entsteht Leben. Jede Finsternis, ja, selbst der Tod muss vor ihm weichen. So stark und unbesiegbar ist das Licht unseres Schöpfers. Er sprach ein einziges Wort, und sein Wort wurde lebendig. Es wurde lebendiges Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Es strahlte in der Finsternis auf wie ein Königssohn in einem leuchtenden Gewand auf seinem weißen Pferd, und das furchterregende Dunkel musste vor ihm weichen. Es konnte nicht vor ihm bestehen. Es wurde von ihm zurückgedrängt wie ein abscheulicher Drache, der seine Beute nur widerwillig losgibt und sich windend und schnaubend vor dem Königssohn zurückzieht, zurück in die unheimliche Finsternis, aus der er gekrochen ist, tiefer und tiefer, bis seine Macht ganz gebrochen ist. Die Finsternis war besiegt. Und zurück blieb eine Dunkelheit, die nicht mehr bedrohlich war, sondern sanft und ruhig wie eine warme Sommernacht.
Und Gott nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Dies war der erste Tag. Und es wurde Abend und es wurde Morgen. Der zweite Tag begann.«
Sein Vater machte eine Pause. »Weiter«, drängte ihn Noah. Er klebte förmlich an seinen Lippen. »Erzähl weiter, Vater! Erzähl!«
Lamech lächelte. Dann fuhr er mit dem Erzählen fort.
»Nachdem Gott das Licht von der Finsternis getrennt hatte, sprach er erneut und sagte: ›Ein Gewölbe soll sich mitten aus den Chaosfluten erheben, wie eine feste Kuppel soll es sich darüber ausbreiten und das Wasser darunter von dem Wasser darüber trennen.‹ Kaum ausgesprochen kam Bewegung in das Wasser. Es sprudelte und gurgelte wie aus Hunderten von Quellen. Es toste und schäumte und dampfte wie das Wasser, das durch tausend Schluchten jagt. Wasserfontänen schossen in die Höhe wie Säulen eines Palastes, höher und höher kletterten sie, bis sie irgendwo weit, weit über der Erde verschwanden und dort zur Ruhe kamen. Auch das wilde ungestüme Wasser unter der Kuppel beruhigte sich allmählich wieder. Die Wellen wurden kleiner und kleiner, bis nichts zurückblieb als eine spiegelglatte Fläche aus Wasser, die die ganze Erde bedeckte. Aber hoch oben, höher, als je ein Vogel fliegen könnte, schimmerte etwas Blaues, wie ein klarer See, der sich von einem Ende des Horizontes bis zum anderen spannte.«
»Der Himmel!«, rief Noah begeistert.
»Ja. Gott nannte das Gewölbe Himmel. Und es wurde Abend und wieder Morgen. Der dritte Tag begann. Und Gott sprach: ›Das Wasser unter dem Himmel soll zusammenfließen, damit das trockene Land zum Vorschein kommt.‹ Da donnerte und blitzte und krachte es in der Tiefe der Erde wie bei einem gewaltigen Gewittersturm, wie wenn tausend Berge gleichzeitig einstürzen. Aber sie stürzten nicht ein. Nein! Sie erhoben sich mitten aus dem Wasser! Die ganze Erde bebte und zitterte. Sie wurde regelrecht durchgeschüttelt von dem, was da geschah. Es war ohrenbetäubend laut und die Wellen bäumten sich auf. Da! Die erste Bergspitze ragte aus den schäumenden Fluten! Da! Eine zweite tauchte auf! Dort eine dritte und da drüben eine vierte! Was für ein Anblick! Sie wurden größer und höher und das Wasser wich immer weiter zurück. Sanfte Hügel formten sich und mächtige Gebirgszüge und zwischen den Bergen entstanden weite Ebenen und Täler mit klaren Seen und kleinen Bächlein und reißenden Flüssen. Und Wasserfälle donnerten über die Bergfelsen ins Tal. Der Schöpfer sah sich alles an und nannte das trockene Land Erde und das Wasser Meer. Und er sah, dass es gut war.«
Noah hörte seinem Vater mit offenem Mund zu. »Und dann?«, fragte er seinen Vater, auch wenn er die Geschichte schon so oft gehört hatte, dass er sie in- und auswendig kannte. Aber jedes Mal, wenn sein Vater sie ihm erzählte, war es, als würde Gott alles aufs Neue erschaffen und Noah wäre mittendrin im Geschehen. Und er konnte sich alles ganz genau vorstellen. »Was geschah dann?«
Lamech erzählte weiter.
»Dann sprach Gott zur Erde: ›Lass es sprießen und blühen und wachsen. Allerlei Pflanzen sollen aus dir hervorgehen, ein jedes Samen tragend, um sich zu vermehren, Gräser und Sträucher und Blumen und Bäume, die Früchte tragen.‹ Da regte sich etwas im Erdboden, ganz still und bescheiden. Kein Laut war zu hören. Kein Lüftchen wehte. Nichts bewegte sich. Doch! Doch, da bewegte sich etwas. Eine kleine grüne Spitze bohrte sich durch die Erde, nicht größer als eine Tannennadel, ganz fein und zerbrechlich. Ein Sprössling! Das allererste Pflänzchen! Neugierig streckte es seine Knospe dem Licht entgegen, wuchs in die Höhe und als es schließlich seine winzigen Blütenblätter öffnete, kam eine wunderschöne Blume zum Vorschein. Sie leuchtete im kräftigsten Gelb, das die Welt je gesehen hatte, und ein wundervoller, süßlicher Duft ging von ihr aus.
Und der Wind trug ihren Duft über die ganze kahle Erde hinweg und überall entlockte ihr lieblicher Duft der Erde neues Leben. Bald war die ganze Erde von Pflanzen jeder Art bedeckt, grün und bunt, winzig klein und riesengroß. Da gab es zarte Farne, sattes Gras, Sträucher und Fruchtbäume, Wälder und Wiesen, Steppen und Blumenbeete bis zum Horizont. Sie dufteten so herrlich und leuchteten in allen Farben, und der Wind spielte mit ihren Blättern und rauschte durch die Baumkronen.
Es war alles so schön, dass Gott sich selbst nicht daran sattsehen konnte. Er betrachtete liebevoll alles, was er bisher geschaffen hatte, den Himmel und die Erde, das Meer und die Seen, die Berge und Täler, die Hügel und fruchtbaren Ebenen und die Pflanzen in all ihrer Vielfalt. Und er war sehr zufrieden mit seinem Werk. Und so wurde es Abend und wieder Morgen und der vierte Tag begann.«
»Jetzt kommen die Sterne!«, rief Noah aufgeregt.
»Und die Sonne und der Mond.«
»Und die Sterne!«, wiederholte Noah. Die Sterne hatten es ihm besonders angetan.
»Ja, die Sterne«, schmunzelte Lamech. »Am vierten Tag schuf Gott alle Himmelslichter, die Sonne, damit sie den Tag erleuchte, und den Mond für die Nacht, dazu Tausende und Abertausende von Sternen, die des Nachts am Himmel funkeln. Es sind so viele, dass wir sie nicht zu zählen vermögen.«
»Und wenn wir eine ganze Nacht lang zählen würden?«, warf Noah ein. Er stellte die Frage jedes Mal.
»Selbst wenn wir hundert Jahre lang zählen würden, wir würden immer wieder einen neuen Stern entdecken. Weißt du, warum sie so zahlreich sind, Noah?«
Der Kleine schüttelte den Kopf. »Damit wir nie vergessen, wie unfassbar groß und gewaltig unser Schöpfer ist«, entgegnete Lamech. »Er ist so groß, dass alle Himmel ihn nicht fassen können, und gleichzeitig hat er sich für uns so klein gemacht, dass er hier drin Platz hat.« Lamech legte sich die Hand aufs Herz. »Und hier.« Er legte seine Hand auf Noahs Herz. Noah wurde es ganz warm dabei. Für einen flüchtigen Moment vergaß er sogar, dass die Geschichte von der Erschaffung der Welt ja noch weiterging.
Doch sofort war er wieder bei der Erzählung, als sein Vater ihn fragte: »Und was kam am fünften Tag?«
Noahs Augen strahlten. »Die Tiere!« Den Teil mochte er am liebsten. Erwartungsvoll blickte er seinen Vater an, während dieser wieder in die Geschichte eintauchte.
»Am fünften Tag sprach Gott: ›Im Wasser soll es wimmeln von Leben und in der Luft sollen Vögel fliegen!‹ Und was er sprach, geschah. Das Wasser begann sich zu kräuseln. Es schäumte und spritzte und plötzlich … Da! Hast du es gesehen?«
»Ja!« Noah sperrte die Augen auf. »Ein Fisch!«
»Ja, ein kleiner Fisch mit glänzenden Schuppen und Flossen! Seine Schuppen schimmern im Licht wie pures Gold. Siehst du es?«
»Ja!«, rief Noah aufgeregt.
»Er springt aus der Gischt hervor, klatscht mit einem fröhlichen Platschen ins Meer und schießt wie ein goldglänzender Pfeil durchs Wasser. Oh, und da! Noch ein Fisch! Und noch einer! Und noch einer! Das ist ja ein ganzer Schwarm von Fischen, siehst du sie?!«
»Ja, Vater!«
»Und jetzt jagen sie dem ersten Fisch hinterher, um mit ihm zu spielen. Und schau nur, da sind noch andere Fische, große und kleine, dicke und dünne, es werden immer mehr. Sie schwimmen miteinander um die Wette, sie machen Sprünge vor Freude, weil Gott sie erschaffen hat. Es gibt welche, die leuchten im Dunkeln, andere sind durchsichtig, wieder andere bunt wie Schmetterlinge. Die einen sind winziger als dein kleiner Finger, die anderen so groß wie ein Berg mit einem Maul, dass sie ein ganzes Schiff verschlingen könnten.«
Noah sah seinen Vater mit riesigen Augen an. Er konnte sich alles ganz genau vorstellen und wusste bereits, was als Nächstes kam.
»Und als das ganze Meer von Tausenden und Abertausenden verschiedener Wassertiere bevölkert war, ließ Gott einen sanften Wind durch die Luft streichen. Der Wind streifte die Baumwipfel des Waldes. Es raschelte in den Blättern und plötzlich flatterte etwas daraus hervor: Es war ein kleiner weißer Vogel, eine Taube! Erst flatterte sie etwas unsicher, aber als sie merkte, dass die Luft sie tragen konnte, schwang sie sich hoch in den Himmel hinauf. Ihre Federn strahlten so weiß, dass es dich geblendet hätte, hättest du versucht, sie anzuschauen. Ihr Federkleid war weißer, als man je ein Kleid hätte färben können. So ein leuchtendes Weiß hast du noch nie gesehen, Noah. Und überall, wo die kleine weiße Taube hinflog, ließ der Schöpfer neues Leben entstehen, und überall begann es zu flattern und zwitschern in der Luft.
Da waren Schwalben und Eulen, Habichte und Störche, Papageien und Reiher, Spatzen und Gänse. Die einen Vögel waren zierlich und leicht, die anderen hatten große Schwingen und konnten damit mühelos über die höchsten Berggipfel segeln. Es gab welche mit bunten Schnäbeln, andere mit langen Beinen und langen Hälsen. Die einen hatten ein farbenprächtiges Federkleid, prächtiger als ein König sich je hätte kleiden können. Andere waren ganz unscheinbar, konnten aber so laute Töne von sich geben, dass man es von einem Ende des Waldes bis zum anderen hörte. Und es gab Singvögel, die die wunderschönsten Melodien sangen. Jeden Morgen, bevor die Sonne aufgeht, lobten und priesen sie Gott mit ihrem Gesang und sangen von seiner Güte und Herrlichkeit.
Gott freute sich an den Fischen und Vögeln, die er geschaffen hatte. Er segnete sie und sprach: ›Seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt das Meer. Ihr Vögel, breitet euch auf der ganzen Erde aus.‹ Es wurde Abend und wieder Morgen. Der sechste Tag brach an. Noch hatte Gott nicht alle Tiere erschaffen. Ein paar fehlten noch. Aber davon erzähle ich dir morgen Abend, einverstanden?«
»Nein, jetzt!«, rief Noah entrüstet. »Das gilt nicht. Du musst die Geschichte zu Ende erzählen!«
»Aber dir fallen schon fast die Augen zu, Noah.«
»Gar nicht! Ich bin hellwach! Siehst du?« Er sperrte die Augen so weit auf, wie er konnte. »Erzähl weiter, Vater, erzähl!«
»Also gut«, willigte Lamech schmunzelnd ein. »Am sechsten Tag sprach Gott zur Erde: ›Bring alle Arten von Tieren hervor, Vieh und Kriechtiere und wilde Tiere.‹ Und während Gott noch sprach, kam die Erde plötzlich in Bewegung. Kleine Erdhügel türmten sich auf und aus ihnen begann sich etwas zu formen, wie wenn ein Töpfer einen Klumpen Lehm formt, nur dass man keine Hände sehen konnte. Langsam und geheimnisvoll nahmen die Erdklumpen Gestalt an. Erst konnte man nicht genau erkennen, was daraus entstehen sollte. Aber allmählich formten sich daraus allerlei Kreaturen mit Fellen, Panzern und Stacheln, mit Hörnern, Rüsseln, Klauen, Hufen und Tatzen. Ganz unsicher waren sie anfangs auf den Beinen. Sie schüttelten die Erde von sich ab und machten ein paar erste tapsige Schritte, fielen hin und rappelten sich wieder auf. Sie brauchten ein paar Anläufe, bis es klappte. Aber dann waren sie nicht mehr zu halten. Sie sprangen und hüpften über die Felder und Wiesen, sie kletterten an den Bäumen und Felsen hoch und balgten sich miteinander. Sie brüllten und blökten und wieherten vor Freude über ihr Leben und jagten einander galoppierend durch die fruchtbaren Täler und endlosen Steppen. Was für eine Freude! Was für eine Freiheit! Und egal, wo man hinblickte, gab es neue Tiere zu entdecken. Sie waren so vielfältig und so einzigartig, ein jedes in seiner Art. Da, Noah, erkennst du sie?«
Lamech formte mit seinen Händen Figuren und durch den flackernden Lichtschein der Öllampe entstanden Schatten an der Wand. Noahs Augen glänzten, während er ein Tier nach dem anderen bei seinem Namen rief.
»Ein Pferd! Ein Tapir! Eine Schildkröte! Ein Stier! Eine Echse! Ah, das ist leicht: eine Maus!«
Immer wenn Lamech aufhören wollte, rief Noah: »Noch eins! Noch eins!« Und sein Vater formte nochmals ein Tier, das Noah anhand seines Schattens erraten musste.
»So, jetzt ist aber Schluss für heute«, sagte Lamech schließlich und fuhr Noah durch sein verstrubbeltes lockiges Haar.
»Nur noch eins«, bettelte der Junge.
»Also gut. Ein allerletztes. Aber dieses hier kannst du nicht erraten.«
»Wieso nicht?«
»Weil ich dir noch nie von ihm erzählt habe.«
»Wieso nicht?«
»Weil es so furchtbar und schrecklich ist, dass du bei seinem bloßen Anblick erstarren würdest.«
»Ein Bär?«
»Nein, kein Bär.«
»Ein Blutwolf?«
»Nein, auch kein Blutwolf.«
»Was dann?«
»Ein Taurox«, sagte sein Vater.
»Was ist ein Taurox?«, fragte Noah.
»Er gehört zur Familie der Drachen. Er ist ein riesiges, aufrecht gehendes Biest mit kräftigen Hinterbeinen, kleinen Vorderbeinen mit messerscharfen Krallen und einem schauerlichen Rachen mit dolchförmigen Zähnen. Der Taurox ist größer und schwerer als ein Mammut, durch seinen wuchtigen Schwanz doppelt so lang und er kann schneller laufen als der Wind.«
Noah sah seinen Vater mit offenem Mund an. »Hast du schon einmal einen gesehen?«
»Nein. Aber gehört.«
»Gehört?«
»Ja, vor vielen Jahren, als dein Großvater und ich deinen Urgroßvater Henoch besuchten und er uns von einem Berg aus das Drachenland zeigte, das Land Eden, wo Urvater und Urmutter einst lebten.« Lamech kniff die Augen leicht zusammen. »Es ist ein Laut, den ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Ein Schrei, der dir durch Mark und Bein geht.«
Noahs Augen weiteten sich. »Hast du Angst gehabt?«
»Ich war wie erstarrt vor Schreck.«
»Und dann?«
»Dann hat Henoch, dein Großvater, mir versichert, ich bräuchte keine Angst zu haben. Eden sei von hohen Bergen umgeben. Außerhalb davon wurde noch nie ein Drache gesehen, in keinem der vier Reiche. Deswegen halten manche die Drachen auch für eine Legende.«
»Aber das sind sie nicht, oder?«
»Nein, das sind sie nicht. Ganz und gar nicht. Ich weiß, was ich gehört habe, und das hat mir gereicht.« Lamech blickte gedankenversunken in die Dunkelheit. »Ja, Noah. Es gibt wilde Tiere da draußen, denen man lieber nicht begegnet. Aber Gott hat auch den mächtigen Taurox erschaffen. Weißt du, warum?«
»Warum?«
»Um uns demütig zu machen und zu zeigen, wie klein und unscheinbar wir sind. Kein Mensch kann es mit dem Taurox aufnehmen. Genauso wenig können wir vor Gott bestehen. Wir sind geringer als der Staub der Erde, aus dem wir erschaffen wurden. Und dennoch … liebt Gott die Menschen.« Lamech lächelte, ein ungläubiges Staunen im Gesicht. »Er ist jeden Tag bei uns. Er gibt uns alles, was wir zum Leben brauchen. Manchmal spricht er sogar zu uns.«
»Wie?«, fragte Noah.
»Du wirst es wissen, wenn er es tut.«
»Aber wie?«
»Das kann ich dir nicht sagen. Das musst du selber herausfinden, Noah.«
»Spricht er zu dir, Vater?«
Lamech seufzte. »Es ist lange her, seit ich ihn das letzte Mal gehört habe.«
»Was hat er gesagt?«
»Er würde uns einen Tröster senden, jemanden, der uns aufatmen lässt bei all unserer schweren und mühseligen Arbeit auf dem Acker, den er verflucht hat. Jemand, der uns die harte Arbeit, den Schweiß und die Tränen vergessen lässt und uns endlich Ruhe und Trost schenkt.« Lamech sah Noah an und strich ihm liebevoll über die Wange. »Und dann bist du zur Welt gekommen. Darum haben wir dich Noah genannt, der Trostschaffende, der Ruhebringer.«
Noah grübelte eine Weile nach. »Vater«, sagte er dann. »Was ist, wenn der Schöpfer gar nicht mit mir reden will?«
»Willst du denn, dass er mit dir redet?«
Noah nickte ernst.
»Dann wird er es auch tun, Noah. Ganz bestimmt.«
»Wann?«
»Das weiß ich nicht. Du musst geduldig sein und dein Herz immer für ihn offen lassen. Willst du das tun?«
Noah nickte.
»Ich habe dich lieb, Noah.«
»Ich dich auch«, sagte Noah.
»So, und jetzt ist es Zeit zu schlafen. Morgen erzähle ich dir, wie der Schöpfer Urvater und Urmutter, die allerersten Menschen auf der Welt, erschaffen hat.«
Noah kuschelte sich in sein Fell und gähnte. Er konnte seine Augen kaum offen halten. »Singst du noch das Sternenlied?«
»Aber natürlich, mein Sohn.« Sein Vater begann leise zu singen.
Kalter Abend, warmer Wind,schlafe ein, mein liebes Kind,unser Schöpfer hält nun Wacht,bis der Morgen neu erwacht,und der Sterne klares Lichtscheinet hell auf dein Gesicht,bis der neue Tag anbricht,schlafe friedlich, sorge nicht.
Und während er sang, wurden Noahs Augen immer schwerer, bis er schließlich in einen ruhigen, tiefen Schlaf fiel.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Die Menschenjäger
In Noahs neunzehntem Lebensjahr.
Noah wischte sich den Schweiß von der Stirn und trank einen Schluck Wasser aus seinem Trinkschlauch. Es war ein schwüler Sommertag. Die Sonne brannte von einem stahlblauen Himmel auf das Kornfeld, in dem sein Vater, er und seine beiden Brüder seit den frühen Morgenstunden schufteten, um die Ernte einzubringen. Die Gerstenähren waren dieses Jahr besonders groß und schwer. Es würde eine gute Ernte werden, genug, um die Familie durch den Winter zu bringen. Noah war sehr erleichtert darüber, denn es hatte auch andere Jahre gegeben, wo der karge Ackerboden kaum etwas hergegeben hatte. Letzten Winter war es besonders schlimm gewesen und sie wären beinahe verhungert. Das Leben in dieser einsamen Gegend war geprägt von Entbehrung und Mühsal, aber es war das einzige Leben, das Noah kannte. Er konnte sich nicht vorstellen, irgendwo sonst zu sein. Hier war sein Zuhause. Hier lebte seine Familie in einer bescheidenen Hütte aus lehmbeworfenen Flechtwänden und einem Walmdach aus Gras.
Noah ließ seinen Blick über die weite Ebene gleiten. Sie war bis auf ein paar Wiesen und Wälder ziemlich öde, weswegen sich nur selten jemand hierher verirrte. Das nächste Dorf, Iri Sana, war zwanzig Meilen, also einen Tagesmarsch weit, entfernt. Manchmal gingen sie dorthin, um geflochtene Körbe und getrocknete Kräuter zu verkaufen. Unten im Tal gab es einen kleinen Fluss. Von dort schleppten Noah und seine Geschwister jeweils das Wasser zur Hütte hoch und pflückten Weiden, um Körbe zu flechten.
Noah bündelte ein paar Ähren mit der linken Hand zusammen und sägte die Garbe mit dem gebogenen Erntemesser unterhalb seiner Faust ab. Sein Vater tat dasselbe ein Stück weit von ihm entfernt und Noahs Bruder, der elfjährige Jared, sammelte die geschnittenen Getreideähren getreulich in einen geflochtenen Korb. Noahs neunjährige Schwester Emra war zu Hause geblieben, in der Hütte hinter dem Ackerfeld, um einen neuen Binsenkorb zu flechten und auf Kael aufzupassen. Kael war das jüngste der vier Geschwister und erst im Frühjahr zur Welt gekommen. Doch Noahs Mutter war bei Kaels Geburt gestorben. Das war ein harter Schlag für die Familie gewesen. Noahs Vater hatte seither nie mehr gelacht. Er war ernst geworden und verschlossen. Früher hatte er seine Kinder abends immer um die Feuerstelle in ihrer Hütte versammelt und ihnen Geschichten erzählt. Doch seit Mutters Tod hatte er dies nie mehr getan.
Sein Gram hing wie eine schwere Wolke über der ganzen Familie und belastete Noah sehr. Er hatte das Gefühl, als würde die ganze Verantwortung für die Familie auf einmal auf seinen Schultern lasten. Schließlich war er der Sohn, den seine Eltern so sehnlichst erwartet hatten, der Tröster, der ihnen bei der beschwerlichen Arbeit auf dem verfluchten Acker zur Hand gehen sollte. Und jetzt, wo Mutter gestorben war und Vater vier Kinder alleine ernähren musste, war er mehr denn je auf seinen ältesten Sohn angewiesen. Also arbeitete Noah doppelt so hart, einerseits, um seine jüngeren Geschwister zu erziehen, da Mutter nicht mehr da war, und andererseits, um Vater zu helfen, die Familie durchzubringen. Es schmerzte ihn, Tag für Tag den Kummer seines Vaters zu sehen. Er hätte alles dafür getan, um ihn irgendwie über Mutters Tod hinwegzutrösten. Bisher war ihm dies allerdings nicht gelungen.
»Vater! Vater!«
Die verstörte Kinderstimme von Emra riss Noah aus seinen Gedanken. Er hob den Kopf und sah seine Schwester eilends durch das Gerstenfeld laufen, den kleinen Kael im Arm. Irgendetwas musste geschehen sein. Noah steckte das Erntemesser in seinen Gurt und ging ihr entgegen. Auch Lamech ließ die Ähren los, die er gerade schneiden wollte, und Jared ließ den Korb stehen und folgte seinem Bruder. Keuchend erreichte Emra ihren Vater und ihre zwei Brüder.
»Was ist los?«, fragte Noah.
»Männer!«, keuchte das Mädchen atemlos. »Drüben am Waldrand!«
»Was für Männer?«, hakte Lamech nach.
»Ich glaube, es sind Menschenjäger.«
Lamechs Gesicht verfinsterte sich.
»Menschenjäger? Hier? Bist du sicher?«
»Ich sah Käfige und … und gefesselte Menschen, glaube ich.« Emra wirkte völlig durcheinander.
»Haben sie dich gesehen?«
»Ich weiß es nicht. Aber sie sind schon ganz nah! Was, wenn sie Kael mitnehmen, um ihn Nachash zu opfern?!«
Ein Schauer durchfuhr Noah und auch im Blick seines Bruders spiegelte sich blankes Entsetzen. Sie kannten die Geschichten von den Menschenjägern nur allzu gut. Ihr Vater hatte ihnen oft genug erzählt, wie gefährlich sie waren.
»Sie streifen plündernd und mordend durchs ganze Land«, so hatte er ihnen erzählt. »Sie rauben Menschen, verkaufen sie als Sklaven und die kleinen Kinder verkaufen sie an die Tempeldiener Nachashs, damit sie der Schlangengöttin geopfert werden.«
Es war grauenvoll, sich vorzustellen, dass Menschen zu so etwas Schrecklichem in der Lage waren. Noah erinnerte sich noch an eine andere Geschichte, die sein Vater nur ihm allein erzählt hatte. Das war im Frühjahr gewesen, als sie mit den Furchenstöcken den Acker zur Aussaat vorbereitet und sich eine Weile in den Schatten eines Baumes gesetzt hatten, um auszuruhen.
»Weißt du, warum wir wirklich aus Hawil hierhergezogen sind, Noah? Hier in dieses abgelegene Tal?«, hatte sein Vater ihn gefragt.
»Ja, Vater. Die Verdorbenheit der Menschen hat euch dazu gezwungen. Du hast gesagt, ihr wärt vor dem König geflohen.«
Lamech nickte. »Ja, das sind wir. Du hast ja keine Ahnung, zu was Menschen fähig sind, wenn sie sich vom Schöpfer abwenden. Ihre Bosheit kennt keine Grenzen. Und in den Städten ist es besonders schlimm. Früher, als dein Großvater noch ein Knabe war, war Hawil eine kleine, friedliche sethitische Siedlung an der westlichen Meerenge. Aber dann zogen mehr und mehr Kainiten nach Hawil und es wurde eine große Stadt, eine verdorbene Stadt.«
»Ich weiß, Vater. Du hast gesagt, die Menschen hätten keinen Respekt mehr voreinander gehabt und sich mit Gewalt genommen, was sie wollten.«
Sein Vater nickte, während er vor sich in die Luft starrte und in Gedanken nach Hawil zurückkehrte.
»Das Böse ist erfinderisch, mein Sohn. Richtig schlimm wurde es jedoch erst, als der Kainit Lamech die Stadt eroberte. Ein Jammer, dass er denselben Namen trägt wie ich. Das geschah im selben Jahr, als Urvater Adam starb. Dein Großvater Metuschelach hatte so eine Vorahnung, dass uns dunkle Zeiten bevorstünden. Er wollte, dass wir die Stadt umgehend verlassen, aber ich war jung und naiv, sechsundfünfzig Jahre alt und bis über beide Ohren verliebt in deine Mutter, die ich in ebendiesem Jahr kennengelernt hatte. Also blieb ich, während meine Eltern Hawil verließen und sich weit weg, im Gebirge im Südosten, niederließen. Ich hätte niemals bleiben dürfen. Deine Mutter und ich heirateten und zwei Jahre später beschloss König Lamech, Nachash einen Tempel zu bauen. Das war der Beginn unseres Untergangs.«
»Wieso?«, fragte Noah.
»Der Tempel für die Schlangengöttin sollte ein gewaltiger, mehrstufiger Tempelturm werden mit einer riesigen Tempelanlage. Aber dafür brauchte es Arbeitskräfte. Also zwang Lamech alle Sethiten, ihn in Fronarbeit zu erbauen. Tausende starben beim Bau, Tausende an Hunger und Seuchen. Um den Bau voranzutreiben, schloss Lamech Verträge mit Menschenhändlern, die das ganze Reich durchkämmten, um Sklaven für seinen Tempelbau aufzutreiben. Außerdem schürte er unter den Kainiten den Hass auf die Sethiten. Es wurde uns verboten, den Schöpfer anzubeten. Es wurde uns sogar unter Todesstrafe verboten, seinen Namen in den Mund zu nehmen. Viele Sethiten schworen in dieser Zeit dem Herrn ab und begannen, Nachash anzubeten. Die Angst regierte in den Straßen, in den Häusern, in den Familien. Um ihre eigene Haut zu retten, verrieten Väter ihre eigenen Kinder und Kinder ihre eigenen Eltern, wenn sie merkten, dass diese dem Schöpfer die Treue hielten. Und dann begannen die Menschenopfer.« Noahs Vater blickte angewidert vor sich hin, während er weitererzählte. Noah hörte ihm schweigend zu.
»Zur Einweihung des Tempels opferte König Lamech der Schlangengöttin hundert Erstgeborene. Sie wurden den sethitischen Müttern einfach aus den Armen gerissen. Das war für die bereits unterdrückte sethitische Bevölkerung zu viel. Noch in derselben Nacht kam es zum Aufstand, einen Aufstand, den der König mit brutaler Gewalt niederschlug. Unser Volk wurde regelrecht abgeschlachtet. Nur einer Handvoll, so wie deiner Mutter und mir, gelang die Flucht. König Lamech nannte es die große Säuberung. Es war grauenvoll.«
»Davon hast du mir nie erzählt, Vater.«
»Nein«, sagte Lamech düster. »Und es gibt noch etwas anderes, das ich dir verschwiegen habe.«
»Was denn?«
Noahs Vater sah seinen Sohn an. »Deine Mutter war zu dieser Zeit schwanger und brachte an ebendiesem Tag eine kleine Tochter zur Welt, unser erstes Kind.«
»Ich habe eine ältere Schwester?«
»Nicht mehr«, murmelte Lamech und ein schweres Seufzen ließ seinen Körper erbeben. »Sie war gerade erst geboren, da kamen Lamechs Menschenjäger und haben sie deiner Mutter entrissen, um sie Nachash zu opfern. Wir haben sie nie mehr wiedergesehen.«
Noahs Augen weiteten sich. Sein Vater starrte mit finsterer Miene vor sich ins Leere. »Als der Aufstand ausbrach, gelang es uns, aus der Stadt zu fliehen. Die Todesschreie und das Wehklagen waren noch zu hören, als wir Hawil längst hinter uns gelassen hatten. Wir schworen uns, bis ans Ende der Welt zu laufen, wenn es sein musste. Nie wieder würden wir zulassen, dass Menschenjäger uns ein Kind raubten. Nie wieder. Fünf Monde lang sind wir gereist, bis wir dieses Stückchen Land gefunden und uns hier niedergelassen haben. Zehn Jahre später bist du geboren worden.« Lamech sah Noah betrübt von der Seite an. »Jetzt kennst du den wahren Grund, warum wir uns in dieses entlegene Tal zurückgezogen haben, fernab von irgendeiner Stadt.«
Noah wusste nicht, was er sagen sollte. Eine Weile lang saßen Vater und Sohn schweigend da und eine lähmende Stille hing in der Luft.
»Warum hast du mir nie erzählt, dass ich noch eine Schwester hatte?«, fragte Noah schließlich.
»Mutter wollte nicht, dass ihr davon erfahrt. Ihr Kummer war zu groß. Ich musste ihr versprechen, euch nie etwas davon zu erzählen, solange sie lebt. Dies ist das erste Mal, dass ich darüber spreche.«
»Wie hieß sie? Meine Schwester?«
»Aisha«, antwortete Lamech. »Ihr Name war Aisha.«
Das Gespräch mit seinem Vater an jenem Frühlingstag auf dem Acker war Noah noch lebhaft in Erinnerung, als Emra nun auf das Gerstenfeld gelaufen kam und ihnen keuchend berichtete, sie habe Menschenjäger am Waldrand gesehen. Sie hielt Kael im Arm. Die nackte Angst stand ihr ins Gesicht geschrieben.
»Ich habe Angst, Vater!«
Lamech reagierte instinktiv.
»Schnell!«, sagte er und sah seine Kinder der Reihe nach an. »Versteckt euch zwischen den Ähren! Gebt keinen Mucks von euch und bleibt hier, bis ich euch hole!«
»Was hast du vor, Vater?«, fragte Jared.
»Ich werde sie ablenken.«
»Ich komme mit!«, sagte Noah entschlossen, doch sein Vater wies ihn hart zurück.
»Nein, auf keinen Fall! Du beschützt deine Geschwister. Egal, was passiert, ihr rührt euch nicht von der Stelle, verstanden?«
Die Kinder nickten.
»Duckt euch! Und keinen Laut!«
Lamech stürmte davon und die Kinder kauerten sich ängstlich nebeneinander ins Getreidefeld. Kael begann zu weinen.
»Halt ihm den Mund zu, Emra«, sagte Noah zu seiner Schwester. »Wenn die Männer ihn hören, sind wir alle des Todes!«
Emra legte Kael die Hand auf den Mund und versuchte, ihn zu beruhigen. »Schsch … Kael … sei bitte still … bitte …«
Der elfjährige Jared atmete hastig, starrte in die Richtung, in die der Vater verschwunden war, und sagte kein Wort. Noah legte beschützend die Arme um seine Geschwister und redete ihnen leise zu, auch wenn er genauso viel Angst hatte wie sie. Aber er ließ es sich nicht anmerken.
»Es wird alles gut. Keine Sorge. Es wird alles gut.«
Sie lauschten. Alles war still. Plötzlich hörten sie das Geräusch von Wagenrädern, Kettenrasseln und Männerstimmen.
»Sie sind da!«, piepste Emra.
»Sch …«, machte Noah und legte sich bedeutungsvoll den Finger auf den Mund.
Emra begann leise zu wimmern. Noah rieb ihr tröstend die Schulter.
»Leise«, flüsterte er. »Seid leise.«
Noahs Herz pochte ihm bis zum Hals. Er versuchte, anhand der Geräusche herauszufinden, was genau sich bei ihrer Hütte abspielte. Alles, was er hörte, war ein Gewirr von Männerstimmen. Was sie redeten, konnte er nicht verstehen. Aber der Klang ihrer Stimmen war scharf und befehlend. Noah hielt es kaum noch aus. Er musste seinem Vater helfen! Rasch blickte er seine Geschwister an.
»Ich will sehen, ob ich etwas herausfinde«, flüsterte er. »Bleibt hier. Jared, pass auf Emra und Kael auf. Ich bin gleich zurück.«
Auf den Ellenbogen robbte der Neunzehnjährige bis zum Rand des Kornfeldes. Er legte sich ganz flach auf die Erde und spähte durch die Ährenhalme hindurch zu ihrer Hütte, die einen guten Steinwurf weit entfernt war. Emras Verdacht schien sich zu bestätigen. Noah zählte drei hölzerne Käfigkarren, in denen fremdartige, wilde Tiere eingesperrt waren, gefolgt von einer Menschenkette, einem Dutzend Gefangener, die mit einem langen Strick aneinandergebunden und deren Hände gefesselt waren.
»Menschenjäger!«, raunte Noah.
Angeführt wurde der Zug von mehreren berittenen Männern. Noah zählte vier auf den Wildpferden, zwei, die beim Hühnergehege standen, und zwei weitere, die die Hütte durchwühlten, wie Noah durch die offene Tür erkennen konnte. Die Männer waren mit Fellen bekleidet und mit Äxten bewaffnet. Sie sahen wild und unberechenbar aus. Lamech kniete vor einem der Männer auf dem Boden und versuchte zu verhandeln. Noahs Herz krampfte sich zusammen bei seinem Anblick. Der Menschenjäger stand breitbeinig vor Lamech und hatte seine Axt lässig auf der Schulter abgelegt.
»Bitte«, hörte Noah seinen Vater betteln. »Ich bin nur ein einsamer, armer Mann. Nehmt euch von mir aus, was ihr wollt, aber lasst mich leben!«
»Du lebst alleine hier?«, fragte ihn der Jäger, der vor ihm stand. Er schien das Sagen zu haben.
»Ja, Herr.«
»Wo ist deine Frau?«
»Gestorben.«
»Hast du Kinder?«
»Nein, Herr.«
Der Mann musterte Lamech misstrauisch. »Ich glaube dir nicht. Du wohnst nicht alleine hier. Wo sind deine Kinder?«
»Ich habe keine Kinder! So glaubt mir doch. Meine Frau war unfruchtbar.«
Einer der Männer kam soeben aus der Hütte gestapft, mit Fellen über der Schulter, einem Vorratskrug im linken Arm und in der rechten Hand ein Fladenbrot, an dem er herumkaute. Er wandte sich seinem Anführer zu und sagte etwas, was Noah nicht verstehen konnte, worauf sich ein breites Grinsen über das Gesicht des Mannes zog.
»Keine Kinder, ja? Und wozu brauchst du dann fünf Essschalen? Hm?«
Der Mann nahm die Axt von seiner Schulter und legte die geschliffene breite Klinge an Lamechs Hals. »Ich frage dich noch einmal: Wo sind deine Kinder?«
Noah blieb schier das Herz stehen.
Nein, nein, nein!, dachte er verzweifelt.
Er musste irgendetwas tun, bevor die Menschenjäger auf die Idee kamen, nach ihm und seinen Geschwistern zu suchen oder seinem Vater etwas anzutun! Aber was? In diesem Moment hörte Noah hinter sich im Feld das Kreischen eines Babys. Noah glaubte, ihm müsse das Blut in den Adern gefrieren.
»Kael!«, hauchte er entsetzt.
Wahrscheinlich hatte Emra kurz ihre Hand von Kaels Mund genommen. Es war nur ein einzelner Schluchzer gewesen, doch sofort drehte einer der berittenen Männer seinen Kopf und schaute in Richtung Kornfeld. Noah wusste, dass er handeln musste, oder seine Geschwister wären verloren. Jäh sprang er auf und kam mit großen Schritten auf die Hütte zugelaufen.
»Vater!«, rief er, möglichst laut, um mögliche weitere Schluchzer seines Babybruders zu übertönen und gleichzeitig Zweifel in die Köpfe der Männer zu säen, was das Geräusch war, das sie eben gehört hatten. »Vater!«
Sein Plan schien aufzugehen. Keiner blickte mehr zum Getreidefeld. Die ganze Aufmerksamkeit war nun auf ihn gerichtet. Als er bei der Hütte ankam, packte ihn einer der Männer an den Haaren und zwang ihn neben seinem Vater auf die Knie. Lamech schaute seinen Sohn bekümmert an.
»Noah, warum?«
»Es tut mir leid, Vater«, flüsterte Noah zurück. »Ich konnte nicht anders.«
Der Anführer trat vor Noah hin, hielt ihm die Axt unters Kinn und zwang ihn, zu ihm hochzublicken. »Wie alt bist du?«
»Neunzehn, Herr.«
»Wo sind deine Geschwister?«
»Meine ältere Schwester ist bei der Geburt gestorben«, antwortete Noah wahrheitsgetreu. »Und meine Mutter lebt auch nicht mehr.«
»Hmm.« Der Mann schürzte die Lippen und überlegte eine Weile. »Steh auf!«, sagte er dann. »Meine Männer und die Tiere haben Durst. Gib ihnen zu trinken.«
»Sofort, Herr.« Noah eilte in die Hütte und kam mit einem Wasserkrug und einem Trinkgefäß zurück. Nachdem er allen Männern zu trinken gegeben hatte, tränkte er die Wildpferde. Immer wieder lief er hin und her, um neues Wasser zu schöpfen. Dann ging er zu den Käfigen der Tiere und füllte ihre Wassertröge. Es waren Tiere, von denen er bisher nur gehört, die er aber nie zuvor mit eigenen Augen gesehen hatte. Im vordersten Käfig lagen drei elegante Wildkatzen mit wunderschön geflecktem Fell. Im zweiten Käfig befand sich ein halbes Dutzend kleiner Äffchen mit buschigem Fell. Noah fragte sich, was wohl mit ihnen geschehen würde. Angebunden an den hintersten Käfig war die Menschenkette der Gefangenen. Als Noah auch ihnen Wasser geben wollte, pfiff ihn einer der Männer auf den Pferden zurück.
»Denen nicht!«
»Aber der Weg ins Tal ist lang. Sie werden euch unterwegs zusammenbrechen, wenn ihr ihnen kein Wasser gebt«, entgegnete Noah kühn.
Der Mann auf dem Pferd warf seinem Anführer einen fragenden Blick zu und dieser nickte einwilligend.
»Danke, Herr«, sagte Noah und ging zu den Gefangenen. Gierig tranken sie aus der Schale, die er ihnen reichte. Sie sahen erbärmlich aus. Barfuß. Ihre Kleider nichts als Lumpen. Ihre Rücken gebeugt, ihre Gesichter erschöpft und ausgezehrt. Einige mochten ungefähr in seinem Alter sein. Es waren auch Kinder dabei, nicht älter als seine Geschwister. Sie taten Noah leid. Wie konnten Menschen einander nur so etwas antun?
»Komm her, Junge!«, befahl ihm der Anführer, als er dem letzten Gefangenen zu trinken gegeben hatte. Noah gehorchte und blieb in demütiger Haltung vor ihm stehen. Der Mann musterte ihn eingehend, mit dem geübten Auge eines Händlers, der den Wert seiner Ware abschätzt. Plötzlich packte er Noah mit einer Hand grob am Hals, sodass der Junge kaum noch Luft bekam. Sein Blick bohrte sich in Noahs Augen.
»Niemand widerspricht meinen Männern«, schnarrte er. »Hast du mich verstanden?«
Noah nickte hastig, während er nach Luft rang und versuchte, sich aus dem Würgegriff des Mannes zu befreien. Dieser schien Noahs Panik förmlich zu genießen und ließ ihn so lange zappeln, bis er ganz blau im Gesicht war. Dann spuckte er vor ihm aus und gab ihn wieder frei. Noah beugte sich vornüber, hielt sich seinen Hals und schnappte nach Luft. Sein Herz pochte wie wahnsinnig. Die Realität ihrer ausweglosen Lage stand ihm auf einmal so klar vor Augen, dass es ihm den Magen umdrehte vor Angst. Was würde mit ihnen geschehen? Unterdessen gab der Anführer seinen Männern ein Zeichen mit der Hand.
»Brechen wir auf!«, ordnete er an. Und dann sagte er genau das, was Noah insgeheim befürchtet hatte und ihm das Blut in den Adern gefrieren ließ. »Den Mann lassen wir zurück, der sieht mir zu verbraucht aus. Aber den Jungen nehmen wir mit. Der wird uns einen guten Preis einbringen.«
Sein Vater schrie auf.
»Neeeeein! Nicht meinen Jungen! Nein!«
Zwei Männer packten Noah und zerrten ihn zu den Gefangenen. Lamech wollte ihm hinterherlaufen, doch der Anführer stieß ihm hart seinen Stiefel in die Brust, sodass er zusammensackte.
»Schweig!«
Lamech weinte vor Verzweiflung. »Nehmt mich! Verschont meinen Jungen! Nehmt mich an seiner Stelle!«
»Soll ich ihn töten?«, fragte einer der Männer.
Der Anführer überlegte einen Moment.
»Nein«, meinte er dann. »Weiterzuleben ist der größere Fluch. Lasst ihn am Leben.«
Das Wimmern und Klagen seines Vaters und seine eigene Todesfurcht trieben Noah die Tränen in die Augen. Nie in seinem Leben hatte er sich so hilflos und ausgeliefert gefühlt. Die Männer fesselten seine Hände und banden ihn mit dem Strick zuhinterst an die Menschenkette. Dann sprangen sie auf ihre Wildpferde und der Zug setzte sich in Bewegung. Lamech wollte seinem Sohn hinterhereilen, doch die Reiter hielten ihn zurück.
»Noah! Noah!«, schrie er.
»Vater!«, rief Noah zurück. Immer wieder drehte er sich nach ihm um, doch der Strick riss an seinen Händen und die Kette der Gefangenen zwang ihn gnadenlos weiterzugehen. Irgendwann sank sein Vater schluchzend in die Knie. Den Ausdruck auf seinem Gesicht würde Noah nie vergessen. Es kam ihm vor, als sei der letzte Funke von Kraft aus ihm entwichen. Als sei er innerlich gestorben. Er war ein gebrochener Mann.
»Vater!«, wimmerte Noah. »Vater!«
Er stolperte und fiel der Länge nach hin. Der Strick schnitt ihm in die Handgelenke und zerrte an seinen Armen. Er wurde ein Stück über den harten Boden geschleift, bis es ihm gelang, wieder auf die Beine zu kommen. Ein letztes Mal warf er einen Blick zurück, zurück auf seinen Vater, zurück auf die Hütte und auf das Kornfeld, in welchem sich seine Geschwister versteckt hielten und nun in Sicherheit waren. Wenigstens waren sie in Sicherheit. Dann verschwand alles aus seinem Blickfeld, seine Heimat, sein Zuhause, sein ganzes bisheriges Leben. Eine Ohnmacht ergriff von Noah Besitz, dass er glaubte, seine Beine würden ihm jeden Moment den Dienst versagen, und eine lähmende Gewissheit bohrte sich in seine Gedanken: Er würde seine Familie nie mehr wiedersehen.
In dieser Nacht, Hunderte von Meilen im Nordwesten, wälzte sich ein Mädchen unruhig auf ihrem Felllager und wurde von einem schrecklichen Albtraum geplagt. Es war derselbe Albtraum, den sie schon seit Jahren hatte, aber je näher das Fest ihrer ersten Lebensreife rückte, desto bedrohlicher und realer schien er zu werden. Sie hörte gellende Schreie von allen Seiten, während sie in einem Flammenmeer stand und eine riesige Schlange sich vor ihr aufrichtete. Es war Nachash, die Schlangengöttin. Ihre gespaltenen Augen blitzten. Die Schlange zischelte Worte voller Bosheit, die wie Gift in das Hirn des Mädchens tropften. Sie hatte das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Sie glaubte, ihr Kopf müsste platzen! Sie wand sich in ihrem Bett hin und her, während sie im Traum versuchte, die Stimme loszuwerden, die lauter und immer lauter wurde.
»Du gehörssst mir! Du gehörssst mir! Bald fordere ich dein Leeeben von dir, auf dass du für immer miiir gehörst. Du gehörssst miiir, Naaaamaaaa!«
»Nein!«, schrie Naama. Sie schreckte hoch. Kalter Schweiß stand ihr auf der Stirn. Zitternd und mit rasendem Herzen saß sie auf ihrem mit Fellen gepolsterten Steinbett und starrte vor sich in die Dunkelheit. Eine Ohnmacht ergriff von ihr Besitz, dass sie glaubte, sterben zu müssen. Und eine lähmende Gewissheit bohrte sich in ihre Gedanken: Das war kein Traum. Das war ein grausiges Unheil, das sich über ihrem Leben zusammenbraute und immer näher rückte!
Sie erhob sich und trat ans Fenster, von wo aus sie einen eindrücklichen Blick über Hawil hatte. Der Mond schien vom klaren Nachthimmel und tauchte die riesige Stadt in ein geheimnisvolles Licht: die Tausenden von eng aneinandergebauten Lehmziegelhäusern der Außenbezirke und die Steinhäuser der Adligen, Kaufleute und Handwerker im Stadtkern. Naama sah Teile der großen Stadtmauer, dahinter den breiten Pischon-Strom, der sich einem Silberstreifen gleich an die hohe Mauer schmiegte und sich irgendwo zwischen den Palmen und den waldigen Hügeln im Osten verlor. Weit in der Ferne konnte sie das kahle Gebirge im Südosten ausmachen.
Ihr Blick glitt zurück auf die Stadt. Ihr Vater hatte sie einst erobert und nun, 143 Jahre später, gab es keine Stadt im ganzen Reich, die mächtiger und reicher war als Hawil. Ihr Vater sagte, die Stadt verdanke ihren Wohlstand der Schlangengöttin Nachash. Von klein auf hatte Naama gelernt, sie anzubeten und zu fürchten. Aber seitdem sie mit sieben Jahren das erste Mal dabei gewesen war, als ihr Vater Nachash neugeborene Babys opferte, hatte sie diese grauenvollen Bilder und die Schreie der kleinen Kinder, die von den Flammen verzehrt wurden, nicht mehr aus ihrem Kopf gekriegt. In jener Nacht hatten die Albträume begonnen und seither nie mehr aufgehört. Aber so schlimm wie gerade eben waren sie noch nie gewesen.
Naama schaute hinüber zu dem monumentalen, stufenförmigen Tempelturm in der Mitte der Stadt, auf dessen höchsten Podest sich der Tempel Nachashs befand. Vor dem Tempeleingang stand ihre steinerne Statue und eine riesige Feuerschale, in der Tag und Nacht ein Feuer brannte, das nie erlöschen durfte. Naama fröstelte allein vom Hinsehen. Ob sie die Einzige in Hawil war, die solche Angst vor Nachash hatte? Aber sie war doch die Tochter des großen Lamech! Sie durfte keine Angst haben! Sie fasste sich an ihre Brust und fühlte, wie ihr Herz dagegenhämmerte. Der Traum hatte sie furchtbar aufgewühlt.
Ich würde alles dafür geben, diese Angst loszuwerden, dachte sie. Im selben Moment geschah etwas Seltsames. Sie hörte eine Stimme in der Dunkelheit. Es war keine Einbildung, dabei war niemand da, der hätte sprechen können. Doch Naama hörte die Stimme ganz deutlich, leise und sanft und erfüllt von so viel Frieden und Klarheit, dass es Naama heiß ums Herz wurde:
»Hab keine Angst. Ich bin bei dir.«
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Verschleppt nach Hawil
Nach vielen Tagen Fußmarsch erreichten die Menschenhändler mit ihrer Ware die Küste des Südmeeres. Noah, die anderen Sklaven und alle Tiere wurden auf ein Handelsschiff verfrachtet. Die Schiffsfahrt war der absolute Horror. Ein paar der Sklaven starben unterwegs und wurden einfach über Bord geworfen. Noah glaubte zuweilen, er müsste selbst sterben, so elend fühlte er sich. Aber irgendwie überlebte er, abgemagert, halb nackt, von Kummer und Sorge überwältigt und mit dem mulmigen Gefühl, dass sein Leidensweg gerade erst begonnen hatte.
In Hawil, der berühmten Metropole im Westen des Reiches Hawila, der mächtigen Hafenstadt, die zwischen dem Westarm des Südmeeres und dem Fluss Pischon eingebettet war, mussten sie alle von Bord. Die Luft war heiß und feucht. Die Sonne schien von einem wolkenlosen Himmel. Zwei rote Papageien flogen krächzend über die kleinen Fischerboote und großen Handelsschiffe hinweg, die lautlos in der Meerenge dahinglitten oder am Hafen angelegt hatten.
Der Anblick der Stadt, als Noah das Schiff zusammen mit den anderen Sklaven über einen schmalen Steg verließ, war gigantisch. Eine hohe Stadtmauer erstreckte sich in beiden Richtungen der Küste entlang bis zum Horizont. Palmen, Agaven und allerlei Bäume und Blumen wuchsen entlang der Mauer. Die Dimension der Stadt dahinter konnte Noah nur erahnen. Sie schien jedenfalls viel größer, als er sie sich vorgestellt hatte. Hoch über der Stadtmauer sah Noah die Spitze eines gewaltigen Bauwerkes. Das musste der Tempelturm sein, von dem sein Vater erzählt hatte, der Tempel, an dem sein Vater gezwungen worden war mitzubauen. Noah schauerte, als er an die Schilderungen seines Vaters zurückdachte, die Ermordung der Sethiten, die neugeborenen Kinder, die der Schlangengöttin geopfert worden waren, seine Schwester, die in jener Nacht umgekommen war.
Und jetzt bin ich ausgerechnet am selben Ort gelandet, dachte er, in der Stadt, aus der meine Eltern flohen, um dem sicheren Tod zu entgehen. Er mochte gar nicht daran denken, was für ein Schicksal ihn hier erwartete.
Während die Käfige der Tiere von Bord getragen wurden, trieben die Menschenhändler die Sklaven vor der Stadtmauer zusammen. Sofort stürzten sich Händler wie Geier auf sie und feilschten mit den Menschenhändlern gebärdenreich um die neu eingetroffene Ware. Hunderte von Menschen tummelten sich vor der Stadtmauer, die meisten einfache Arbeiter in Sandalen, gekleidet mit knielangen groben Hemden aus Schaffell oder Agavenfasern, die schwere Getreidesäcke, Körbe und Tonkrüge auf ihren Rücken trugen. Da waren Fischer, die frisch gefangene Fische, Krabben und Muscheln feilboten, und Jäger, die Wachteln, Kaninchen, Enten, Tauben, Papageien und sogar Geier und Falken verkauften. Es war lärmig und stickig und stank nach Fisch. Käufer gingen von Stand zu Stand. Sie trugen lange Röcke aus Schaffellen und einen großen Schal, den sie sich über die linke Schulter geworfen hatten, sodass die rechte Schulter und der rechte Arm frei blieben. Die Männer hatten langes Haar und geflochtene Bärte. Die Frauen hatten ebenfalls langes Haar. Die einen trugen es offen, andere hatten es zu kunstvollen Frisuren geflochten und mit Glöckchen, Knochenstückchen, Muscheln und Federn verziert. Einige führten große Echsen, Tannenzapfentiere und sogar Geparde an langen Leinen mit sich, bei anderen saßen kleine Papageien, Eulen und winzige Äffchen auf den Schultern.
Innerhalb kürzester Zeit waren alle Sklaven und exotischen Tiere, die mit Noah auf demselben Schiff gewesen waren, an mehrere Händler verkauft. Der Händler, der die meisten Tiere, Menschen und auch Noah erworben hatte, trieb seine Sklaven aneinandergekettet in die Stadt hinein. Sie passierten ein großes gebogenes Stadttor. Erst jetzt sah Noah, wie dick die Stadtmauer war. Sie bestand aus riesigen Steinblöcken, die alle unterschiedlich groß waren und dennoch haargenau aufeinanderpassten. Noah fragte sich, wie es möglich war, dass Menschen überhaupt so schwere Steine transportieren und dann auch noch so präzise aufeinanderschichten konnten. Es bedurfte mit Sicherheit Hun