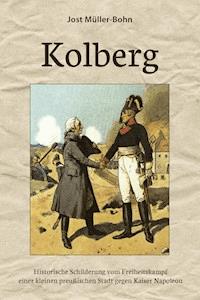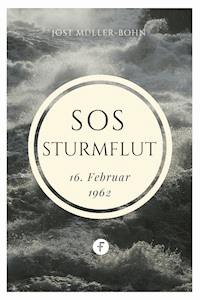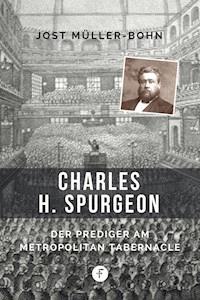Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folgen Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dies ist die Geschichte der Taube Sulamith, die in der weiten, offenen Landschaft der norddeutschen Tiefebene aufwächst. Als sie sich auf ihren ersten langen Flug in den Süden begibt, wird sie als Zugvogel zu einer Zeugin der tiefgreifenden Verbindung zwischen Mensch und Tier. Auf ihrer Reise begegnet sie den Spannungen innerhalb der Gesellschaft und den bedrohlichen Umweltproblemen des 20. Jahrhunderts. Der Leser wird auf einer eindrucksvollen Reise von Europa nach Israel begleitet, bei der er sowohl die atemberaubende Schönheit der Natur als auch die dramatischen Gefahren einer Welt in Veränderung miterlebt. Doch trotz der Herausforderungen, denen Sulamith und die Erde selbst gegenüberstehen, vermittelt dieses Buch eine optimistische Hoffnung und einen neuen Glauben an die Schöpfung, die zwar bedroht ist, aber im Zeitalter der Gnade nicht untergehen wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Noahs letzte Taube
Eine Reise von Deutschland nach Israel
Jost Müller-Bohn
Impressum
© 2016 Folgen Verlag, Bruchsal
Autor: Jost Müller-Bohn
Lektorat: Mark Rehfuss, Schwäbisch Gmünd
ISBN: 978-3-944187-92-1
Verlags-Seite: www.folgenverlag.de
Kontakt: [email protected]
Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
Inhalt
Der Wald
Das Dorf
Die Stadt
Der weite Flug
Im Heiligen Land
Jerusalem
Der Wald
In den märkischen Feldern und Wäldern hatte sich der Frühling angemeldet. Aus dem grauen, stumpfen Winterkleid der Norddeutschen Tiefebene brachen überall frische Farben hervor. Im weiten Land zwitscherte und pfiff es aus Büschen und Bäumen. Über dem ruppigen Geäst der Schlehdornhecke lag es wie glänzender Schnee. Zigtausend Blüten gaben der Landschaft ein bräutliches Gewand. Der Frühling feierte prachtvoll seine erneute Wiederkehr.
Aus voller Kehle jubilierten Amsel, Drossel, Fink und Star. Die kleinen und etwas größeren Sänger und Sängerinnen pfiffen, schnurrten und flöteten ein tausendstimmiges Jubelkonzert. Die Grasmücke sang im Gebüsch; der Specht trommelte liebestoll am verwitterten Baumstamm. Meisen und Buchfinken übten sich im frischen Staccato; der Bussard schrie erregt, und im tiefen Park begann die Nachtigall ihre unvergleichliche melodische Hymne zu zelebrieren.
Zwischen den frischbegrünten Birkengehängen gab es seit gestern noch ein gemütliches Gurren und Schnurren. Aus der kleinen Krüppelkiefer kam gleich darauf ein verdächtiges Echo hervor.
Es klang so, als wollten sich irgendwelche Bauchredner einen Scherz erlauben. Geheimnisvoll klatschend und knallend schlugen Flügel zusammen. Eigentlich fehlte bei dem munteren Federvolk jetzt nur noch das hastige Gezwitscher der Schwalben; dann würde der freudige Lobgesang über das neuerstandene Wunder der Auferstehung des Frühlings vollkommen sein. Buschwindröschen und goldgelbe Schlüsselblumen hatten sich aus dem trockenen Winterlaub emporgerichtet; silbern glänzte es über den weiten Flächen.
Aus weitem Land, über Meer und Gebirge waren Menam, der Täuber und Mesa, seine Lebensgefährtin, in ihr heimisches Revier zurückgekommen. Fast dreitausend Kilometer hatten die Vögel in knapp einer Woche zurückgelegt. Tagelang durcheilten die beiden Turteltauben, Seite an Seite, die unendlich scheinenden Weiten des Firmaments. In der Höhe, über Meer und Gebirge, herrschte stets heilige Stille. Die Luft strich mit eisigem Rauschen durch das Gefieder. Aus dieser Perspektive sah die Welt verschwindend klein aus. Alles schien wesenlos und gering zu sein. Das leicht gekrümmte Meer erstreckte sich von Horizont zu Horizont. Auch über den Fluten, Wiesen und Hügeln erschien alles harmlos und friedevoll. Doch Menam und Mesa wussten, dass es eine Täuschung war. Sie kannten beide den Kampf ums Dasein – sie wussten, dass es ohne Kampf kein Überleben gab. Sie waren darauf gefasst, den täglichen Streit erneut auf sich zu nehmen; denn kämpfen musste man überall: im warmen Süden wie im kühlen Norden.
So waren sie wieder in ihr nördlichstes Nistgebiet gelangt. Am Lietzengraben, einem frischen Wasser, wählten sich die beiden auf einem Jungbaum im dicksten Gewirr der Fichtenzweige einen neuen Nistplatz aus. In den Ästen der Schlehdornhecke schmetterte ein Pieper sein Lied. Der Ruf der Ringeltaube kam aus dem nahen Eichwald; auch die Hohltauben stimmten mit dumpfem Murmeln in den tausendfältigen Gesang ein. Doch was wäre der Frühling in diesem Land ohne das zärtliche Gurren der Turteltaube und das fröhliche Klatschen ihrer Flügel gewesen. Wenn die anderen Vögel noch so kunstvoll sangen und pfiffen, es würde das Einzigartige, das Herzliche fehlen, nämlich das sehnsüchtige Girren der kleinen, wohlgekleideten Tauben mit ihrem zimtfarbenen Gefieder, dem schlanken Schwanz, der weißen Endbinde, eben den Turteltauben.
»Turr – turr – turr«, klang es selbst in den heißesten Mittagsstunden, wenn alle anderen Vögel schwiegen.
Der Förster nannte sie die »Vögel des Lichtes und der Sonne«. Nicht etwa, weil sie als Zugvögel bekanntlich aus dem strahlenden Panorama der südlichen Mittelmeerzone kamen, nein, weil die kleinen Tiere sich nur da wohl fühlten, wo im Wald das Sonnenlicht bis auf den Boden fiel.
Menam und Mesa bevorzugten, wie ihre Artgenossen, lichte Wälder, Felder und Wiesen, wo möglichst ein munteres Bächlein dahinfloss – denn Durst hatten sie oft und immer wieder. Hier fühlten sie sich am wohlsten. Dort, wo der hohe Fichtenwald düster und das verwucherte Unterholz keinen Sonnenstrahl hindurchließ, gefiel es ihnen nicht. Dieses Revier überließen sie den Hohltauben. Da, wo die helle warme Sonne scheint, fühlen sich Turteltauben wohl. Auf einem schwankenden Ast saß Menam. Die korallenroten Augen blickten hin und her; nach rechts und nach links drehte er dabei den zierlichen Kopf. Behutsam schob sich der Täuber den Ast entlang, bis er den sonnenreichsten Platz erreicht hatte. Ständig zupfte er mit seinem Schnabel an seinen rötlichgrauen Brustfedern herum. Dann spreizte er wohlig seine Flügel, fächerte den weißumrandeten Schwanz und äugte hinüber zu seiner Auserwählten.
Plötzlich streicht er hinüber zu ihr. Unaufhörlich girrend versucht er ihr zu erklären, wie wunderschön er sie noch immer findet und dass es einfach keine andere in der weiten Welt gäbe, die so reizvoll sei wie sie. Immer zärtlicher schnurrt er, immer sehnsüchtiger wird sein Minnelied. Mesa zeigt sich verlegen. Sie dreht und wendet sich schüchtern, als hätte sie Menam gerade eben erst kennengelernt. Dabei haben die beiden schon manche Brut herangezogen und gar manche Nöte und Gefahren durchstanden. Immer verliebter girrt Menam neben ihr, doch weicht Mesa immer wieder aus. Jetzt steigt der verliebte Täuber mit Eleganz hoch in die Luft und klatscht seiner Holden mit den Flügeln Beifall. In weitem Kreise umfliegt der »Bräutigam« seine »neu erkorene Braut«. Plötzlich segelt er zu ihr hernieder, wird zudringlicher und betört sie mit zärtlichen Blicken. Eine geraume Zeit vergeht, bis die beiden des lieblichen Spiels müde geworden zu Felde fliegen, um den Magen zu befriedigen.
Alles hat seine Zeit, auch die Liebe. Wenn sich der Magen meldet, hört das Kosen und Schäkern auf – die Bedürfnisse des Herzens müssen dann den profanen Ansprüchen weichen.
Wie verabredet scharen sich auch andere Tauben auf dem frisch gesäten Getreidefeld, eine beachtliche Schar von »Saaträubern«. Ob es nun erlaubt ist oder nicht, hier wird nicht lange gefragt. Alle beginnen »vogelfrei« mit der Futtersuche. Ein munteres Hin und Her beginnt. Oftmals kreisen die Tauben über dem Feld, fallen ein und fliegen empor; kreisen über den eifrigen Körnersuchern und lassen sich selbst wieder herab.
Doch wachsam bleibt diese lose Gesellschaft, wenn sie auch unverdrossen herumpickt; eine Taube flattert immer auf und sichert das Revier – ob nicht etwa ein Feind naht. Auch das »gefräßige Fußvolk« auf dem Boden hält ständig Ausblick und späht mit seinen Augen die Umgebung ab.
Der Bauer könnte eigentlich der hungrigen Gesellschaft dankbar sein, denn Unmengen Samenkörner von allerlei Unkraut verschwinden in den Kröpfen der Tauben. Emsig picken die dunklen Schnäbel alle Körnlein, die ihnen vor die Augen kommen. Dabei verschlucken sie auch kleine Steinchen und hier und da ein Schneckengehäuse.
Wer ihnen zuschaut, könnte meinen, sie hätten sich vorgenommen, planmäßig jeden Zollbreit das Feld abzusuchen. Eilig tippeln die feuerroten Füßchen über das Erdreich. Dann bekommen die Tiere Durst – eine Taube nach der andern fliegt davon – hinüber zum Lietzengraben. Vorsichtig nähern sie sich der Tränke. Rundherum im hohen Gras, unter Büschen und Ästen warten sie zunächst. Vorsichtig blicken sie umher, bis dann ein mutiger Täuber als erster die Wasserstelle besucht. Danach kommen auch die anderen heran. Diese Tiere brauchen viel Wasser, denn die Körnernahrung muss gut eingeweicht werden. In langen Zügen saugen die Tiere ihren Kropf voll. Dabei beugen sie ihre kleinen Köpfe hastig ins Wasser, dass es nur so spritzt. Doch ihr Gefieder ist leicht gepudert. Sie besitzen Puderdaunen von feinster Beschaffenheit, die wasserabstoßend wirken.
Wenn die Tauben sich sattgetrunken haben, fliegen sie zu Holze. Hier beginnt die fröhliche Runde von neuem. Der Wald ist erfüllt von dem zärtlichen Gurren. Hier und da treiben die Täuber ihre Lebensgefährtinnen, heben sich laut klatschend mit den Flügeln über das grüne Blätterdach der Bäume empor und verjagen die Nebenbuhler. Dann nähern sie sich sofort wieder der Auserwählten und turteln ihr Liebeslieder ins Ohr.
Schnell hatten Menam und Mesa das kleine Nest zusammengetragen. Bis zur Nachtzeit schleppten die beiden Tauben Äste und Zweige in das verworrene Geäst der Fichte. Aus kleinen Stöckchen bauten sie einen undurchdringlichen Verhau. Erst, als die wärmenden Strahlen der Frühlingssonne das graue Nest in ihren goldenen Schein hüllten, kamen Menam und Mesa endlich zur Ruhe. Unter der Schutzhülle von Nadeln und Zweigen verbargen sie ihre Köpfe im blaugrauen Gefieder und träumten vom Glück kommender Tage.
Hier, im heimlichen Versteck, konnten sie auch die gefährlichen Nachteulen nicht fassen. Still wurde es im düsteren Wald. Der Schein des Mondes wanderte langsam von Ast zu Ast.
Es war ein wonneschöner Morgen, als im Nest zwei weiße Eier lagen. Zwischen den Kiefer-, Fichten-, Tannen- und Buchenreisern leuchteten sie hell in den Frühlingstag. Obgleich das Nest nicht gut verarbeitet, war es fest im Gestrüpp verankert, so dass es dem Sturm und jeder Art von Unwetter trotzen konnte. Stundenlang lag Mesa still und ergeben auf der Mulde. Unter ihrem Körper spürte sie mit großem Behagen die beiden Eier. Es war wohlig warm. Sie erwartete Menam, der vor geraumer Zeit fortgeflogen war. Wenn er ihr auch beim Brüten nicht allzu viel helfen wollte, so unterhielt er sie doch aufs Allerliebste durch sein schönes Gegurre.
Endlich, wie ein kleiner, heller Kugelblitz schoss er aus der Höhe heran, landete auf seinem Lieblingsplatz, einem glatten Ast der Buche. Mit ruckartigen Wendungen seines Kopfes vergewisserte er sich, dass den beiden keine Gefahr drohte. Gleich darauf hüpfte er an die Seite seiner Gefährtin und freute sich, wie sie ihn willkommen hieß. »Turr – turr – turra – turr«, murmelte er verbindlich, um sie über seine längere Abwesenheit hinwegzutrösten.
Nach einigen Tagen bemerkte Mesa unter der Schale des einen Eies eine leichte Bewegung. Vor Freude begann sie bauchrednerisch zu gurren. Auf diese Weise versuchte Mesa, durch die Eierschale hindurch, zu ihrem noch nicht geborenen Küken Verbindung aufzunehmen. Ihre melodische Stimme sollte dem noch ungeborenen Leben Trost und Ansporn sein.
Die Maisonne stand hoch am Himmel. Das kleine Nest war so gut versteckt, dass selbst raffinierteste Lausbuben es nicht aufstöbern konnten. Im Grunde genommen hatte Mesa nicht viel von ihrem Leben. Gerade war sie aus dem fernen Süden heimgekehrt, da saß sie auch schon im Nest.
So vergingen die Tage und Nächte; wieder hockte das Tier auf den Eiern und hielt Ausschau nach Menam, als sie eine leichte Erschütterung unter sich wahrnahm – auch war ein zartes Klopfen von Zeit zu Zeit in den Eiern zu hören.
Vor sieben Jahren war Mesa selbst, unweit dieses Nestes, aus einem Ei geschlüpft. Bei ihrem ersten Flug über die endlos scheinenden Weiten des Mittelländischen Meeres und später in der erhabenen Wüste Juda hatte sie Menam kennengelernt. Mit ihm flog sie nun schon sechsmal den langen Flug zu ihrer nördlichen Heimat. Sie war stets ihrem Instinkt gefolgt und konnte sich dabei noch an ihren ersten Flug mit ihren Eltern erinnern.
Nun spürte Mesa unter sich ein leichtes Knacken. Sie erhob sich und blickte mit ihren korallenroten Augen erwartungsvoll auf die schneeweißen Eier. Ein kleiner gezackter Riss klaffte quer über der Rundung des Eies. Mesa beobachtete mit gespannter Aufmerksamkeit, wie sich das noch unsichtbare Wesen mit immer neuen Anstrengungen und Beharrlichkeit von innen gegen die zu eng gewordene Eischale stemmte. Bei jedem Ruck schaukelte das Ei ein wenig hin und her. Mesa äugte in die Ferne. Von Menam war nichts zu sehen und zu hören. Ein Habicht zog hoch am Himmel seine Kreise. Erschrocken begann Mesa zu gurren: »Turr – turra – turr …« Sie rückte etwas zur Seite und wandte sich den Eiern zu. Wieder ruckelte das angerissene Ei, als sie hoch oben aus dem fernen Himmel, vom goldenen Strahl der Maisonne erfasst, Menam erkannte. Mit schwirrendem Flügelschlag begann er seinen Anflug hin zu dem trauten Nest. Noch bevor er den Ast erreichte, vernahm Mesa ein Rauschen und Flattern aus der Luft, ehe sich ihr Beschützer neben ihr niederließ. Nun standen die Tauben Seite an Seite und beobachteten, wie ein kleiner Schnabel durch den winzigen Spalt der berstenden Eierschale sichtbar wurde. Blind, zappelig, sehr hässlich mit nacktem Köpfchen lag bald ein klebriges Daunenbällchen neben dem noch geschlossenen zweiten Ei. Mit zaghaften Bewegungen stellte sich das hilflose Etwas mühsam auf die kleinen Beinchen. Fröstelnd erschauerte das Taubenküken, als es die kühle Mailuft umwehte. In der Höhe schrie schrill der Habicht, so dass das Neugeborene vor Schreck das Gleichgewicht verlor und zur Seite fiel. Mesa und Menam rückten heran. Zart strichen ihre Schnäbel über den spärlichen Daunenflaum ihres Kleinen und reinigten es von den feuchtwarmen Überresten der Schale.
Sulamith war geboren – eine unscheinbare Taube wie Millionen andere in aller Welt. Bei Tagesanbruch, als das Morgenrot am Himmel über den Kronen der Fichten, Buchen und Eichen aufleuchtete, wehte ein lauer Wind. Längst war das graubraune Küken neben dem noch immer geschlossenen Ei völlig getrocknet, doch blind für seine Umwelt.
Bald zerbrach auch die Schale des anderen Eies und Alwa schlüpfte als klebriges Daunenbällchen in die raue Wirklichkeit des Daseins. Wieder lag ein feuchtglänzendes Häufchen Leben hilflos da. Aber dann stellte sich das neue Geschöpf neben seiner Schwester recht unbeholfen auf die hauchdünnen Beinchen – torkelte hin und her, verlor das Gleichgewicht und fiel auf die nassen Überreste des zerbrochenen Eies zurück. Nachdem Alwa von den Eltern auch gereinigt und geputzt war, kuschelte er sich in die wohltuende Wärme unter Mesas Brust. Mit ihren aschgrauen Federn sah Mesa nicht besonders schön aus, doch an Äußerlichem war dem treuen Tier nichts gelegen, ihr genügte es, liebevoll und zärtlich zu sein.
Behagliche Wärme durchzog den lichten Wald. Der Frühling näherte sich seinem Ende. Ab und zu schnurrte hier und da noch ein allzu verliebter Täuber bei der Suche nach einer Partnerin. Doch dann wurde es still.
Erst am späten Nachmittag schwoll das Murmeln und Gurren wieder an. Mit zärtlichem Geschnurre trieben die Täuber ihre Auserwählten vor sich her, erhoben sich laut klatschend über Baum und Strauch, schwebten über dem dunklen Grün der Wälder und ließen sich endlich dicht neben der Liebsten nieder.
Für Mesa und Menam galt es jetzt, unaufhörlich Futter zu suchen, denn ihre munteren Sprösslinge blieben schier unersättlich. Zunächst fütterten die Eltern ihre kleine Brut mit der eigens zu diesem Zweck hergestellten Kropfmilch. Diese wurde später mit weichem Futter vermischt. Sulamith und Alwa steckten ihre Schnäbel gierig in die Schlünde der Altvögel und entnahmen ihre Nahrung.
Die Tage vergingen. Bald hieß es für die beiden Jungtauben, vom Nest aus die nächste Umgebung kennenzulernen. Der spärliche Wald wurde von einem hellglitzernden Wasserbach durchflossen, was die beiden fröhlich zur Kenntnis nahmen. In der Ferne war der Bach von Wiesen, Feldern, von knorrigen Weiden und Haselnusssträuchern umgrenzt. Was gab es nicht alles zu entdecken und zu lernen. Auf den Wiesen tummelten sich Vögel aller Art. Der flötende Ton des Spechtes und der schrille Schrei des Turmfalken klangen anders als das gemütliche Gurren von Menam und Mesa. Verwirrend hörte sich das vielstimmige Konzert der Singvögel in dieser Gegend an. Wunderschön klangen die Koloraturen einer Drossel, die vom höchsten Punkt einer Fichte ihren Lebensbereich verteidigte. Ganz anders tönte das kurze Ticken des Rotkehlchens. Das Quarren der plumpen Krähen machte den Küken schreckliche Angst. Unglaublich viel gab es, was die jungen Tauben kennenlernen mussten. Von dort, wo die Grillen zirpten oder die Frösche gemütlich quakten, war in der Regel keine Gefahr zu erwarten. Anders wurde allerdings die Sache, wenn der Eichelhäher reklamierte oder ein Specht Lärm schlug. Dann war irgendetwas nicht in Ordnung, schon ganz und gar nicht, wenn ein Rehbock oder ein Kaninchen fluchtartig davonlief, oder wenn die Drosseln zu zetern begannen. Mesa und Menam stupften dann ihre Jungen schnell ins Nest, weil die Sache jetzt bedenklich wurde.
Viel Täuschung gab es in dieser schillernden Welt – das melancholische Unken des Waldkauzes war überhaupt nicht als harmlos zu verstehen. Überall lauerte Gefahr.
Dann waren da auch noch die Menschen – sie trugen bunte Tücher an den Armen, am Körper und an den Beinen. Ihre Füße steckten in seltsamen Hülsen – sehr schwerfällig wirkten diese Lebewesen – sie konnten nicht blitzschnell wie der Bussard oder Sperber heranfliegen, doch trauen konnte man ihnen nicht. Meistens waren sie ungefährlich, besonders dann, wenn sie lärmend quer durch das Unterholz kamen. Einige bückten sich ständig, um Beeren zu pflücken; andere gingen achtlos an allem vorüber. An einigen Stellen entzündeten sie Feuer und bereiteten Speisen darauf. – Es war dennoch stets ratsam, sie nie mehr als dreißig Flügelschläge an sich heranzulassen – man konnte ihnen einfach nicht trauen.
Eines Tages strichen zwei dieser Geschöpfe ganz in der Nähe des Nestes, dass es Sulamith und Alwa angst und bange wurde.
»Sind diese Pilze giftig?«, fragte ein blonder Junge seinen Vater und hielt ihm einen prachtvollen Steinpilz vor die Augen.
»Nein, diese Pilze sind nicht giftig – trotzdem dürfen wir sie nicht mehr essen, denn sie sind radioaktiv verstrahlt.«
»Weshalb sind sie denn auf einmal verstrahlt? Im vergangenen Jahr haben wir doch viele solcher Pilze gesammelt und gegessen?«
»Durch die Explosion in einem Atomkraftwerk, mein Kind. Der Wind und der Regen brachten diese gefährlichen Strahlen von Russland herüber. In vielen Ländern Europas wurden Früchte und andere Gewächse, die entweder zu dieser Zeit gerade in der Blüte standen oder aus dem Boden hervorkamen, verseucht und dadurch für die Menschen gesundheitsschädlich.«
»Weshalb bauen denn die Menschen solche schrecklichen Sachen?«
»Um billig Strom zu erzeugen und neue Kraftquellen zu gewinnen.«
»Wenn aber diese Kraftquellen später die Natur zerstören, dann nützt uns doch der billige Strom nichts?«
»Du hast recht, mein Junge, man nennt diese grausamen Vorgänge die Logik des Wahnsinns. Ja, hinter allem steht der Böse, der die ganze Schöpfung restlos zerstören möchte.«
Die beiden wanderten weiter in den Wald hinein. Mesa und Menam hatten die beiden gehört – aber verstehen konnten sie sie nicht. Von Natur aus neugierig, blickten Sulamith und Alwa den davonziehenden Menschen nach.
Fröhlich und unverdrossen rumorten die buntgefiederten Sänger und Sängerinnen im grünen Revier. Ob es regnete oder stürmte, es störte die jungen wie auch die alten Vögel kaum, ihre flügelleichte Freiheit zu genießen. Immer farbiger, wärmer und lebendiger ging es im Wald zu. Die Büsche leuchteten goldbraun. Es glitzerte und funkelte an jedem Zweig. An allen Blättern und Knospen perlten silberne Taudiamanten. Des Kuckucks voller Ruf übertönte das muntere Konzert.
Sulamith erblickte eines Tages auf einem engen Pfad etwas Seltsames näherkommen. Im blauen Trainingsanzug trabte ein Mann durch das Unterholz. Mit den Armen schien er sich Schritt um Schritt vorwärtszudrängen. Keuchend blieb er an einer blauen Tafel mit weißer Schrift und einer symbolischen Grafik stehen. Der Schweiß lief ihm an den Schläfen herab. Mit beiden Armen begann er kreisende Bewegungen zu vollführen, dabei zählte er laut und keuchend die Übungen aus. Anschließend rannte er im Bogen weiter, blieb an einem nächsten Platz stehen, schaute auf die Tafel und begann, über einen am Boden liegenden Baum zu springen und mehrmals zu hüpfen, um dann wieder weiterzulaufen. Alles sah urkomisch aus, dieser Mensch bewegte sich ganz anders als seine würdigen Artgenossen. Ein anderer Wanderer kam gemächlichen Schrittes ihm entgegen und rief dem Sportlichen hinterher: »Du armer Mensch läufst dem Schicksal nicht davon!« Doch das hörte der Mann im Trainingsanzug nicht mehr. Unwillkürlich versuchte Sulamith, auch im Nest zu hüpfen. Doch dann vernahm sie schon die warnenden Rufe der Mutter, die sie vor allzu großer Kühnheit bewahren wollte. Sulamith gab sich einstweilen damit zufrieden, am äußersten Rand des Nestes zu hocken und auf das bunte Treiben im Wald hinabzublicken.
Tag für Tag ließen sich die beiden Küken von ihren Eltern sattfüttern und beobachteten ihre eleganten An- und Abflüge. Noch war bei Sulamith die Angst stärker als das Verlangen, sich in freier Luft den Flügeln anzuvertrauen. Sie hielt es für angebracht, alles mit gewissem Abstand zu beobachten. Von Zeit zu Zeit stieg aber die Ahnung in ihr auf, sich doch einmal mit eigenen Schwingen in die Luft erheben zu können.
Noch vieles mussten sie lernen und weitere Erfahrungen bekommen. Alwa mochte Sulamith nicht leiden. Mit ihren mattbraunen Federn sah sie geradezu hässlich aus, meinte er. Wenigstens sah sie nicht so vornehm wie Mesa und Menam mit ihrem zimtfarbenen, schön gemusterten Gefieder aus. Dabei ahnte Alwa nicht, dass er genauso trist und unauffällig mit seinem Kinderkleid auf Sulamith wirkte.
Überhaupt benahm sich Alwa recht ruppig – er hackte und schubste an Sulamith viel herum. Doch wenn ein Schatten über das Nest strich, duckten sich beide dicht an dicht und zitterten um die Wette. War die Gefahr vorüber, stellte sich Alwa wieder forsch auf den äußersten Rand des Nestes und versuchte, mit unsicherem Flügelschlag auf dem Gewirr der Zweige herumzubalancieren. Sulamith verfolgte mit Angst und Zittern die tollkühnen Kletterkünste ihres Bruders. Plötzlich flog Alwa hinüber zum nächsten Baum. Sulamith blieb vor Schrecken bald das Herz stehen. Sie bangte um ihn; denn es war sein erster Flugversuch. Wie froh war sie, als Mesa zurückkehrte und Alwa wieder ins Nest lockte. Ein letztes Mal durften die beiden Taubenkinder zur Rechten wie zur Linken ihre Kindernahrung aus dem Kropf ihrer Mutter saugen; dabei steckten sie gierig ihre Schnäbel tief in den Schlund der Mutter.
Am nächsten Tag wagten beide Jungvögel, ihre Schwingen schon weiter zu spreizen. Alwa folgte Menam, der in zügigem Flug eine Wasserstelle anvisierte. Da, wo die stämmigen Buchen ihre kräftigen Äste über den Bach ausbreiteten, war das Ufer flach. Im frischen Schlamm konnte man unzählige Abtritte von allerlei anderen Vögeln sehen. Vorsichtig näherte Menam sich der Tränke. Alwa folgte ihm mit trippelndem Taubenschritt. In langen Zügen begannen beide, das frische Wasser hastig zu trinken. Mit rauschendem Flügelschlag flogen noch andere Vögel heran, die Alwa nicht kannte. Dort bekam er so manchen Schubs und einige gezielte Schnabelschläge. Für ihn begann nun der tägliche Kampf ums Dasein.
Unbemerkt hatte sich Rachan, der Habicht, in die dichte Krone der Buche hineingeschwungen. Mit seinen kräftigen Greifern umklammerte er einen hellgrauen Ast, dicht am Stamm des alten Baumes. Die messerscharfen Krallen zuckten in nervöser Gier. Aufgerichtet, vor Erregung ganz erstarrt, saß er da, lautlos schwenkte er den Kopf hin und her. Seine gelben, brutalen Mörderaugen blickten hinab zur Tränke. Wo Rachan auftauchte, herrschte immer Angst und Schrecken! Keiner seiner Artgenossen erregte in der kleinen Tierwelt so viel Furcht und Abscheu wie dieser Mordgeselle. Der berüchtigte Räuber hauste ein Stück weiter in der Heide. Auch er hatte im Horst sein Weib und eine fast flügge Brut sitzen. Um sie satt zu füttern, musste der kräftige Vogel manchem Tier den Garaus machen, um damit diese nimmersatten Jungen einigermaßen zufriedenstellen zu können. Oft verfolgte er andere Vögel, die ihm nicht gewachsen waren, um ihnen die Beute zu entwenden, die sie selbst zu ihrem Nest bringen wollten.
Bei solchen Hetzjagden wurde Rachan förmlich von einem Blutrausch erfasst. Aus größter Höhe stürzte er pfeilschnell auf seine Opfer und attackierte mit seinem großen, hakenförmigen Schnabel Eichelhäher, Elstern, Amseln und zu gern auch zarte, weiche Tauben. Seine Beute schlug er in der Luft oder auch am Boden. Was er einmal gefasst hatte, ließ er nicht mehr los.
Fasane waren seine Festtagsspeise, aber auch Hühner und alles, was ihm vor die Krallen kam, griff er an.
Jetzt hatte er es auf Alwa abgesehen, der noch recht tollpatschig seine ersten Trinkversuche an der Wasserstelle unternahm.
Plötzlich stößt der Habicht nieder – erfasst blitzschnell eine ausgewachsene Taube – aber nicht Alwa, sondern eine Täubin, die Sekunden vorher über den Bach gewechselt war. Entsetzt stiebt die blaugraue Schar auseinander. Alwa beobachtet erschrocken, wie der grausame Unbekannte mit der verzweifelt um sich schlagenden Taube ins Unterholz abzieht. Zu Tode geängstigt tippelt Alwa im Schlamm völlig entnervt hin und her, bis Menam anfliegt und ihn emporlockt. Jetzt ertönt aus allen Winkeln das Angstgezeter der Drosseln und Amseln. Die Eichelhäher meckern boshaft, Rotkehlchen und Meisen ticken so laut sie können, während der Hase einen Haken schlägt und das Rotwild buschunter hinter den Brombeeren verschwindet.
Alwa hatte eine der wichtigsten Lektionen des Überlebens gelernt, nämlich, besser fliehend der Gefahr zu entrinnen, als jämmerlich darin umzukommen. Zitternd hockte er neben Sulamith, die ihren ruppigen, angriffslustigen Bruder nicht wiedererkannte noch verstand. Es musste etwas Seltsames passiert sein. Menam nickte den Jungtauben zu, so, als wollte er sagen: Blutrünstig geht es in der Welt zu.
Im Grunde herrschte zu aller Zeit nur ein trügerischer Friede, denn auf lautlosen Schwingen konnte sich immer irgendeine Gefahr nahen.
Es gab viele Nestplünderer – doch Rachan war der verrufenste Mordgeselle in dieser Gegend. Sogar die Falken fürchteten den hartgesottenen Habicht. Auch sie hatten begriffen, dass sie gegen diesen Bösen nichts ausrichten konnten.
War es für Rachan nicht möglich, genug Kleintiere zu schlagen, so machte er sich über die Nester der näheren Umgebung her. Wenn er mit seinen scharfen, gelben Mordaugen die vielen Nistplätze überflog, erzitterte die gesamte Vogelwelt. Längst hatten die Vögel begriffen, dass sie als einzelne nichts gegen die scharfen Fänge dieses abgefeimten Mörders ausrichten konnten.
Wieder und wieder schien der Böse als dunkler Schatten am Firmament. Unbeeindruckt vom Hass der anderen Vögel stürzte er sich pfeilschnell auf ausgemachte Nester nieder. Vom schrillen Gezeter, aus dem Angst und Empörung zu vernehmen war, ließ sich der Raubvogel überhaupt nicht beeindrucken.
Nur einmal ging es ihm schlecht, als sich nämlich alle Vögel des Reviers mit wütendem Geschrei auf ihn stürzten. Paarweise schossen sie über den Mordgesellen her. Sie versuchten, ihn mit ihren Schwingen zu treffen und in den Nacken zu hacken. Mit fürchterlichem Rätschen fielen die Krähen auf ihn nieder. Bis tief in den Wald hinein verfolgten sie den Berüchtigten. Viele Püffe musste er sich gefallen lassen. Er konnte sich der schwarzen Gesellschaft einfach nicht mehr erwehren. Die flinken Angreifer versetzten ihm so viele Schnabelhiebe, dass er es vorzog, in einer steilen Kurve Höhe zu gewinnen. Eine Weile kreiste er wie ein Adler in großer Höhe und schon wieder erspähte sein scharfer Blick andere Nistplätze am Bach. Sofort schwebte er über die linke Schwinge hernieder und schoss im Gleitflug auf sein Opfer herab. Das ohrenbetäubende Geschrei aller Vögel prallte an ihm ab. Der große Räuber plünderte systematisch alle Nester, die ihm vor seine stechenden Augen kamen.
Mesa und Menam mussten mit ansehen, wie sein harter Schnabel die Eier anderer Gelege zertrümmerte und zarte Küken herunterwürgte, ehe er sich dann schwerfällig wieder in die Lüfte schwang. Ungerührt glitt der »furchtbare Satansengel« träge über das hinterlassene Chaos der zerstörten Nester mit den zerbrochenen Eischalen dahin. Scharfäugig hielt er bereits wieder nach neuer Beute Ausschau. Es gab einfach keinen Frieden, solange dieser Ausbeuter unbehelligt die Gegend in große Schrecken versetzen konnte.
Sulamith und Alwa zitterten mächtig. Sie spürten instinktiv, dass das ganze Dasein mit großen Gefahren verknüpft war. In dieser Welt kämpfte eine Kreatur gegen die andere. Oftmals wurde auch eine gerade überstandene Gefahr durch eine noch schlimmere abgelöst. Wenn ein Mensch, mit grünen Tüchern bekleidet, durch den Wald schritt und neben ihm ein schnüffelnder Hund rannte, dann galt es, besonders aufzupassen. Die grünbekleideten Zweibeiner trugen manchmal ein blinkendes Rohr mit Holzschaft unter dem Arm. Dann begann das große Zittern nicht nur bei den Vögeln; sogleich sprangen auch die Rehe davon; es flohen die Hasen, ja, selbst Rachan, der Bösewicht, suchte eilends das Weite. In diesem Falle gab es dann ein ungeschriebenes Gesetz der allgemeinen Hilfeleistung innerhalb der Tierwelt. Jedes kluge Tier in der Umgebung warnte die anderen. Deshalb war es immer geboten, ob man nun beim Futtersuchen oder an der Tränke oder auch beim Nestplündern war, ab und zu in die Höhe zu fliegen und wachsam alle Wege, Büsche und Verstecke zu beobachten. Misstrauen war das Gebot des Überlebens, denn jede Kreatur hing mit allen Fasern ihres Daseins an diesem kleinen Leben.
Eines Tages trabte ein Grünrock ohne Hund und blinkendes Eisen mit noch zwei anderen Zweibeinern durch das Unterholz. Angeregt unterhielten sich die drei.
»Die deutschen Wälder liegen im Sterben, ob wir es nun wahrhaben wollen oder nicht. Ich bin zwar kein Prophet, aber wenn die Schadstoffbelastungen weiter fortschreiten, gibt es in Mitteleuropa wahrscheinlich bereits in zwanzig Jahren keine zusammenhängenden Waldgebiete mehr«, sagte der Grünrock.
Recht skeptisch erklärte der Kleinste von den dreien, ein Verwaltungsangestellter: »Aber, Herr Forstrat, ist diese Zukunftsprognose nicht etwas übertrieben? Ich meine, das klingt doch sehr nach Panikmache. Es könnte einem ja angst und bange werden, wenn man Sie so sprechen hört. Nimmt man dabei nicht der heutigen Jugend jede Hoffnung auf die Zukunft?«
Der Forstrat knickte einen Zweig von einer verkrüppelten Fichte und schüttelte die Nadeln auf die Erde: »Ganz abgesehen davon, dass ein Laie die mangelhafte Benadelung bei den Fichten und Blautannen nicht gleich erkennen kann, meine ich, dass die Angst doch in gewissem Sinne wie der Schmerz im Körper einen wichtigen Dienst als Schutzfunktion übernimmt. Leider können die Bäume bei ihrer tödlichen Erkrankung nicht schreien, sonst würden wir schon wegen des Gebrülls etwas unternehmen. Der Jugend ist nicht geholfen, wenn man sie täuscht«, sagte der Mann in dem grünen Rock.
»Sagen Sie, Herr Pastor, hat hier nicht die Furcht nur die Wirkung, alle Dinge zu dramatisieren?«, fragte der Skeptiker.
Die Art und Weise der Auslegung des Geistlichen war sehr nüchtern und überzeugend: »Die Furcht hat in der Schöpfung ihren besonderen Sinn. Aber zu viel Furcht zerbricht das Glas – es gilt einfach, die realen Gründe der Furcht zu beseitigen. Der Schöpfer verlieh uns nicht den Geist der Furcht, sondern die Besonnenheit. Wenn Christus von einem Zeitalter sprach, wo die Menschen vor Furcht in Erwartung der Dinge, die kommen sollen, ihren Geist aufgeben werden, so meine ich, sollte man es doch ernst nehmen. Ich bin wie Sie auch kein Fachmann, doch die massiven Warnungen von Biologen und anderen Wissenschaftlern sind gewiss keine Hirngespinste, sondern Hinweise zur Achtsamkeit. Tatsache ist, dass wir seit etwa hundert Jahren eine rapide Zunahme des Aussterbens von Tierarten, Pflanzen und Bäumen registrieren können.«
»Mir scheint, die Menschheit gleicht einem Alkoholiker, der ahnungslos über ein hochexplosives Minenfeld dahintorkelt; immer auf der Suche nach neuen Rauschmitteln«, meinte der Forstrat.
»In der Heiligen Schrift finden wir Weisheiten, die nicht nur ein Wissen über das Dasein des Menschen beinhalten, sondern auch Aussagen, die weit über das hinausgehen, was Wissenschaftler, Psychologen oder Soziologen zu dem Thema der Innen- und Umweltverschmutzung jemals werden beitragen können. Wir haben es in der Heiligen Schrift schlicht und einfach mit der absoluten Wahrheit zu tun. Das hat nicht ein Theologe, sondern ein bekannter Naturwissenschaftler unserer Tage erklärt«, versicherte der Pastor.
Die drei waren bei ihrem angeregten Gespräch weitergegangen.
»Spätestens seit der Reaktorkatastrophe im Atomkraftwerk von Tschernobyl wissen wir, dass wir uns mit Riesenschritten dem Zeitalter der Apokalypse nähern. Vor fast zweitausend Jahren hat uns ein hochbetagter Mann über die Zukunft durch Gottes Geist prophezeit: ›Ein Drittel der Erde, ein Drittel der Bäume, ein Drittel des grünen Grases wird verbrennen.‹ Darüber hinaus sollen nach seinen Aussagen ein Drittel der Meere, ein Drittel der lebendigen Geschöpfe im Meer an Verseuchung sterben. Gleichermaßen sollen die Flüsse und Wasserquellen verschmutzen, so dass sie ungenießbar werden. Bedarf es da noch einer Auslegung oder einer besonderen Interpretation? Präziser konnte es uns doch nicht vorausgesagt werden.« Nun war der Theologe doch ins Predigen gekommen.
Die Männer blieben unter dem Baum stehen, auf dem Sulamith mit Angst und Zittern verharrte. Von alledem, was da unten gesprochen wurde, verstand sie natürlich nichts.
Der Förster gab dem Theologen recht: »Neulich las ich von einer Ansprache, die anlässlich eines Universitätsjubiläums gehalten wurde. In seiner Festansprache versicherte der Dekan: ›Für die Tier- und Pflanzenwelt ist der Mensch das schlechthin satanische Wesen. Mit überlegenen, unheimlichen Mächten ausgestattet, geht er in allem seiner Willkür nach. Er pflanzt die Gewächse an, wo und wie er mag, und er vernichtet sie nach seinem Gefallen. Er verändert sie wieder nach seinem kurzsichtigen Gutdünken …‹«
Der Forstrat vergrub seine Hände in den Hosentaschen. »Dabei ahnen wir heute noch gar nicht, welche unheimliche Wirkung das Waldsterben für das gesamte gesellschaftliche Leben haben wird. Was wissen wir schon, welche Krankheitssymptome bei den Menschen auftreten, wenn wir den Wald endgültig beseitigt haben? Die Filterwirkung des Waldes und der Parkanlagen werden von vielen unterschätzt. Wenn die grünen Lungen Europas aussterben, siecht auch bald die Menschheit dahin. Kluge Stadtplaner haben deshalb von jeher für guten und vielfältigen Baumbestand gesorgt; nicht nur, um dem Auge eine wohltuende Umgebung zu bieten, sondern auch, um die Lungen der Bewohner zu schützen.«
Der Theologe ergriff noch einmal das Wort: »Befragen wir doch die tausendjährige Geschichte unserer Umwelt. Überall, wo am Baumbestand brutaler Raubbau betrieben wurde, verwandelten sich ganze Länder in unfruchtbare Wüsten. Israel z. B. war ein fruchtbarer Landstrich zur Zeit, da Jesus über diese Erde ging. Nachdem unter der Türkenherrschaft willkürlich der Wald abgeholzt wurde, heulte dort nur noch der Wüstensturm sein diabolisches Tohuwabohu über die fruchtlose Fläche. Oder denken wir an die übrigen Küsten des Mittelmeeres. Aus Nordafrika und anderen Landstrichen bezogen die Bewohner des römischen Weltreiches einen großen Anteil ihres Getreides. Das Atlasgebirge war dicht bewaldet. Doch für die Römer bedeutete luxuriöser Komfort, Festungsanlagen und Galeeren mehr als die Erhaltung der Wälder in den damals annektierten Außenprovinzen. Die Folge war, dass auch Sizilien zu einem recht mageren Elendsgebiet wurde. Nicht Naturkatastrophen haben den biologischen Schaden angerichtet, sondern der Mensch mit seiner beutegierigen Profitsucht.«
Der Skeptiker war noch längst nicht von der Gefährlichkeit der Schadstoffkombination im sauren Regen überzeugt:
»Wenn man Sie beide so sprechen hört, könnte man meinen, in einigen Jahrzehnten fahren Reisebusse nur noch über kahle Bergkuppen, und Fremdenführer würden den dann Lebenden mit Nachdruck erklären: ›Hier also müssen Sie sich die riesigen Fichten und Tannen des sogenannten Schwarzwaldes vorstellen. Da gab es auch Eichen, Ahorn, Buchen und andere Bäume. Deshalb heißt diese Gegend noch immer der Teutoburger Wald oder der Westerwald, obwohl wir nichts Grünes mehr erblicken können.‹ Ich halte so etwas einfach für übertriebene Schwarzmalerei.«
»Du großer Gott, was muss denn noch geschehen, ehe Ihnen die Sinne erleuchtet werden? Sie werden noch an die Worte denken, die die Menschen aus Leichtsinn, Bequemlichkeit, Abenteuerlust, Profitgier oder aber einfach nur aus Gleichgültigkeit dahergeredet haben. Sie haben dann höchstwahrscheinlich furchtbare Zerstörungen auf dem ihnen anvertrauten Planeten angerichtet. Diese biologischen Veränderungen sind so gravierend und unwiderruflich, dass sich die Menschheit auf Dauer damit selbst zerstören könnte«, sagte der Förster in Erregung.
Obwohl sich der Theologe nicht direkt betroffen fühlte, versuchte er, das Gespräch in versöhnlichere Bahnen zu lenken:
»Aus dem Gesagten geht doch deutlich hervor, dass das Problem tiefer verwurzelt ist, als wir glauben. Nicht nur die Umweltverschmutzung bedroht uns, sondern vielmehr die Innenweltverschmutzung zerstört global die menschliche Existenzmöglichkeit. Um in etwa Albert Einstein zu zitieren: ›Nicht die Entdeckung der atomaren Kraft, sondern die Gleichgültigkeit und die Brutalität, ja, die Boshaftigkeit des menschlichen Herzens bedroht die Bevölkerung der Welt.‹ Solange die Wurzel dieses Übels nicht beseitigt ist, werden Gesetze, Verordnungen und halbherzige Anweisungen nicht viel ausrichten.«
»Ja, lieber Herr Pastor, glauben Sie denn, wir müssen uns deshalb mit dem Gedanken abfinden, dass es in einigen Jahrzehnten möglicherweise keine Wälder mehr gibt?«, wollte der Mann im grünen Rock wissen, dabei stemmte er seine Hände in die Hüfte.
»Nein, man kann wohl verschmutzte Luft von den schädlichen Verbindungen wieder befreien. Auch verseuchte Flüsse und Meere können sich wieder regenerieren, aber es bedarf meines Erachtens eines besonderen Eingriffs von außen her, um der Innenweltverschmutzung zu begegnen, um die egoistischen und gleichgültigen Verhaltensweisen, die diese chaotischen Zustände hervorgerufen haben, den Menschen bewusst zu machen. Nur so wird das biologische Gleichgewicht wiederhergestellt werden können. Die Offenbarung der Heiligen Schrift gibt uns eine berechtigte Hoffnung für ein Zeitalter, das wir heute Lebenden vielleicht nicht mehr sehen werden. Es ist zukünftigen Geschlechtern prophezeit: ›Dann wird der Wolf beim Lamm zu Gast sein, der Panther neben dem Ziegenböcklein liegen; gemeinsam wachsen Kalb und Löwenjunges auf, ein kleiner Junge kann sie hüten. Die Kuh wird neben dem Bären weiden und ihre Jungen werden beieinanderliegen; der Löwe frisst dann Häcksel wie das Rind. Der Säugling spielt beim Schlupfloch der Schlange, das Kleinkind steckt die Hand in die Höhle der Otter. Niemand wird Böses tun und Unheil stiften – so wie das Meer voll Wasser ist, wird die Erde sein von der Erkenntnis des Herrn‹«, der Pfarrer klopfte energisch auf seine Brust.
»Sehen Sie, dann ist das Problem der Innenweltverschmutzung für diese Zeit gelöst. Auch diese Weisheit gehört zur Prophetie der Heiligen Schrift.«
Der Förster winkte ab: »Das ist mir zu spekulativ und auch im gewissen Sinn verantwortungslos. Doch gehen wir weiter. Ich wollte Ihnen ja die Schadstellen des Waldes zeigen.«
Damit verschwanden die drei im stillen Wald.
Die Tiere kamen wieder aus ihren Verstecken hervor und lebten unbeschwert in die Zeit hinein.
Mit jedem neuen Tag wagte sich Alwa weiter vor in die nähere Umgebung des Nestes. Oft begegnete ihm Korax, der Rabe, mit schwerem Flügelschlag. Plump und feist erschien ihm dieser Vogel. In der Wendigkeit und Fluggeschwindigkeit war ihm Alwa schon überlegen; deshalb drehte er mehrmals eine Runde um den schwarzen Gesellen. Mit ihm überflog Alwa eines Tages sein vertrautes Revier.
Über Äcker und Wiesen ruderte Korax im Tiefflug gemächlich dahin. Alwa hätte nie gedacht, wie groß die Welt ist. Krächzend und quarrend kamen noch andere ortskundige Rudel von Krähen heran. Das Rauschen ihrer dunklen Schwingen und die furchtbar rauen Stimmen bereiteten Alwa stets Furcht. Doch voller Neugierde überflog er mehrmals kreisend das dunkle Volk. Wohin die Schwarzröcke wohl alle pilgerten? In der Ferne wogte es auf und ab, über einem bestimmten Platz fanden sich ganze Scharen mit furchtbarem Geschrei zusammen. Bald geschlossen, dann aber auch in aufgelockerter Formation scharten sich Hunderte übereinander. Die Luft war vom Wirbel der schwarzen Gesellen erfüllt.
Zum ersten Mal sah Alwa eine kunterbunte Mülldeponie: Scherben und Flaschen, weiße Fetzen und Papier, Konservendosen und Plastiktüten lagen durcheinander in einem schrecklichen Brei von verdorbenen Nahrungsmitteln, Brotkrusten und Speckschwarten, Wurststücken und Obstresten, alten Pfannen, Coca-Cola-Flaschen, verschmiertem Butterpapier, stinkenden Lappen, zerbrochenem Geschirr, Fischköpfen, Eingeweiden und unzähligen anderen Dingen, Medizinflaschen und Babywindeln; ein grausames Schlachtfeld von Abfall und Haushaltsmüll, verfaulte, stinkende Überreste einer übersättigten Konsumgesellschaft schimmelten dahin. Ratten huschten in beachtlichen Schwärmen durch die grausame Wüstenei. Auf diesem gärenden Kehrichthaufen ließen sich die schwarzen Vögel nieder. Alwa überblickte das heillose Durcheinander vom Ast eines Baumes, der in der Nähe der Abfalldeponie stand.
Donnernd kam ein schwerfälliges Vehikel von rostbrauner Farbe aus der Ferne heran. Vor Schreck erhob sich Alwa in die Lüfte. Die feisten Krähen ließen sich von dem anrollenden Ungeheuer kaum stören. Korax wühlte mit seinem großen Schnabel in dem angehäuften Dreck herum. Mit brüllendem Gedröhn rollte der Wagen der Müllabfuhr an den Rand der Kippe. Zwei Männer in rötlicher Kleidung, die am hinteren Teil des Gefährts gehangen hatten, sprangen zur Seite. Aus dem Bauch des großen Müllwagens stürzten neue Überreste einer großen Konsumgesellschaft den Hang hinunter. Alle Krähen machten lange Hälse. Über dem neuen Nachschub flatterte schon beutegierig die wilde Schar. Sobald der Wagen davonfuhr, stürzten sich flatternd die schwarzen Gesellen darauf. Sie stocherten und scharrten mit ihren starken Schnäbeln in dem ekelhaften Abfall herum. Mit kräftigen Flügelschlägen erkämpften sich die brutalsten »Abfallgeier« ihre Beute: hier einen Knochen, dort den Rest eines Hühnerbeines. Keine Krähe gönnte der anderen auch nur einen Bissen. Die krächzende Meute verteidigte mit scharfem Schnabel ihre »Kostbarkeiten«. Korax war in seinem Element. Siegesbewusst watschelte er mit einer großen Fischgräte mit Kopf und Schwanz über den Unratsbrei.
Was unrein ist – verdirbt den Reinen den Appetit. Von diesem schmutzigen Geschäft angewidert, erhob sich Alwa und kehrte mit flinkem Flügelschlag in den Wald zurück. Schnell fand er die Lieblingsplätze seiner Sippschaft – doch zu seinem großen Entsetzen war von Mesa, Menam und Sulamith weit und breit nichts zu sehen. Alwa mochte noch so inbrünstig gurren, es kam kein vertrautes Echo aus dem tiefen Wald. Er konnte natürlich nicht ahnen, dass Sulamith ihre zwei Jahre ältere Schwester Pellej kennengelernt hatte. Pellej war eine muntere, erfahrene Taube; sie liebte es, zwischen Wald und Dorf hin- und herzupendeln.
Um den Kummer über seine plötzliche Einsamkeit zu vertreiben, flog Alwa auf gut Glück durch das Revier, in der Hoffnung, seine Sippschaft doch noch zu finden.
Das Dorf
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Die Stadt
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Der weite Flug
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Im Heiligen Land
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Jerusalem
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Unsere Empfehlungen
John Bunyan: Die Pilgerreise zur seligen Ewigkeit
Folgen Verlag, ISBN: 978-3-958930-05-6
Dieses eBook enthält die vollständige Ausgabe der Pilgerreise von John Bunyan. Als Grundlage diente eine deutsche Übersetzung von 1859, die für diese Ausgabe überarbeitet und der neuen Rechtschreibung angepasst wurde. Zusätzlich enthält sie die Zeichnungen aus der ursprünglichen Ausgabe.
Das Besondere an diesem eBook sind die verknüpften Bibelstellen und den Fußnoten. Insgesamt sind es über 500 Fußnoten mit ca. 1000 Bibelstellen, die direkt im eBook aufgerufen und gelesen werden können. Diese zahlreichen biblischen Verweise führten Charles Spurgeon zu folgender Aussage über John Bunyan:
Dieser Mann ist eine lebende Bibel! Wo immer du ihn auch anzapfst, wirst du feststellen: Sein Blut ist Biblin, die Essenz der Bibel selbst. Er kann nicht sprechen, ohne ein Bibelwort zu zitieren, denn seine Seele ist voll des Wortes Gottes.
Anton Schulte: Gedanken über Ehe und Familie
Folgen Verlag, ISBN: 978-3-944187-66-2
Die Familie ist die kleinste Zelle der menschlichen Gesellschaft. So wie alles Große sich aus vielen winzigen kleinen Zellen zusammensetzt, besteht auch ein Volk aus vielen, vielen kleinen Zellen, die wir Familien nennen.
Eins der größten Probleme der Menschen von heute ist das Ehe- und Familienproblem. Deshalb möchte ich in dieser Schrift auf viele wesentlichen Fragen und Antworten eingehen. Dass ich dabei mit dieser Schrift nicht Anspruch auf eine lückenlose Behandlung des Themas stelle, ist klar. Aber ich glaube, dass der Briefverkehr mit den Radiohörern die größten und notvollsten Fragen der Menschen offenbart. Möge den vielen, die ihre Fragen für sich behalten haben, aus dieser Schrift eine helfende Antwort werden.
Jost Müller-Bohn: Der Mensch Martin Luther
Folgen Verlag, ISBN: 978-3-944187-49-5
Martin Luther – der weltbekannte Reformator und Gottesstreiter – wer meint nicht, etwas von ihm zu wissen? Aber kennen wir den Reformator wirklich? War er nur der geistliche Kämpfer, der trotzige Streiter gegen die verderblichen Irrtümer der damals existierenden Kirche?
Ist Luther nicht in gewissem Maße dem heutigen Leser ein Unbekannter geblieben, weil hinter den landläufigen Ansichten über den kirchengeschichtlichen Luther der private Luther in den Hintergrund getreten ist?
Um die private Sphäre Martin Luthers und seine Gedankenwelt geht es in diesem eBook. Jost Müller-Bohn lässt durch ausgewählte Ausschnitte aus den Schriften, Predigten, Briefen und Reden Luther selbst zu Wort kommen und macht eine bisher nur wenig beachtete Seite des großen Reformators sichtbar.