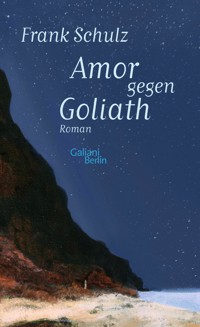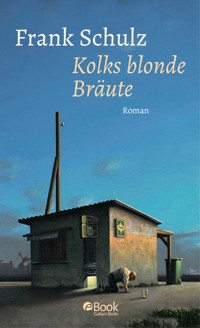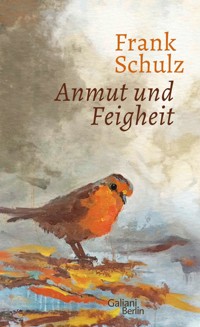9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Onno-Viets-Romane
- Sprache: Deutsch
Bühne frei für Onno Viets!Es gab Svevos Zeno Cosini, es gab Loriots Herrn Lohse, es gab Henscheids Herrn Jackopp und den Dude in The Big Lebowski. Und jetzt gibt es Onno Viets! Was passiert, wenn einer wie Onno Viets zum ersten Mal in seinem Leben eine richtig gute Idee hat? Onno, Mitte 50, Hartz-IV-Empfänger, Noppensockenträger und ungeschlagener König einer Hamburg-Eppendorfschen Pingpong-Runde, bekennender Nicht-Schwitzer, leicht phobisch, hat das Finanzamt im Nacken, den Geburtstag seiner Frau Edda vor Augen und eine Eingebung aus dem Fernsehen: Er wird Privatdetektiv! Seine geplagten Sportsfreunde vom Tischtennis ahnen Ungutes. Aus langjähriger Erfahrung. Dennoch verhilft einer von ihnen Onno zu seinem ersten Fall: Der Popmagnat Nick Dolan argwöhnt Untreue seiner aktuellen Flamme, Onno soll ein Beweisfoto von ihr und dem Liebhaber liefern. Und Onno hat Glück, schon bald wird er Dolans Nebenbuhler ansichtig. Allerdings ist der Kerl mit dem Spitznamen »Händchen« nicht nur zwei Meter groß und 130 Kilo schwer – er ist auch die unberechenbare, gefürchtete rechte Hand eines Hamburger Kiez-Oligarchen. Onno schafft es nicht, den Fall wieder abzugeben, und muss die beiden bis nach Mallorca verfolgen. Dort setzt sich fort, was begann, als einer wie Onno mal eine richtig gute Idee hatte: Der Sog der Katastrophe beschleunigt sich rasend … Was passiert, wenn ein Autor wie Frank Schulz zum ersten Mal in seinem Leben seine wild wuchernde Phantasie und Sprachlust mit der spannungsgeladenen Handlung eines Thrillers kombiniert? – Schafft der Leser nicht, das Buch rechtzeitig zuzuschlagen, wird er hineingerissen in einen Strudel aus Verrat und aberwitzigen Dialogen, Hochspannung und unvergesslichen Figuren, Situationskomik und abgründigen Milieustudien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhalt
CoverTitelDas Internetvideo »Irrer Huene«, Clip 1/4Rückblende I: Wieso Onno Detektiv wurdeDas Internetvideo »Irrer Huene«, Clip 2/4Rückblende II: Weshalb Onno verbrannteDas Internetvideo »Irrer Huene«, Clip 3/4Rückblende III: Warum Onno untertauchteDas Internetvideo »Irrer Huene«, Clip 4/4EpilogDanksagungBuchAutorImpressumHandlung und Figuren sind erfunden.Wer sich wiedererkennt, ist selber schuld.
[Hauptpersonen der Handlung]
Onno Viets (53), genannt Noppe
Hartz-IV – Empfänger, Anwärter zum Privatdetektiv; Tischtennisspieler
Edda Viets (50)
seine Frau; Kindergärtnerin
Tibor Tetropov (23),genannt Händchen
Rechte Hand eines Kiez-Oligarchen
Fiona Schulze-Pohle (23)alias Fiona Popo
Tänzerin, Tetropovs heimliche Geliebte; eigentlich liiert mit
Harald Herbert Queckenborn (52)alias Nick Dolan
Popstar
Albert Loy (48)alias Hein Dattel
Streetworker; Exkommilitone Viets’
Milan (12)
Laufbursche
Roberta Wanda Müller (28),genannt Robota
Rechtsanwaltsgehilfin
Dagmar (47) & Ellen (47)
Hamburg-Touristinnen
Die Sportsfreunde
Raimund Böttcher (52),genannt Der schöne Raimund
Anzeigenleiter; Viets’ ältester Freund
Ulli Vredemann (41),genannt EP (für Elefantenpeitsche)
Speditionskaufmann
Christopher Dannewitz (49),genannt Stoffel
Rechtsanwalt, Dr. jur.; Viets’ zweitältester Freund – der Erzähle
[Menü]
Das Internetvideo »Irrer Huene«, Clip 1/4
beschrieben und kommentiert von RechtsanwaltDr.Christopher Dannewitz
Clip 1/4
Länge: 01 min. 42 sec.
Aufrufe: 1.444.567
Bewertung: *****
Hamburg, Außenalster. 13.August. Ein Freitag, übrigens. Freitag, der dreizehnte. Über das ominöse Datum hinaus dokumentiert die digitale Einblendung die fortlaufende Uhrzeit – zu Beginn 11:22 Uhr.
Im Übrigen kann man von der ersten Sekunde an hören, was da auf einen zukommt in Dagmars Video. Man braucht nur die Lautstärke hochzuregeln, um hinter den Vordergrundgeräuschen zwei weitere herauszuhorchen: das Auspuffgeknatter eines geländegängigen Motorrads (gemeinhin als Enduro bekannt) und das zweitönige Einsatzsignal der republikanischen Ordnungskräfte. Das Martinshorn. Dies noch schwach, aber unverkennbar. Tääätäää! Tääätäää! Tääätäää! Das ewige markige, gallige, törichte Echo der Millionenstadt.
Formatfüllend zu sehen ist in dem Clip zunächst nur das wackelnde Abbild einer blütenweißen Prachtfassade, flächenweise verdeckt von Baumkronen. (Davor eine Staffel kahler Masten von Leihsegelbooten.) Hochformatige Sprossenfenster über fünf Etagen, gekrönt von einem grünen Kupferdach; vor einer Gaube die Majuskeln ATLANTIC.
Währenddessen zu hören, direkt am Mikro: »Da wohnen wir, und jetzt sind wir auf einem Alsterdampfer und legen gerade ab.« Dagmars rheinische Intonation. Ein bißchen kratzig und kurzatmig, aber gut verständlich, so daß Dagmars ungebetener anonymer Webmaster – Monate später – bei der Bearbeitung fürs Internet auf Untertitel verzichten konnte.
Es bebt, das Bild, schwillt dann ruckartig ins Nah-Unscharfe und zoomzuckt wieder zurück. Dagmar hatte am Vorabend einen Campari zuviel genossen. Außerdem dieselte das Sektfrühstück nach. Zu schweigen davon, daß ihr die schwüle Witterung zu schaffen machte. Doch gedreht werden mußte – schon als Rechenschaftsbericht für den Göttergatten.
Die Vordergrundgeräusche auf der Tonspur des Camcorders: Straßenverkehr zwischen Hotel Atlantic und Alsterufer, ferienbedingt spärlich. Maschinengebrumm der Saselbek, von dessen halboffenem Achterdeck aus Dagmar filmte. Ferner die letzte Strophe eines Sangessolisten aus dem Fahrgastraum (»… de Lüüd för dat Schipp, de weern ok blots schanghait«) samt Chorantwort der anderen föftein Schlumper Shantyboys (»To my hoo day, hoo day, ho-ho-ho-ho…«). Beides ein bißchen zu breitbeinig. Ein bißchen. Zwei, drei μ. Die Stickigkeit, die Stickigkeit unter Deck.
Und dann die Stimme Ellens, Dagmars Busenfreundin aus Hanau, die den Alarm des Streifenwagens nachäfft: »Wäääwäää, wäääwäää, wäääwäää … Klingt eische’tlisch wie e Karnevalstusch, findst net aach?«
In diesem Fall war der Webmaster auf Nummer sicher gegangen und hatte die Szene untertitelt:
Klingt eigentlich wie ein Karnevalstusch, findest du nicht auch?
Und zum entrückten Hexengelächter einer Möwe wiederum Dagmars Stimme, wiederum direkt am Mikro (wobei das Atlantic wiederum erbebt): »Nää.« (Ohne Untertitel.) Sie war einfach allzu gründlich fokussiert, um das allzu spitze Ohr ihrer Freundin würdigen zu können. Denn grad vollstreckte sie einen ihrer unwiderstehlichen Reißschwenks – und zwar jenen, der die beispiellose Internetkarriere ihres Werkes begründen sollte.
»Alstermonster!« »Amok-Huene!« »Real Splatter!« Dies noch die sachlichsten Stichwörter, unter denen das in vier Clips gegliederte Video im weltweiten Netz kursiert. Und seinen sog. Kultstatus bis heute behauptet.
Wobei der meistaufgerufene Clip eben diese hundertzweisekündige Anfangssequenz ist, obwohl bloß zweit- oder drittspektakulärste von allen vieren. Die nutzerfreundliche Kürze dürfte eine Ursache dafür sein. Hauptgrund aber die verquere, zufällige Vollkommenheit, mit der die Bilder, obwohl zweifelsohne authentisch, wirken wie inszeniert. Wie inszeniert von einem Regisseur, der formalen Dilettantismus simuliert, um die Aussagekraft zu steigern.
Dagmar brauchte Dilettantismus nicht zu simulieren. Dreh-Erfahrungen mit ihrem Weihnachtsgeschenk hatte sie lediglich im letzten Arnoldsweiler Karneval gesammelt.
Bis hierhin, in der ›Atlantic-Phase‹ des Clips, verstreichen die ersten vierundzwanzig Sekunden. Die kommenden zehn zählen zur ›Phase des Apokalyptischen Reiters‹: Nach dem Ruck weg vom Atlantic – kein Schnitt, wohlgemerkt! – übernimmt der Betrachter des Clips ebenso abrupt, aber präzis die Sichtachse in die räumliche Tiefe eines geländergesicherten Stegs. Dieser Steg wurzelt im nuancenreich begrünten Ufer. Und dort, im perspektivischen Fluchtpunkt, entspringt, untermalt von nun deutlicherem Geknatter und Viertaktergequengel, bereits avisierte Enduro.
Da hinten macht sich deren Fahrer noch vage aus – ein menschliches Ding, ein Unding. Ein Kannibalenhäuptling oder so was. Oder Stuntman? Kostümierter, maskierter Werbeträger für das Deathmetal-Grusical Satan’s Soul, das grad im Hafen anlief? Eigentlich nimmt man zunächst nicht viel mehr als Buntheit wahr, und Bulligkeit. Und, so viel kann man auf den ersten Blick sagen: Der Schädel wirkt bizarr. Ohne daß man hätte sagen können, inwiefern. (Zumal … Trägt er etwas quer im Gesicht? Apportiert er etwas?) Kommt jedenfalls mittels Enduro auf den Betrachter zugebrettert, und mit dem Crescendo der Beschleunigung steigt die Frequenz des Plankengeratters.
Nun war es so, daß Dagmar einst Herz und Hymen einem Dürener Ghettoprinzen geschenkt hatte, der Geländerennen fuhr. Das war dreißig Jahre her, doch in einer empfindsamen Seelenlage wie auf dieser Strohwitwentour, da fiel der Gänsehaut im Nacken Wiederauferstehung leicht. Als Erweckungssignal reichte der Enduro-Sound. Und im Zuge dieses Schauderns, im Zuge der Schwüle und des Katers betätigte Dagmar – ein Reflex – den Zoom. Wie in einem Spaghetti-Western ruck, zuck in der Totalen: Kopf und vornübergekauerter Torso des Fahrers. Durch dessen eigene rasche Vorwärtsbewegung gleich wieder aufgelöst in Unschärfe.
Horrormasken gehörten zur Folklore ihrer Kindheit. Dennoch erschrak Dagmar – meinte sie im Schock der allzu prompten Vergrößerung doch erkannt zu haben, daß die Hirnschale des Fahrers ab Hutschnurlinie fehle und all der Blumenkohl offen zutage liege (aus welchem, wie um den groben Unfug abzurunden, auch noch zwei Stummelhörner herauszuragen schienen). Worüber sie die übrigen grauenerregenden Details des irren Hünen vorerst übersah.
Vor Schreck zoomte Dagmar rückwärts, erweiterte die Perspektive also wieder. Gerade pünktlich genug, um einfangen zu können, wie der ellenlange Gegenstand, der quer im Mund des Hünen klemmt und in der Sonne aufblitzt, im Vorüberrasen das Blatt einer Kübelpalme absäbelt – woraufhin hinter dem Motorrad eine Wolke aus jenen mysteriösen seidenschwarzen Schmetterlingen explodiert, deren biologische Sensation in jenem Sommer unter den Lepidopterologen der Welt Furore machte. So daß der anschließende Sprungflug des apokalyptischen Reiters in die Alster vor symbolischer Kulisse vonstatten geht, einer Kulisse von Dutzenden taumelnder ›Schwarzer Engel‹, wie jene Repräsentanten der Jugend sie tauften, die sich Gruftis nennen, oder Gothics. Ein weiterer Zufallsgrund für den weltweiten Hype um diesen Internetfilm.
Als der Hüne auf seiner Enduro ins Wasser flog, befanden sich auf der Terrasse des Cafés Lorbaß, das in den Alsteranleger integriert war, abgesehen von Gastronomiekräften fünf Personen. (Drei davon konnten später nicht mehr ermittelt werden.) Für mehr Betrieb war es einfach zu heiß – schon um diese Tageszeit 31,1 Grad Celsius –, und außerdem würden die Ferien des Bundeslandes Hamburg erst am darauffolgenden Mittwoch enden. Nicht zuletzt das war der Grund, weshalb dem ›I.Moderlieschen-Fest‹ ein Flop vorhergesagt worden war.
Das Moderlieschen (Leucaspius delineatus) ist ein unscheinbares Fischchen, das in stehenden und schwach fließenden Gewässern vorkommt. Hat wirtschaftlich kaum Bedeutung, taugt selbst für Angler bestenfalls zum Zanderköder. Ab dem Vorjahr war sein Bestand nichtsdestoweniger plötzlich bedroht. Schon wurde es zum Symboltier eines neuen Alsterfestes. Zwischen Christopher-Street-Day und Cyclassics war noch ein Wochenende frei.
Die Umsetzung allerdings gestaltete sich einfallslos. In welchem Maße, läßt sich an dem Faktum ablesen, daß der Einsatz der Schlumper Shantyboys, der Poppenbütteler Pennschieter und ähnlicher Unterhaltungskoryphäen auf den Liniendampfern der weißen Alsterflotte noch zu den besten Ideen zählte.
Nichtsdestoweniger vermuteten jene zwei Gäste des Cafés Lorbaß eine Aktion in diesem Rahmen, als sie den Enduro-Sprung von ihrem Loungesessel aus verfolgten. Aufmerksam geworden waren sie ja schon durch den Motorenlärm, und als die Maschine samt Fahrer flach vom Steg schoß, sagte der eine »Äy« und der andere gar nichts. Es fiel ihm nichts ein, »gar nichts, aber auch gar nichts« fiel ihm dazu ein – außer daß er, wenn das ein Gag zum Moderlieschen-Fest sein sollte, auf die Pointe sehr gespannt wäre.
Der andere behauptete das eine Mal, er habe durchaus wahrgenommen, daß der irre Hüne splitternackt und ganzkörpertätowiert gewesen sei. Das andere Mal aber vielmehr, er habe an einen ›Catsuit‹ geglaubt, an ein buntes Ganzkörperkondom einschließlich Kapuze (wegen des diffusen Eindrucks fehlender Ohren). »So in der Art von Spider Man«, lautet seine Beschreibung im Protokoll der späteren Vernehmung.
Auch die übrigen Leute, einschließlich der Servicekräfte, lungerten nur und lauschten und gafften, wie sich der irre Hüne von der meckernd durchdrehenden Maschine löste und, sodann zu einer gewaltigen, bunten Arschbombe geballt, samt Enduro einschlug und eine stattliche, zweistrahlige Fontäne hinterließ. Das Motorrad blieb weg. Das Mensch tauchte wieder auf – das kurze Schwert oder den Dolch, oder was genau es war, nun in der Rechten haltend –, schwenkte nach einer Sekunde Orientierung ins Kielwasser der Saselbek ein und begann, wie mit Dreschflegeln betrieben hinter ihr herzurauschen.
Dagmar war ihrem Unstil in puncto Kameraführung treu geblieben. Nach der Explosion der Schwarzen Engel hatte sie einfach gar nichts getan, als weiter draufzuhalten, so daß der Enduro-Jockey auf den Betrachter zuspringt und, in Unschärfe aufgelöst, über dessen rechten Schulter im Nichts verschwindet. Während in der Totalen das Sprudeln der Schwarzen Engel als Kommentar verbleibt, bis das doppelte Platschen aus dem Off die akustische Fortsetzung liefert.
Anschließend (Phase drei: ›Impressionen einer betrunkenen Libelle‹) schien Dagmars Auge unverrückbar fixiert auf den Sucher, so durcheinander war sie. Tief innen ahnte sie bereits, daß dieser Tag spektakulär verschieden von dem verlaufen würde, den sie und Ellen sich eben noch, beim Frühstück im Atlantic, ausgemalt hatten. Während bei den anderen Fahrgästen auf dem Achterdeck noch babylonisches Urstaunen vorherrschte, hatte Dagmar bereits Angst (allerdings nicht nur Angst). Jedenfalls war sie verwirrt genug, geschlagene acht Sekunden lang zu vergessen, daß der Sucher des Camcorders kein Körperteil war. Auch keine Brille oder so. Und weil das Objekt aus ihrem Objektiv verschwunden war, irrte sie acht Sekunden lang mit dem Sucher Reißschwenk für Reißschwenk im Ungefähren herum. Wobei sie auch noch den Schaukelknopf des Zooms für nervöse Entladungen mißbrauchte. Das Ergebnis ähnelt dem, was ein Nutzerkommentar als »impressions of a drunken dragonfly« qualifiziert.
In nächster Mikrofonnähe zu hören ist in dieser Phase eine Übersprunghandlung Ellens: eine Art südhessischer Gospel. Jubelgelall. Nicht einmal ein gebürtiger Hanauer Phonetiker hätte eine Bedeutung herausfiltern können. Es gelang Ellen später selbst nicht mehr.
Schließlich drang Dagmar ans Bewußtsein, daß sie ohne Digicam vorm Gesicht viel besser sehen könnte, was hier vor sich ging. Sie blieb zwar auf der Bank sitzen, wie Ellen in der Hüfte gedreht, um sich mit dem linken Arm aufs Geländer der Heckveranda lehnen zu können. Hob die Kamera jedoch anscheinend mit rechts über Ellens Kopf hinweg – für den Betrachter jedenfalls ein schwindelerregendes Manöver –, und bettete das Gerät in ihren Schoß. Und filmte die nächsten siebenundzwanzig Sekunden ein Stilleben: den Saum ihrer Khaki-Shorts, die Holzdielen des Dampfers, die lackierten Nägel ihrer Zehen (Aubergine metallic), welche aus goldenen Dreihundertsiebzig-Euro-Sandaletten krallten, Beute vom Vortag aus der Edelshoppingmeile Große Bleichen.
Das Hörspiel zu dieser siebenundzwanzigsekündigen Stillleben-Phase‹ besteht aus den tosenden Kraulhieben des Berserkers sowie, zunächst noch, dem sonoren Diesel der Saselbek samt letztem Shantyrefrain. Einem Porsche-Röhren, vom Alsterufer her. Den tosenden Kraulhieben. Wiederum Ellens Stimme, nun leiser, doch deutlicher: »Leck misch, was –« (Ohne Untertitel.) Der Stimme der Sitznachbarin zur Rechten Ellens, einer sechsundsiebzigjährigen Hammerbrookerin: »Wat is dor denn koputt. Wat will de denn. Wat sall dat. Werner. Werner.«
UT: Was ist da denn los? Was will der denn, Werner?
(Ellen beschrieb die Frisur der alten Frau später recht plastisch als ›Pusteblum‹.) Der Stimme eines siebenundsiebzigjährigen Hammerbrookers: »Wat will de denn. Wat sall dat denn.«
UT: Was will der denn? Was soll das denn?
Den tosenden Kraulhieben. Stimmengewirr der übrigen vier Achterdeckspassagiere, zweier junger Pärchen, leicht bekleidet, gepiercet. Zu verstehen nur wiederkehrende Wendungen in vier verschiedenen Stimmlagen: »Schwert … Dolch … krass, Alter …« (Diese vier jungen Leute waren diejenigen, die am raschesten begriffen. Die kurz nach der Kaperung über Bord springen, zurück zum Anleger schwimmen und in der Live-Schalte von Agora TV Hamburg schon als Augenzeugen berichten sollten, als die Geiselnahme noch lief.)
Nach wie vor zum Bild der Khaki-Shorts hört man als nächstes, wie der Motor der Saselbek aussetzt. Mitten in der Koda der Schlumper Shantyboys (»… Saaa-cra-men-tooo!«). Doch aus dem vierzehnköpfigen Publikum heraus erschallt ungerührt ein Einzelapplaus, wie er typisch ist für Typen, die erst merken, was um sie herum passiert, wenn es sie in den Hintern tritt. (Angeblich handelte es sich um das Herrchen jener weißen Schäferhündin, die der Hüne rund fünf Minuten später enthaupten sollte.)
Erich L., Schiffsführer und Schaffner, hatte im Führerhaus trotz Rückspiegels nur erahnen können, was da achterwärts geschah. Weil er befürchtete, daß sich jemand an der Schraube verletzen könnte, hatte er die Maschine entschlossen gestoppt. Und dem Hünen damit ein Quentchen Kraft erspart, das der Eleganz seines Manövers nicht eben abträglich war.
Und so herrscht im letzten Drittel der ›Stilleben-Phase‹ nur mehr eine Geräuschsorte vor. Kein Shanty, kein Schiffsmotorpuckern, kein menschliches oder auch nur Möwengeschrei, kaum Autoverkehr, vielleicht wegen Ampelphasenwechsels. Sondern man hört eine Abfolge von Wassertritten und kryptosexuellen Raubtierlauten. Während dieser Phase nahmen Dagmars organische Linsen wahr, wie der irre Hüne die Saselbek einholte und enterte.
Ein seltsamer Anblick, die Draufsicht auf das herankraulende Wesen. Ein Menschentier, dem man das Fell über die Ohren gezogen und Kriegsbemalung verpaßt hatte. (Wobei … welcheOhren eigentlich?) Oder ein Riesenlurch. Ein monströser, mordsmuskulöser Salamander, dessen Leibzeichnung die Mimikry einer hanebüchenen Kultur zu sein schien. Alle Regenbogenfarben kamen vor, doch auch – auf dem breiten Kreuz – viel Braungeschiefertes wie Hühnergefieder und, insbesondere entlang den Extremitäten, das Steakrot von Fleischfasern, und auf dem Schädel eben Hirngrau … Einzelheiten zu unterscheiden aber war bei der Rapidität der Handlung unmöglich.
Nach einer Rumpfbewegung im Delphinstil schnellte der Hüne mit dem letzten Kraulschlag bis zur Taille aus dem Wasser. Hechtete ans Heck des Schiffes. Wuchtete, innerhalb ein und derselben Aufwärtsdynamik, seine Bruttoregisterzentner auf der rotlackierten Fenderkante in den linkshändigen Stütz. (Grollen durch die Gurgel, bei geschlossenen Kiefern, die die Dolchklinge gleich hinterm Parier schraubstockfest fixierten.) Haschte, bevor er zurückzufallen drohte, mit dem rechten Mittelfinger die Fahnenstange. Erwischte und umkrallte sie. (Kurzes, überschnappendes Muhen.) Setzte den linken, baren Echsenfuß Schuhgröße einundfünfzig neben die linke Stützhand. (Bellen.) Dann, mit einem hormontrunkenen Grunzen zwischen aaa und äää – Ausdruck von Etappenbefriedigung und Siegesgewißheit –, hievte er sich mit der Rechten in die Lotrechte. Sein Bizeps war mit der Struktur eines American Football tätowiert (einschließlich Naht, Logo und Herstellername Wilson), und weil er sich bei dieser Zugbewegung zu fünfneunzig Prozent definierte, schien er fast zu platzen. Kabeldick trat eine Ader aus dem ›Leder‹.
Erst in dem Moment beginnt die neunzehnsekündige Phase fünf, die ›Busenphase‹: dem Moment, in dem Dagmar – die Kamera an der Brust bergend – und Ellen von der Bank aufsprangen und zurückwichen. Bis dahin waren sie hypnotisiert gewesen. Hypnotisiert wie Mäuse vom Totenkopf auf dem Kobra-Nacken.
»Es war furchtbar«, sagte Dagmar später, als sie mir das Mandat zur Nebenklage erteilte, immer wieder. Fuch’chtba.
»Der sah furchtbar aus«, ergänzte Ellen, »furchtbar!« Foschba.
Als er die holzverkleidete Reling packte, brannte sich Ellens Gedächtnis das Bild seiner Faust ein. Diese Faust sah aus, als sei sie mit der grünlichbraunen Hornhaut eines Schuppenpanzers bezogen. Auch die spitzgefeilten und gefärbten Fingernägel unterstützten den Eindruck einer Reptilkralle. Nur waren auf den ersten Fingergliedern Buchstaben zu lesen: ein B auf dem kleinen, auf dem Ringfinger ein U sowie je ein M auf Mittel- und Zeigefinger. (Auf der linken Faust, wie sie später sah, in umgekehrter Reihenfolge: Z, A, C und K. Die Schlagkombination eines Linksauslegers ergäbe aus Sicht eines künftigen Opfers folglich ZACK BUMM.) Jede Letter war bauchig, weiß koloriert, fett umrandet; eine Schrifttype, wie man sie von Explosionen in Comics kennt, oder von Graffiti auf den Barackenwänden entlang der Abstellgleise unserer Republik.
Als weitere Abweichung vom Kroko-Look waren auf der derben Schwimmhaut zwischen Daumen- und Mittelhandknochen – nachträglich eingefaßt von einem smaragdgrünen Kleeblatt – drei Punkte in billigem Blau zu sehen. Dies triangelförmige Zeichen aus alter Knasttradition steht für die Faustregel Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen, was sich auf Kollaboration mit Behörden aller Couleur bezieht.
Als der Hüne an Bord klomm, versprühte er eine Brise aus modrigem, fischrauhem Teichgeruch – in der Hitze elementar und aufreizend. Triefend stieg er über seine Faust an Bord, mit einer eleganten Scherenbewegung der schwerathletischen Schenkel (die gleich den Schultern weitgehend wie gehäutet wirkten, gezeichnet wie in einem Schaubild zur Anatomie der menschlichen Muskulatur). Und aus dem somit präsentierten Hüftbecken sprang dabei ein fetter Aal auf (mit Kopf), angewachsen an einem schlammfarbenen Beutel mit dem Fassungsvermögen von zwei Schlangeneiern.
Ellen mochte nicht einsehen, was sie da sah. (Und jedesmal in ihrem wiederkehrenden Alb assoziierte sie den Beutel mit einem Schlüsselanhänger. Da hob selbst ihr Traumatherapeut die Adlerbraue.) Sie weigerte sich, es wahrzunehmen, und deshalb hob sie gleich darauf ihren Blick, um ein irgendmöglich gutmütiges Dementi in den Augen des Irren zu erheischen.
Hatte er überhaupt Lider? Wimpern waren nicht zu erkennen, und in den Tiefen der waschbärartig schwarzgefärbten Höhlen glänzten Iris, schmal gerändert von rosa-weißem Marmor, aber so schwarz, daß sie aussahen wie riesige Pupillen. Ellen hielt das nicht aus, und ohnehin überwältigte sie nun der Gesamteindruck des Schädels. Wenigstens war es keineswegs so, daß das Gehirn frei lag. Es war nur eine Tätowierung des kantigen Kahlkopfs. Eine illusionistische Arbeit in der Tradition eines Trompe-l’Œil; sie reichte bis hinunter zu jenem Knochengesims, das statt mit Brauen mit je einem Dutzend kleiner goldener Ringe geschmückt war. Das Stummelgehörn allerdings war keine Täuschung, sondern definitiv dreidimensional. (Eine Implantation aus Teflon.) An dem einen Horn haftete die feuchte Cellophanhülle einer Zigarettenschachtel. Beifang.
Trotz der Strapazen atmete er gar nicht schwer, eher wie unter positivem Streß oder wie jemand, der gerade einen längeren Witz erzählt hat. Und doch vernahm man erhebliches Schnaufen. Was wohl dem abgenagten Poulardenknochen geschuldet war, der quer in der Nasenscheidewand steckte. Die hageren Wangen zierte je ein Narbenmikado, und wenn ihn etwas menschlich erscheinen ließ, dann die fünf, sechs Schönheitsfehler bzw. – flecken, die offenbar von Mückenstichen herrührten. Seinen Lefzen entnahm er nun den knapp ellenlangen Dolch (einen Yoroi-dōshi, mit dessen Panzerklinge Samurai einst des Gegners Rüstung zu durchdringen sowie ihn zu köpfen vermochten) und lächelte.
Lächelte blutig. Obwohl der Dolch einschneidig war, hatte sein Besitzer sich einen winzigen Schnitt in der Oberlippe zugezogen – bei der Aktion an der Palme oder beim Eintauchen ins Wasser, oder wann immer. Es tropfte und tropfte. Doch er lächelte, lächelte mit viel Zunge und Zahnfleisch. (Anderthalb Wochen zuvor, so sollten die Ermittlungen später ergeben, hatte er einen kokainsüchtigen Wellingsbütteler Kieferchirurgen dazu bewogen, ihm bis auf die Backen- sämtliche Zähne zu ziehen.) Die Ohren – der Eindruck hatte also nicht getäuscht – fehlten. (Hatte er angeblich eigenhändig entfernt, mit einem Teppichmesser, schon vier Wochen vorher. Die Wundmale, die sich um die Löcher mit den Knorpelzapfen schnörkelten, waren bereits recht gut verheilt.)
Wie ein Schwerhöriger sprach er lauter als nötig, mit kehliger Stimme; eine sinnvolle Aussage herauszufiltern war dennoch schwer. Nicht nur wegen Nasenschmucks und Zahnlosigkeit, sondern auch hamburgischen Kiezakzents wegen. In lautmalerischer Umschrift sähe das, was an Äußerung in diesem Moment zu vernehmen ist, ungefähr so aus: »Tächau. Die For’äoufwoiwee biddeee?« In dudenmäßiger Lautschrift:
Arnoldsweilerin Dagmar verstand natürlich kein Wort, ebensowenig Hanauerin Ellen. Gemeint war – das dürfte als gesichert gelten, und entsprechend sollte es der Webmaster dann später auch untertiteln – so viel wie:
UT: Guten Tag auch. Die Fahrausweise, bitte?
Es lachte aber niemand. Nicht einmal er selbst. Jedenfalls ist im Film nichts dergleichen zu hören.
Statt dessen hatte er stumm mit einer Kralle auf Dagmar gedeutet und sie gestisch aufgefordert, weiterzufilmen. Ihn zu filmen. Immer weiterzufilmen – nur zu, keine Bange. Und aus komplizierten psychologischen Motiven, die auch mit Angst, aber nicht nur mit Angst zu tun hatten, gehorchte sie. Und wieder tat der höhere Regisseur sein Bestes bei der Kameraführung Dagmars. Wobei die letzte Sequenz dieses Clips ein wenig vom Prisma eines Tropfens Alsterwasser gestört wird, der durch das Gefuchtel des Hünen auf die Linse geraten war.
Zu sehen sind in der letzten, der vierzehnsekündigen ›Posing-Phase‹ dieses ersten Clips hauptsächlich vier Posen des Hünen. Posen, die er den Repertoires von Body Building, Kung-Fu und Säbelkampf entlehnt haben dürfte. Bei jeder neuen seiner unbedingt beeindruckenden Schaufiguren gibt er Laute von sich. Selbstanfeuerung. Vertonung seiner Wunschvorstellung davon, was das Publikum bei seinem Anblick ästhetisch empfinden möge. Oder erotisch. Laute wie [ja:], sowie ; zuletzt sogar, bei jenem Hüftschwung, ein gar nicht mal unschwules
Rosenrotes Blut trieft von seinem leicht verletzten Gesäß, und rosenrotes Blut trieft von seiner Oberlippe. Ellen zufolge bildete sich bereits eine kleine Lache an Deck, was auf dem Film nicht zu sehen ist.
Zwo Meter zwo (ohne Gehörn). Hundertachtundzwanzig Kilogramm Knochengerüst und massive Muskulatur, kein Milligramm davon überflüssiges Fett. Wie später ermittelt, hatte er seit elf Wochen täglich vier Stunden unter der Skarabäusnadel des weltberühmten anonymen Künstlers »###« gelegen (und dafür bereits zweiundfünfzig Riesen angezahlt). Und obwohl sie auf dem Film unübersehbar, ja ausschnittweise relativ gut erkennbar sind, all die spektakulären Porträts und Szenarien und Muster, die in die Haut des Hünen gestochen, geritzt und gebrannt worden waren – als Betrachter konzentriert man sich unweigerlich auf Posen und Muskelkontraktionen. Auf Dolch, triefendes Blut, irren Schädel. Auf Aal oder Cellophanhülle. Geschweige, daß es Ellen und Dagmar in der akuten Situation anders gegangen wäre.
Als aus dem Off die Stimme von Käpt’n L. ertönt, sieht man, wie der Hüne die vierte Pose abbricht.
Sie ertönt recht deutlich, die Stimme von Schiffsführer Erich L., weil er plötzlich direkt hinter Dagmar in der offenen Tür zum Fahrgastraum stand. Eine Stimme wie geschnitzt und geölt. Eine Stimme wie ein Requisit aus dem Ohnsorg Theater. »Wät is hiär denn läous.«
UT: Was ist hier denn los.
Und wiederum gehorchte Dagmar ihrem höheren Regisseur, indem sie nicht vor der Stimme erschrak, nicht nach der Stimme schwenkte, nicht zagte und zauderte. Sondern filmisch festhielt, wie der Hüne sich lässig aus seiner letzten Pose löst, die kriegerstolze Haltung eines vollwertigen Verhandlungspartners annimmt, zweimal mit der flachen Klinge auf das rechte Horn tippt – beim zweiten Mal bleibt die Cellophanhülle daran kleben – und mit seinem blutigen, zahnlos grinsenden Maul unter dem quersteckenden Nasenknochen nuschelt: »Der Deubl, Diggä. Der Deubl if läouf, Diggä.«
UT: Der Teufel, Dicker. Der Teufel ist los, Dicker.
Schnitt. Ende des ersten, hundertzwosekündigen Clips jenes weltweit millionenfach angeklickten Internetfilms mit dem Titel »Irrer Huene«.
So weit die per Camcorder aufgezeichneten Geschehnisse auf Hamburgs weltberühmtem Binnensee bis 11:24 Uhr MEZ an jenem Freitag, dem 13.August eines der Nuller-Jahre Ende des ersten Jahrzehnts im dritten Jahrtausend unserer Zeitrechnung. Nachdem alles vorbei war, fragten sich die Medien der Welt, allen voran die verlogene HEZ, natürlich wie üblich: »Wie hatte es so weit kommen können?«
Um mit der Floskel eines alten Sportsfreundes zu antworten: »Njorp …« Was in diesem Fall soviel bedeutet wie: ungefähr folgendermaßen …
[Menü]
[Rückblende I]Hundertsechzehn Tage vorher …
Rückblende I: Wieso Onno Detektiv wurde
Ein Erotikstar geht fremd – Die Tücken der Observation – Wiedersehen mit Hein Dattel – Wird Onno lieber doch nicht Detektiv?
[1]
Montag, der 19.April. Sporthalle des Günther-Jauch-Gymnasiums in Hamburg-Eppendorf.
Es wird so gegen acht Uhr abends gewesen sein, als diese weite, elastische Diele von jenem gewissen Schlachtruf widerhallte. Baßtönig, rasend, und doch geradezu infantil gesättigt von Genugtuung, klang er in etwa wie »KABAANAAAaaa…!«
Blanker, rutschfester Boden; entlang den Wänden Gummimatten und Klettergerüste und Basketballkörbe; taghelles Deckenlicht, himmelhohe Milchglasfenster an der Bankseite. Und doch wirkte die Halle gar nicht karg auf uns Alte Herren. Fühlten uns wohl in diesem etwas schwülen Gemäuer, wo wir unsere chromosomatisch immer noch schwelende Tollheit für ein paar Stunden kontrolliert anzufachen vermochten – momentweise bis zur Verzückung.
Der vierschrötige Bursche, der da losgebölkt hatte wie ein Vandale, wechselte den Schläger in die Linke, um die geballte Rechte für eine triumphale Pleuelgeste freizuhaben. Den restlichen Energieüberschuß baute er ab, indem er schnaubend hin und her stapfte: Ulli Vredemann. Unser Küken.
Sein Pseudonym EP (Elefantenpeitsche) verdankte er solchen Bällen. Durch die schlagartige Beschleunigung auf etwa 140km/h huschte das Celluloidbällchen wie eine Sternschnuppe durchs Blickfeld. Am plastischsten war es akustisch wahrzunehmen: erst am Hieb mit der Rückseite des Schlägers, dann am Knall, mit dem es in die offene Ecke des Tischtennistisches ein- und in noch spitzerem Winkel wieder herausschoß – ta’zeng!!
Benommen der Hüpfrhythmus, in dem der Ball nun durch die Halle irrte – und wie üblich hinter den Verstrebungen der langen Bänke verschwand. Hinterdreinschleichen des Gegners.
»Ka… kaba… Wie war das? Ka… bana?« sinnierte ich halblaut – ich, Dr. Christopher Dannewitz, und zwar in meiner Eigenschaft als Rechtsanwalt: Denn §14 der Vereinssatzung schrieb vor, sich regelmäßig über das Triumph- und Klagewelsch der Sportsfreunde lustig zu machen. Dankbarste Quelle: eben Ulli EP Vredemann.
»Kabana, ja«, bestätigte Raimund. Wir kauerten nebeneinander auf der Bank, seicht schwitzend, so gut wie selig. »Kommt aus dem Umgangsvredonischen. Bedeutet so viel wie: ›Nimm das, Sohn eines Ostfriesen!‹«
»Ah.«
Wiewohl massig an Gestalt, vermochte Ulli eine schon unwahrscheinlich flinke Figur zu machen. Ungerührt von unserem Gefrotzel wechselte er auf die andere Seite der Platte. »So«, schnaufte er. »Zwo null.« Die schütteren Haare waren klatschnaß, und das Hemd strotzte vor Versumpfung.
»Dalli, Noppe!« schnauzte Raimund. Gemeint war Ullis Gegner, der nach erfolgter Ballbergung wieder angelatscht kam. »Wir haben Durst!« Einst hieß das so viel wie Alarmstufe Rot! Doch das war vorbei – noch nicht allzu lang, scheinbar; aber vorbei –, und wir wußten es alle.
Der als ›Noppe‹ angesprochene Mann balancierte den Ball auf der Rückhandseite seines Schlägers denn auch, als probte er fürs Eierlaufen. Folglich schaute er nicht auf, sondern hob nur, da Linkshänder, die Rechte ans Ohr. Beziehungsweise dorthin, wo es verborgen war. Dort, wo das Anthrazitfarbene des strähnigen, nackenlangen Schopfes stufenlos ins Schiefergraue changierte. »Was?«
»Duhurst! Dalli!«
Seine Füße steckten in einem Paar Noppensocken. Schottenkaro. Dazu trug er Shorts, deren manisch-depressives Muster den taffsten Clown in den Suizid triebe. Das T-Shirt mochte – im vergangenen Jahrtausend – blau gewesen sein, oder grau. In Höhe der Schulterblätter gähnte ein Mordsloch. Materialermüdung. »Ja, ja«, versetzte er. »Immer mit der Ruhe.« Sanft rollte das R – ein R wie geschaffen für ein Wort wie ›Ruhe‹. Vervielfältigte man dieses R zu einer Endlosschleife, klänge es wie das Schnurren eines Katers.
Er ließ die Rechte wieder sinken. Sein Arm war schimmelweiß. Wo andere den Trizeps, hatte er eine Art Flechte. Genauer betrachtet, eine Tätowierung. Fünfzehn war er, als sie ihm aufgrund einer verlorenen Wette in einem Kellerlokal an der Reeperbahn zugefügt worden war – von einem schwammigen, besoffenen Zwergalbino. Bis heute erschien er in seinen Träumen. Das Motiv vermochte man nur von relativ nahem zu identifizieren: ein männchenmachender Pudel. Farbton: auf der Skala zwischen Schweinsohrstempel und Bluterguß.
Bis an den Tisch jonglierte er den Ball. »Los!« blaffte, nicht locker lassend, der schöne Raimund. »Null zwo! Letzter Satz!«
»Was?«
»Letzter Sahatz!!«
Neckisch. Ulli müßte natürlich auch den kommenden Satz erst mal gewinnen, damit feststünde, daß es der letzte gewesen war. (Sonst hieße es zwo eins. Mit der Gefahr des zwo zwo und, tja, eben auch zwo drei.)
Und so drehte er sich einmal zur Bank, unser alter Sportsfreund Onno ›Noppe‹ Viets, machte »Öff, öff!« und grinste sein gutmütiges, gütiges, ja gutes Grinsen, das er seit jeher zu grinsen pflegte – unverbrüchlich; auch und gerade, wenn weißgott wieder einmal etwas dahinschwand, das wenigstens halbwegs begrinsenswert gewesen wäre.
[2]
Ungefähr Viertel vor neun. Après-Pingpong im Tre tigli.
Kaum daß wir unseren Stammtisch mit Beschlag belegt hatten, präsentierte Onno uns sein Husarenstück. »So, Sportsfreunde. Achtung, Achtung. Ich glaub’, ich werd’ Privatdetektiv. Öff, öff.«
Hatte sich was mit öff, öff. War bitterer Ernst. Und besonders bedenklich, daß sein Gespür für Timing versagte.
Normalerweise garantierten unsere entschlackten Leiber für diese Phase des Montagabends eine Stimmungslage, die Raimund einmal mit »besenrein« umschrieben hatte. Solide geistige Dumpf- sowie Maulfaulheit. Was dringend zu sagen war, hatten wir an der Platte gesagt – Kabaanaaa! –, und bis das erste Bier auf dem Tisch stünde, waren nichts als Seufzer der Zufriedenheit gelitten. Allenfalls noch ein, zwei selbstironische Grunzer der Überforderung durch den Fußmarsch.
Immerhin dauerte er drei Minuten; zwo Minuten zuviel, nach einer zwostündigen Beanspruchung von summa summarum zwohundert Jahre alten Knochen. Auch wenn es ein Weg war, der uns bestärkte in unserer Alters-Schwäche für heimelige Bürgerlichkeit bzw. bürgerliche Heimeligkeit. Im harschen Laub, das unter den Koniferen und winterharten Stauden entlang dem Schulgebäude weste, scharrten Amseln wie die Hühner auf dem Lande. Gegenüber wedelten Eichen mit ihren knotigen, gerupften Flederwischen über den Firsten der vierstöckigen Jugendstilhäuser. Mit dem aufgesogenen Restlicht des Tages leuchteten deren Fassaden in der Dämmerung, während die Falten der Portikusornamente und Pflanzenkapitelle sich bereits verschatteten. Roßkastanien und Birken, denen man seit Tagen beim Ergrünen förmlich zuschauen konnte, kitzelten mit ihrem Junglaub die schwarzen Gerippe noch splitternackter Kirschespen. Zu beiden Seiten der kopfsteingepflasterten Einbahnstraße bissen die Schnauzen von Panda und Jaguar schräg in die steilen Kantsteine der Trottoirs, diese wie jene mit Samenspreu von Besenahornen bestreut.
Genau gegenüber der Einmündung in die Heino-Jaeger-Straße steckte, gemütlich im Souterrain zwischen zwei Hochparterre-Treppen der benachbarten Bürgerhäuser, das Tre tigli. Am heutigen 19.April hätte man bereits – lauschig beleuchtet von schmiedeeisernen Laternen – unter den Laubschirmen jener Linden sitzen können, die dem Lokal den Namen verliehen. (Übrigens gab es nur zwei Exemplare; da Platz für ein drittes kaum je vorhanden gewesen sein dürfte, verdankte sich die Aufrundung mutmaßlich poetischen Erwägungen.) Aus mangelnder Geschäftigkeit war das Gartenmobiliar jedoch noch eingekellert, und die Bodenplatten klebten vom Knospensaft. (Wie der Schwarze Engel Monate später, eine in diesem Jahr erstmals aufgetretene Abnormität, die den Biologen Rätsel aufgab.) Wir stiegen die drei Stufen hinab und traten ein.
Der Kommandostand der Theke verwaist, und die paar Tischchen wie meist übersichtlich besetzt. Wie üblich dominierte ein Aroma, als sei am Vorabend ein Barriquefaß geplatzt. Eng und verqualmt der hiesige Gastraum, der Raucherraum; der Nichtraucher im Hinterzimmer geräumiger. Doch wer ging schon ins Hinterzimmer, wo Carina nur auf Abruf auftauchte?
»Wo ist sie?« rüffelte Raimund einen anonymen Gott der Gewohnheit, während wir unsere Sporttaschen mit den schweißschweren Trikots und nassen Handtüchern in einer reservierten Ecke unterm Tresen stapelten.
Es antwortete aber Schnorf. »Hinten.« Und fügte dieses Katarrhgeräusch hinzu, auf das Raimund ihn getauft hatte.
Schnorf hieß in Wirklichkeit Steamy Little Buffalo. Ogellalah. Alter Fahrensmann, vor Jahren in Hamburg gestrandet. Wann immer wir den Raum betraten, hockte er in der äußersten Ecke der Theke, wo das Schankholz bereits recht abgeliebt war, trank Feuerwasser, rauchte Unkraut und büffelte vor sich hin. Eine Art Freude zeigte er nur beim Eintritt Onnos. Wie manch anderer Zeitgenosse hatte auch er einen Narren an dessen gütigem Lächeln gefressen. Onno verfügte über etwas, das wir im Freundeskreis ›Charisma für Arme‹ nannten.
Womöglich war es die Säumigkeit unserer Montagsfee, die die Unleidlichkeit in der Stimmung an unserem Tisch noch verschärfte, nachdem bereits Onno so ungeschlacht vorgeprescht war. Raimund jedenfalls erwiderte auf dessen Annonce seiner neuesten Geschäftsidee nichts weiter als ein Geräusch, auf das man einen vulgären Scherzartikel taufen konnte, und auch EP und mir fehlten noch der Saft und die Kraft und die Herrlichkeit, uns mit Onnos Flausen zu befassen, bevor auch nur der Schatten Carinas erahnbar war. Außer Onno, der sein liebliches Grinsen grinste (leicht angeranzt allerdings, weil Botschaft verstanden) und, einzig verbliebener Raucher aus unserem Klüngel, sich eine seiner dünnen Zigaretten drehte, blätterten wir grunzend in den laminierten Speisekarten, die wir uns vom Beistelltisch geschnappt hatten. Nur, um uns abzulenken.
Denn die Küche des Tre tigli war widerlich bis mittelmäßig, je nachdem. Je nach wem, das hatten wir ebenso wenig je herausgefunden wie einen angeblichen Inh. Luigi Campone.
Niemand wußte, ob der noch lebte oder tatsächlich, wie Schnorf schwor, längst den Freitod gewählt hatte. »Wenn Selbstmord, dann«, wie ein wiederum anderer Urgast eines Abends behauptet hatte, »aus niederen Motiven! … Luigi? Luigi war ein Vollblutarschloch.« In den achtziger, neunziger Jahren sei er höchst angesagt gewesen – ungeachtet seiner Wucherpreise, ungeachtet seiner Kinderstube. Ständig lausig gelaunt, behandelte er die illustren Gäste wie Asylanten, und die interpretierten es als authentisch bukolisch. Al dente, al dente. Meine Swanse ieße al dente. Huch! Nein, dieser Luigi! Die Gattin eines Fernsehansagers a.D. hatte er mal – am Samstagabend, vor vollbesetztem Haus – als Schlampe eingestuft. Monatelang habe sie davon geschwärmt.
Endlich erschien Carina auf der Bildfläche, von Kopf bis Fuß in Charme gebadet, und wir wußten wieder, weshalb wir immer wiederkehrten.
»Prachtkind! Wo bleibst du denn!« wimmerte Raimund und hangelte irgendwie kopfüber nach ihrer Hand oder so.
»Na, ihr Sugardaddys?« Sie tätschelte ihm von hinten die Schultern. Lächelte uns über seinen nach wie vor vollgültigen Scheitel hinweg an. Gegen sie war Schneewittchen eine Kuh. Wir wärmten uns an unserem eigenen Augenlicht.
Bis auf Raimund. »Schuggaddd–?« Schnappte nach Luft.
Raimund war wirklich ein schöner Mann mit dichtem dunkelblondem, noch ungefärbtem Burschenhaar, immer noch ausdrucksvollen grauen Augen, nur leicht outriertem Kinn etc., und er hatte es stets waidgerecht eingesetzt. Jahrzehntelang. Erst neun Jahre zuvor hatte er sich entschlossen, Vater eines Stammhalters zu werden, und acht Jahre zuvor die Kindsmutter geheiratet. Liese. Vier Jahre später war auch noch Töchterchen Paula hinzugekommen, in die der Mann derart verschossen war, daß er manchmal von der Arbeit aus zu Haus anrief, um sich ihrer zu versichern. Nichtsdestoweniger, auf freier Wildbahn ließ er sich nach wie vor ungern als Daddy bezeichnen, schon gar nicht als Sugardaddy. »Klingt so nach Altersdiabetes.«
Nachdem die erste Runde Pils angerollt war, hellte die Atmosphäre an unserem Tisch schon mal ein wenig auf. Jeder von uns hatte seinen eigenen Grund, weshalb er die Stimmung mit einem Schuß Mißliebigkeit trübte. Raimund, weil er als Onnos ältester Freund von Onnos jüngstem Berufsplan verstimmt war. Onno, weil er als Raimunds ältester Freund von Raimunds Verstimmung verstimmt war. Ich, weil es mir als Raimunds und Onnos zweitältestem Freund oblag, die Verstimmungen zu beheben.
Doch ich opferte mich – bevor sie aufs neue würden aneinandergeraten können, der schöne Raimund und der unschöne Onno. Und zwar, indem ich mit all der Tücke des geborenen Anwalts die Ursache zur Mißstimmung des Vierten im Bunde aufrührte. Aus heiterem Himmel pinkelte ich ihm ans Bein: Ich, Christopher Dannewitz, nehme »dir, Ulli EP Vredemann«, der die historische Chance, die indolente chinesische Unschlagbarkeit von Celluloidtitan Onno Noppe Viets, unter der wir, die wir bekanntlich nichts als unwürdige Nichtvietse seien, seit Jahren litten, zu durchbrechen, ja zu brechen, um womöglich eine pingpongpolitische Neuordnung, Silberstreifen am Horizont und bla bla, »einzuleiten, verpaßt hast, krumm«.
»Einzuleiten. Verpaßt hast. Krumm«, äffte Ulli kühl. »Winkeladvokat.«
Denn natürlich hatte er die Partie noch verloren. Zwo zu drei.
Es war so:
In unserer Jugend hatten wir alle vereinsmäßig Tischtennis gespielt (bis auf Onno). Dieses unser aktuelles montägliches Training aber – wir pflegten von Training zu sprechen, als hätten wir je einen Ernstfall zu erwarten – hatte erst fünf Jahre zuvor begonnen, peu à peu zum »Höhepunkt der Woche« aufzurücken, wie Raimund in einem schwachen Moment gestand (womit er für uns alle sprach).
Aufgrund einer Schnapsidee hatten er und ich unsere Mitgliedschaft im Betriebssportverein Hollerbeck Eppendorf erneuert (ehem. Fabrik für Kupferfittinge). Zuletzt hatten wir dort zwanzig Jahre vorher Volleyball gespielt. Nun wollten wir, dazu taugten die Kniegelenke noch mit Ach und Krach, die Tischtennissparte wiederbeleben. Deren einziger williger Hinterbliebener Ulli Vredemann lautete. Deshalb redeten wir Onno ein, Bewegung tue auch ihm gut. Als wären wir uns nicht sicher, daß ein Onno Viets sich auch beim Sport wie seit jeher bewegen würde: ergonomisch. Ergo wenig.
Zugegeben, offiziell hatten wir Onno als fehlenden Doppelpartner rekrutiert, insgeheim aber als Sparringssack. Nichts gegen allseits gleiche Spielstärke. Doch für die Psychohygiene der Mehrheit, also für eine harmonische Gruppendynamik, leistete kaum etwas bessere Dienste als ein stabiles Opfer. Keine Pfeife, wohlgemerkt. Mithalten sollte es schon. Nur verlieren.
Woran Onno sich dann selten hielt. Das war nicht vorherzusehen gewesen.
Zumal er einen Stil spielte, der mit dem Attribut ›unorthodox‹ nur allzu arg verniedlicht wäre. Raimund nannte ihn »sittenwidrig«. Das traf es exakt. Nicht nur, daß Onno darauf bestand, statt in Sportschuhen auf diesen Noppensocken zu spielen. (»Warum?! Warum?!!« tobte der schöne Raimund. »Warum nicht, nech«, sprach Häuptling Rollendes R.) Sondern darüber hinaus verfügte er über null Vorhand, aber Rückhand konnte man »das« (Raimund) auch nicht nennen. In Anlehnung an den fernöstlichen ›Penholder‹-Griff prägte wiederum Raimund die genauestmögliche Bezeichnung »Zenholder«. Onno vermochte damit sogar zu schmettern, indem er den Ellbogen hochriß wie ein abschmierender Flugsaurier. Jeder andere würde sich die Schulter auskugeln. Und das alles auch noch mit links! »Paralympisch ohne Not.« (Raimund)
Onnos Kraftaufwand an der Tischtennisplatte lag also unwesentlich höher als an der Würstchenbude. Flips und Schüsse spielte er nur gelegentlich, doch wenn, dann so sicher wie alle anderen Schläge. Meistens blockte er einfach alles weg, was scharf genug daherkam, und was nicht, das schupfte er. Spielten wir nicht scharf genug, schupfte er uns unser Spiel kaputt. Er schupfte uns zur Weißglut, aber wenn wir entnervt wieder anziehen wollten, blockte er kompromißlos. Er spielte weder definitiv defensiv noch offensiv, er erzwang Fehler oder wartete sie mit der Seelenruhe einer Leiche ab. Es war, wie einmal mehr Raimund es mit der Führungskräften eigenen Präzision ausdrückte, »zum Kotzen«. Nie wurde man das bittere Gefühl los, »sich selber in die Scheiße zu reiten«.
Anfangs dachten wir noch, es liege an Onnos Schläger. Es handelte sich um einen, den Onno von irgendeinem Lehrgang beim Barras anno 1976 hatte mitgehen lassen. Klang mittlerweile wie ein Kochlöffel, doch hatte der Belag Außennoppen (daher Onnos Spitzname, gar nicht mal wegen der Socken). Außennoppen waren nach §11 verpönt. Außennoppenbelag verleiht dem Ball nicht erst durch raffinierten Ober- oder Unterschnitt konkurrenzfähiges Flugverhalten, sondern schon allein durchs Material. Onno hielt den Schläger einfach hin, und das Noppenprofil katapultierte den Ball zurück, der dabei flatterte wie ein Dum-Dum-Geschoß; es kehrte seinen Schnitt um und machte ihn schwer berechenbar.
Da kam Onnos Fuffzigster gerade recht. Kurzerhand schenkten wir ihm einen hochwertigen Schläger aus Balsaholz. Mit erstklassigen Belägen. (Wir hatten kurz erwogen, nur die Rückhandseite … aber das erschien uns dann doch zu vorwitzig.) Außerdem entsprachen sie Onnos Blockstil durchaus. Nur verfügten sie über Innennoppe wie unsere auch, verdammt noch mal.
Tja. Drei, vier Montage Eingewöhnung, und Onno wurde noch stärker. Seither galt er als unschlagbar.
Daß er seine Statistenaufgabe partout nicht erfüllte, war für uns natürlich betrüblich. Lag darin der tiefere Grund, daß wir seine fünfundneunzigprozentige Siegquote im Einzelkampf auf Dauer einfach ignorierten? Es beißt die Maus keinen Faden ab: Für drei Viertel unseres Vereins spielte Onno insgeheim außer Konkurrenz. Die stillschweigende kollektive moralische Umwertung verlief auch individualpsychologisch reibungslos, denn Onnos Erfolge trotz seines ästhetisch verheerenden Spielstils anzuerkennen widersprach jedem einzelnen unserer Selbstbilder. Gut, es gewann, wer Punkte machte. Aber hatte, wer seinen Florettgegner mit der Fliegenpatsche zum Wahnsinn trieb, Respekt verdient?
Immerhin hatte Onno stets den Anstand besessen, seine Rekorde nicht weiter zu thematisieren. (Wenn er den jeweils jüngsten Triumph einfuhr, beklatschte er fair die Leistung des Gegners. Was für unseren Geschmack allmählich zwar einen Hautgout von Überheblichkeit annahm.)
In Anbetracht all dessen kam es natürlich einem Stich ins Wespennest gleich, als ich die historische, wettkampfmäßige Wahrheit des BSV Hollerbeck Eppendorf ungeschminkt aussprach. Während wir mausetote Spaghetti reingabelten und ein zweites Pils tranken, debattierten wir bei mnemotechnischer Rekonstruktion und Analyse der spektakulären fünf Sätze aufs lebhafteste – was nach einer Stunde zur erwünschten Befriedung des Abends führte:
Ulli genoß die verdiente Rehabilitation als erster Spieler seit langem, der immerhin einen zeitweiligen Zwei-null-Stand gegen Onno vorweisen konnte. Raimund genoß den Umstand, daß er aufgrund der obligatorischen Eins-drei-Niederlage gegen Onno keine historische Chance verpatzt hatte. Onno genoß, daß die Ungeschicktheit seines erwerbsbiographischen Vorstoßes vergessen gemacht war, und ich, daß mein Kalkül aufging. Die Stimmung war stabil.
»Also, nun noch mal«, stöhnte der schöne, geplagte Raimund schließlich, indem er auf Onnos Bierdeckel starrte. »Ist das dein Ernst, Knatterton?«
[3]
Privatdetektiv, öff, öff.
Detektiv!…
Natürlich hatte Raimund recht: Einem Dreikäsehoch ließe man so was durchgehen, aber einem dreiundfünfzigjährigen Greis? Der in seinem Leben zudem bereits mit zahllosen Ausbildungen, Studiengängen und Erwerbstätigkeiten gescheitert war, sowie zweimal Konkurs gegangen? Und jedes einzelne Mal hatte er Raimund nach seiner Meinung gefragt – und sie jedes einzelne Mal ignoriert.
So gehörte es zu den onnomanischen Eigenschaften, wenn er seine durchaus vorhandene Sensibilität ausgerechnet dem ältesten Freund gegenüber vernachlässigte, ja bei dessen verständlichem Ingrimm auch noch einschnappte. (Wobei man bei einem Viets von vernehmlichem Einschnappen nicht sprechen konnte. Annähernd ausgedrückt, handelte es sich um das Gegenteil von Nichteingeschnapptheit.) Außerdem war ungeschriebenes Gesetz, daß wir im Vierermodus – d.h. in Anwesenheit Ullis – nicht mit allzu privatem Quark auftrumpften.
Doch inzwischen war die Stimmung, wie gesagt, stabil. Onno grinste. Kurbelte braunäugig an einer seiner stiftdünnen Zigarettchen. Machte aber nicht mal mehr öff, öff, und wenn Raimund noch einen Funken Hoffnung gehegt hatte, so erlosch der mithin. Er lehnte sich zurück, und das Knarren des labilen Drei-Linden-Möbels durchkreuzte sein Seufzen. Er tastete Brust und Bauch ab. »Ich krieg’ nicht mal mehr Sodbrennen. Ich muß gefühlstot sein«, unkte er. »Oder tot.«
Onno, der nicht den Sarkasmus, sondern nur ›Sodbrennen‹ mitgekriegt hatte, hielt die Hand an die linke Kopfseite. »Was?«
»Du brauchst deine Ohren wohl auch bloß noch, um die Lesebrille zu befestigen!« rief Raimund. Dessen eigene zunehmende Harthörigkeit nicht ins schöne Selbstbild paßte. Und deshalb als nicht existent galt. »Ich sagte, ich muß gefühlstot sein! Oder tot!«
Mit niedergeschlagenen Schlupflidern grinste Onno und verzichtete auf einen Gegenschlag. Grinsend beleckte er das Blättchen. Wer ihn nicht schon so lange kannte wie Raimund und ich, mochte derlei Querschädeligkeit mit Verlegenheit verwechseln. EP verfolgte das kleine Duell mit unverhohlenem Glucksen.
»Nein, nein – keine Bange«, beruhigte ich Raimund unterdessen und improvisierte einen kleinen pseudopathologischen Vortrag, in dem unter anderem vorkam, daß man im Todesfall oft noch eine letzte Erektion bekomme. »Oder hast du grad eine?«
Geistesabwesend war er nämlich dabei, mit zwei Fingern jene Venus zu tätscheln, die unter einem staubigen Pfennigbaum auf der Fensterbank ihren Gipspo exhibierte.
EP lachte meckernd. Onno keckerte.
»Ja, du sei bloß ruhig«, kläffte Raimund. »Du –«
»Psst«, machte ich. Sonst erschrecke unser Carinamäuschen, und Schnorf schaue auch bereits, als schleudere er gleich den Tomahawk.
Gedrosselt, doch um so druckvoller fuhr Raimund fort. Indem er mit der gesamten Ausdehnung seines rechten Arms längs über den Tisch, zwischen Tellern und Gläsern hindurch, die Distanz überbrückte, wandte er sich an EP. »Hast du«, fragte er ihn mittels Fingerzeig, »schon mal Noppes Sporttasche angehoben? Nach dem Training, mein’ ich? Wie leicht die ist?«
»Nein?«
»Dann mach das mal. Die ist so leicht …«
»… die schwimmt sogar in Milch«, vervollständigte Onno, steckte das Stäbchen zwischen die Lippen und entzündete das fransige Ende. (Benutzte Zündhölzer, weil er dann angeblich weniger rauchte.) Er war Meister darin, Sprüche zu assoziieren. Werbesprüche, gegebenenfalls jahrzehntealte; Fernsehserienfigurensprüche von Al Mundy bis Al Bundy, Sprüche von toten oder halbtoten Verwandten – Hauptsache, sie paßten halbwegs. Um das beurteilen zu können, brauchte man aber oft ein gewisses Wissen. Zum Beispiel, daß die Lockerheit und Leichtigkeit eines Schokoriegels einst mit dem Slogan besungen wurde, der schwimme sogar in Milch.
»Die wiegt praktisch nichts, das glaubst du nicht«, fuhr Raimund ungerührt fort. »Vergleich die mal mit deiner eigenen.« Er zeigte mit der Linken in Richtung Tresen, falls EP vergessen haben sollte, wo er seine Tasche abgestellt hatte. »Und weißt du, woran das liegt?«
»Unterschied Noppensocken/Sportschuhe?«
»Auch. Vor allem aber, weil ein Viets nicht schwitzt. Ein Baron von und zu Viets, der vermeidet es bitte sehr gern, zu schwitzen, vielen herzlichen Dank auch.«
Da war was dran. Onno haßte es seit jeher, wenn ihm dieses Sauerkrautwasser aus den Haaren in die Augen rann. Über Hals und Nacken in den Kragen floß, ergänzt von Zuströmen aus den Achselquellen durch die Unterwäsche sickerte und, somit noch essigmäßig angereichert, bis in die Socken – so oder so ähnlich hatte er es mir mal erläutert. (Rein philosophisch war ihm nicht am Zeug zu flicken: Waren die alten Griechen auch fürs Schwitzen, die alten Chinesen dagegen!)
»Und diese Abneigung gegen Eigenschweiß«, fuhr Raimund fort, »findet man auch zwischen den Zeilen von Vietsens tabellarischem Lebenslauf.«
»Behaupten böse Zungen«, behauptete Onno. »Eigentlich nur Raimunds, nech.«
Denn Onnos Laufbahn war so voller Stolpersteine, Schlaglöcher und Erdrutsche nicht wegen Faulheit. Nicht, daß er nicht faul wäre. Onno war faul. Verglichen mit Onno war Aas emsig. Doch war das nicht die Ursache für seine illustre Erwerbsbiographie. Er kämpfte ja stets gegen seine Trägheit an. Ausdauernd war er. Ausdauer hatte er wie eine Frau.
Nein, begraben lag der Hund in dem sauren Grund, daß er einfach nichts so richtig konnte, unser Onno. Aber auch so gut wie gar nichts. Nun ja, ein paar Primzahlen, Kartoffeln schälen u.ä. Darüber hinaus verfügte er über drei unstrittige Eigenschaften, ja Fähigkeiten, die sog. »Superkräfte« (Raimund; s. weiter u.). Um seinen Lebensunterhalt verläßlich zu bestreiten, reichte jedoch nichts davon hin noch her. In einer Gesellschaft, die nach Leistung bezahlte, war er eigentlich ein Fall für die Organbank.
Nach wie vor Zeigefinger und Knöchel seiner ausgestreckten Rechten als Kimme und Korn nutzend, zielte Raimund Ullis breite Brust an und sagte: »Ich werde jetzt den Lebenslauf des Onno Viets vortragen, wie er der Hamburg-Eimsbütteler Agentur für Arbeit vorliegt, ergänzt um die ungeschönten Informationen. Silvester neunzehnhundertzappenduster: geboren in Hamburg-Wilhelmsburg …«
Onno kicherte. Kicherte in Anerkennung seines alten, ältesten Freundes, wenn nicht in Liebe.
Nichts gegen Menschen, die über sich selbst lachen können. Ganz im Gegenteil, das unterscheidet noch den Stoffel vom Stiesel. Doch grenzte es ans Verdächtige, ja Unheimliche, mit welcher Leidenschaft unser Onno sich darüber amüsierte, was für ein ausgemachter Esel und/oder Taugenichts er – nicht immer, doch mitunter – sein konnte. »Das glaubt ihr nicht«, zum Beispiel. »Heut morgen hat mich die Einfahrtsschranke vom Parkhaus bei ALMOS auf’n Kopp gehau’n. ’ch, ’ch, ’ch …« Und ähnliches.
»… neunzehnhunderteinundsechzig bis fünfundsechzig: Grundschule. Sechsundsechzig bis einundsiebzig: Realschule. Einundsiebzig bis zweiundsiebzig: Lehre zum Radio- und Fernsehtechniker. Abgebrochen. Zwei- bis dreiundsiebzig: Lehre zum Klempner und Installateur. Abgebrochen. Drei- bis vierundsiebzig: Lehre zum Bürokaufmann. Abgebrochen. Vierundsiebzig bis siebenundsiebzig: Zeitsoldat. Unehrenhaft entlassen. Achtund–«
»Das ’ne dreckige Lüge, du Rotarsch!« Onno grinste.
»– siebzig bis … zweiundachtzig? Dreiundachtzig? Pächter der Gaststätte ›Plemplem‹. Konkurs. Dreiundachtzig bis … mach du mal weiter, Stoffel, mir wird’s jetzt zu unübersichtlich.« Eh ein Wunder, daß Raimund soweit gekommen war. Im Gegensatz zum Problem der Harthörigkeit konkurrierte er mit Onno erstaunlicherweise gern darum, wer mit den breiteren Erinnerungslücken, den schlimmeren Problemen bei Wort- und Namensfindung zu kämpfen hatte. »Neulich fiel mir nicht mal mehr Carina ein!«
Versicherungsvertreter, parallel immerhin Abitur auf dem zweiten Bildungsweg. Studium der Sozialpädagogik. Abgebrochen. Der Soziologie. Abgebrochen. Diverse Jobs per Zeitarbeit, sowohl kaufmännisch als auch gewerblich; parallel diverse Projekte (kaufmännisch, gewerblich, ja künstlerisch: alle abgebrochen). Pächter eines Ladenkiosks für Tabakwaren mit Lotto-/Toto-Annahme. Konkurs. Arbeitslos. Freiberuflicher Journalist. Abgebrochen. Seit zwei Jahren arbeitslos.
EP kannte lediglich die letzte Phase. Beim Après-TT war das bislang kein Thema gewesen. »Kein Job zu kriegen? Taxifahrer?« schlug er vor. »Pizzabote? Apothekengehilfe, dringende Arzneimittel und so?«
Raimund knarzte hämisch. »Der könnte doch ums Verrecken nicht die kürzeste Verbindung zwischen zwei Stadtplankoordinaten imaginieren. Wenn nicht hin und wieder Edda neben ihm säße, würde er nach jeder Stadtfahrt in Bremen oder Flensburg landen statt in Hoheluft-West.«
»Maler? Tapezierer?«
»Nee. Nich«, sagte Onno. »Allergie. Bei bestimmten Farbstoffen nies’ ich mir die Polypen aus’m Zinken, nech.«
»Imbißkraft?«
Onno schwieg opak. Raimund nicht, doch noch opaker: »Hat ’ne Phobie gegen Hühnerköpfe.«
»Aber im Imbiß«, sagte Ulli nach einer Pause, in der sein Entschluß gereift war, derlei bizarren Unfug als bizarren Unfug aufzufassen, »sind die doch meistens schon ab.«
Ich kicherte über das ›meistens‹.
»Im Ernst«, sagte Raimund. »Themawechsel. Sonst kotzt der hier gleich auf’n Tisch.«
Ulli gab nicht auf. »Fahrradkurier?«
Jetzt prustete Onno noch vor Raimund los. Ich sprang ein. »Dazu müßte man fahrradfahren können.«
Ullis Stirne knüllte sich. »Du kannst nicht fahrradfahren? Ich meine, du kannst … nicht fahrradfahren? Mein Neffe ist drei. Der kann fahrradfahren. Meine Oma ist vierundachtzig. Die kann fahrradfahren. Ich kenn’ Leute, die sind total bescheuert und können fahrradfahren.«
»Bin damals gleich vom Tretroller auf Mofa umgestiegen«, sagte Onno. »Und bevor du mir mit Bademeister kommst – schwimmen kann ich auch nicht, nech. Hab nicht mal Seepferdchen. ’ch, ’ch, ’ch …« Er kicherte sich in einen Hustenanfall hinein.
Jetzt gab Ulli auf. Kein Wunder. Selbst Onnos Arbeitsberater bekam beim Anblick von Onnos Dackelfalten Dackelfalten.
»Gut, er hat noch nicht alles durch«, sagte Raimund. »Aber die Aufsichtsräte der gängigsten Konzerne sind ja leider derzeit besetzt. Öff, öff.«
[4]
Kurzum: Im heutigen Frühstücksfernsehen auf dem Kanal von Agora TV hatte Onno einen Beitrag verfolgt, den ich später als Videostream im Internet nachgeschaut hatte. Da steht unser beliebtes Gretchen Ngoro in der schwarz-rot-goldigen Studiokulisse von Good Morning, Germany! und sagt mit einer Geste, die einladend sein soll, doch wegwerfend wirkt:
»Ja, liebe Zuschauer, Dinge aufzuspüren, Leuten auf der Lauer zu liegen, und das alles ganz verdeckt, das alles ist natürlich eine ganz spannende Sache, es geht um den Beruf des Detektivs.«
Sapperlot. Es trillert der Auftakt zur Titelmelodie von Mission: Impossible. Im Bild das Doppelobjektiv eines Feldstechers, gefilmt im Außenspiegel eines Pkw. Aus dem Off tönt einer jener Gießkannentenöre, wie sie vorwiegend bei den Privatsendern getrimmt werden:
»Beobachten, ermitteln, verfolgen – anders als im Fernsehen hat der Beruf des Detektivs wenig mit Action zu tun.«
Anders als im Fernsehen, öff, öff. Und warum wählen sie für einen Fernsehbericht über den Beruf des Detektivs die Musik aus einem Action-Film, wenn der Beruf des Detektivs wenig mit Action zu tun hat? Ironie? Möglich. Denn auf dem Bildschirm erscheint nun ein Philister. Sakko, Schlips, grauer Schnauzer.
»Manfred Sievers ist Detektiv aus Leidenschaft.«
Leidenschaft. Der.
»Zuverlässigkeit – für ihn die Grundvoraussetzung.«
Und O-Ton Sakko Sievers, verschnarcht wie ein Ai:
»Natürlich auch Geduldigsein. Bei der Arbeit sitzt man natürlich stundenlang im Auto, und es darf einem nicht langweilig werden, ja? Und äh, Ausdauer, Durchhaltevermögen natürlich … Das sind alles Sachen, die ein Detektiv natürlich haben sollte.«
Natürlich. Nun wieder Gießkanne:
»Eine solide Ausbildung garantieren Fachkurse. Teilnehmer kommen aus allen Berufssparten.«
Zum Beweis stottert ein Zeitsoldat eine Hymne auf sein Ausbildungsinstitut. Leiter – trau, schau, wem –: Sakko Sievers. Kanne:
»Hier wird der wißbegierige Schüler vom Meisterdetektiv in die hohe Kunst des Ermittelns und Observierens eingeweiht. Unverzichtbare Arbeitsinstrumente: Fernglas und Fotoapparat.«
Ganz wichtig: unauffällig sein. Detektive kommen zum Einsatz, wenn zum Beispiel eine Ehefrau glaubt, ihr Mann betrüge sie. (Gelegenheit, Strapsmaus einzublenden.) Oder wenn eine Firma herausfinden will, ob ein Mitarbeiter regelmäßig blau macht. (Gelegenheit, Florida-Rolf einzublenden. Mit Strapsmaus.) Und übrigens, die Detektivausbildung bedeutet für viele eine neue Chance. Arbeitslose Detektive kennt Sakko Sievers nämlich nicht. Sakko wörtlich:
»Arbeitslose Detektive kenne ich nicht.«
Und zum Abschluß liest er, an der Kamera vorbeischielend, leiernd irgendwo ab wie folgt:
»Durch das mangelnde Unrechtsbewußtsein und den Verfall der Moralvorstellungen wird der bundesweite Umsatz in den nächsten Jahren wohl um rund zwanzig Prozent steigen.«
Wohl. Rund. Na.
Schleichwerbung für das Detektivinstitut Sakko Schnauzer Sievers, nichts anderes. Und doch, wie auch immer …
Innerhalb unseres traditionellen Trios trug, wie bereits angedeutet, meist ich die Robe des Salomo. (Ob sie mir nun paßte oder nicht; Onno und Raimund hatten es ja auch nicht leicht in ihren Wahlzwillingszwangsjacken.) Und ohne die kurze Dokumentation zu dem Zeitpunkt schon gesehen zu haben – an jenem Montagabend hatte ich das geradezu plastische Gefühl, seinen Tatendrang auf keinen Fall bremsen zu dürfen.
»Ja, find’ ich gut«, sagte ich also, nachdem Onno referiert hatte, was Fernsehbericht und Internetrecherchen zutage gefördert hatten. »Versuch’s doch einfach mal.«
Baff, matt, blieb Raimund für diesmal stumm. Selbst ein meinungsstarker Citoyen wie er mochte den mühsam geretteten Après-Pingpong-Frieden so kurz vor Feierabend nicht mehr gefährden. Onno richtete seinen Haselnußblick auf mich, um den Sarkasmusgehalt meiner Aussage zu prüfen.
»Nee, im Ernst«, improvisierte ich weiter. Und daß ich ihm Kontakt vermitteln könne. Meine Kanzlei nehme ja regelmäßig die Dienste von Detekteien in Anspruch. (Was eine Halbwahrheit war – ›unregelmäßig‹ wäre die ganze Wahrheit gewesen.) Zur Beweisführung wählte ich einen uralten Fall, bei dem ich einen dealenden Studenten vorm Knast bewahrt hatte, indem ich einen Belastungszeugen aus dem Milieu beobachten ließ, um dessen Glaubwürdigkeit zu unterminieren.
Die Sportsfreunde waren beeindruckt (Ulli), müde (Raimund), enthusiastisch (Onno; sofern ein Halbostfriese enthusiastisch sein kann). Und skeptisch bezüglich der eigenen Courage (ich).
Ich dachte mir das so: