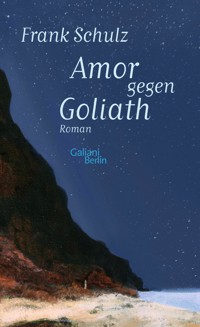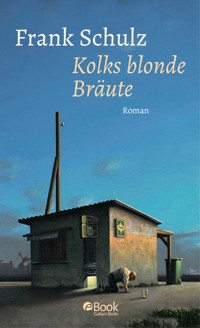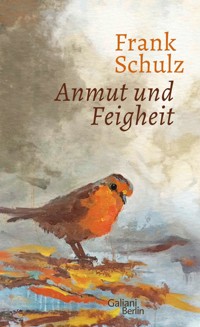
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Liebe ist nichts für Feiglinge – Frank Schulz blickt in seinen Erzählungen hinauf zu Wolke 7 und hinab in die Abgründe der Seele Buch des Monats August 2018 bei NDR Kultur Die Liebe, sie trifft uns alle, und meist ist sie kein Zuckerschlecken, vor allem dann nicht, wenn die Jahre vergehen. Frank Schulz folgt seinen Protagonisten wie ein Privatdetektiv, er nimmt ihre Seelen unter die Lupe – aber er erschrickt nie über das, was er findet. Schulz, der Chronist des ganz alltäglichen Lebens und all seiner Untiefen, fängt den Klang von gesprochener Sprache ein wie niemand sonst. Ein Juniorsenior (gerade 60) liefert sich per SMS ein Verbal-Pingpong mit seiner jungen Freundin, das so gleichberechtigt fies ist, dass man ganz verzaubert ist: das muss dann doch wohl Liebe sein! Ein Mann und eine Frau schreiben sich Briefe, die der jeweils andere immer erst zwanzig Jahre später öffnen darf. Und überhaupt: Älterwerden ist durchaus keine friedliche Angelegenheit. Wenn die Augen und das Gedächtnis zum Beispiel gerade genug nachgelassen haben, dass man sich, wie die Unternehmerwitwe im Spreewaldresort, nicht mehr sicher ist, ob der Gatte beim Wandern in die Schlucht gestürzt ist – oder ob man selbst ihn ein bisschen geschubst hat. Frank Schulz, das wird in diesem Erzählband einmal mehr klar, kennt sich aus mit den Schwachheiten der Verliebtheit, den Feigheiten des Egos, mit den brutalen Auswüchsen von Einsamkeit, mit den herzzerreißenden Momenten der Wahrheit. "Schulz ist ein Meister der Milieubeschreibung." Die Zeit
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Frank Schulz
Anmut und Feigheit
Ein Prosa-Album über Leidenschaften
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Frank Schulz
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Frank Schulz
Frank Schulz, Jahrgang 1957, wurde für seine Romane vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Hubert-Fichte-Preis (2004), dem Irmgard-Heilmann-Preis (2006) und dem Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor (2015). 2012 erschien Onno Viets und der Irre vom Kiez, 2015 Onno Viets und das Schiff der baumelnden Seelen, 2016 Onno Viets und der weiße Hirsch.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Die Liebe, sie trifft uns alle, und meist ist sie kein Zuckerschlecken, vor allem dann nicht, wenn die Jahre vergehen. Frank Schulz folgt seinen Protagonisten wie ein Privatdetektiv, er nimmt ihre Seelen unter die Lupe – aber er erschrickt nie über das, was er findet. Schulz, der Chronist des ganz alltäglichen Lebens und all seiner Untiefen, fängt den Klang von gesprochener Sprache ein wie niemand sonst.
Ein Juniorsenior (gerade 60) liefert sich per SMS ein Verbal-Pingpong mit seiner jungen Freundin, das so gleichberechtigt fies ist, dass man ganz verzaubert ist: das muss dann doch wohl Liebe sein! Ein Mann und eine Frau schreiben sich Briefe, die der jeweils andere immer erst zwanzig Jahre später öffnen darf. Und überhaupt: Älterwerden ist durchaus keine friedliche Angelegenheit. Wenn die Augen und das Gedächtnis zum Beispiel gerade genug nachgelassen haben, dass man sich, wie die Unternehmerwitwe im Spreewaldresort, nicht mehr sicher ist, ob der Gatte beim Wandern in die Schlucht gestürzt ist – oder ob man selbst ihn ein bisschen geschubst hat.
Frank Schulz, das wird in diesem Erzählband einmal mehr klar, kennt sich aus mit den Schwachheiten der Verliebtheit, den Feigheiten des Egos, mit den brutalen Auswüchsen von Einsamkeit, mit den herzzerreißenden Momenten der Wahrheit.
»Schulz ist ein Meister der Milieubeschreibung.« Die Zeit
Inhaltsverzeichnis
Hinweis zum Buch
Motto
Szenen in Beige
Rotkehlchen
I. Kapitel
II. Kapitel
Zwei Briefe in die Zukunft
Hüli mit Füll
Das Unheimchen
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
Die Verböserung der Welt
Der Ritter von der Rosskastanie
Threesome Cowboy
Flaschenpost für Ekke Nekkepen
Als sie noch ein Mädchen war
Der korfiotische Kuss
Punkrocksong
Nachts im Nichts
Geliebte mein im Schuhkarton
Frierende Frauen
Die Weiße Fee von Töwerland
Ballistische Augen
Auf dem Weg von San Salvador nach Chalatenango; 11. November 1989, morgens.
Auf dem Weg von Chalatenango nach San Antonio Los Ranchos; 11. November 1989, mittags.
In San Antonio Los Ranchos; 11. November 1989, nachmittags.
San Salvador; 11. November 1989, abends.
Es war einmal eine Königin
In Kanada läuft das Wasser bergauf
Drachen über der Alster
Der Sommer, in dem ich ein Zebra ritt
Heiligabend
Mamapapamamapapa
›Die Babies‹ bitten zum Tanz!
Der Kupferaschenbecher
Kalbsfell
Anmerkungen
Die Rechtschreibreform von 2006 spiegelt sich bewusst im Lauftext der Erzählungen wider: neue Rechtschreibung bis einschließlich »Nachts im Nichts«, alte Rechtschreibung ab »Geliebte mein im Schuhkarton«.
Es ist ein großer Unterschied, ob ich etwas weiß,
oder ob ich es liebe;
ob ich es verstehe, oder ob ich nach ihm strebe.
Petrarca
Man kann das Leben nur rückwärts verstehen;
leben muss man es aber vorwärts.
Kierkegaard
[2018]
Szenen in Beige
Hellgraue Hosen, und überm dicken mittelgrauen Pullover eine – ha! – beigefarbene Funktionsweste. Die Füße V-förmig gestellt, die Finger im Kreuz verschränkt, beugt der betagte Herr sich vor, bis der Schirmstutzen seiner dunkelgrauen Schiebermütze gegen das Schaufenster stößt. Dann bleckt er das Gebiss.
Vorbildlich, der alte Zausel, denkt Kortsch, während er sich nähert; Gebiss blecken beim Gucken: ungeschriebenes Greisengesetz. Die Weste: sicher kugelsicher, denkt er und lächelt, zugegeben: blasiert. Er wirft den Gedanken auf, ob er all die Einfälle in seinem iPhone notieren soll, verwirft ihn aber gleich wieder. Er hasst dessen Tastatur-Attrappe. Und diktieren, mitten auf dem Bürgersteig? So weit kommt’s noch. Außerdem fiele ihm jetzt so auf Anhieb kaum wieder ein, wie noch mal gleich die Diktier-Funktion funktioniert. Einfach hoffen, dass er sich alles merken kann, um es Köhler erzählen zu können.
Als er noch drei Schritte von dem alten Herrn entfernt ist, erhält Kortsch eine SMS. Der alte Herr fährt zusammen und starrt den herannahenden Kortsch an, und sofort grault sich der. Weil er vergessen hat, das iPhone leise zu stellen, als er aus dem Haus gegangen ist, und wegen des Geräuschs an sich. Zum x-ten Mal nimmt er sich vor, Yvonne zu fragen, wie er den Ton, mit dem eine Kurznachricht angekündigt wird, ändern kann. Ist der Pfiff einer (Miniatur-)Dampflok eines beamteten Kulturmenschen nicht überaus unwürdig? Und zudem schämt sich Kortsch insofern, als seinen gedanklichen Reflexen (Zausel, Greisengesetz, kugelsichere Weste) die Reflexion folgt. Unweigerlich. So schnell fliegt kein Bumerang.
Irgendwo hat Kortsch mal gelesen, dass man andere Menschen als alt empfindet, wenn sie mindestens fünfzehn Jahre älter sind als man selbst. Nicht zum ersten Mal wird ihm bewusst, wie viel peinliche Milde, seichte Überheb- und Selbstherrlichkeit aus dieser Haltung sprechen. Und wie viel Angst.
Nach wie vor im Fokus des alten Mannes, spitzt Kortsch die Lippen und hebt die linke seiner überzüchteten Brauen, indes er in seinen Mantel greift; dabei rollt er die Augen, sodass er mit ein und demselben Schwenk erstens selbstironische Technophobie signalisieren, zweitens direkten Blickkontakt vermeiden sowie drittens seine Lust zu rätseln befriedigen kann, welche der Waren in jenem Schaufenster wohl des Westenträgers Interesse geweckt haben mag: die rosafarbene Faszienrolle? Der Kompressionsstrumpf-Anzieher MediButler? Den Rollator zum Einführungspreis von € 259 braucht er ja ganz offensichtlich noch nicht. All das im Vorübergehen. Ha! Synapsen 1a geschmiert.
Den starrenden, zähnefletschenden Greis hinter sich lassend, gewahrt Kortsch allerdings, dass er nicht sein iPhone zu fassen bekommen hat, sondern vielmehr den Event-Rekorder, den Dr. Tanners MTA ihm vorhin um den Hals gehängt hat. Zufällig im selben Moment beginnt die Manschette um seinen linken Oberarm sich unterm Mantelärmel aufzublähen, begleitet von einem Surren. Automatische Blutdruck-Messung. So wird das jetzt alle zwanzig Minuten gehen, die nächsten vierundzwanzig Stunden lang. Kortsch lässt die Linke hängen, während er sein iPhone aus der Innentasche fischt und mit ein-, zweimal Daumentippen und -wischen befragt.
Die Nachricht lautet:
Ja, mach ich. Schalt die Autokorrektur wieder ein!!!
Als Absenderin steht da Betreuerin. So beliebt er Yvonne zu bezeichnen, seit sie zu ihm gezogen ist, Ende letzten Jahres, ein paar Wochen nach seinem leichten »Infarkt im Kleinhirnschenkel links«. Dreiundzwanzig Jahre jünger als er, Kortsch, ist sie. Auch trotz sechs Jahren glücklichen Zusammenseins vermag er nicht in wünschenswerter Tiefe zu begreifen, was zum Kuckuck sie an ihm zu finden meint. Er ist kein Hollywood-Star – und sieht auch nicht so aus –, sondern eben Beamter. Und sieht auch noch so aus. Und sie eine attraktive Mittdreißigerin mit Charme, Humor und Aussichten auf Habilitation. Irgendwas stimmt mit ihr nicht. Hoffentlich merkt sie’s nicht, solang er lebt.
Kortsch liest seine Kurznachricht nach, die Yvonne zu ihrer galligen Replik veranlasst hat.
Uch bring Brätchen mot. Denkst du an Kloüaüoer?
O. k.
O. k., auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. Nachdem die Blutdruck-Manschette wieder erschlafft ist, antwortet er auf Yvonnes Ansinnen, die automatische Korrekturfunktion wieder zu aktivieren:
Den Trugel werd uch tin!
Auf der Feier seines sechzigsten Geburtstags hatten er und Köhler sich mit Yvonne und ihrer Freundin Wiebke »krass gefetzt«, wie Wiebke sich ausdrückte. (Bis auf den heutigen Tag hat sich Kortsch nicht daran gewöhnen können, dass Yvonne und die Freundinnen und Freunde aus ihrer Alterskohorte an diesem albernen ›krass‹ – oder noch schlimmer: ›voll krass‹ – ihres Jugendjargons festhielten; und Yvonnes Nachweis, dass er und die Freundinnen und Freunde aus seiner Alterskohorte es mit ›geil‹, ›echt geil‹, ›echt ätzend‹ und so weiter keinen Deut anders hielten, half ihm auch nicht weiter.)
»Noch würdeloser«, so Köhler vom edlen Grappa befeuert, »als das eigenhändige Gescrabbel auf dieser Winztastatur ist es ja wohl, die Verantwortung für die Verstümmelung allfälliger Simse zu deligieren!«
»Deligieren?«
»Na ja, an die Autokorrektur eben. Oder an Schiri oder wie die heißt.«
Die Damen lächelten schief.
»Ist doch wahr!«, tönte Köhler. »Ihr tippt ›Heilerde‹ und nehmt billigend in Kauf, dass ›Heil Hitler‹ oder so was dabei rauskommt.«
»Quatsch«, ereiferte sich Wiebke; Yvonne aber lachte nur.
»O doch. Und überhaupt.« Kortsch beeilte sich, in dieselbe Kerbe zu hauen. »Abgesehen davon, dass diese kümmerliche Tastatur für normale männliche Wurstfinger völlig ungeeignet ist – die QWERTZ-Belegung ist allemal idiotisch.«
»Die was?«
»Na, die übliche Belegung der Tasten mit den üblichen Buchstaben.«
»Wieso denn das, wenn sie doch üblich ist?«
»Na ja, herrje, im Zehnfingerblindsystem erfüllt die ja ihren Sinn, aber doch nicht auf dieser … ätzenden Miniaturimitation einer Tastatur! Warum sind die angeblich so genialen Apple-Nerds denn nicht auf den Bolzen gekommen, die Lettern schlicht und einfach alphabetisch anzuordnen? Dann bräuchte man als Zehnfingersystemiker nicht ständig wie ein Idiot herumzusuchen.«
»Wieso denn das, wenn du’s doch angeblich blind –«
»Na, weil ›blind‹ eben nur haptisch funzt und beidhändig, und dafür ist diese idiotische Tastatur eben viel zu mickrig; davon rede ich doch die ganze –«
Und so weiter, und so fort. Als Höhepunkt der hitzigen Debatte hatte Köhler in Yvonnes iPhone hineingerufen: »Siri, wir wissen, wo dein Auto steht!« Und als leidenschaftlicher Fußball-Hasserin musste man Yvonne den Witz dann auch noch erklären, Siri gleich Schiri gleich Abkürzung für Schiedsrichter, und dass Schiedsrichter von den Fanchören gern mal daran erinnert werden, dass ihre Autoreifen angreifbar sind, insbesondere bei Fehlentscheidungen, und bei all den langwierigen Erläuterungen konnte man amüsierte Langmut vorspiegeln, dabei machte es geradezu Spaß, den bis in die Niederungen der Popkultur hinunter bewanderten Weltversteher zu geben, und so weiter und so fort. Ein prima Fest.
Es anzuzetteln, hatte Kortsch lange gezaudert. Zuvor hatte er beim Abendessen Yvonne gegenüber einen Versuchsballon steigen lassen. »Die Geburtstagsfeier findet in aller Stille statt.«
»Mein Beileid.«
»Was ein zünftiger Senior ist«, versetzte Kortsch, »der schätzt nun mal die Gemütlichkeit, ja Ruhe und Besinnlichkeit. Auf den Zapfen gehauen wird erst wieder zum Fünfundsechzigsten.«
»Ist das nicht einigermaßen widersinnig?«
»Wann, wenn nicht jetzt, soll es denn noch gelingen, dieses deprimierende Prinzip der Dezimierung zu überwinden?«
»Dezimierung. Witzig, witzig.«
»Ist doch wahr … O.k., den zehnten Geburtstag zu feiern leuchtet ja noch ein. Den zwanzigsten erst recht, zu schweigen vom dreißigsten. Den vierzigsten und fünfzigsten zu begehen aber war schon fragwürdig genug. Nix da! Der sechzigste fällt aus. Dixit senior in spe.«
Seit einem halben Jahr bereits hatte er die Rede vom Seniorentum strapaziert. Genauer: seitdem er aus dem Newsletter der Deutschen Bahn AG erfahren hatte, ›Personen ab sechzig Jahren‹ hätten für die BahnCard 50 Anspruch auf ›Seniorenrabatt‹.
Ein Schock. Empfanden Leute Leute als alt, die mindestens fünfzehn Jahre älter waren als sie selbst, so empfanden Leute wie Kortsch sich als locker fünfzehn Jahre jünger, als sie nun mal waren. Seniorenrabatt, Seniorenteller … furchtbar. Wie sang doch Stoppok seinerzeit so lustig: von der »harten Zeit zwischen Twen-Tours und Seniorenpass«? Die war dann ja wohl tatsächlich bald vorbei. Da half nur noch Selbstironie.
Und kurz darauf, vier Monate vorm Jubiläum, sollte er die bitterer nötig haben, als er je befürchtet hätte. Jene acht Oktobertage 2016 würde er zeit seines Lebensabends nicht vergessen: den Moment nachts um vier, als er verschwitzt aufwacht und beim Gang zur Toilette plötzlich von ›starker Fallneigung nach links‹ überwältigt wird, sodass er sich an Wänden und Türzargen entlanghangeln muss. Den Moment in der Notaufnahme, als die diensthabende Ärztin den Verdacht auf Schlaganfall äußert. Den Moment in der Stroke Unit, als dieser junge Arzt ihm eröffnet, er müsse erst wieder lernen, geradeaus zu laufen. (Bis dahin hatte er in seiner jugendlichen Gedankenlosigkeit gemeint, man würde ihm eine Spritze oder so was geben und fertig – ungeachtet der Tatsache, dass er es doch tausendfach anders gehört und gelesen und im Fernsehen gesehen hatte. Das Ego denkt halt nicht gerne nach, und das Gedächtnis ist nun mal egozentrisch.) Den Moment in den statistisch so wichtigen ersten dreiundsiebzig Stunden, da die Pflegerinnen und Pfleger jeweils ans Bett treten, seine Körperempfindungen testen und ihn bitten, den Wochentag zu nennen und den Bundespräsidenten und ›Die Katze tritt die Treppe krumm‹ nachzusprechen. Den Moment, als Yvonne mit feuchten Augen sagt, er sehe aus »wie ein defekter Terminator mit all den Kabeln, Steckdosen und Lüsterklemmen«. Den Moment, als er Yvonne aus jener Informationsbroschüre für Angehörige vorliest (»Sie können Ihr Mitgefühl bspw. durch Streicheln oder Halten der Hand ausdrücken. Keine Babysprache verwenden! Gut gemeinte Appelle wie ›Jetzt stell’ dich mal nicht so an!‹ haben einen negativen Effekt.«), und den Moment, als sie entgegnet, »jetzt stell dich mal nicht so an«, und er: »Und jetzt noch mal in Babysprache.«
Am fünften Tag wurde er entlassen, und am achten konnte er schon wieder auf eigene Faust den Gertrudenberg erklimmen. Nur bei raschen Drehungen wurde ihm noch ein paar Wochen lang schwindlig.
Und das ihm, der seit zehn Jahren nicht mehr raucht, maßvoll trinkt, maßvoll isst und regelmäßig joggt. Altwerden ist nichts für Feiglinge … Erst nach dieser schallenden Ohrfeige hatte er Bette Davis’ Bonmot wirklich kapiert. Die schwarze Pädagogik des Schicksals.
Eines Abends, kurz nachdem sie eingezogen war, kündigte Yvonne dann eine »wichtige Amtshandlung« an. »Hier, hier und hier«, sagte sie, indem sie ihm einen Stapel Papiere über den Küchentisch zuschob. Zum Unterzeichnen nämlich, offensichtlich.
»Och nö. Was zum Kuckuck –«
»Erstens die sogenannte Vorsorgevollmacht, vulgo Konto-, Depot- und Schrankfachvollmacht, abgestimmt mit den in der Deutschen Kreditwirtschaft zusammenarbeitenden Spitzenverbänden. Zwotens –«
»Moment«, bremste Kortsch sie, zugegebenermaßen tatsächlich ein wenig unlustig und ungehalten; doch nach einer Schrecksekunde ließ er sich auf ihren Frotzelmodus ein. »Moooment. Heute ist Dienstag, die Katze tritt die Treppe krumm, und der Bundespräsident heißt –«
»Und der Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz Heiko Maas. Der meint auf seiner Homepage, es sei wichtig, sich mit dem Thema ›Patientenverfügung‹ auseinanderzusetzen, ehe es zu spät dafür ist.«
»Was denn überhaupt für ein Schrankfach? Was für ein Depot? Und wo bleibt mein frisch aufgebrühter Ginseng-Quinoa-Umckaloabo-Tee, du ›Betreuerin‹?«
Sie kicherte und las ihre Antwort vom Blatt: »Im Alltag wird das Wort ›Betreuung‹ oft falsch verstanden und mit einer sozialen Betreuung verwechselt, mit praktischer und persönlicher Hilfestellung zur Bewältigung des Alltags. Die rechtliche Betreuerin hat aber vielmehr die Angelegenheiten des Betroffenen rechtlich zu besorgen. Ich will dir doch bloß weitere Teilhabe am öffentlichen Leben und Teilnahme am Rechtsverkehr ermöglichen!«
»Wie bitte? Teilnahme am Geschlechtsverkehr?« Er legte die Hand ans Ohr, lachte ranzig und beeilte sich gespielt (oder vielmehr gespielt gespielt): »Wo soll ich unterschreiben?« Dann las er, gespielt vom eigenen ›Humor‹ ermüdet, was sie ihm hinhielt. »Was? Ich befuge dich, über freiheitsentziehende Unterbringung und/oder Maßnahmen, zum Beispiel Bettgitter … He, Finger von meiner Gurgel!«
Wieder kicherte sie. »Du hast gesabbert.«
»Bettgitter. Das hätte ich nicht von dir gedacht. Sag mir die Wahrheit! Wie lange hab’ ich noch?«
»Das«, so frömmelte die Betreuerin, »weiß nur der liebe Gott.«
»Was aber«, zitierte Kortsch aus Eckhard Henscheids altehrwürdigen ›Sudelblättern‹, »wenn sich später, in der Ewigkeit, herausstellte, dass Gott gar nicht ›Gott‹ heißt. Sondern beispielshalber ›Hottner‹ …?«
»Ein Grund mehr zu unterschreiben.«
Sechs Wochen vor seinem Sechzigsten hatte er dann doch das deutliche Bedürfnis verspürt, denselben im Kreise seiner Liebsten zu feiern. Zu Yvonnes freudiger Überraschung. Per E-Mail lud er alle ins Da Capo.
Nachdem er den Einladungstext mit ihr durchgegangen war, hatte sie sich wie üblich erkundigt, ob er sich etwas wünsche. Weil ihm nichts einfiel, seufzte er scheinheilig: »Ach, ich hab doch alles.«
»Ach, komm. Du kriegst den Hals doch nie voll.«
Das war niederträchtig, aber nicht falsch. Er mochte Dinge; er hing an seinen Büchern und seiner Vinyl-Platten- und DVD-Sammlung, und er bekam gern entsprechende Geschenke. Nur hegte er den romantischen Wunsch, die Schenkende möge eigene Ideen entwickeln, und mochte diesen mädchenhaften Gedanken nicht aussprechen.
»Zusammen alt werden«, sagte er. Das war noch niederträchtiger, denn als sie geboren worden, war er bereits zehn Jahre Raucher gewesen.
»Mit wem denn?« Das war natürlich am niederträchtigsten.
In der darauffolgenden Nacht, nach der zweiten der üblichen Pinkelpausen, begann eine absurde Grübelei darüber, was denn ein angemessenes Geschenk zum sechzigsten Geburtstag tatsächlich sein könnte. Dinge vermochten ja über ihren Gebrauchswert hinaus Bedeutung zu transportieren, symbolische, entwicklungspsychologische oder so. Rätselhafterweise fiel Kortsch die Gillette-Werbung aus den späten Achtzigern ein. (Warum sagten eigentlich alle immer »Neunzehnhundertachtzigerjahre«, auch wenn stets klar war, dass die Achtzehnhundertachtziger mitnichten gemeint sein konnten; und warum sagten übrigens alle immer »D-Mark«, seit es sie nicht mehr gab, wohingegen jeder »Mark« sagte, als es sie noch gab; und warum musste man eigentlich über derartigen Kram ausgerechnet mitten in der Nacht nachdenken?) Jene Gänsehaut-Szene also, da der Vater dem Sohn einen Rasierer überliefert, während die Filmmusik den aufwühlenden Refrain ›Vom Vater zum Sohn/ so war es immer schon‹ intoniert …
Nun ja, er hat weder Vater mehr noch Sohn je gehabt (geschweige Tochter), und allein deshalb hatte es darüber hinaus wenig Sinn, sich die Augen aus dem Kopf zu heulen, wenn der Opi im Fernsehen dem Enkel Sahnebonbons zusteckte oder Ähnliches. Kortsch selbst hält zwar Opas Zigarrenschneider mit Hirschhorngriff in Ehren, obwohl er die letzte Zigarre im vergangenen Jahrtausend geraucht hat. Rasiert aber hat Kortsch sich auch schon lang nicht mehr, und mit Bonbonwünschen dürfte man der sehr geehrten Betreuerin wohl ebenso wenig kommen dürfen.
Wie so häufig in solchen Momenten, da er sich in Gedankenspielen verhedderte, tauchte vor Kortschs innerem Auge Köhlers Imago auf, und dann dachte Kortsch praktisch vermittels Köhlers Verve in Köhlers Schwurbelduktus weiter: Ja, dachte er, es müsste ein Ding mit Stil sein, ästhetisch plausibel, weil ironische Brechung eingebaut, das dennoch die neue Altersstufe berücksichtigte, ja hervorhöbe und doch auch ein Stück weit aushebelte; ein Ding, das Würde im Sinne des Artikels 1, Absatz 1 GG repräsentierte, aber auch ungebrochene Virilität signalisierte; das dem Präsens Präsenz verliehe und allegorische Trostmächtigkeit verströmte und – – und plötzlich fiel es dem Köhlerkortsch wie Plaque aus den Synapsen: ein Spazierstock!
Au ja, Mensch. Nein, natürlich nicht so einen, wie er ihn dem Alten Herrn selig mit ins Grab gegeben hatte; vernagelt mit bunten Plaketten vom Rheinfall bei Schaffhausen, aus Hannoversch Münden und Fusch am Großglockner, mit gebogenem Griff und Metallspitze. Vielmehr so ein Dings, mit dem der Lüpertz immer rumfuchtelt, der alte Geck, der; vielleicht nicht unbedingt mit silbernem Totenschädel-Knauf, aber …
Beim Frühstück war wieder Vernunft eingekehrt. Kortsch konnte sich vorstellen, wie Yvonne auf eine solche Idee reagierte. »Einen Stock? Ach du dicker Vater. Kommt der mit der Gummikapsel nicht noch früh genug?«
Aber was sonst? Einen hübscheren Tablettenspender vielleicht?
Der Schlaganfall hatte erhöhten Pillenbedarf zur Folge gehabt – und der wiederum eine Neuanschaffung: zwei längliche Medikamentenboxen nämlich, deren sieben Segmente mit Mo bis So beschriftet waren. Eine Box für morgens (pro Segment 1 ockerfarbene Bohne, 1 braun-beige geteilte Kapsel, 1 kreideweiße Pastille, 1 senfgelbes Zäpfchen, 1 beigefarbener Torpedo mit Aufdruck OM 20), eine Box für abends (je 1 ockerfarbene Bohne, 1 altrosafarbene Linse, 1 cremefarbener Drops und alle zwei Wochen sonntags zusätzlich 1 transparente Perle).
O.k., diese Plastikdinger hatten je 1 € gekostet und sahen entsprechend trostlos aus. Doch wäre eine Pillenetagere aus Gold und Elfenbein im Jugendstil, wenn es denn so etwas gab, wirklich tröstlicher? Und musste man die Betreuerin denn wirklich mit der Nase drauf stoßen, wie hinfällig ihr Klient bereits war?
Am Ende gab es dann ein Heizkissen mit Kragen. »Ein Syntrox Germany XXL!«, jubelte Kortsch, damit seine Gäste im Da Capo was zu lachen hatten.
»Aua, aua«, jammerte Köhler.
»Tja«, bestätigte Kortsch. »Und künftig, sagt der Onkel Doktor, gibt’s statt schwarzem Tee bloß noch weißen Tee.«
»Und statt Schwarzem Krauser«, sagte Yvonne, »ja eh seit zehn Jahren Weißkohl.«
»Na ja«, sagte Köhler, »immer noch besser, als aus einer dieser Deppenflöten heiße Luft zu nuckeln. Mit Aprikosen-Spargel-Aroma oder was weiß ich.« Eine Spitze gegen Wiebke, die grad draußen vor der Tür stand.
»Und statt schwarzem Humor bloß noch weiße Folter«, fügte Yvonne hinzu, um ihrer Freundin beizustehen, und nur, weil Kortsch ihre bevorzugte Musikfarbe mal als solche bezeichnet hatte.
»Und statt Schwarzhaarigen bloß noch Blondinen«, so Kortsch wuchtig, nicht übel stolz auf seine Schlagfertigkeit. Doch anstatt den Fehdehandschuh aufzunehmen wie ein Mann, kicherte Yvonne tussihaft und sagte, perfiderweise zu Köhler gewandt: »Köstlich, dieser Plural!«
Dazu gab’s eine Glückwunschkarte, die beim Aufklappen Sechzig Jahre und kein bisschen weise dudelte. »Ah! Curd Jürgens. Der normannische Kleiderschrank.« Ganz Zeitzeuge, schnalzte Kortsch mit der Zunge.
»Ist übrigens«, ergänzte Köhler aus seinem gusseisernen Gedächtnis, »mit sechsundsechzig gestorben. Wiewohl doch wiederum Namensvetter Udo behauptete, da fange das Leben erst an.«
»Hm«, sinnierte Yvonne doppeldeutig. »Sechs Jahre noch. Was machen wir denn so lange?« Ein prima Fest, wie gesagt.
Teils mangels ärztlicher Vorsorge, teils mangels Eigeninitiative hatte Kortsch es hingekriegt – häufiger Nachfrage vonseiten Yvonnes zum Trotz –, die endgültige Fahndung nach der Ursache für den kleinen Schlaganfall anderthalb Jahre lang zu verschleppen. Zwar hatte die MRT Verkalkungen offenbart, doch schienen die zu geringfügig, als dass sie als Auslöser infrage kämen. Plaque konnte sich im Prinzip jederzeit lösen und irgendwelche Durchgänge verstopfen. Jedenfalls war es nach wie vor angezeigt, Herz-Rhythmus-Störungen und vor allem Vorhofflimmern als Gefahrenquelle auszuschließen. Das ist der Grund, weshalb ihm heut Morgen von Dr. Tanner die Alternative eröffnet worden ist, immer mal wieder ein Langzeit-EKG zu tragen oder aber sich den Event-Rekorder dauerhaft implantieren zu lassen, in Form eines Chips in der Brust. Er hat sich zunächst einmal für Ersteres entschieden.
Nachdem er seine SMS an Yvonne abgesetzt hat, setzt er seinen Weg durch die Hasestraße fort, überquert den Markt am Rathaus – wo er ein Schwätzchen mit einem Kollegen aus dem Amt hält – und biegt links in die Bierstraße ein. Vor der Bäckerei wartet bereits, unterm Arm eine Achter-Packung Kloüaüoer, blond lächelnd Yvonne.
»He, bist du schnell! Ihr jungen Leute!«
»Tja! Mit dem Trugel im Bunde!«
Gemeinsam treten sie ein.
Die Verkäuferin ist, was man zu Kortschs Zeit Twen nannte. Wenn nicht Teen. Ihre blauen Augen strahlen mit derartiger Blauäugigkeit, dass es ihm schier das Herz zerreißen will. (Ob darauf wohl der Event-Recorder reagiert?)
Was folgt, ist ein alltagsmagischer Moment. Kinder- und familial ahnungslos bis dorthinaus, hat Kortsch eine Art Vision: Innerhalb jenes zufälligen Drei-Generationen-Ensembles – Senior, Betreuerin, Verkäuferin – tritt ihm plötzlich, wie aus den Tiefen der menschlichen Entwicklungsgeschichte, seine Rolle als designierter Stammesältester ins Bewusstsein. Liegt es nicht in seiner Verantwortung, denkt er im Köhler-Sprech, jenem Küken da ein paar mahnende Philosopheme in puncto offensichtlich himmelschreiender Naivität zu vermitteln – hic et nunc, ganz nonverbal, einfach qua Aura? Oder vielmehr ein Quantum Trost zu teleportieren angesichts einer nur allzu langen, ungewissen Zukunft voller Trolle, Starkregen und Black Rocks?
Leider geht ihm schlechterdings nichts Bedeutungsvolleres im Kopf herum, als dass er gern vier Brötchen hätte. Folglich sieht er sich unvermittelt mit ihren blauen Äuglein und empfängt aus ihrem von unverkalkten, blutdurchtosten Arterien versorgten Gehirnchen folgenden Gedanken: Na los, Opi. Zwei Megaknackis und zwei Weltmeister?
Und in derselben Sekunde beginnt sich erneut die Manschette um seinen linken Oberarm unterm Mantelärmel aufzublähen. Jenes dezente, doch unüberhörbare Surren erfüllt die Luft zwischen ihnen dreien, zu ausdauernd, als dass die Blauäugige etwaigen Vibrationsalarm eines Mobiltelefons hätte vermuten dürfen. Kurzes Pingpong undefinierbarer Blicke zwischen allen Beteiligten, und – nichts.
Vielleicht sollte er sich doch einen Chip implantieren lassen …
Köhler meinte später am Telefon, er an Yvonnes Stelle hätte die Situation mit folgenden Worten erlöst: »Ach, das ist nur seine Penispumpe. Zwei Megaknackis und zwei Weltmeister, bitte!«
Und schon am darauffolgenden Abend erlebt er eine weitere solcher ›Szenen in Beige‹, als die Köhler sie tituliert hat. Erst im üblichen nächtlichen Grübelzirkel nach der zweiten Pinkelpause wird Kortsch erkennen, dass sie höchst geeignet ist, seinen Wunsch nach einem tröstlichen Sinnbild zu erfüllen …
Gedankenverloren steht er auf der Angers-Brücke und starrt, aufs Geländer gestützt, in den seichten Lauf der Hase. Da naht ein ›Seniorsenior‹ (wie Köhler die mindestens fünfzehn Jahre Älteren in Abgrenzung zu ihnen beiden, den ›Juniorsenioren‹, getauft hat). Ein hagerer Altvorderer, wie er im Buche steht (1. Mose). Unter anderem trägt er eine Fellmütze, eine unbeschreibliche Nase und ein Gebiss, das – wie aufgrund seiner faszinierenden Äußerungen deutlich vernehmbar – nicht eben fugendicht sitzt. Gebannt lauscht Kortsch, gestützt durch das Brückengeländer, doch nachhaltig bedürftig und vorauseilend dankbar, Methusalems Wort. Rüstig und mit luziferischem Blick marschiert er vorüber und verkündet – im Vollbewusstsein der wissenschaftlichen Unumstößlichkeit mit bescheidenem Stolz, vor allem aber mit nüchterner Festigkeit – seiner unmittelbaren Umwelt die präzisen Resultate seiner Lebenserfahrung. Und zwar mit lässlicher Ausnahme der S-Laute wohlprononciert: »Einsch und einsch ischt tschwei. Tschwei und tschwei ischt vier. Vier und vier …«
Rechne nach, o Kortsch.
[2017]
Rotkehlchen
Ein Fragment
I
Letztendlich kam der Anruf tatsächlich – natürlich; nur entsetzlich viel zu früh –, der Anruf, den ich so oder so ähnlich mein ganzes Hamburger Leben lang gefürchtet hatte. Nicht, dass die Furcht es beeinträchtigt hätte. Doch saß sie tief in den Eingeweiden, wie ein verkapselter Tumor, fast vierzig Jahre lang. Und als er dann kam, der Anruf, platzte die Kapsel auf, und der Albtraum begann.
Vorangegangen war ein Anruf meiner anderen Schwester. Dass schon der nichts Gutes bedeuten konnte, war klar: Wenn an einem Samstagmorgen das Telefon vor acht Uhr läutet (war es nicht sogar noch vor sieben? ich weiß es nicht mehr), löst das Immunsystem automatisch Alarm aus. Besorgt, aber gefasst teilte S. mir mit, unsere Mutter sei wieder einmal ins Krankenhaus eingeliefert worden.
»Das kann ja wohl nicht angehn!« So oder ähnlich werde ich reagiert haben. (Auch daran kann ich mich – jetzt, bei der Niederschrift, mehr als anderthalb Jahre später – nicht mehr erinnern.) Irgendeine solche Erregungs- und Empörungsformel wird es gewesen sein. Im Nachhinein peinigend, diese Dissonanz von kindlicher Angst und nachkommenschaftlicher Arroganz, die in dem Ausruf mitschwang. Andererseits, mit Selbstverlaub, verständlich; denn genau ein Jahr zuvor, an ihrem fünfundsiebzigsten Geburtstag, war sie zum ersten Mal mit Vorhofflimmern eingeliefert worden, zum zweiten Mal irgendwann zwischendrin (ich meine, im Vorfeld des einundachzigsten Geburtstags unseres Vaters) und nun, am Morgen ihres sechsundsiebzigsten Geburtstags, zum dritten Mal.
S. berichtete, gegen sechs Uhr habe unsere Mutter unseren Vater gebeten, den Notarzt zu rufen. Wie auf den Tag genau ein Jahr zuvor hatte sie viel zu lange damit gewartet, hatte bereits die ganze Nacht (in ihrem Schnarchexil, sodass unser Vater es nicht mitbekam) unter Symptomen gelitten: Herzrasen, massives Herzstolpern, flatternder Puls, Atemnot. Ihr war das nächtliche Aufhebens unangenehm gewesen. Und obwohl Notarzt, Hausarzt, Kardiologe und ihre Familie ihr eingeschärft hatten, beim nächsten Mal nicht zu zögern, hatte sie auch diesmal wieder viel zu lange gewartet. Im Übrigen hatte sie, genau wie ein Jahr zuvor, am Vorabend geputzt und geräumt und vorbereitet, um Familie und Anverwandten zur Feier ihres Geburtstags ein Haus präsentieren zu können, dessen Behaglichkeits- und Gastlichkeits-, Ordentlichkeits- und Sauberkeitsniveau ihren Vorstellungen Genüge tat (Vorstellungen, die sie wiederum von ihrer Mutter übernommen hatte). Zum Zeitpunkt von S.s Anruf wurde sie bereits im Elbe-Klinikum St. versorgt. Unser Vater war bei ihr.
S. versprach mir, mich auf dem Laufenden zu halten. Sie und A. übernahmen die Absagen an die Verwandten. Resigniert verabredeten wir, dann eben – wie bereits ein Jahr zuvor – am Krankenbett zu »feiern«. Wenn ich mich recht erinnere, peilten wir achtzehn Uhr an.
Ohnedies hatte ich schlecht geschlafen. Kam manchmal vor. Der unvollendete neue Roman – heikel nicht zuletzt just aus familiärer Indikation –, permanenter wirtschaftlicher Druck, das ein oder andere Zipperlein (»Zimperlein«, wie mein Vater später gut freudianisch sagen sollte), die ein oder andere Meise. Nicht zuletzt womöglich gar die alltägliche Tagesschau (wen ließ das Drama millionenfacher Flucht schon kalt in jenem Spätsommer und Herbst des Jahres ’15). Ich weiß nicht mehr, was ich in diesem überreizten Zustand an diesem Vormittag tat. Schlafen, so meine ich, konnte ich nicht mehr. Ich meine, ich grübelte über unser Geschenk, das noch nicht fertig war.
Immer mal wieder hatte unsere Mutter von einer Radtour um die Berliner Seen geschwärmt, die sie vor Jahren einmal mit dem Landfrauen-Verband unternommen hatte. Ich hegte die fixe Idee, die Neuauflage einer solchen Tour für sie zu arrangieren. Die Sache war aber unausgegoren: Nähme die gesamte Familie teil, wäre die Unternehmung bei Weitem zu teuer; ohnehin übernachtete mein Vater nicht mehr gern aushäusig; allein hätte meine Mutter dazu aber wohl auch keine Lust; und so weiter. Unser Wunsch, unserer Mutter ein Geschenk zu machen, das sie über das in ihren eigenen Augen angemessene Maß hinaus erfreuen würde, war groß. (Jetzt, anderthalb Jahre später, wächst er bei jedem Gedanken daran weiter ins Unermessliche.) Doch war er nicht einfach zu verwirklichen. In unserer lebenspraktisch orientierten, nicht sonderlich begüterten Familie war es völlig in Ordnung, ihr zum Siebzigsten zum Beispiel einen sogenannten Hackenporsche zu schenken. Nicht von ungefähr hatte ich in einer meiner früheren Geburtstags-Oden auf sie (zum Fünfzigsten? zum Sechzigsten?) auf »unsere Mama« »genügsam wie ein Lama« gereimt. (Mein Gedicht zu ihrem Siebzigsten ging übrigens so:
Mama wird – angeblich – siebzig!
Drum lasst uns sie mit ein paar kecken
gereimten Versen bisschen necken.
Denn was sich neckt, das liebt sich.
Jeden Morgen vier Uhr dreißig
weckt die Mama einen Hahn,
auf dass dann seinerseits der fleißig
krähen und sie wecken kann.
Zack! steht sie auf, denn Punkt halb acht
muss sie die Gartenblumen wässern,
um all des Wachstums bunte Pracht
möglichst erheblich zu verbessern.
Drei Stunden noch. Das wird recht eng.
Was ist des eil’gen Pudels Kern?
Die Mama wohnt morgens so gern.
Ihr Ritualfahrplan ist streng.
Kaffee tanken: rund zwei Stunden.
Erst dann hat sie ihr Quantum drin.
Sie lässt es sich wohlweislich munden –
trotz Zeitverlust steigt Lustgewinn.
Zähne putzen: halbe Stunde.
Verflixt, die Blumen schreien schon!
Durchs Fenster dringt beredte Kunde
Von ihrer schlimmen Leidensfron.
»Frau Sch.!« Eindeutig Phlox-Gejammer.
»Hilfe! Hilfe! Ich verdürste!«
Zutiefst geschockt verschluckt die Mama
den Motor ihrer E-Zahnbürste.
»Frau Sch.! Frau Sch.!«, stimmt auch der Krokus
ins Klagelied vollmundig ein.
Die aber muss noch auf den Lokus
und fällt vor Schreck fast rückwärts rein.
Nun fängt auch noch der Sonnenhut
zu heulen an: »Frau Sch.! Frau Sch.!
Mir geht es überhaupt nicht gut!
Hab’ nur noch äußerst schwachen Puls!«
Da endlich … ah! Die Rettung naht
mit Gartenschlauch. Im Morgenrock.
Das ist nun mal Mamachens Art:
Im Morgenrock zum Rosenstock.
Nun ist’s vollbracht. Total besoffen,
gluckst die Flora. Kurz und gut,
wir wollen einfach mal schwer hoffen,
die Mama wisse, was sie tut.
Meistens weiß sie es tatsächlich:
Blümchen, die bei A. schwächlich,
erholen sich bei Mama tüchtig.
Wahrscheinlich sind sie mamasüchtig.
So. Acht Uhr. Jetzt geht’s zum Duschen.
Allmählich kommt Mama in Fahrt
und auch ihr Gatte in die Puschen
(der das ja auch durchaus bejaht).
Nun schreien Abwasch, Bügeleisen,
Einweckgläser, Tiefkühlspeisen
nach Mamas fachkundiger Hand.
Doch die ist grad zum Unterpfand
der Television geworden!
Man glaubt es nicht! Um neun am Morgen!
Muss man sich um die Mama sorgen?
Um ihren güld’nen Hausfrau’norden?
Ach wo. Sie setzt nur rigoros
Prioritäten. Denn famos
gefallen ihr TV-Beiträge,
die über Bau und Schau und Pflege
ihres Steckenpferds berichten:
zum Beispiel »Hessens schönste Gärten«.
Und auch auf »Bayerns schönste Gärten«
mag sie mitnichten gern verzichten.
Geschweige Brandenburgs, Tasmaniens,
Nordrhein-Westfalens, Schweiz’ und Spaniens …
und so weiter und so fort
bis an der Welten letzten Ort.
Am Abend kommen dann die Jäger
mit Sauenknochen an der Mütze.
Meist fordern sie nicht Bier noch Häger,
sondern vielmehr – Rote Grütze!
Ja, Mama hat die zünft’gen Männer
mit leichter Hand längst umerzogen:
vom Saufaus hin zum Nachtischkenner.
Da staunen selbst die Soziologen.
So ist sie, uns’re liebe Mutter:
Bis heut’ sorgt sie für Seelenfutter.
Und ihren letzten Hähnchenschenkel
kriegt noch der satteste der Enkel.
Auch in uns’ren größten Schmerzen:
Auf Mama konnten wir uns stets verlassen.
Wir lieben sie von ganzem Herzen
und woll’n sie jetzt HOCH leben lassen!)
Zwischen halb zwei und zwei muss es gewesen sein, als letztendlich A.s Anruf kam. Um die Tageszeit ist mein Biorhythmus – selbst nach einem Vormittag, der auf normale Nachtruhe folgt – auf seinem Tiefpunkt (seit Jahrzehnten ist das so). Um sich zu regenerieren, lechzt mein Körper dann nach einer Siesta. Normalerweise hätte ich Handy und Festnetztelefon aus- und erst gegen 15 Uhr wieder eingeschaltet, doch heute ließ ich es wegen der besonderen Umstände selbstverständlich durchgehend an.
A.s Stimme war tränenerstickt. »Du, Papa hat eben angerufen, Mama ist im Krankenhaus umgefallen.«
Umgefallen?
Ich zunächst: na ja, kann passieren. Sie war leider mehrfach gestürzt in den letzten Jahren; im Garten ein-, zweimal (und im Anschluss so benommen, dass unser Vater in Panik geriet); einmal auf dem buckligen Pflaster des samstagmorgendlichen Stader Gemüsemarkts (was sie uns Kindern gegenüber zu verschweigen versuchte); einmal am Hauseingang so schlimm, dass sie sich das Becken brach. Und wenn das einmal mehr passierte – zumal im Krankenhaus –, wie dramatisch konnte das schon sein?
Dann fragte ich nach, wie unser Vater am Telefon geklungen habe, und da sagte A.: »Er hat geweint … Wir sollen sofort kommen.« Und da packte mich dann eine Heidenangst. In aufwallender Verzweiflung wich ich noch aus, doch sie packte mich am Schlafittchen.
Trotzdem spulte ich mein Programm ab. Na ja, du weißt ja, wie er ist, macht doch immer erst mal ziemlichen Wind, ich würd ja erst mal davon ausgehen, dass es nichts Schlimmes ist. Ich mach’ mich dann mal fertig und fahr los. Und legte auf, und in dem Moment wurde dieses ahnungsvolle Grauen von einem jähen Zorn auf ihre Putzwut überwältigt, und ich pfefferte ein Sofakissen in eine Zimmerecke.
Um nicht in lebensgefährliche Hektik zu verfallen, zwang ich mich zu Ruhe, Besonnenheit und Konzentration. Das war anstrengend, und flatterig – phasenweise wie in Zeitlupe – packte ich vorsichtshalber für eine Nacht Wäsche ein, die üblichen Pillen und ich weiß nicht was. Stuhlgang drängte. Kehle und Mundraum waren staubtrocken, aber Wasser kaufte ich, glaube ich, erst an der Tankstelle in der Julius-Vosseler-Straße, der letzten Tankstelle vor der Autobahnauffährt Hg.-Stellingen, wo ich zum zweiten Mal unwiderstehlichen Drang zum Stuhlgang verspürte; kein Durchfall, doch meiner nahezu psychotischen Unruhe zum Trotz keinerlei Aufschub duldend. Bei den ersten Fahrten in den Wochen danach sollte der Anblick jener Tankstelle so schmerzlich für mich werden, dass ich künftig andere Routen wählte.
Mein Körper ahnte längst, wie ernst es war, während ich die endlose Fahrt durch Elbtunnel und Altes Land minütlich bittere, bange Blicke nach dem Nebensitz warf, auf den ich mein Smartphone platziert hatte. Doch je länger eine erlösende SMS meiner Schwestern auf sich warten ließ, desto zermürbender der Kraftaufwand, meine Unruhe zu bändigen, um mich auf den Verkehr konzentrieren zu können. Male mir die ganze Zeit aus, wie ich ankomme und sich alles als harmlos herausstellt, steht in meinen Laptop-Notizen, die ich ungefähr zwei Wochen danach anfertigte, immer wieder von Weinkrämpfen unterbrochen, doch dann mit der blindwütigen Energie eines vollgekoksten Jazzpianisten fortsetzte, weil ich genau wusste, wie schnell die Erinnerung an die Dinge verblasst, wenn man sie nicht fixiert; ich war von meinem eigenen Tun unangenehm berührt – ein Sohn, der seiner sowieso sehr zweifelhaften Arbeit wegen über die Leiche seiner zweifellos sehr geliebten Mutter geht (und der unausbleibliche Koketterie-Verdacht macht’s natürlich nicht besser). Doch später, beim Wiederlesen von Philip Roths Patrimony, verspürte ich einen (wiewohl wiederum vielfältig anrüchigen) kleinen Trost, als der große Schriftsteller von diesem seinem Buch sprach, an dem er, während sein Vater starb, die ganze Zeit über geschrieben hatte, und zwar »in keeping with the unseemliness of my profession«. Die Ungehörigkeit, Unschicklichkeit meines Berufes.
Wie auch immer: Habe ich mir tatsächlich die ganze Zeit ausgemalt, wie ich ankomme und sich alles als harmlos herausstellt? Seltsamerweise kommt mir, was ich zwei Wochen später niederschrieb, heute, anderthalb Jahre später, ausgedacht vor. Ich spiele mit dem Gedanken, anzuhalten und meine Schwestern anzurufen, sehe aber die Sinnlosigkeit ein. Ja, das klingt schon anders.
Gewiss bin ich nicht der Einzige, der Krankenhäuser hasst, und sehr wohl ist mir bewusst, wie wohlfeil diese Abneigung ist. Dennoch, zeit meines Lebens wird meine Vorstellung von Krankenhäusern mit dem süßlichen Gestank meiner eigenen Exkremente verbunden bleiben, die ich beim ersten (nein, zweiten) Klinikaufenthalt meines Lebens, mit neun oder zehn Jahren, zu meinem schamhaften Entsetzen in eine Bettpfanne zu setzen angewiesen worden bin. (Bettpfanne! – was für ein Ausdruck! Ein Wunder, nie an Albträumen gelitten zu haben …) E.L. hatte mir beim Fußball derart heftig gegens Schienbein getreten, dass es glatt durchgebrochen war.
Mein erster Aufenthalt aber muss früher datieren. Ich dürfte sieben oder acht Jahre alt gewesen sein, als ich heimlich mit dem Hirschfänger meines Großvaters gespielt hatte. Das Blut eines Fuchses unter Tollwutverdacht klebte daran. Meine Mutter und ich sitzen in einem nach Bohnerwachs riechenden Krankenhausgang mit Linoleumboden und warten. Sie trägt ihre Ausgehsachen, in denen sie immer so unvergleichlich schön aussieht – immer wieder fällt mir auf, dass sie mit großer Selbstverständlichkeit die Schönste und Anmutigste unter allen anderen Frauen ist, sei’s im Dorf oder in den Straßen von St.; bis heute erinnere ich mich an eine Szene im roten Schienenbus: Ein rauchender, Anzug tragender Mann sitzt uns gegenüber, und beim Abaschen krümelt er aufs bemäntelte Knie meiner Mutter (Nichtraucherin). Er beeilt sich, den Schmutz wegzuwedeln und -zuwischen, mit leichter Hand, vollkommen seriös, ohne auch nur den Anflug einer Anzüglichkeit; mit selbstsicherem Charme entschuldigt er sich und verwendet dabei eine grammatische Finesse, wie sie mir bis dato unbekannt ist: »Das hat nicht sollen sein.« Sein Blick aber hat sich mir eingeprägt. Meine Mutter reagiert, wie es sich Mitte der Sechzigerjahre Fremden gegenüber als Dame vom Lande ohnehin gehört: höflich und kurzangebunden.
Nun, im Krankenhausgang, bemerkt sie meine spröde Betäubung, ausgelöst von der Hiobsbotschaft, dass ich womöglich hier bleiben muss. Sie schaut mir in die Augen, streicht mir übers Haar und gurrt »Ach, Jüngeli!« – ein Diminutiv aus abgrundtiefer Einfühlung, das sie selten verwendet; es ist reserviert für Trost in dramatischen, tragischen Momenten. Weswegen mir die Dramatik und Tragik dieses Moments erst mit voller Durchschlagskraft zu Bewusstsein kommt. Auf dass erst jetzt die Tränensäcke überlaufen. Ich meine aber, mich erinnern zu können, dass ich nicht dort zu bleiben brauchte. Allerdings bekam ich eine Spritze, von der ich kollabierte.
Mein dritter Krankenhausaufenthalt wiederum – mit dreizehn, vierzehn, wegen eines gebrochenen Arms, geschlagene sechs Wochen, wenn ich mich recht entsinne – zeitigte ein wiederum anders gelagertes mindergradiges Trauma: dieser melancholische Nadelstich, als ich bei meiner Rückkehr durchs Autofenster erkannte, dass die Bäume im Dorf in hochsommerlicher Pracht grünten, als sei das über Nacht geschehen; ein erster, unverschmerzter Aderlass an Lebenszeit.
Meine Abneigung Krankenhäusern gegenüber ist also ganz trivial begründet. Wer mag schon Krankenhäuser. Wie auch immer, sobald ich ein Krankenhaus betreten musste, beschwor ich, um es überhaupt betreten zu können, imaginativ den Zeitpunkt, da ich es wieder verlassen würde. Am heutigen Tag, dem 10. Oktober 2015 – dem sechsundsiebzigsten Geburtstag meiner Mutter –, tat ich das nicht; ich hatte keine Zeit dafür: In dem Moment, als ich die Intensivstation betrat, rief S. auf meinem Mobiltelefon an. Ihre Stimme klang – nun ja, scheinbar normal, in Wahrheit bloß absorbiert von der Konzentration auf unsere Kommunikation und die Lotsenaufgabe, und so schreiend ungerecht es meiner Schwester gegenüber ist, ein tief in der Hölle meines Innersten tobender Vierjähriger nimmt es ihr bis heute krumm, dass jene vermeintliche Normalität in ihrer Stimme den kläglichen Rest an utopischer Hoffnung für wenige Sekunden zum Ballon aufblies. Er platzte, als ich sah, wie ihre im ersten Moment noch gefasste Miene angesichts meiner angst- und schreckenerfüllten brach.
Sie hat einen Schädelbasisbruch, und die Ärzte sagen, es gibt keine Hoffnung.
Was?
Sie greift nach meiner Hand, oder ich nach ihrer. Ich will nicht weitergehen. Ich will stehen bleiben. Ich will mich setzen, einfach hinsetzen und nachdenken. Aber ich gehe mit ihr. Oder wer immer das ist, der da mit ihr geht, ein schwerfälliger Fremder, der mir seine weichen Knie unterschiebt. Mussten wir vor jener automatischen Doppeltür, die mir in den kommenden drei Tagen so abscheulich vertraut werden sollte, warten und klingeln? Weiß ich nicht mehr. Einige Meter den aseptischen Korridor entlang, an den ich mich erinnerte, weil wir meinen Vater dort an Weihnachten besucht hatten. Bevor wir eintreten, sagt sie einen Satz, der ihre Schockschwere hinter der Anstrengung, Fassung zu bewahren, besser zum Vorschein bringt, als ein Zusammenbruch es vermocht hätte:
Erschrick dich nicht, sie hat ganz blaue Augen.
Sie führt mich in einen kleinen Saal mit all den elenden medizintechnischen Gerätschaften und mehreren Betten, in denen Patienten liegen – in einem davon unsere Mutter. S. setzt sich auf einen Stuhl an der Wand, ein paar Meter entfernt, und hält sich den Leib. A. und mein Vater stehen an dem Bett, in dem meine Mutter liegt, ins künstliche Koma hinabgeschickt, gehalten von Schläuchen. Sie hat die geschwollenen, blutunterlaufenen Lider geschlossen. (Ein gottverfluchter Satan hat sie geschminkt – wann war es, dass sich mir dieser beschissene, bescheuerte Gedanke ins Hirn pflanzte und nie wieder verschwand?) Am Ohrknorpel verkrustetes Blut. Ihre Zunge findet zu wenig Platz neben dem hakenförmigen Plastikröhrchen im Mund, quillt zwischen den Lippen hervor, in einer Weise, wie es ihr peinlich wäre, wenn sie nicht im Sterben läge, und abgesehen von ihren Verletzungen ist dies das untrügliche Zeichen, dass sie nicht bloß schläft. Ihre Brust hebt und senkt sich in maschinellem Rhythmus. Mein Vater und meine Schwester stehen da, schockgeschlagen. Oder sitzt mein Vater? Hält er die Hand meiner Mutter? Streichelt meine Schwester ihr Gesicht? Wir schauen uns in die abgrundtief entsetzten Augen, die vertrauten Gesichtszüge verzerrt.
Das darf nicht wahr sein … (Wie oft flüstern wir diesen Satz in den kommenden Tagen und Wochen – Monaten? Wie oft hat man diesen Satz in seinem Leben schon vor sich hin geknurrt, meist bloß wütend, verärgert, gedankenlos. Nun besagt er nichts als kristallklare, steinharte Verzweiflung. Als ich acht, neun oder zehn Wochen danach von einem vierwöchigen Aufenthaltsstipendium wiederkehre und meinen Vater im verwaisten Hauswirtschaftsraum begrüße, ist es der zweite Satz, den er einverständig ausspricht, indem er ihn von meinen Augen abliest: Das darf nicht wahr sein …)
Kam dann eine Krankenschwester oder Ärztin und kündigte an, meine Mutter würde demnächst in ein Einzelzimmer verlegt, damit wir uns »in Ruhe verabschieden können«? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass diese Formulierung so früh von irgendwem fiel, dass ich vor Empörung stumm aufschrie.
War es diese junge Ärztin? Auch das weiß ich nicht mehr. Hätte ihr jedenfalls ähnlich gesehen. Ich sehe uns im Wartezimmer sitzen, und es setzte sich zu uns diese junge Ärztin, womöglich im Praktikum oder weiß der Teufel was – jedenfalls schaffte sie es, mich innerhalb von Sekunden aufzubringen.
Ihre Mutter kommt gleich in den OP, aber es gibt wenig Aussicht (oder so ähnlich). Wir brauchen Ihr Einverständnis (für irgendwas, weiß der Teufel was), falls (irgendwas).
Ich, der ich vor wenigen Stunden noch den Geburtstag meiner Mutter feiern wollte und nun gerade mal seit ein paar Minuten mit ihrem so gut wie sicheren Tod konfrontiert bin, sage irgendetwas, von dem ich nicht mehr weiß, was. Bis heute kann ich mir nicht verzeihen, dass ich sie nicht einfach weggeschickt und den Chefarzt verlangt habe.
Daraufhin sie so etwas Ähnliches wie: Ich verstehe Ihren Frust, aber Sie müssen uns auch verstehen!
Ich kann es bis heute nicht glauben, was ich da gehört habe, aber ich habe es gehört; in dieser Hinsicht ist die Erinnerung untrüglich. Sie war hübsch und schlank und noch jung und vermutlich unerfahren, und als Metzgerin hätte sie die weitaus bessere Figur gemacht. Später geriet ich noch mit ihr aneinander, ich weiß nicht mehr, wann genau – am selben Tag? Einen Tag später? Ich sitze am Bett meiner Mutter, nun schon im Einzelzimmer, und die junge Ärztin steht rechts hinter mir und sagt wieder: Ich verstehe Ihren Frust.
Nur um Missverständnisse zu vermeiden: Sie ist lupenreine Bio-Deutsche, und sie mag eine Eins in Latein haben – Deutsch jedenfalls kann sie offensichtlich nicht. Mein unermesslicher, gerechter Zorn scheitert an meiner inneren Mauer aus ohnmächtigem Kummer, und so diffundiert bloß ein schwächlicher, gnatteriger Satz:
Das ist ja wohl kaum der richtige Ausdruck.
Die junge Ärztin, nicht faul: Was wollen Sie damit sagen!
Ich werde hier nicht mit Ihnen zanken.