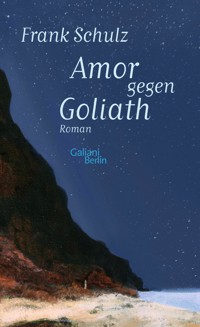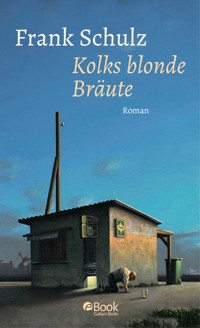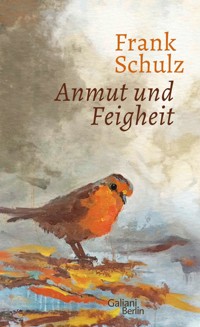9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Onno-Viets-Romane
- Sprache: Deutsch
»Frank Schulz hat den grandiosesten Antihelden unserer Zeit geschaffen. (...) Der Roman gehört so ziemlich zum Komischsten, was man in den vergangenen Jahren lesen durfte.« FAZ. Der eigenwilligste Privatdetektiv der Literaturgeschichte zieht aufs Dorf. Doch die Idylle trügt gewaltig. Der dritte Onno ist beileibe kein Regionalkrimi, sondern ein Roman von Welt. Protzten Onnos bisherige Abenteuer noch mit Kreuzfahrtschiffen und Kiezoligarchen, Popmagnaten und Rotlichteskapaden, ist der Mittelpunkt der Welt beim dritten und letzten Onno Viets das Dörfchen Finkloch. Selten gab es mehr Dorfidylle auf so wenigen Quadratmetern. Doch Onnos scheinbar beschaulicher Sommer bei den Schwiegereltern hat einen düsteren Hintergrund: Geplagt von einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung, ist der Privatdetektiv von eigenen Gnaden von Hamburg raus aufs Land geflohen. Denn seit dem dramatischen Fall um den Irren vom Kiez ist er nicht mehr er selbst: Nicht nur, dass er an der Pingpongplatte versagt, er leidet vor allem unter ausgewachsenen Panikattacken, die seine Tage zur höllischen Qual werden lassen. Dörflichkeit und kuscheliger Schoß der Schwiegerfamilie sollen für Linderung sorgen. Doch natürlich stolpert Onno auch in Finkloch unfreiwillig in finstere Machenschaften, bei denen nicht nur gekreuzigte Pharaonenkatzen und Schusswaffen eine gewichtige Rolle spielen, sondern auch die »Katzenzenzi«, exilbayerische Esoterikerin, die es vom Astro-TV ins norddeutsche Dorf verschlagen hat, wo sie sich mit Vollmondseminaren eine goldene Nase verdient. Bald schon überschlagen sich die Ereignisse, es gibt sogar einen Toten … doch auf einmal beginnt Frank Schulz, aus der Komik seiner Regionalfarce heraus das Schicksal ganzer Generationen zu erzählen. Das Dorfbuch mutiert zum Weltbuch und Schulz erzählt mit einer Wucht, die den Leser umhaut. Der nächste große Schulz'sche Wurf – der würdige Abschluss einer grandiosen Trilogie. Das fehlende Puzzlestück im Onno-Universum – ein Roman mit unerwarteter Wucht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Frank Schulz
Onno Viets und der weiße Hirsch
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Frank Schulz
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Frank Schulz
Frank Schulz, Jahrgang 1957, lebt als freier Schriftsteller in Hamburg. Für seine Romane wurde er vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Hubert-Fichte-Preis (2004), dem Irmgard-Heilmann-Preis (2006) und dem Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor (2015). 2012 erschien Onno Viets und der Irre vom Kiez, 2015 Onno Viets und das Schiff der baumelnden Seelen.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Onno Viets und der Jäger der Jäger
Der eigenwilligste Privatdetektiv der Literaturgeschichte zieht aufs Dorf. Doch die Idylle trügt gewaltig. Der dritte Onno ist beileibe kein Regionalkrimi, sondern ein Roman von Welt.
Protzten Onnos bisherige Abenteuer noch mit Kreuzfahrtschiffen und Kiezoligarchen, Popmagnaten und Rotlichteskapaden, ist der Mittelpunkt der Welt beim dritten und letzten Onno Viets das Dörfchen Finkloch. Selten gab es mehr Dorfidylle auf so wenigen Quadratmetern.
Doch Onnos scheinbar beschaulicher Sommer bei den Schwiegereltern hat einen düsteren Hintergrund: Geplagt von einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung, ist der Privatdetektiv von eigenen Gnaden von Hamburg raus aufs Land geflohen. Denn seit dem dramatischen Fall um den »Irren vom Kiez« ist er nicht mehr er selbst: Nicht nur, dass er an der Pingpongplatte versagt, er leidet vor allem unter ausgewachsenen Panikattacken, die seine Tage zur höllischen Qual werden lassen. Dörflichkeit und kuscheliger Schoß der Schwiegerfamilie sollen für Linderung sorgen.
Doch natürlich stolpert Onno auch in Finkloch unfreiwillig in finstere Machenschaften, bei denen nicht nur gekreuzigte Pharaonenkatzen und Schusswaffen eine gewichtige Rolle spielen, sondern auch die »Katzenzenzi«, exilbayerische Esoterikerin, die es vom Astro-TV ins norddeutsche Dorf verschlagen hat, wo sie sich mit Vollmondseminaren eine goldene Nase verdient. Bald schon überschlagen sich die Ereignisse, es gibt sogar einen Toten … doch auf einmal beginnt Frank Schulz, aus der Komik seiner Regionalfarce heraus das Schicksal ganzer Generationen zu erzählen. Das Dorfbuch mutiert zum Weltbuch und Schulz erzählt mit einer Wucht, die den Leser umhaut. Der nächste große Schulz’sche Wurf – der würdige Abschluss einer grandiosen Trilogie.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Prolog
Teil eins
Teil zwei
Teil drei
Teil vier
Teil fünf
Epilog eins
Epilog zwei
Glossar
Dank und Anmerkungen
Meinen geliebten Eltern gewidmet
Prolog
Januar 2009
Es ist am Nordrain des Mondwaldes, wo Onno nach monatelanger zielloser Suche endlich innehält; endlich … und plötzlich. Vom Ruck an der Leine fiept Diana, und Onnos Haut im klammen Fäustling flammt auf. Unterm Stiefel zerbirst ein Spiegel aus Eis. Sieben Jahre Unglück. Durchs Krachen aufgestört, erhebt sich, fuchtelnd und fluchend, ein Rabe ins Abendgrau überm hartgefror’nen Moor.
Da. Zwischen Hohlweg und Waldrand, unter dem ausgreifenden Rankengewirr eines Brombeerbuschs, tut sich tatsächlich eine Grube auf. Überrest eines Entwässerungsgrabens, von der Einebnung ausgespart. Eben wegen des widerspenstigen Gestrüpps, vermutlich.
Gut und gern achthundert Meter vom Hochsitz entfernt, hatte Onno diese Vertiefung nicht auf der Rechnung gehabt. Im Spätsommer nicht und auch nicht im Herbst, und im übrigen ist sie selbst jetzt, trotz des Kahlschlags durch Gevatter Winter, nicht sofort als solche erkennbar. Der fahle Bewuchs, die weichen Konturen … damit das Auge die Tiefe ausloten kann, hat es offenbar einen Kontrast gebraucht. Einen Kontrast durch einen Gegenstand. Einen eigentümlichen Gegenstand; für einen – sehnenlosen – Flitzebogen etwa viel zu kurz und am einen Ende zu stark eingedreht. Zudem knochenbleich. Eine … Rippe?
Die Luft riecht nach nichts. Beinah klinisch riecht sie, so kalt ist sie. »Sitz«, sagt Onno. »Sitz, Diana.« Der Dampf ihrer Atmung: zwei fröstelnde Lebensgeister; fröstelnd, verhuscht, doch quicklebendig … heroisch auf rührende Weise. »Brav. So ist brav, nech?«
Dianas Schlappohren vibrieren, allerdings keineswegs vor Kälte. Bis in die Spitze der Rute gespannt verfolgt sie, wie Onno unters Gestrüpp in die Kuhle kriecht. Er keucht dabei. In Abständen ächzt er, und als der Strauch einen Widerhaken in seine Kopfhaut zieht, seufzt er scharf auf – schimpfen aber tut er nicht.
Onno Viets. Ähnlich zäh wie das Dornendickicht.
Ein paar Tage später verfluchte ich ihn. Ich, Dr. jur. Christopher Dannewitz, ihn, meinen Mandanten und Gelegenheitsdetektiv, vor allem aber Sports- und Busenfreund seit Jahrzehnten. Verfluchte ihn bis in die Steinzeit und zurück … plus sieben Jahre in die Zukunft.
Teil eins
Mai 2005
… das gute, fromme, ebene Land …
Ludwig Tieck, »Der Runenberg«
Den Tag, an dem ihr Vater seinen siebzigsten Geburtstag beging, verklärte Edda später gern. Vielleicht, weil die Feier so schön und lustig verlaufen war – jedenfalls überhöhte sie den Tag später zu einem, an dem die Welt noch in Ordnung gewesen sei.
Sicher: Noch ungeschehen war die folgenschwere Gründung der ›Detectei Viets‹ im April 2007 (zu schweigen von Onnos sonderbarer, einsamer, irreführender Kreuzfahrt mit dem gräßlichen Ende im Oktober 2013). Es war Eddas geliebte Großmutter noch am Leben … Knut Wiesmanns Gebiß noch nicht entweiht … noch kein nächtlicher Schußwechsel im Revier vorgefallen und überhaupt der Mondwald noch kein Ort des okkulten Schreckens, der Eddas Vater und seine Jagdfreunde bedrohte. Und die Schicksale von Onno, Edda und meiner Person waren noch nicht derart miteinander verwickelt, wie sie es am Ende dieser Moritat sein würden. Doch gärte all das bereits im Sumpf der Zukunft.
Allemal war es der süßeste Maitag gewesen, den man sich nur wünschen konnte. Halb Finkloch war eingeladen und die Stimmung überwiegend leichtherzig; war das Dörfchen für Weltanschauungen im besonderen zu klein, so der Garten der Baenschs im allgemeinen groß genug, und was die Generationen anging, so begegneten sie sich im Geiste dessen, was doch möglichst ihre Ursache sein sollte: Liebe.
Die Anfahrt von Hamburgs Stadtgrenze dauerte, Stau oder nicht, stets achtundachtzig Minuten. Bildlich gesprochen. Die liegende Acht ist bekanntlich das mathematische Zeichen für unendlich, und wahrlich, wenn etwas an Endlosigkeit gemahnte, dann die Fahrt von Hamburg nach Finkloch. Die Dreiviertelstunde Autobahn war halbwegs erträglich, aber die über Land zog sich. Ausschließlich Tempo siebzig war erlaubt, sei’s wegen etlicher Straßendörfer, sei’s wegen all der Kehren und Windungen in den Wäldern, wo überdies alle naslang vor starkem Wildwechsel gewarnt wurde.
Irgendwann aber tauchte es doch auf, jenes paradiesische Fleckchen. Kaum jemand kannte es … außer seinen dreihundertelf Ureinwohnern, einer zugegebenermaßen wachsenden Anzahl Rad- und anderer Wanderer sowie den Patientinnen einer gewissen Bayerin. Und die nannten Finkloch nicht Finkloch, sondern Funkloch.
Wie Bongotrommelwirbel klang’s, als Onnos und Eddas Ford Ka übers blütenbestreute Kopfsteinpflaster der Kastanienallee auf den reetgedeckten, denkmalgeschützten Fachwerkbau des Kühl- und Feuerwehrhauses zurollte. Sodann umkurvten sie den Löschteich. Hinter den Vorhängen der fünf Monet’schen Trauerweiden lud je eine Bank aus roh behauenem Birkenholz ein, vom Boßeln oder Nordic Walking auszuruhen. Und zu unken, was sich wohl unter dem hochflorigen Teppich aus Entengrütze verbarg. Oder mobil zu telefonieren: Hier am Ortsrand war die Wahrscheinlichkeit von Netzempfang noch am höchsten.
Vom dortigen Dorfplatz schließlich zweigten die Wege ab wie die Zinken einer Mistgabel, bis die anliegenden Siedlungen aus Rotklinkerhäuschen und (in der Mehrzahl umgebauten) Bauernhöfen an die Grenzen stießen: Felder (einst vorwiegend Korn und Rüben, heut vorwiegend Raps und Mais), Forst (Nadel-, Laub- und Mischwald), ein bißchen Heide, ein See sowie das trockengelegte Moor.
Um zu den Baenschs zu gelangen, hatte man jahrzehntelang den linken Zinken wählen müssen, der am Forsthaus nebst Lärchenhain endete. Die Ära war vorbei. Und es war wohl kein Zufall, daß Edda ausgerechnet in dem Moment, da Onno den rechten Abzweig einschlug, die Frage stellte, die er seit Tagen erwartet hatte: »Meinst du, Nelkenheini taucht auf?«
»Weiß man nicht, nech?« sagte Onno. »Weiß man nicht. Aber ich glaub das nicht.«
Wie lieb er damals noch zu ihr gewesen war, dachte Edda später unter unsäglichen Leib- und Seelenschmerzen, wenn sie sich jenes Tages als desjenigen Tages erinnerte, an dem die Welt noch in Ordnung gewesen zu sein schien; wie lieb, wie alltäglich unbeschwert mit seinen fünfzig Lenzen, und wie unschuldig …
Nicht, daß der Ford Ka ihre barocke Figur allzu sehr beengte … nichtsdestoweniger enervierte Edda die Fahrt oft. Sobald jedoch der Jägerzaun entlang der Längsfront des Baensch’schen Hauses in Sicht kam, wurde Edda Viets, geb. Baensch, wieder von jener Freude und Geborgenheit durchströmt, welche die Zugehörigkeit zu einer liebevollen Familie zu schenken vermag. Als sie den Schlag des Kleinwagens zuwarf, erkannte sie am Ende der Straße – die dort in eine mit Verbundstein gepflasterte Buckelpiste überging (und letztlich in verschiedenen Etappen durch die Feldmark weiter zum Mondwald und in die Heide, ins Moor und an den See führte) – zwei Rehe.
»Guck mal«, sagte sie, »guck dir das an.«
»So dicht«, sagte Onno, »so dicht am Dorf.«
Nach ein paar staunenden Augenblicken lenkten die Eheleute ihre Schritte in die Zufahrt. Edda öffnete das Türchen im niedrigen Tor, und jaulend kam die zuverlässigste Glücksbotin des Hauses auf sie zugerast, springteufelte auf sie ein und machte Anstalten, sie zu küssen. Mit Zunge. Die nach Karnickelaas roch. »Ja meine Süüüße!« winselte Edda. »Ja was machst du denn! Ja wo bist du denn! Ja, ja, ja, ja, ja!! Jaaaa, du bist brav … ganz Brave bist du … jaaaaa … so. Aus. Aus, Diana! Nu is gut. Ja, nu is gut.«
»Tochter!« tönte es darein, von links, vom Gartenhäuschen her. »Größte Tochter aller Zeiten! Was machst du denn! Wo bleibst du denn!«
»Henry!« schimpfte es postwendend aus der entgegengesetzten Ecke. Eddas Mutter, noch unsichtbar hinterm Haus. »Mach doch nicht schon wieder so ’nen Wind!« Und unweigerlich folgte jener Ausdruck von Gegenwind, der typisch für sie war: »Horr…!« Der Anklang, als verschlucke sie die zweite Silbe des Wortes Horror, täuschte aber. In Wahrheit war es eine Äußerung von Zuneigung, tief und bombenfest verwurzelt. Bloß, daß sie die aufgelaufenen Kosten der baldigen goldenen Hochzeit mitreflektierte. Ein Trugschluß, Liebe nähre sich ausschließlich von Eierkuchen.
»Ja, wir warten doch schon alle! Komm her, Größte, Liebste …!« Und mit ausgebreiteten Armen eilte Eddas Vater herbei und koste und herzte sie – ein wenig so, als sei sie nicht grad achtundvierzig geworden, sondern vierzehn. Und als sei sie das Geburtstagskind.
Einen Meter achtzig groß, repräsentierte Henry Baensch den einsamen hageren Zweig der Familie. Eine beneidenswerte Frisur aus hunderttausend Silberfäden krönte das Haupt, ein Schicksalskeil spaltete die dreifach gefurchte Stirn über der Nasenwurzel, und unter den schwarzen Brauen trauerten kastanienbraune Augen, in dunkleren Höhlen als ehedem, doch seelenvoll wie je. Ein Amtsförster a.D. wie aus dem ZDF … wäre da nicht jene Trübung des Nimbus. Die allerdings nur Vertraute bemerkten.
»Wieso«, sagte Edda, »wir haben doch extra noch mal angerufen, daß wir’s erst zu halb zwölf schaff’nnnnn!« In der Stimmhaftigkeit des Schlußkonsonanten verströmte sie gern ihre Emotionalität. Die Tonhöhe hielt dabei eine vage rhapsodische Spannung.
»Jaja!« meinte ihr Vater.
»Ja!«
»Ja, aber ist doch schon zwanzig vor! Ist das ›halb‹? Wohl kaum, Komma!«
»Papa!! – Horr…« Ging es um Familienangelegenheiten, stimmte Edda oft in den Tonfall ihrer Mutter ein.
Um sich weiterer Kritik seiner ältesten Tochter zu entziehen, klagte Henry ihre Gratulation ein … dabei hatte sie ihm schon am Telefon gratuliert. Ihren anschließenden Neuansatz zur Nörgelei vereitelte er, indem er seinen Schwiegersohn empfing; immer noch mit Überschwang, doch maskulin angepaßt.
Während Onno ihn auf die Straße lotste, um ihm die beiden Rehe zu zeigen – sie waren allerdings mittlerweile verschwunden –, begrüßte Edda Knut Wiesmann, den greisen Freund des Hauses. Vierzehn Jahre lang hatte er Henry als Forstwirt gedient (gemeinsam mit einem weiteren namens Klaus-Dieter Heinrich), und auch im Ruhestand noch weitere zehn Jahre. Mittelgroß war er und drahtig, und die Bräunung der Schädeldecke glänzte durch die Schäfchenwolke seines Schopfs. Heller als sein Haar noch strahlte das Gebiß, das eine Nummer zu groß schien. Ständig machte er Geräusche damit. Damit, und überhaupt. »Mensch, Edda … mm-nn-rrrrrr … Edda, Edda … Mensch, ich bin vielleicht nervös, du! … Ft, ft.«
»Jetzt schon, Knut?«
Er war es, der am Abend die Hauptrede hielt.
»Ja! Nn. Ja! Wt, ft. Mensch, Mensch.« Es war, als grinste er unentwegt – doch war es zumeist Konzentration … oder auch Selbstvergessenheit. Ab und zu hackte er ein-, zweimal mit dem Gebiß, als feuerte er sich an oder weckte sich auf. In der Linken hielt er eine Schweißerbrille. Irgendwas hatten die beiden zu schweißen da im Gartenhäuschen.
Giebel vis-à-vis Giebel, wirkte es auf den ersten Blick wie eine Miniatur des Wohnhauses. Doch war es eingeschossig und nicht aus rotem Backstein, sondern aus Fichtenholz, mit inzwischen verbotenem Karbolineum imprägniert, und das geschindelte Satteldach flacher. Die straßenseitige Fassade ein Puzzle aus zahllosen Querschnitten von Holzscheiten. Gegenüber auf einem Gaskocher ein voluminöser emaillierter Topf zum Abkochen von Rehbockschädeln. Daneben stöhnte ein Komposthaufen.
Die andere Seite öffnete sich dem sonnendurchleuchteten Garten mit meisterhafter Klempnerei (halbrunde Dachrinne mit Rinnenhalter und Fallrohr aus Titanzink), malerischem Fensterkreuz nebst zwei Kästen voller Tagetes in den herzerwärmendsten Rot- und Gelbtönen sowie möblierter Terrasse. Außen grenzten Feldsteine das dichte Rasengras von den mäandernden Säumen der Pflanzenbeete ab, innen Kantsteine von der rechtwinkligen Zufahrt in den engen Hof. Den Angelpunkt markierte die alte Eiche, deren Stamm von einer sechsgliedrigen Sitzbank umzingelt wurde.
Dieser Garten war Betty Baenschs Leidenschaft. Eine dankbare Leidenschaft. Buchfinken besichtigten das luxuriöse, strohbedachte Vogelhaus, das auf dem abgesägten Birkenstamm thronte, der hoch über einem gelben Trollwäldchen aus Kriechspindel emporragte. Auf einem krummen Stuhl aus Ästen derselben Birke stand ein Topf Fuchsien mit baumelnden roten Kelchen. Hornveilchen strahlten zu ihnen auf, als lebten sie von ihren Seelenpollen. Zart sprossen Waldphlox und Vergißmeinnicht, und eine rare Biene taumelte volltrunken aus dem Etagenschneeball in die Hortensien, von den weißen und lilafarbenen Akeleien in den Azaleenbusch, vom Steinkraut in die Fleißigen Lieschen.
Unbefangen duschte Amselweib- mit -männchen auf dem kleinen Fels unterm kleinen Wasserfall am kleinen Teich – obwohl unmittelbar daneben, unter der Pergola an der Jägerstube, geprünt wurde. »Was prünt ihr denn da«, schmetterte Edda voraus, und die Selbstverständlichkeit, mit der ihr dieses hübsche niederdeutsche Wörtchen für Nähen einfiel, hob ihre Stimmung. (So sehr, daß sie Tage später, zurück in Hamburg, beim Gedanken daran fast zu weinen beginnen sollte. Zu ihrer eigenen Überraschung. Aus spontaner Sehnsucht nach der Sprache ihrer Kindheit entschied sie, zwei Karten à fünfzehn Euro fürs Ohnsorg Theater zu besorgen. Eine Summe, von der sie und Onno gewöhnlich drei Tage zu existieren vermochten.)
Betty Baensch aber, die den Puffärmel einer Folklorebluse reparierte, sagte: »Er macht schon wieder einen Wind den ganzen Vormittag«, sagte sie, »das glaubst du nicht. Und seit ’ner halben Stunde alle fünf Minuten: ›Wo bleiben sie denn, wo bleiben sie denn‹ …«
»Aber wir haben doch extra noch angerufen, daß wir –«
»Direkt danach ist die Standuhr stehengeblieben. Und das, nachdem ihm schon beim Brötchenholen zwei schwarze Katzen übern Weg gelaufen sind; und heut nacht hat er von einem Korb voll Kirschen geträumt.«
»Gott«, sagte Edda. Henrys Aberglaube war legendär.
Ein Blaumeisenpaar flatterte vom Blauregen hinüber in die Hemlock-Tanne und von der Hemlock-Tanne herüber in die Mädchenkiefer.
»Ach Mama«, seufzte Edda, am Terrassentisch angekommen. »Erst mal hallo!« Gurrend umarmten sie sich, und auch Schwester und Schwager begrüßten sie; Rosemarie außer mit Freude in geübter Sorge, Peter außer mit Freude zugleich in jener Miesepetrigkeit, die weder Frau noch Tochter oder Söhnen mehr auffiel – vielleicht nur ihm selbst.
Nach dem üblichen schwiegerlichen Geplänkel überließ Onno Henry dessen ehemaligem Forstwirt. Im Gartenhäuschen – von innen eine passable Allzweckwerkstatt – schweißten sie an einem ausladenden Grill.
Als Onno von jener Gartenterrasse über den Rasen zu derjenigen unter der Pergola hinüberstapfte, dachte er etwas wie: Die drei Grazien muß man gesehen haben … Bronzelockig, blauäugig und strotzend vor Stabilität eine wie die andere, unterschieden sie sich in ihrer Art der Ausstrahlung denn doch. Müßig zu erwähnen, daß die eine Jahre älter war und wirkte als die beiden andern. Zwar verströmte sie unerschütterliche mütterliche Autorität, unterfüttert jedoch von der Bereitschaft, jederzeit nachzugeben – ihren Kindern jedenfalls, jedenfalls seit sie erwachsen waren. Leid hatte sie das gelehrt. Das Leid mit Nelkenheini.
Momentan war ihr augenfälligstes Merkmal allerdings die Signalfarbe der Nase. »… und dann«, näselte sie, »bin ich trotz meinem Schnöf extra zu ihr rübergelaufen …« Die Rede war von ihrer Mutter.
»Warum das denn?« fragte Edda. »Warum hast du sie nicht angerufen?« Ihr Lächeln schien fast wund vor vielgestalter Sinnlichkeit. Hübsche Zähnchen rahmte es, Zähne so weiß wie ihre Haut. Hauchblau wie ein Wasserzeichen das Aderndelta im Dekolleté. Blauer aber ihre Augen, die aus den brauengekrönten, sommersprossigen Grotten wie Unterwasserstrahlen hervorleuchteten. Für diese Augen würde Onno, ohne mit der Wimper zu zucken, seine eigenen geben.
»Weil Oma momentan nicht ans Telefon geht«, sagte Rosemarie. Nein, quakte Rosemarie. Ihr Timbre ähnelte dem Daisy Ducks. Sie kultivierte es, um angsteinflößende Einflüsse zu verniedlichen. Ja, phasenweise schien sie sich mit der gesamten Außenwelt nur noch im Umgangston Entenhausens verständigen zu mögen.
Anderthalb Jahre jünger als Edda, fehlte Rosemarie doch deren Unbeschwertheit. Gut, sie war buchstäblich schwerer noch, und nicht nur, weil fünf Zentimeter größer. Den Ausschlag aber gab wohl die sonderbar lastende Intelligenz im Blick. Ein irritierender Gegensatz zum Entensopran.
»Sie geht nicht ans Telefon?« fragte Edda. »Wieso das denn nicht?«
»Weil sie Angst hat«, quakte Rosi, »daß giftige Dämpfe austreten.«
»Oh nee …« Edda seufzte dumpf. Spröder Knacks im Herzkranz. Die Liebe zu ihrer Großmutter war eine besondere; bedingungslos, unverbrüchlich, und ebendeswegen in einer ganz gewissen Hinsicht – belastend. Schamerfüllt.
»Na jedenfalls«, erzählte Betty nasal, »bin ich trotz meinem dicken Kopp extra zu ihr rüber, und hab gesagt, »Ick hef morgen fröh keen Tied, Mama« – um ihre Entschiedenheit nachzustellen, imitierte sie ihre eigene Intonation –, »ick mutt noch mien Rezept afholn. Und was sagt sie? Du dienkst ok blots an’t Freten.«
Hellauf lachten sie; lachten mit dem gleichen klingelnden Akzent, und das Entzücken des Wiedersehens war ganz auf Onnos Seite.
»Was meinst du«, fragte Onno, das Glas ansetzend. Kurz unschlüssig, sog er dann doch unterm schrägen Schaumpfropfen einen Schluck Bier heraus, schluckte umständlich, aber gewissenhaft, und vollendete erst dann seine Frage – leise genug, daß nur Adressat Peter ihn verstand (und höchstens noch ich): »Ob Nelkenheini wohl kommt?«
Mittag und Nachmittag waren in gemeinschaftlicher Betriebsamkeit verflogen. Pünktlich hatte der Monopolist für Partyservice aus dem vierunddreißig Kilometer entfernten Kreisstädtchen Geestend Mobiliar und Ausrüstung angeliefert und installiert. Das Lüftchen, das die Arbeiten erleichtert hatte, war versiegt, nun, da die Sonne allmählich ausbrannte … und es folgte die Stunde einer duftenden Abendwärme. Längst erschallte der Garten in Geplauder aus ungefähr neunzig leutseligen Kehlen, inzwischen einschließlich meiner und Meikes. Mit Onno und Peter dem Miesepetrigen und einem halben Dutzend weiteren Anverwandten des Jubilars saßen wir auf der Pergola-Terrasse, in nächster Nähe übrigens Oma und Tante Hertha.
»Weiß der Teufel«, so Peters Antwort auf Onnos Frage.
»Weiß der Teufel«, griff Oma sie auf … versonnen … versponnen … Und vielleicht weil sie sich stets vorkam, als heuchelte sie, wenn sie hochdeutsch sprach, dolmetschte sie plattdeutsch hinterdrein: »Dat weet de Düwel.« Worum es überhaupt ging, dürfte sie schlechterdings kaum mitbekommen haben.
Tante Hertha neigte sich zu ihr und legte ihre Hand auf ihre Hand: zwei Eichenblätter vom letzten Winter. »Wat seggst du, mien Deern?« Dreiundneunzig Jahre alt – wie Oma, ihre Kusine –, war sie jedoch wacher geblieben als diese. »Wat sall de Düwel woll weeten?«
»Dat weet de Düwel«, wiederholte Oma, freundlich, ja eilfertig. Ahnend aber, daß diese ihre Aussage sich auf nichts bezog – ja fürchtend, daß sich alle ihre Aussagen, ja womöglich menschliche Aussagen grundsätzlich kaum jemals auf irgend etwas Wesentliches bezogen –, lachte sie gleich darauf. Das helle Klingeln ihres Gelächters: Matrix für das ihrer Tochter und Enkeltöchter und Urenkeltochter.
Nickend ließ Tante Hertha es dabei bewenden.
Onno zupfte Tabak aus dem Beutel und zog ihn auf ein Blättchen.
»Guck«, sagte Peter und hielt ihm seine qualmende Zigarettenspitze hin. »Solltest du dir auch anschaffen. Austauschbarer Filter. Kieselgel. Gesund.« Da er auf dem Gymnasium der Kreisstadt Lehrer für Sport und Biologie war, verstand sich die Ironie von selbst. Er hatte seine Zigarette gerade so gut wie aufgeraucht, und also demonstrierte er Onno anhand einer unscheinbaren Fingerbewegung, wie man die Kippe hinauspreßte. »Auswurfautomatik.«
»Ih gitt«, rutschte es meiner Meike heraus – im Grunde hatten wir alle etwas ähnliches schon ein Weilchen erwartet –, und da mußte selbst Miesepeter lachen. Desgleichen Oma, warum auch immer. Vielleicht bloß, um etwas zu lachen zu haben in den letzten fünf Wochen ihres Lebens. Onno aber wußte genau, weshalb er sein gütiges Grienen griente. Ohne daß Meike es merkte, griente er mir zu.
Meike Meidlitz, neunundzwanzig, neunzig-sechzig-neunzig und Magistra der Medienwissenschaften. Eigentlich Meike von der Meidlitz, aber sie wollte »weg von der Aristokratenhybris«. Als ich sie daraufhin Meike weg von der Meidlitz nannte, holte sie sich allerdings eine Schramme am Grenzbaum zur Selbstironie. Oder mindestens eine Laufmasche.
Wir kannten uns erst zwei Wochen, und nicht nur deshalb hatte ich es eigentlich für unpassend erachtet, sie zu diesem Anlaß mitzunehmen. Zeitweilig intellektuell beeinträchtigt, ließ ich mich jedoch von ihrer Engelszunge betäuben. Zumal sie sich doch beinah entleibte vor Ergötzung, als sie von all dem vollauthentischen Landleben hörte, und Förster und alles … Nun, Finkloch, es sollte ihr Waterloo werden.
Um die angeblichen ersten Erfolge einer akuten Kohlsuppendiät zu feiern, hatte sie sich in Hamburgs City ein Kleid von Che+She gegönnt. Doch schon während der Begrüßungsarien ahnte sie, daß sie im Baensch’schen Garten keinen Blumentopf damit gewinnen würde. Ebensowenig mit ihrer Hochsteckfrisur, einer Art Horst; Henry schaute besorgt, als könnte ein Bussard drin landen. Als sie sich auf dem Rasen so köstlich unkonventionell ihrer goldenen High-Heels von Arturo Hop entledigte, heimste sie immerhin einen Flirtversuch des greisen Knut Wiesmann ein: »Na Hauptsache, Füße gewaschen, nn? Ft, ft.« –
Die jeweiligen Empfindungen der übrigen Gäste bei ihrem Anblick hätten kaum unverhohlener gespiegelt werden können. Allenfalls angesichts einer Äthiopierin mit Tellerlippen. Eddas Miene etwa vermittelte unzweideutig andächtiges Staunen.
Vielleicht war Meike das ländliche Kleinbürgertum denn doch zu authentisch, oder die Kohlsuppendiät hatte ein erstes böses Omen erzeugt, oder sonstwas – jedenfalls schien es bereits eine Stunde nach dem Empfang, als habe sie nur auf ein Reizwort wie »Auswurf« gewartet, um unauffällig eine Äußerung aufgestauten Mißbehagens fahren lassen zu können.
Die Krönung war womöglich Jenny. So einiges hatte Meike sich auf diesem Parkett vorstellen können, Anmutskonkurrenz nicht. Und so dürfte es ihre Laune kaum gebessert haben, als sie Onno zu Peter sagen hörte: »Ist ’ne Wucht, nech?, deine Tochter!« Unversehens suchten des Schwagers Muffelmiene Stolz und Innigkeit heim, während Onno mit dem äußersten Wohlgefallen, das auszudrücken er nur fähig war, fortan den Weg Jennifers durch den Garten verfolgte.
Die Lichtgestalt der Sippschaft. Niemand würde das bestreiten (außer sie selbst). Jeder rief Jennifer Jenny, und wer sie so rief, hoffte auf Abglanz. Zweiundzwanzig Jahre alt, absolvierte sie bereits das sechste Semester im Münsterland. Als Hauptfach hatte sie Komparatistik/Kulturpoetik belegt – für ihre Großeltern ein Buch mit sieben Siegeln, noch für ihre Eltern mit drei bis vier. Zu deren Leidwesen sie nur mehr selten auf Heimatbesuch kam: zu umfangreich das Studium, zu aufwendig die Jobs, um es zu finanzieren. Zumal jede übrigbleibende Minute ihrem Engagement in ökologischen und politischen Initiativen, in vielfältigem Netzaktivismus und dem Laientheater galt.
Gestartet hatte Jenny ihre Kredenztour anhand eines Tabletts voller Gläschen mit Kräuterschnaps unterm Dach der Doppelremise zwischen Jägerstube und Hintereingang des Hauses. In den Reihen von Bierbänken und -tischen hockten Töchter von Tanten und Basen von Vätern, Onkel von Müttern und Vettern aus Dingsda, je nach Gusto in Sonntagsstaat oder legerer Garderobe – darunter Betty, Rosi und Edda (Onnos Eltern lagen beide im Krankenhaus) –, die allermeisten hungrig, durstig, schunkelfest; geselligkeitsgestählt bis in die frisierten Haarspitzen. Dort wurde Jenny von Knut Wiesmann zum ersten Mal gestellt. Mit weißem Kopf nickte er auf sie ein und hackte mit weißem Gebiß vor ihr herum, während er mit braungebrannten Fingern ihre Schulter berührte oder ihr Schulterblatt.
Mit Ziel Gartenterrasse überquerte Jenny dann eine kleine Tanzfläche auf dem Verbundsteinpflaster der Zufahrt, vorbei an der Verstärkeranlage samt Keyboard und Mikrophonständern und Schlagzeug einer noch unbemannten Kapelle. Auf dem Fell der Baßtrommel stand in biedermeierlichen Lettern ›Finklocher Dörpsmus’kanten‹. Am Tisch vorm Gartenhäuschen rauchten die Honoratioren vom Ortsrat Zigarren – Walter Hartmöller und Adolf Petersen, Wolfram Porst und der einundneunzigjährige Ehrenbürgermeister Joseph Bock, um nur die wichtigsten zu nennen –, und indessen Jenny Schnaps verordnete, holte Knut Wiesmann sie auch dort ein, setzte ihr mit seinem typischen Hahnentritt nach – leicht vorgebeugt, schrittweise vorruckendes Kinn – und hielt sie im Schnack auf.
An den drei Stehtischen auf dem Rasenfilet, vorsorglich, doch glücklicherweise unnötigerweise überdacht von Marktschirmen, amüsierten sich Elfriede und Günther Hornbach, das amtierende Königspaar des Schützenvereins Finkloch, mit dem zweiten Vorsitzenden und der Jugendobfrau des Sportvereins Finkloch, Gerold Heinßen und Barbara Thomsen-Nieth; ferner die Heimatvereinsmitbegründer Herbert und Ewald ,Schnucki’ Erzfeldt überkreuz mit ihren Eheweibern Mimi und Olga, beide einst maßgeblich am Aufbau der Gymnastiksparte des Sportvereins beteiligt; außerdem Jelle Jensen mit Krischan Heidkamp und Arnulf Toppin mit Klaus-Dieter Heinrich, Waidmänner im Finklocher Revier alle vier, letzterer neben Knut Wiesmann einst der zweite Forstwirt Henry Baenschs. Gerade erzählte er zum wahrscheinlich eintausendsten Male die Anekdote, wie er sich im Zuge seiner Finklocher Einbürgerung Bürgermeister Bock vorgestellt hatte: »Mien Nom is Klaus-Dieter Heinrich, hef ick seggt, und he, wat seggt he? – Jo, wat denn nu.« Beinah ebenso bekannt war er für seine Fähigkeit, Tierstimmen zu imitieren – neben denen aus heimischem Feld und Flur auch Flipper, den Fernsehdelphin der sechziger Jahre.
Unter der Eiche hielt ein Witwenkarussell aus dem Altenkreis ihr Schwätzchen, und Männerduette fachsimpelten vor den beiden schmiedeeisernen Grillöfen (repariert), den die Betreiber der ehem. Metzgerei Gebr. Poppenkamp, Inh. Hein und Fietje Poppenkamp, grad mit aufstaubender Holzkohle zu beschicken begannen.
Jedes all jener ohnedies fidelen Grüppchen blühte schier zusätzlich auf, sobald Jenny ihr Tablett darreichte. Die Bläue ihrer Augen, der Sprengel von Sommersprossen übertrafen selbst die ihrer Tante Edda noch im Ausmaß der Macht, Entzücken hervorzurufen. Ihre Mähne spiegelte sowohl Peters einstige Rappenhaftigkeit als auch Rosis Füchsinnenton wider, und so war sie schon als Abiturientin in der Schulinszenierung einer keltischen Sage die Idealbesetzung der Fee gewesen.
Nach den einzelnen Stationen galt es jeweils für Nachschub zu sorgen – aus einem mannshohen, bis an die Zähne bewaffneten Kühlschrank, der dem Tresen samt Zapfanlage angegliedert war. Hier, in nächster Nähe zur Pergola-Terrasse, walteten Jennys Brüder Dennis und Tim. Der ältere, kräftigere zapfte Bier, der jüngere, schlaksige spülte Gläser, schenkte Wein und Köm aus und schäkerte zwischendurch mit seiner Urgroßmutter und Tante Hertha.
Es war der letzte Bundesligaspieltag der Saison – als Deutscher Meister stand seit Wochen, wenn nicht seit Jahren Bayern München fest –, und soeben war, wie die jungen Männer diskret per Kofferradio verfolgt hatten, die Begegnung zwischen Hannover 96 und Hertha BSC zu Ende gegangen.
»Null null, Tante Hertha? Schwaches Bild!«
Dennis drehte das Messer in der Wunde um. »Torlos-Tante!«
Stunden bereits amüsierten sich die Geschwister damit, den jüngsten Avantgardismus der Sprachentgleisung zu parodieren. Seit geraumer Zeit grassierten in den Boulevardzeitungen Komposita von Eigenschafts- und Hauptwort. Eine Kindsmörderin wurde als Gnadenlos-Mutter tituliert, ein Musiker als Düster-DJ, eine Figur aus dem Privatfernsehen als Peinlich-Schäfer.
»Wat?« Tante Hertha wirkte sachte angefaßt, und da Tim bloß feixte, wandte sie sich an Peter: »Wat het he seggt?«
Bevor der auch nur abwinken konnte, schaltete sich Jenny ein: »Mach dir nix draus, Tante Hertha!« rief sie. Zu allem Überfluß war ihr Alt-ähnliches Timbre Musik noch in den stumpfsten Ohren. »Ist ja auch voll fies, elf junge Kerle gegen eine alte Dame! Taktlos-Brüder!« In dem Moment bemerkte sie Bewegung in ihrem Rücken. »Oh mein Gott«, murmelte sie noch – indes, zu spät. All wedder kam Knut Wiesmann im Hahnentritt herbeigeschaukelt. Inzwischen wedelte er mit einem Manuskript herum wie mit einem Fächer.
»Immer noch nervös, Onkel Knut?« flötete sie.
Schon als sie vierzehn war, hatte er ihr zu untersagen versucht, ihn weiterhin mit Onkel anzusprechen, und schon damals vermittelte ihr ihre Intuition, daß sein Motiv nicht ausschließlich auf demokratischer Generosität fußte. Weswegen sie unverwandt entgegnet hatte: »Wie denn? Opa Knut?«
»Wohl kaum, Komma«, hatte er seinerzeit den kryptischen Lieblingsspruch seines Chefs und Idols nachgeplappert, gekränkt, versteht sich: liebte er doch das Selbstbild vom alterslosen, unverwüstlichen Naturburschen – ein anderes Idol war Luis Trenker – und pflegte es; siehe Teint, siehe Gebiß. Notorisch lustiger Witwer, kam er an keiner Frau unter sechzig vorbei, ohne ihr seine braungebrannten Finger auf Schulter oder Schulterblatt zu legen. Allerdings kannten sie ihn in Finkloch alle. Ist ja gut, Knut.
Seine Familientreue hatte etwas Vasallenhaftes, das Henry mal rührte und mal peinigte, doch nach wie vor selten gleichgültig ließ. Daß Knut es sein mußte, der die zentrale Rede zum Siebzigsten seines Exchefs hielt, war unabdingbar. Zumal er schon die zum Sechzigsten und die zum Fünfzigsten gehalten hatte – und ohnehin für seine Meriten als Dorfchronist ackerte.
Allerdings vornehmlich im stillen Kämmerlein; und so drohte sich sein akutes Lampenfieber zur Psychose auszuwachsen. »Ja klar«, hechelte er, und sein Gebiß blendete sie, »immer noch aufgeregt … ft-pft … Du bist doch Profi, Jenny, du bist doch erprobt, du stehst doch dauernd auf der Bühne … mm … äh Bühne, ja. Wie machst du denn das? Wie machst du denn das? Wie machst du denn das! Wt, ft. Wie … machst du denn das.«
»Na ja«, sagte Jenny. »Aufgeregt bin ich ja auch. Kraß aufgeregt. Gehört doch voll dazu.«
Zähnefletschend wandte Knut sich an Tim. »Und du? Mm. Du auch? Rrrrr. Du doch auch, oder? Nn. Oder du nee, du schreibst ihr nur die … rrrrr … die Stücke? Mm. Nn. Ft, ft.«
»Eins, Knut«, sagte Tim, der grad frustiert sein Handy wegsteckte. Null Balken. »Ein Stück hab ich ihr mal geschrieben. Am zweiten sitz ich grad.«
»Am zweiten sitzt du grad? Mn’am … zweiten … sitzt du grad? Ft, ft. Wie soll’s denn heißen?« Er grinste wie des Wahnsinns fette Beute, und unterdessen hackte er zweimal mit den Zähnen. Zwei- bis dreimal.
»Hab noch keinen Titel«, sagte Tim.
»Hast noch keinen Titel? Hast noch keinen Titel? Rrrrrrrr Mensch, ich weiß gar nicht, ich muß – mmmmm …«
Hektisch wandte er sich um. Aus den Augenwinkeln hatte er etwas entdeckt. Zwei, drei Schritte an den Rand des Beets. »Kßßßßß! Kßßßßß!« Eine rotgeflämmte, weiße Katze machte auf dem Grat des Zauns zum Nachbarn kehrt.
Auf der Tanzfläche formierten sich sechs Männer unterschiedlichen Alters in grünen Kniebundhosen und Jankern mit Hornknöpfen. Davor nahmen vier Frauen in wadenlangen roten Faltenröcken, weißen Blusen und grünen Jacken Aufstellung. Alle hatten ein kleines Jagdhorn in der Hand, bis auf Klaus-Dieter Heinrich, der ein Parforce-Horn. Es herrschte ein kleiner Aufruhr, denn Henry – bis zum Kragen in seinem Element – rief händeringend: »Ich auch? Ach du lieber Himmel! Ach du lieber Himmel! …« Nun, so überraschend war es nicht. Immerhin war er Mitbegründer der Truppe. »Na, dann will ich mal mein großes Horn rausholen!«
Worauf hinterm Tresen Tim und Dennis in schlüpfriges Gelächter ausbrachen. »Schamlos-Enkel«, gackerte Jenny flankierend, während sie frustriert ihr Mobiltelefon in der Handtasche verstaute – null Balken –, und Tim tönte: »Jetzt hab ich einen! Jetzt hab ich einen Titel!«; und Knut, der das grad noch mitkriegte, fragte erregt nach: »Jetzt hast du einen … einen Titel? Was für einen denn? Was für einen Titel hast du denn? Rrrrrr –«
»Na, dann will ich mal mein großes Horn rausholen!« zitierte Tim, und auch Knut mußte lachen – wobei offenblieb, ob vollständig im Bilde, worüber. »Na, dann will ich mal mein großes Horn rausholen!« wiederholte er und lachte noch einmal, um sich dran zu gewöhnen. Bei der Sache war er sichtlich nicht. Das Lampenfieber dampfte ihn förmlich ein.
Zwecks Verdrängung begann er, mir einen Erfahrungsaustausch hinsichtlich unserer Autos abzupressen. Obwohl in fußläufiger Entfernung wohnend, war er hergefahren, um seine Geschenke leichter transportieren und bis zur Stunde X verborgen halten zu können, und er hatte sie gerade mit einer Wolldecke getarnt, als Meike und ich direkt neben ihm eingeparkt hatten. Wir fuhren das gleiche T-Modell der C-Klasse, nur mit unterschiedlicher Maschine. Die Genugtuung, mit einem promovierten Juristen aus der Metropole Hamburg auf Basis eines Vorsprungs in Höhe von fünfundfünfzig Pferdestärken verkehren zu können, kostete ihn Hackdoubletten en gros … doch er zahlte sie mit hörbarer Wonne.
Um jedoch endlich seine Rede hinter sich bringen zu können, hatte er noch etliche Programmpunkte abzuwarten.
Zunächst das kleine Potpourri von Jagdhornsignalen. Nachdem Henry sein großes Horn aus der Jägerstube geholt hatte, gesellte er sich, als einziger in Zivil, zu dem anderen Parforce-Hornisten, und beide stellten sich im rechten Winkel zur uniformierten Formation auf. Die das jeweils hüft-gestützte Horn auf ein pointiertes Nicken ihres Leiters choreographisch ansetzte und die Begrüßung spielte. Dennis filmte mit einer kleinen Handkamera. Anschließend folgte Sau tot und schließlich Jagd vorbei, Halali! Insgesamt recht sauber, nur fünf, sechs Töne hatten sich verselbständigt, teils als feuchtwarme Luft, teils als etwas, das danach klang, was es beschwor: sterbende Sau.
Meike, die die ganze Zeit an meinem Arm hing, wand sich – im Wortsinn, doch aus gänzlich undespektierlichen Gründen, wie mir schwante, und mir war, als formte ihr Schmollmund das Wort ›Kohlsuppe‹.
In den Applaus hinein betraten Dennis und Tim den Platz. »Liebe Leute«, sprach Dennis ins Mikrophon, »wußtet ihr eigentlich, daß es zu den Melodien, die wir eben gehört haben, auch Texte gibt?« Bestätigungsgemurmel aus dem Fachpublikum, Verneinung bei den Laien. »Das haben wir uns gedacht. Also, Sau tot zum Beispiel geht so.« Und sie schmetterten los, den zweiten Vers sogar mit sauberer zweiter Stimme:
»Gestern abend schoß ich auf ein grobes Schwein,
gestern abend schoß ich auf ’ne Sau.
Gestern abend traf den Keiler ich allein,
gestern abend traf ich ganz genau.
Halali! Halali!«
Auch dafür gab es Beifall, womöglich sogar ein paar Grad wärmeren: Bonus für den Nachwuchs. Und doch steigerte er sich noch, gleich darauf … in weitherziger Wertschätzung jener Frechheit, mit der die jungen Leute den eigentlichen Coup landeten. »Dieses Signal, liebe Leute«, kündigte Tim ihn an, »haben wir mal ein bißchen umgedichtet. Wir bitten um Aufmerksamkeit.
Opa Henry ist von echtem Korn und Schrot,
siebzig Jahre zählt er heut genau.
Opa Henry ist noch lang, noch lang nicht tot,
Opa Henry bleibt ’ne coole Sau!
Halali! Halali!«
Diesmal filmte Jenny. Ansonsten hatte sie entschieden, sich bei dieser Unternehmung zu enthalten. Im Zuge ihrer Beschäftigung mit dem Veganismus stand sie der Jägerei zunehmend kritisch gegenüber (sosehr sie ihren Großvater auch liebte; was die Sache nicht einfacher machte). Als die Jungs sich wieder an ihren Platz hinterm Tresen begaben, gesellte sich Knut zu ihnen. Doch nicht etwa, um ob der Leistung ein Chapeau zu überbringen oder ähnliches. »Du Tim … äh Tim, Tim«, schnappte er und wrang sein Manuskript, »wie war das noch mal? Mm, nn … Und dann …? Und dann …?«
»Wie meinst du, Knut?«
»Dein Titel … mm dein … Und dann hol ich mir … – oder wie?«
»Ach so! Na, dann will ich mal mein großes Horn rausholen!«
»Ach so! Ja! Genau! Na, dann hol ich mir mal …«
»… dann will ich mal mein großes Horn rausholen! Was hast du denn vor? Willst du’s in deiner Rede erwähnen? Soll ich’s dir eben schnell aufschreiben?«
»… will großes Horn erwähn-äh rausholen, genau. Nee, nee mmmmm, das werd ich mir ja wohl noch merken können wt, ft! Ich hab doch noch kein Altershei äh Alzer … heimer nicht noch nicht da mrrrrrr. Na mm nn, dann hol ich mal … äh will ich mal rausholen … genau.«
Unglücklich kam Meike aus dem Haus zurück – zum zweiten Mal unverrichteter Dinge. Das Gäste-WC war dauernd besetzt, und darüber hinaus stand nur ein derbes provisorisches Herrenpissoir am Komposthaufen hinterm Gartenhäuschen zur Verfügung. Offiziell. Ich bot ihr an, Erlaubnis für die private Toilette im Bad einzuholen, doch mutlos lehnte sie einstweilen ab.
Als nächstes brachten die Finklocher Finken Gründervater Baensch ihr Ständchen: zwölf wohltemperierte Damen, darunter Betty und Rosemarie, in farbenprächtigen, mit viel Liebe zum Detail geprünten, individuell unterschiedlichen, aber stilistisch ähnlichen Schürzentrachten – einheitlich nur die kornblumenblauen Fransenstores –, nebst neun Herren mit weißen Hemdblusen, klatschmohnroten Westen und passend gemusterten Halstüchern. A cappella brachten sie den Jung’ mit’m Tüdelband, den Jäger aus Kurpfalz und Mondwald, o Mondwald, die inoffizielle Hymne des Dorfes, die, und zwar bereits anno 1979, wiederum niemand anderer als Amtsförster Henry Baensch komponiert und gedichtet hatte.
Diesmal wurde er nicht aufgefordert mitzutun. Doch als drei Schlager mit instrumentaler Begleitung folgen sollten – indes also bereits Hermann Potthold ans Keyboard schritt, Antje Hauff und Henning Tamerlan sich den jeweiligen Riemen von Akkordeon und Baßgitarre überwarfen und Gerd Schulz in die Schießbude einstieg –, stellte sich Henry, bewaffnet mit einer Trompete, in die Frontlinie, und der unstillbare Trieb, loszulegen – diese Entschiedenheit und Tatkraft von geradezu kindlicher Unerschöpflichkeit, dieser Wille, all sein musisches und menschliches Talent in die Waagschale zu werfen – im Austausch mit einer Umgebung, die Sicherheit und Anerkennung, Behagen und Trost angesichts der ewigen Todesdrohung spendete –, diese kurzum: Lebenslust strahlte ihm aus sämtlichen Knopflöchern und vertrieb die Finsternis aus seinen Augenhöhlen.
Dennis filmte.
An jenem Moment des Abends angelangt, hatte Meikes Stimmung einen neuerlichen Tiefpunkt erreicht. Zwar hatte sie mittlerweile vor dem Gäste-WC angestanden – erfolgreich aber nur in puncto Eintritt. Sie war einfach zu skrupulös wegen der Geräuschentwicklung. Ich bot an, am Durchgang zur Küchentür Wache zu halten und sie im Falle feindlicher Annäherung zu warnen, vielleicht, indem ich den Jägermarsch pfiffe oder Horch, was kommt von draußen rein. Doch lehnte sie ab. Sie genierte sich auch vor mir. Wie gesagt, wir kannten uns erst zwei Wochen.
Mittlerweile hatte Knut nur noch einen Programmpunkt abzuwarten: Jennys Vortrag von Amazing Grace, der nicht nur mit donnerndem Applaus bedacht wurde, sondern mit innigsten Seufzern, Tränen und, wie Dennis, der alles filmte, neidlos feststellte, »Massenhysterie«.
Zu Recht. Wie sie da stand in ihrem saphirblauen Kleid, zu dem sie weiße Chucks kombiniert hatte (»Turnschoh op’n söbentichsten Geburtstach?« fragte Oma – sich, Münster, Gott den Herrn), und jene schönen Töne in ihrem überirdischen Alt aus ihrem schlanken Hals hervorfließen ließ … das mochte wohl versöhnen den Menschen mit Tod und Teufel.
Henry aber schritt, heulend wie ein Schloßhund, mit weit ausgebreiteten Armen auf seine Enkelin zu, umklammerte sie und preßte sie derart an sich, daß es niemanden verwundert hätte, wenn von ihr nur noch ein Diamant übriggeblieben wäre.
Onnos und Eddas Blicke suchten – und fanden sich, über Dutzende Köpfe hinweg, hinter Dutzenden Rücken, und wanden sich zu Schleifchen in Herzchenform, jawohl.
Tapfer nahm Knut nun Aufstellung. Zu tattrig, um das Mikrophon herabzuwinden, und zu stolz, das einzusehen, kippte er fast hintenüber: das Lose-Blatt-Manuskript mit dem Ellbogen vor der Brust fixieren, gleichzeitig an Stellschrauben oberhalb der Hutschnur drehen, und alles ungeachtet eines Blutdrucks von zwohundert zu hundert … schwierig. Zu Hilfe eilte Dennis. Knut brabbelte auf ihn ein. Von weitem sah es aus, als schnappte er nach seinem Ohr. Dennis nutzte die Gelegenheit und raunte ihm zu: »Na dann will ich mal …?« Und Knut: »… mein großes Dings, ähnnn Horn rausholen, ft, ft.« Gnadenlos filmte Tim.
Schließlich war Knut soweit. Teils mitleid-, teils furchterregend grinsend, verlagerte er sein Weltergewicht vom einen aufs andere Bein und grölte: »LIEBE GÄSTE!«
»BÖLK DOCH NICH SO«, bölkte Schorse Ossenkopp, und wohlwollendes Gelächter plätscherte wie der kleine Wasserfall vor der Jägerstube hinterdrein.
»Liebe Gäste«, sprach daraufhin Knut – nun selber lieb –, »und vor allem: lieber Henry.« Offenen Mundes versuchte er, das Manuskript mit der Rechten steif zu halten, während seine Linke sich ums Mikro krampfte. Für eine Schrecksekunde dachte so mancher von uns, er beiße gleich hinein. »Hermann Löns hat geschrieben: ›Hier ist das Schweigen im Walde heimisch, das Schweigen, das aus tausend kleinen Stimmen gewebt ist, das flüstert und tuschelt und raunt und kichert, murrt und knirscht, das den einen so ängstigt und den anderen so beruhigt.‹«
Irgendwo mußte er gelesen haben, daß man eine Rede mit einem Zitat beginnen soll. Zähnefletschend, vereinsamt – heischend wonach auch immer –, schaute Knut in die Runde. Drei, vier Menschen, Oma etwa, dem Tode selbst geweiht, taten ihm den Gefallen und murmelten aufs Geratewohl Zustimmung. Dennoch starrte Knut irritiert ins Manuskript. »So beruhigt. Mm. Mmnn.« Er dachte anscheinend drüber nach, was er damit eigentlich noch hatte sagen wollen.
Und dann fand er das Stichwort wieder. »Und das, lieber Henry, ist ja das, was du … immer … hier gesucht hast. Beruhi… also Ruhe und … Frieden. Eine Heimat. Heimatliche Scholle. Heute vor genau siebzig Jahren bist du geboren, vor siebzig Jahren! In der Neumark von Brandenburg, in einem winzigen Dorf, Rauschenbach hieß es, noch winziger als Finkloch war es.«
Eddas schöne helle Augen verdrehten sich wie von selbst ob der biblischen Epik, doch Betty sah es und versetzte ihr einen sachten Schulterstüber. Zusammen mit Rosi und Henry hatten sie auf der äußersten Bierbank Platz genommen, mit dem Rücken zum Tisch, um Knut, der jenseits der kleinen Tanzfläche stand, von Angesicht zu Angesicht lauschen zu können. Henrys Augen schimmerten. Was kaum an dem einzigen bisherigen Jägermeister liegen dürfte. Er begann, sich eine Pfeife zu stopfen – zur Feier des Tages seine mit Abstand wertvollste, eine wunderschön gemaserte Billard von Bo Nordh. Daß er es vor dem Essen tat, bewies den Charakter der Ablenkung.
»Du warst noch ein Junge, als die Russen deinen Vater verschleppten, und du hast ihn nie wiedergesehen, und als die Polen deine Mutter und dich vertrieben, warst du immer noch ein Junge, und ein Junge warst du noch, als ihr in der Lüneburger Heide ankamt, in Hermann Löns’ Heimat ankamt, neunzehnhundertachtundvierzig, und als du bei Hubert Graf zur Au anfangen durftest, als ganz einfacher Waldarbeiter, als ganz einfacher Waldarbeiter, wt, ft. Und als du das Au-pair-Mädchen Elisabeth näher kennenlerntest …«
»– war er immer noch ein Junge«, sagte Betty mit verstopfter Nase, »ist er heute noch«, quakte Rosi, und während aus neunzig Kehlen wohlwollendes Gelächter strömte, lachte auch Henry und drückte Betty an sich. »Laß dich nicht«, rief er seinem Laudator zu, »aus’m Takt bringen, Knut!«
»Nee nee ft, ffft«, pustete der, »nee«, und doch benötigte er die ein oder andere beherzte Hackdoublette, um den rhetorischen Rhythmus wiederherzustellen. Aber er schaffte es, und zusehends sicherer schritt Knut Wiesmann fort im Manuskript. Er sprach von der Baensch’schen Hochzeit vor neunundvierzig Jahren, von Eddas Geburt und Rosemaries anderthalb Jahre später, sprach von Henrys Studium der Forstwirtschaft, das der Graf ermöglicht hatte, verschwieg auch das spätere Zerwürfnis nicht (allerdings den Grund dafür: gräfliche Übergriffe auf Betty), welches im Sommer neunzehnhundertzweiundsechzig zum Umzug aus der Lüneburger Heide nach Hamburg-Wilhelmsburg führte; jenem Stadtteil, der noch am schlimmsten von den Schäden der Sturmflut-Katastrophe gezeichnet war und von wo aus Henry die Revierförsterei im unweiten Eißendorf übernahm.
Und in der Folge gab es »schöne Jahre in Wilhelmsburg, ganz gewiß mehr als nur ein ft, ft Intermezzo« – ja eben: ein zwölfjähriges Intermezzo?! –, und neunzehnhundertvierundsiebzig endlich den »ersehnten Umzug in die neue Heimat«, ins Wunschidyll Finkloch, das Omas und Bettys Heimat war.
Und während Knut munter Henrys segensreiches, vierundzwanzigjähriges Wirken als dortiger Amtsförster würdigte, ging etwas vor sich mit den Baenschs.
Unmerkliches ging vor mit den Baenschs, wie sie da so saßen, während Knut Henrys Verdienste als Bürgermeister von neunzehnhundertachtundsiebzig bis -zweiundachtzig würdigte (der Rücktritt wurde nicht thematisiert); seine Initiative und Gründungsmitwirkung in puncto Schützen-, Sport- und Heimatverein, bei der Gruppe der Jagdhornbläser, bei den Finklocher Finken, bei den Finklocher Dörpsmus’kanten; seine zusätzlichen Talente als Hochsitzkanzel-Ingenieur und -Zimmerer, als gelegentlicher Volkslieddichter, als Musiker überhaupt, als Conférencier und Stimmungskanone und Ausbilder – während dieser Knut Wiesmanns liebreichen Eloge ging etwas Unmerkliches vor sich mit den Baenschs.
Und die allermeisten Gäste bemerkten es trotzdem. Außer etwa allzu zerstreute wie Oma, törichte wie Knut selbst oder ortsfremde wie Meike, unvertraut mit den Familienverhältnissen.
Zwar hockten Henry und Betty, Edda und Rosi nach wie vor auf der Bierbank, Schulter an Schulter, die Töchter die Handballen aufgestützt, Henrys Arm um Bettys Taille. Ihre Gesichter drückten nach wie vor Gutwilligkeit aus und Wertschätzung, Bescheidenheit und Freude (Bettys zusätzlich Leid an der Schnupfenplage) – und doch hatte sich etwas verändert seit dem Anfang von Knuts Rede; etwas Feinstoffliches war mit ihnen vorgegangen. Ein Wechsel in der Resonanz. Vielleicht hatte ihr Muskeltonus zugenommen, so daß ihr Herzschlag dumpfer in den Garten klang als zuvor. Die weitaus meisten Gäste nahmen es durchaus wahr … man sah es daran, daß sie sich nichts anmerken ließen.
Knut Wiesmanns Rede war hölzern und humorlos, pathetisch und schönfärberisch und uninspiriert, aber sie kam von einem nicht bloß bedürftigen, sie kam auch aus vollem Herzen, und all das war sowieso nicht das Problem, das der haarfeinen Befangenheit zugrunde lag. Und es war zwar verführerisch, die Verantwortung dafür Knut in die gewienerten Halbschuhe zu schieben – doch wäre es schreiend ungerecht … nein, nicht einfach ›ungerecht‹; es wäre absurd.
Und ebenso absurd war die ebenfalls unmerkliche Hoffnung der Betroffenen, Knut habe Nelkenheini lediglich in der Chronik vergessen und würde die Erwähnung nachholen, wenn er begönne, Henrys Wirken als Vater und Großvater zu würdigen und also die nächsten Generationen. Absurd, die Hoffnung, wenn es denn eine war … ja, bestenfalls frömmlerisch.
Denn war es nicht vor auf den Tag genau zehn Jahren das gleiche gewesen? Ja, vor zwanzig Jahren schon? Und war seither diesbezüglich irgend etwas verlautbart worden gegenüber Knut? Hatten sie nicht vielmehr alle, wie sie da waren, schlicht und scheinbar machtlos näher und näher heranrücken lassen die Stunde seiner unweigerlichen Rede? – Nicht im Ernst hatte irgendwer geglaubt, ausgerechnet Knut würde eine Klärung des Ungeklärten auf die eigene Kappe nehmen. Warum, um Himmels willen, hätte er das auch tun sollen?
Und so, nachdem er elegisch den bitteren Verlust des Forsthauses anno neunundneunzig und den kalten Krieg gegen das Imperium der Katzenzenzi abgehandelt hatte (nicht ohne hochachtungsvollen Fingerzeig auf mich, Henrys Rechtsbeistand; viel zuviel der Ehre, weil ich so gut wie nichts hatte tun können), sang Knut unverwandt das exklusive Lob auf Edda Viets und Rosemarie Zumfort, auf ihre ererbte gesangliche Begabung, auf ihre menschliche und weibliche Integrität (»Horr …!« fauchte Edda mit gesenkter Stimme), und schlußendlich das fällige Hohelied auf vor allem Jenny, aber auch Dennis und Tim.
Und zwar wie folgt: »Ja, und auch der Jüngste der Sippe hat was vom künstlerischen Talent des rrrrrrr Opas abgekriegt: Er schreibt Theaterstücke für seine Schwester! Nn. Das neueste trägt den Titel: Na gut, wt, ft, dann bring mir mal einer die große Posaune!«
Als einziger verstand die Pointe offenbar Tim; jedenfalls prustete er hemmungslos los. Schwer zu sagen, wer verblüffter darüber war: das restliche Publikum – oder der Laudator höchstselbst, dessen Grinsen aus dem vorfreudig Triumphalen mählich ins Ungefähre, Hohle, ja Nirwana wechselte.
Sein Schlußsatz immerhin war für Knuts Verhältnisse geradezu nobelpreisverdächtig: »Was reimt sich auf guter Mensch? Henry Baensch!« Und dann überreichte er seinem Idol zwei Geschenke, die er unter dem Tapeziertisch hervorzauberte, auf dem das Büfett seiner Eröffnung harrte.
Eines das Modell einer Hochsitzkanzel mit Leiterchen und Türchen, Sitzbänkchen innen und Schießschärtchen, verklebt auf einer grünen Filzteppichfliese, umgeben von einem Wäldchen aus Flachmännern mit Kräuterlikör. Nicht ohne Rührung stellte man sich vor, wie viel Hackdoubletten derlei hingebungsvolle Bastelarbeit gekostet haben mochte. Das andere das goldschnittgerahmte, fette Ölgemälde eines unbekannten Künstlers, ein – röhrender Hirsch, tatsächlich. Unweit von Alttier und Kalb, die ihn anhimmelten, stand er an einem Gebirgssee und beschimpfte, das Geweih im Nacken, ein Grüppchen schmächtiger Tannen vom anderen Ufer. Meike lachte, diätgequält zwar, doch voller Anerkennung für derart hellichte Selbstironie. Bis ich sie verunsicherte, ob es eine war. Mit reichlich Rrrrr und Ft-ft interpretierte Knut das Motiv, während Henry lauthals reklamierte: »So ein starker Hirsch – und keinen Pinsel?!«
Und so konnte sich allenthalben Befriedigung über die Vorlust darauf ausbreiten, daß nach dem kulturellen nun dem leiblichen Wohl gefrönt werden durfte. Henry dankte Knut mit bewegten Worten und erklärte das Büfett für eröffnet.
Entlang der Hauswand war es aufgebaut. Rosi und Edda – sowie Betty mit vorgehaltenem Taschentuch – hoben die Deckel von den stövchenerhitzten Aluminiumbrätern, aus denen Kartoffelgratin und ein Laib Fleischkäse dampften, und von den Terrinen mit je einer Suppe aus Tomaten, Spargel und Huhn (keine aus Kohl, doch Meikes Appetit war ohnehin hoffnungslos gestört). In einem gewaltigen Kessel aber köchelte eine, für die Betty besonders berühmt war. Anderthalb Stunden lang hatte sie Fleisch von Reh- und Damwild abgekocht, zusammen mit geputzten Möhren und Petersilienwurzeln, Sellerie und Porree, das Fleisch sodann ausgesiebt und vom Knochen gelöst, abkühlen lassen und in Bissen geschnitten, um sie in einer Mehlschwitze mit Brühe zu sieden und – unter Zugabe von handverlesenen Pfifferlingen – mit Wildgewürz und saurer Sahne abzuschmecken … Da hatte einst, zu Wilhelmsburger Zeiten, gar Fernsehkoch Hotte Prick niedergekniet, als er mal Teilnehmer einer Treibjagd gewesen war!
Qualmumnebelt wendeten Hein und Fietje Poppenkamp Schweinekoteletts auf ihren erhitzten Rosten, Putensteaks und Hähnchenschnitzel, Rindswürste und Gemüseschaschliks; vernachlässigten aber darüber keineswegs den Wildschweinbraten, einen hundert Pfund schweren Überläufer, den der Partyservice geliefert hatte. Unterdessen drängten sich auf den gedeckten Tapetentischen Körbe voll Baguettes und Saucieren mit Grill-Dips und Kummen und Kasserollen mit zweierlei Kartoffel-, Blatt- und gemischtem Salat sowie gesottenen Hackbällchen; farbenprächtig leuchtete durch gläserne Schüsselwände Obstsalat – flankiert von einer Schale mit gletscherweise Schlagsahne –, und aus einer anderen lockte, gestockte Sünde durch und durch, der noch unberührte Spiegel eines Schokoladenpuddings; es gab ›Kirschen im Schnee‹, und es gab eine weitere Spezialität à la Betty: rote Grütze.
»Mmmmmmm«, machte Knut, »wie macht sie das bloß ft, ft«, und Jenny sagte: »Aus geheimen Beständen in ihren Kellergewölben holt zur Stunde X ein stummer, dummer Diener eingemachten Sauerkirschsaft, den Omi mit Speisestärke andickt, woraufhin sie bei Vollmond, Sprüche murmelnd, feinste Him-, Erd- und Johannisbeeren unterhebt.«
»Und dazu«, ergänzte Tim, »Vanillesoße«, und fügte, ohne daß Knut es auch nur im entferntesten merkte, ein »Ft, ft« hinzu, so daß Jenny sich schlimm verschluckte.
Was Wunder, daß des Schlemmens wollte kein Ende nehmen, und auch die Mundschenke Dennis, Tim und Jenny hatten alle Hände voll zu tun … und also dämmerte es allmählich. Eine Grille zirpte (aus dem Lautsprecher; Dennis’ Idee), doch die friedfertige Amsel-Arie aus dem Wipfel der Eiche war echt. Wir saßen und standen und schlenderten unterm reinen, rauchblauen Himmelszelt überm Baensch’schen Garten und schwatzten, um uns unseres Daseins zu vergewissern; um unser Glück in beliebige Worte zu fassen, unsere Angst vor Unglück zu bannen und unsere Liebsten in Frieden zu ehren. Wir kauten und schluckten und prosteten uns zu – nicht nur einmal wurde die alte Mahnformel bemüht, daß so jung wir nie wieder zusammenkämen! –, und als die ersten Sterne karfunkelten, gesellten sich unserer kleinen Gemeinschaft zwei Rehe hinzu. Wahrscheinlich die, die Edda und Onno am Vormittag am Dorfrand entdeckt hatten.
Diana war in der Jägerstube eingesperrt, weil das Tor einladend offenbleiben sollte, und so, ungestört, freimütig, staksten sie – unwirkliche Schattengestalten im funzligen Lichte der Lampions und Fackeln – über die Zufahrt heran. Sie waren noch jung. Das Schmalreh mußte den Nacken rückwärts biegen, um ein überhängendes Salatblatt aus einer Schüssel von der Tafel naschen zu können. Der Knopfbock blieb stehen und schaute sich um. Drehte und wendete die steilen Lauscher, richtete sie nach dem menschlichen Geräuschgewoge aus Geplauder und Gelächter aus, das sich nach einem Pingpong von spitzen Ausrufen rasch zu einem Raunen abdämpfte. Von der Terrasse am Gartenhäuschen über die Stehtische bis zur Terrasse unter der Pergola spannte sich ein Bogen aus Wispern und Brummen, bis eine andere Energie, eine Pfeilenergie übernahm: »Knut«, sagte Henry, »komm her!«, und Knut: »Klaus-Dieter, du ok, man to!«
Tollwutgefahr war gering, da in diesen Gefilden seit Jahrzehnten ausgerottet. Henry hatte etwas in der Kreiszeitung gelesen, das auf kirremachendes Pflanzenschutzmittel hinwies. Von rapsfressendem Wild gelesen, dessen Instinkt verrückt spielte.