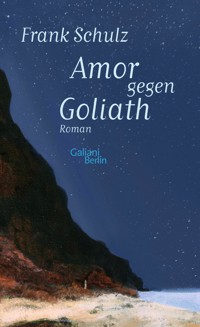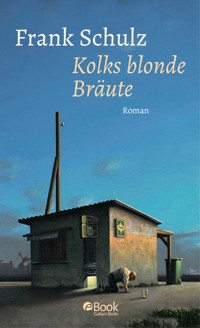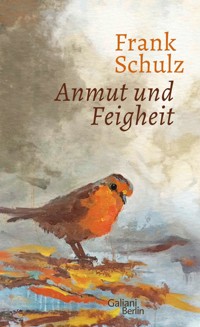9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Die meisten Menschen brauchen mehr Liebe, als sie verdienen.« …auf diesen Aphorismus von Marie von Ebner-Eschenbach stieß Frank Schulz vor vielen Jahren. Seitdem arbeitete er an einem Buch, das ebenjenen Satz in allen Facetten beleuchten soll. Die Protagonisten entstammen den verschiedensten Altersklassen und sozialen Schichten. Diverse Erzählformen tauchen auf – die Miniatur, die Kurzgeschichte, die Novelle, der Dialog und die Collage. Und natürlich die verschiedensten Formen der Liebe (inklusive Hass- und Nächstenliebe) sowie die Suche nach ihr.Katja begegnet ausgerechnet auf ihrer Hochzeitsreise dem Mann, von dem sie schon ihr ganzes Leben träumte (und der natürlich nicht mit ihrem frischgebackenen Ehemann identisch ist). Das grundgute Dörchen entdeckt kurz vor ihrer goldenen Hochzeit einen Streichholzbrief des »Moulin Rouge« in der Manteltasche ihres Mannes und macht sich tapfer auf zur Recherche auf die Reeperbahn; Olaf Bressen begreift am Ende seiner im Scheitern befindlichen Ehe, dass damals, Jahre zuvor, auch er im Ausspruch »So sind sie, die Männer!« inbegriffen war, den sein künftiges Eheweib beim Anblick eines Wichsers von sich gab; und auch die tauchen auf, die ganz zu kurz kamen und vollkommen gefühllos handeln. Frank Schulz leuchtet in diesem Langzeitprojekt inhaltlich ebenso die Facetten des Phänomens Liebe aus wie stilistisch die Möglichkeiten ihrer Beschreibung. »Sowieso mein Lieblingsautor!«, sagte einst Harry Rowohlt über Frank Schulz: nach der Lektüre dieses Bandes wird es vielen so gehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
» Buch lesen
» Das Buch
» Der Autor
» Impressum
Inhalt
Seele mit Käse 9
Männertreu 13
Trilogie der Gewalt I
Schorf 22
Der Stich des Bienenmörders 25
Der Schweiß der Hafenarbeiter 43
Amrumer Mumpfen 56
Pop-Tetrameron I
Loop-di-Love 64
oder Gut Kirschen essen mit J. Bastós
Ein Feuilleton
Am Ende wird geheiratet 69
Pop-Tetrameron II
Trugnattern 83
oder Die Hymne der Zeugen des ersten Kusses
Eine Schnurre
Pop-Tetrameron III
Weiße Katze 90
oder Ein schwarzer Hund spielt keine Rolle
Eine Collage
Trilogie der Gewalt II
Hopfen 97
Untergang der Lügenbrut 100
Pop- Tetrameron IV
Sieben Pferde 111
oder Das einsame Lied vom tiefen, traurigen Traum
Eine Novelle
Wenn Beelzebub flennt 149
Schmetterling des Schreckens 157
Der Schornsteinfeger 188
Ein Aalstrich auf Muschis Grab 196
Der King Kong des Pingpongs 201
Buxtehude 224
Sehnsuchtsglühen 239
Trilogie der Gewalt III
Krebs 263
Okay Blues 266
Die meisten Menschen brauchen mehr Liebe,
als sie verdienen.
MARIE VON EBNER-ESCHENBACH
[Menü]
Seele mit Käse
Seit Wochen schon holte Brinkmann seine Brötchen nicht länger von Jensen, sondern aus der BackBord-Filiale. Die lag auf dem direkten Weg zur U-Bahn, buk die Schrippen knuspriger und preiswerter und bot mehr Auswahl. Doch nichts davon gefährdete Brinkmanns jahrzehntelange Treue zu Jensen, sondern »Fr. Lammers«.
Das Namensschildchen trug sie am Träger ihrer signalroten Schürze mit dem BB-Emblem. Schwarzer Samt bändigte ihr falbes Haar, und auf ihren niedergeschlagenen Lidern lag unfehlbar ein Engelshauch von grünem Schatten. Sie trug keinen Ehering. Trotzdem, sie war bestimmt nicht mehr Ende Dreißig, wiewohl sie mitunter wirkte wie Anfang Dreißig. Anfangs unmerklich, begann Brinkmann, über ihre dauernde Traurigkeit zu grübeln.
Den ganzen Oktober lang fast jeden Morgen das Rauschen des Regenwassers auf dem Asphalt, das der beleuchtete Autoverkehr aufpeitscht; die fuchtelnden, kohlschwarzen Zweige der Linden; die darüber hinfliegenden, dreckigen Riesenschwämme der Wolken ... Doch sobald Brinkmann gegen sechs Uhr zehn um die Ecke des Blocks bog, erstrahlte schräg gegenüber in Gelbund Rottönen die Fensterfront der BackBord-Filiale, und von der ewigen Frage, ob Fr. Lammers Dienst hatte, leierten seine Knie aus — zumindest fühlte es sich so an. Wochenlang war Brinkmann so vernarrt in Fr. Lammers, daß er, als sie einmal ganz allein hinterm Verkaufstresen stand, am offenen Eingang vorbeistakste — nur um sich selbst zu beweisen, daß er so vernarrt noch gar nicht war. Seit seiner Scheidung hatte ihn keine Frau mehr verwirrt. Wenn nicht besessen, so doch beseelt war er von dem Gedanken, sie lächeln zu sehen. Wochenlang schlief er nicht eher ein, bis daß er einen Dialog entworfen hatte, der witzig genug für sie wäre.
Dann jener Morgen Anfang November. Er hatte gut geschlafen und unter der Dusche beschlossen, es heute zu wagen. Schließlich war er kein Jungspund mehr. Einem Plakat an der Tür zufolge lief die »Aktion Schwabentage«. Eine Schlange hatte sich gebildet. Es duftete nach Kaffee. Brinkmann öffnete seinen Parka. Seine Brille war beschlagen, so daß er sie abnehmen mußte und beim Warten in die Zeitung schaute, die er aus dem Ständer gezogen hatte; irgendwas über Hartz IV. Doch er nahm gar nicht wahr, was er las. Er rekapitulierte stumm den Spruch, den er aufsagen wollte. Er litt: Sie bediente allein, die Schlange verlängerte die Frist, sie betrachten zu können — und ausgerechnet dann beschlug seine Brille, ohne daß er ein geeignetes Putztuch dabeigehabt hätte! Schemenhaft schwebte Fr. Lammers zwischen den großen Körben mit den Brötchensorten und der gläsernen Theke voller Zuckerguß und Nougat hin und her. Er sättigte sich an ihrer Stimme.
In gleichbleibender Trübsal rupfte sie der Schlange die nachwachsenden Köpfe ab. Schließlich wurden Brinkmanns Brillengläser wieder durchsichtig; wegen der bleibenden Nebelränder fühlte er sich dennoch tölpelhaft. Doch es kam ohnehin anders.
Der letzte vor ihm war ein Recke in einem grünen Overall, mit schwarzgrauen Schafslocken und klafterbreiten Schultern. Um die Taille trug er einen Gurt mit leeren Karabinerhaken.
»Bitte«, sagte Fr. Lammers.
»Ich hätt' gern 'n Kaffe to go, schwarz, und —«, er deutete auf einen langen Laib Weißbrot aus Dinkel, »— so 'ne >Seele mit Käse<. Und 'n Lächeln.«
Brinkmann verschlug es fast den Atem von der Salve der widersprüchlichen Impulse: Frustration, schlichter Ärger, jungenhafter Wettbewerbsstreß, aber auch geschlechtssolidarische Einfühlung, ja ein Hauch Anerkennung ... Ohne Stocken, ohne die tiefe Stimme zu erheben, hatte der Kerl das vorgebracht. Von ihm zu sehen bekam Brinkmann nur perückenartigen Hinterkopf und breites Kreuz. Frontal jedoch erlebte er mit, wie Fr. Lammers aufblühte.
Ja, aufblühte. Aufblühte wie eine Rosenblüte in extremem Zeitraffer. Noch verschlossen, hatte sie gestutzt, aber nicht länger als Brinkmann gebraucht, um zu verstehen, was da passierte, und nach anderthalb Wimpernschlägen platzte ihre anmutige Schwermut auf, und mit einem verlegen übertriebenen Ha! entfaltete sie ein Antlitz mit Grübchen, strahlenden kleinen Zähnen und Brauenspiel. Trug sie heute Rouge? Während sie die Kanne aus der Kaffeemaschine nahm und einschenkte, sagte sie mit aufgehellter Stimme: »Stehen Sie hier mal den ganzen Tag, da würde Ihnen das Lachen auch vergehen!«
»Wir können ja tauschen«, sagte der Kerl, freundlich, sportlich.
»Was haben Sie denn zu bieten?«
»Gebäudereinigung.«
»Ach du Schande, nee!« schmetterte Fr. Lammers, glücklich entsetzt, mit der Unverschämtheit ihrer unverhofften Schönheit. »Das machen Sie man selber, da hab' ich keine Lust zu!« Sie reichte ihm eine Tüte, in der die Seele mit Käse steckte, und strahlte an ihm vorbei, durch den Nebel direkt in Brinkmanns Pupillen.
»Seh'n Sie?« sagte der Kerl und fügte, da sie nichts erwiderte, so schwach wie das Echo eines Echos hinzu: »Seh'n Sie.«
»Vierfuffzig«, sagte Fr. Lammers.
Brinkmanns Bestellung kam fast wie ein Raunzen heraus, doch Fr. Lammers' Lächeln hielt mit nahezu unverminderter Energie; als sie ihm das Wechselgeld reichte, strahlte sie bereits seinen Nachfolger an. Noch als er von draußen durch die Scheibe hineinblickte in die rotgelbe Sphäre, bevor er seinen Weg zur U-Bahn fortsetzte, war ihr Lächeln unverändert. Ein paar Schritte hielt er Ausschau nach dem Kerl im grünen Overall, vergeblich. Er hätte ihm im Vorbeigehen auf die Schulter geklopft oder so.
Das Gefühl der Demütigung und Erleichterung hielt den ganzen Arbeitstag an. Aber es war ihm ja nicht fremd, und was konnte man schon tun? Die Brötchen wieder bei Jensen holen.
[Menü]
Männertreu
Die gelben Kronen der Ahornbäume leuchten, obwohl der Himmel über Poppenbüttel aussieht wie das Röntgenbild eines Brustkorbs. Der lange Altweibersommer ist an dem Tag zu Ende gegangen, als Lothar nach Bad Kissingen abreiste. Dörchen schlurft, um das Laub zum Rascheln zu bringen. Sie hat ihre Schuhe zwar frisch geputzt, aber seit dieser Geschichte mit dem Sparclub und dem Zündholzbriefchen ist ihr alles ein bißchen egal. Der aufsteigende Duft nach Kompost, Torf und Leder erinnert sie an den Rotwein, zu dem Gitti sie einlud, nachdem sie Lothar zum Hauptbahnhof gefahren hatten. »Ganz schön bitter«, sagte Dörchen nach dem ersten Schluck, und Gitti sagte: »Du weißt eben nicht, was gut ist.« »Ja, ja«, sagte Dörchen, »deine doofe alte Mutter hat eben von nix 'ne Ahnung«, und Gitti verdrehte die Augen, und Jeannette sagte zu Gitti: »Mach Omi nich' an«, und gab Dörchen einen Kuß.
Um auf den S-Bahnsteig zu gelangen, muß Dörchen Treppen überwinden, und am Ende rast ihr Herz. Bis zum Einsteigen beruhigt es sich, einigermaßen, und solange sie nicht an das Zündholzbriefchen in ihrer Handtasche denkt, bleibt der Puls auch während der Fahrt ruhig, einigermaßen. Beim Umsteigen geht's jedoch wieder los, und als sie die Treppen zur Reeperbahn hinaufackert, klopft es im Hals so stark, daß sie, oben angekommen, ihr Seidentuch lockern und eine Weile am Geländer verschnaufen muß. Es ist ihr alles ein bißchen egal geworden seit dieser Geschichte mit dem Sparclub und dem Streichholzbriefchen, aber eben nur ein bißchen; aufgeben wird Dörchen deswegen noch lange nicht. Aufgegeben hat ein Dörchen Possehl noch nie, nicht im Winter 1961, als sie die querliegende Gitti auf die Welt preßte, und nicht in den siebziger Jahren, als Lothars Lütt-un-Lütt-Doppelschichten überhandnahmen, nicht nach Günnis schwerem Unfall beim Barras und ebensowenig, als sie selbst lebensmüde zu werden drohte, nach diesem Zeckenbiß in Tirol.
Lothar hatte vierzig Jahre für eine Baufirma gearbeitet, und wiewohl bereits auf Rente, war er letztes Jahr zu deren Jubiläum eingeladen worden. Nach der offiziellen Feier war er mit den ehemaligen Kollegen noch über die Reeperbahn gebummelt. Wie Dörchen war er zuvor an die dreißig Jahre nicht mehr auf St. Pauli gewesen; wenn die Sauerländer oder Münchner Bekannten zu Besuch kamen, machten sie mit ihnen eine Alster- oder Hafenrundfahrt, besuchten Hagenbecks Tierpark oder bestenfalls den Fischmarkt. Gediegen, wie viele Menschen hier heutzutage unterwegs sind. Sie nestelt das Zündholzbriefchen aus der Handtasche, guckt noch einmal nach der Hausnummer und kämpft sich den Gehsteig aufwärts; der Leutestrom drängt ihr entgegen, teilt sich an ihr oder stockt, um sich jedoch gleich wieder aufzulösen und, ihren Popelinemantel streifend, weiterzufließen; zweimal wird sie angerempelt. Das Geschwätz und Gelächter, das Getöse von der vierspurigen Straße und die muskulösen Sprüche der Koberer rauschen quer durch Dörchens Kopf hindurch. Sie späht nur nach Hausnummern aus und, indem sie den Hut festhält, nach den Schildern der Etablissements; all die regenbogenfarbigen Bilderbogen in den Schaufenstern, all die blinkenden Neonstreben an den Gesimsen, die Säulen von Schwarzlicht und ultravioletten Lichthöfe in den Eingängen blendet sie aus, und schließlich findet sie, was sie gesucht hat. Da steht es, in derselben schwungvollen, leuchtendroten Schrift wie auf dem Zündholzbriefchen: Moulin Rouge.
Einen Schritt vorm Windfang postiert, spielt eine kräftige Frau mit einer Art Tambourstab. Zu ihrer Pförtneruniform gehört ein niedriger Zylinderhut. Gediegen geschminkt ist sie. »Na Muddi, has' dich verlaufen?«
»Nee, ich will man bloß —«
»Äy, ihr Altrocker«, grölt die Pförtnerin plötzlich über Dörchens Hutfeder hinweg und schiebt Dörchen beiseite, »kommt ma rein hier, daß der Sack ma’ wieder leer wird!« Sie berührt einen aus dem Grüppchen mit dem Stab, als wollte sie ihn verzaubern, und hinter ihrem Rücken witscht Dörchen in den Windfang, verheddert sich in der Portiere und befreit sich wieder.
In dem Salon ist es warm wie im Hühnerstall. Die Wände sind mit rotem Brokat tapeziert, rechts und gegenüber Zweierabteile, getrennt voneinander mit Samtvorhängen in Altrosa. Eigentlich ganz gemütlich. Fast wie früher im Tivoli. Komisch, daß ihr das jetzt einfällt. Dörchen nimmt gleich die erste Nische. Sie ist mit zwei Sitzbänkchen möbliert, und auf den beiden Konsolen an der flachen Brüstung stehen je ein Lämpchen mit pergamentenem Schirm und ein Glas mit einem Strauß papierverhüllter Strohhalme, ein Halter mit einer Getränkekarte und auf einem Untersetzer aus Papier ein sauberer Aschenbecher. Darin liegt das gleiche Zündholzbriefchen wie in Dörchens Handtasche. Unter der schwarzlackierten Decke rotiert gemächlich eine Diskokugel; über dem schummerigen Boden kreisen Lichtblüten, ähnlich denen von Männertreu oder Vergißmeinnicht. In den Kurven verzerren sie sich wie in einem Alptraum.
Die Bühne ist so flach wie die zwei übereinandergestapelten Bierkästen daneben, und vor der verspiegelten Wand, zu einer Popmusik, wie Jeanette sie gern hört, tändelt ein junges Ding mit seiner eigenen blonden Mähne. Es hat nur einen winzigen neongrünen Bikinischlüpfer an und stelzt in seinen Hackenschuhen auf und ab. Es wirft Dörchen einen Blick zu und schickt noch einen langen, erstaunten hinterher, tanzt an den seidenen Fäden dieses Blicks. Und als Dörchen das Gesicht dieses Mädchens sieht, da passiert etwas mit ihr, sie kann gar nicht genau sagen, was; es ist, als erschreckte sie vor etwas Bekanntem. Doch bevor sie ergründen könnte, was genau es ist, kommt aus der mit Fransenstores geschmückten Bar-Grotte eine schlanke Brünette in schwarzem Hosenanzug auf Dörchen zu.
»Guten Abend. Was darf's denn sein.«
Was für eine Stimme. Dörchen bestellt einen Piccolo.
»Kommt da noch wer?«
Dörchen verneint. Wieder klopft ihr Herz unten links im Hals.
»Na denn man viel Spaß.«
Wer's hier reingeschafft hat, reimt sich Dörchen zusammen, wird wohl auch egalweg bedient.
Das Mädchen auf der Bühne beobachten zwei Männer. Hingelümmelt in der Sitzgruppe vor der Bühne, werden sie von zwei weiteren halbnackten Mädchen begöscht. Der eine Mann hat sich schon bei dem Wortwechsel nach Dörchen umgedreht, macht nun eine Bemerkung zu dem anderen Mann, und während sich auch der und die beiden Mädchen nach Dörchen umdrehen, steht er auf und kommt zu ihr herüber. »Na Muddi, has' dich verlaufen?« Er paßt hier gar nicht recht rein. Er trägt ein weißes Hemd, gebügelte Hosen, ein ordentliches Jackett und eine Brille, wie sie manchmal kluge Leute im Fernsehen tragen. Er grinst, aber Dörchen weiß nicht, was sie sagen soll.
Er schnipst mit den Fingern zu der Brünetten hinüber, die in der Bar-Grotte einen Piccolo öffnet, und setzt sich grinsend zu Dörchen in die Nische, auf das andere Bänkchen. »Na, erzähl ma. Was has' denn hier verlor'n.« Er grinst immer noch. Dörchen erkennt, wenn ein Grinsen bösartig ist; dieses ist neugierig. Es ist ja auch nicht viel los hier, noch jedenfalls nicht. Vielleicht geht's erst nach Mitternacht richtig los.
Na gut, denkt Dörchen. »Ich wollt' bloß ma’ sehn«, sagt sie, »was Lothar hier verlor'n hat.«
Die Brünette serviert den Piccolo samt Flöte Dörchen und dem Mann mit der Brille ein braunes Getränk, in dem die Eiswürfel klirren. »Lothar?« sagt er, »welcher Lothar?«
Zu Ende des vergangenen Winters war Dörchen eines Nachts von Lothars Geächz wach geworden. Er sagte, er sei schon sechs-, siebenmal zum Klo gewesen, doch der Harndrang lasse nicht nach, sondern werde immer schlimmer. Am nächsten Morgen zeigte er ihr seinen Handrücken, auf dem, wie von einer Prellung, ein gelblichbrauner Fleck prangte. Es war die Stelle, gegen die er seine Stirn drückte, wenn er sich bei seinen Versuchen, Wasser zu lassen, an der Wand abgestützt hatte. Dörchen begleitete ihn zum Urologen. Es schien eine schwere Prostataentzündung zu sein. Um ein Haar wäre er da schon ins Krankenhaus eingeliefert worden, an den Tropf gehängt. Er kriegte was zum Einnehmen und vorübergehend einen Katheter gelegt. »Jetzt ist aber endgültig Sense mit Angeln«, sagte Dörchen, »du holst dir noch den Tod.« Doch im Frühjahr stand er wieder nachts um drei auf und fuhr los, obwohl der Dingsbums-Wert nicht sank, und kam gegen sieben zurück. Die ganze Zeit stand er immer wieder mal nachts um drei auf und fuhr los, auch noch, nachdem eine Gewebeprobe hatte entnommen werden müssen. Einmal hörte Dörchen, wie er am Telefon zu seinem Vereinskameraden sagte, er habe Blut »eka... juliert, verstehs' du«, und wiederum ein paar Wochen später wurde er dann operiert. Gitti, Günni und Dörchen telefonierten täglich mehrmals miteinander.
Als die Kur anstand und Dörchen Lothars Koffer packte, entdeckte sie in der Tasche seines besten Sakkos das Zündholzbriefchen. Obwohl sie sich schon vorher mal gewundert hatte, wieso die Jacke nach Rauch stank — rauchen tat Lothar doch schon seit dem Neujahrstag 1978 nicht mehr —, dachte sie sich erst gar nichts dabei. Und die Streichhölzer stammten ja vielleicht noch von dem Reeperbahnbummel nach der Jubiläumsfeier. Trotzdem; einer Eingebung folgend, rief Dörchen Horsti an, den Kassenwart des Sparclubs, und erkundigte sich unter einem Vorwand nach ihrem Kontostand, und als Horsti sich in Widersprüche verwickelte, drohte sie ihm mit einem Skandal, spätestens beim traditionellen Grünkohlessen an Weihnachten.
»In fünf Jahren feiern wir goldene Hochzeit«, sagt Dörchen zu dem Mann mit der Brille, »und das war weiß Gott nich' alles Gold, aber saufen tut er seit dreißich Jahre nich' mehr, und so was hier«, sagt sie und nickt in den Salon, »hat er sowieso noch nie gemacht. Das hätte ich gemerkt. Hat er noch nie gemacht, und hätte er auch nich' notwendich gehabt.«
»Der hat nie was Schlimmes gemacht hier, Muddi«, sagt der Mann mit der Brille. Inzwischen weiß er, welcher Lothar. Er hatte eine Ahnung gehabt und das blonde Mädchen von der Bühne hergewunken. »Der hat immer nur Selter getrunken, immer nur 'n bißchen geschäkert und den ein' oder annern Piccolo geschmissen, Feuer geben und charmant sein und so, und immer nur mit Chantal — nech, Chantal?«
Als es so vor ihnen stand, das Mädchen, mit der Hüfte an die flache Brüstung gelehnt, und Dörchen offen ins Gesicht schaute, kriegte Dörchen wieder dieses komische Gefühl.
Nach einer Stunde macht sie sich auf. » Was kost' der Piccolo? Fümmundreißich Euro? Da krich ich bei toom zehn große Flaschen für!«
Der Mann grinst. »Denn sach dein' Mann ma’, daß er demnächst zu toom gehn soll ...«
»To'm Dübel soll er gehn«, murmelt Dörchen.
Am nächsten Nachmittag, Sonntag, ruft sie nicht, wie sonst jeden Tag, als erstes Lothar an. Statt dessen sagt sie Gitti ab. »Ich hab das mit'n Darm«, sagt sie. »Kann kein' Kaffe vertragen, und deinen komischen Karottenkuchen schon gar nich'.«
Den ganzen Nachmittag pusselt sie in der Küche herum, dann flust sie die Wohnzimmerlampen mit dem Staubwedel ab und klopft die Sitzecke aus. Unterdessen legt sie eine Platte von Carl Bay auf den Zehnerwechsler. Lothar hat sich immer gewehrt gegen Günni und Gitti, wenn sie die alte Musiktruhe auf dem Flohmarkt verscheuern wollten, und da war Dörchen mit ihm immer einer Meinung gewesen; zwar hat Lothar von den beiden zu irgendeinem Geburtstag eine Stereoanlage geschenkt gekriegt, aber mit »diesen CTs« ist sie nie zu Rande gekommen. Sie zieht neun weitere Platten aus den Klarsichthüllen des Albums — Caterina Valente, Hansi Kraus, Bill Ramsey — und pfropft sie nacheinander auf den Stutzen, und es ist schon dunkel geworden draußen, als sie auch noch die alten Fotoalben aus der untersten Lade im Stubenschrank kramt und im Licht der Stehlampe zu blättern beginnt, mit zittrigen Fingern die Pappdeckel umlegt und das dünne Schutzpapier dazwischen, und schon bei der dritten Seite fängt plötzlich ihr Herz im Hals zu klopfen an.
Unter dem schwarzweißen, gezackten Foto Dörchens Handschrift: Im »Tivoli«, 1958. Was für ein Mannsbild er war; wie ihr Magen mitschwang, wenn ihre Fingerkuppen seine Tolle nachfuhren; und diese gediegenen Manschettenknöpfe ... Und dann betrachtet sie sich selbst; sie war überraschend geknipst worden, das weiß sie noch, von Ewald, der schon seit 1966 nicht mehr unter den Lebenden weilt, und als sie ihr eigenes Gesicht von 1958 anguckt, da fängt plötzlich ihr Herz im Hals zu klopfen an. Wie immer, wenn sie sich beruhigen muß — vor allem, seit sie alt wird —, verspürt sie auch diesmal den Drang, es auszusprechen. »Nur die Haare sind anners«, murmelt sie, während sie ihr Gesicht anguckt, »aber sonst ...« Lippen, Nase, Stirn und Augen, der naive, frische Gesichtsausdruck — »genau wie diese Chantal«, murmelt Dörchen. »Genau wie diese Chantal.«
Noch als die Kuckucksuhr zwölf schlägt, sitzt sie da in Lothars Ohrensessel; sie hat Lothar nicht mehr angerufen, und als das Telefon geklingelt hat, ist sie nicht rangegangen. Seit Stunden denkt sie immer wieder an den gelblichbraunen Fleck auf Lothars Handrücken, die Druckstelle, wo Lothar seine Stirn gegengestemmt, als er die ganze Nacht immer wieder vor dem hochgeklappten Klodeckel gestanden und gepreßt hatte; und Lothars Hände waren zeitlebens allerhand gewohnt gewesen, Mörtel und Stein, Wind und Wetter, Hammerschläge und was nicht sonst noch alles, vierzig Jahre lang.
Irgendwann schläft Dörchen im Sessel ein, und am nächsten Morgen ruft sie Gitti an und bittet sie, ihr eine Bahnfahrkarte nach Bad Kissingen zu besorgen, »erst mal nur Hinfahrt; zurück fahr' ich dann mit Papa«. Nichts hat sie sich beim Erwachen plötzlich mehr gewünscht, als den Winteranbruch mit Lothar zu erleben.
[Menü]
Trilogie der Gewalt I
Schorf
Der Vollmond hängt über den platten Dächern wie 'n Riesenarsch. Wie der Arsch von Gott, 'n Arsch mit Pocken. Eine Luft hier, seit Wochen, und stinkt wie ... Auf’m Nebenbalkon, mitten in den Lobelien, leckt sich Nachbars Katze die Fotze. Lobelien heißen die, glaub' ich.
Ich gaff’ durch die Gitterstäbe. Keiner zieht die Vorhänge zu, die Schweine die, Gekeife und Gerülpse bis in die Nacht. Tagsüber kann ich den Tauben aufs Kreuz gucken, wenn die sich von den Traufen runter in die Gosse stürzen. Das Pfeifen von den Flügeln hört man auch bei dem ganzen Krach von den Gören und Arschlöchern, bei dem Gegröle den ganzen Tag. Nachts ist es meistens ruhig, außer da schreit mal einer.
Gestern abend hab' ich plötzlich 'n komisches Gefühl gekriegt, hier, auf dem Balkon. Ich hatte über alles mögliche gegrübelt. Manchmal grübel ich, bis mir schlecht wird. Und auf einmal hat mich 'ne komische Aufregung gepackt, und ich hab' nicht mehr gewußt, wo der Unterschied ist, ob man nun über den Absatz der Balkontür oder übers Geländer steigt. Jedenfalls hab' ich das Gefühl gehabt, als kannte ich den Unterschied plötzlich nicht mehr. Ich hab' Herzklopfen gekriegt. Ich bin zum Imbiß gegangen und hab' 'n paar Dosen gezecht. Svenni hat bloß gelacht.
Ich leg' den vollgeölten Putzlappen beiseite. Ich find' den trockenen nicht wieder in dem Gerümpel hier, und der Ärmel vom T-Shirt ist zu kurz. Schwitz' ich eben weiter. Ich lutsch' an 'ner Apfelsine. Ist gut, Vitamine. Der Geschmack erinnert mich an Blut. Ich pul' am Schorfstreifen, der sich vom Nabel bis zu den Schamhaaren zieht. Kanaker der. Macht der nie wieder, der Kanaker der.
Eine Luft hier, stinkt wie ... »Mach das Licht wieder aus«, sag' ich nach drinnen. Wisch' ich mir die klebrigen Finger eben mit dem Öllappen ab. Die Augenwinkel jucken vom Schweiß. Putz' ich das Okular eben nicht. Okular heißt das, glaub' ich.
»Was?«
»Du sollst das Licht ausmachen.«
»Warum? Laß ja die Tauben in Ruhe!«
»Nachts und Tauben«, sag' ich, »los, Licht aus.« Ich leg' das Fernrohr auf den Tisch, greif’ nach dem Zylinder und öl' ihn ein. Der ist schwer, ist der.
Zum hundersten Mal das Geplärr von dieser Schlagersängerin, mir fällt nicht ein, wie die noch mal heißt, irgendwas mit F oder V. Das Gelaber von den Fernsehern aus den offenen, erleuchteten Balkontüren, aus unserer auch. Die Schlampe von genau gegenüber, die immer den ganzen Tag die Titten in die Sonne hängt, guckt dasselbe wie meine nuttige Mutter, das seh' ich an dem gleichzeitigen Flimmern.
»Was machst du da.«
»Nichts. Mach endlich das Licht aus, sonst ...«
Sie macht das Licht aus. Ich schraub' den Schalldämpfer vor den Lauf und schieb' das Fernrohr drauf. Sie kann's nicht ab, wenn ich Tauben schieß'. Vump!, und das Viech platzt in der Luft, 'ne Federnexplosion, Ende.
Reklamegelaber. Ich hör' unsere Toilettenspülung. Die Schlampe von gegenüber kommt auf den Balkon und hängt Wäsche auf. Die Luft stinkt nach Fett und halben Hähnchen, ich schnupper' am Waffenöl. Die Katze springt aus dem Blumenkasten in die Wohnung, und plötzlich leg' ich an, den Kolben auf dem Geländer. Fast auf Anhieb hab' ich die Schlampe von gegenüber im Visier. Ich seh' die Wäscheklammer zwischen ihren Lippen und den Pickel am Hals. Ich merk' die zwölf Stockwerke Luft unter mir, heiße, fettige Luft. Ich merk', wie mir schwindlig wird, und vump!, knallt mir der Schaft gegens Schlüsselbein. Sie ist weg. Nur noch die helle Balkontür und der Fernseher, der genau so flimmert wie unserer. Mein Herz klopft ganz schön. Ich blute am Unterleib, irgendwie ist der Schorf abgerissen, fast ganz ab.
Im Imbiß, als ich die erste Dose Bier aufreiß', fällt mir plötzlich der Name der Schlagersängerin ein. Das Bier schmeckt nicht.
Bier auf Apfelsine schmeckt nicht. Svenni lacht bloß. Von hier unten kann man den Mond nicht sehn. Seh' ich ihn eben nicht.
[Menü]
Der Stich des Bienenmörders
I.
Seit sie zwölf oder dreizehn war, glaubte Katja an den Traummann. Drei-, viermal jährlich erschien er ihr. Nie als ganzer Mensch mit Haut und Haar (beides dunkel, soviel wußte sie) — er war nur ein Schemen. Doch in seine Achselhöhle paßte ihr Kopf wie in jenen gepolsterten Helm, den sie trug, wenn ihr Vater sie, selten genug, aus der engen Wohnung zum Kart-Fahren entführte, und verhaute sie eine Mathe-Arbeit, schenkte der Traummann ihr ein Lächeln (Zähne so schön wie Porzellan); ja, manchmal machte er einen Witz, über den sie noch kicherte, wenn sie erwachte. An die Pointe konnte sie sich nie erinnern; die wohlige Reizung des Zwerchfells spürte sie dennoch. Als sie fünfzehn wurde, verliebte sie sich in ihren Klassenkameraden Florian (dessen Traumfrau sie war), doch der Traummann erschien ihr all die Jahre weiter. Nach und nach gewöhnte sie sich an die Angst, sie würde ihn nicht erkennen, wenn sie ihm begegnete, und mit Anfang Zwanzig richtete sie sich darauf ein, daß sie ihm erst sehr viel später begegnen könnte, als sie bislang befürchtet hatte.
Sie täuschte sich. Es geschah, als sie vierundzwanzig war, am Pier von Ancona, zu Beginn ihrer Hochzeitsreise im Juni 1993. Sie schaute zu, wie die Lastzüge die Laderampe des Fährschiffs El. Venizelos hinaufdirigiert wurden. Obwohl sie ihn auf Anhieb erkannte, jagte ihr sein langer Blick aus dem Führerhaus jenes Fünfundzwanzigtonners Heidenangst ein. Wie eine Spritze ins Rückenmark fühlte sich das an; die Injektion schien endlos zu dauern (literweise süßes Gift), und noch Stunden, nachdem sie den Einstich verschmerzt hatte, war ihre Wirbelsäule wie taub. Ihre Augäpfel aber brannten. Immer wieder elektrisierten willkürlich der Flaum im Nacken und die Härchen auf den Unterarmen, und die Anstrengung, Florian das Glucksen und Seufzen zu verheimlichen, raubte ihr fast den Atem.
»Bist du gar nicht müde?« flüsterte er.
»Hm ...?« Sie spürte, wie er seinen Kopf bewegte. Indem sie den Hals streckte, schob sie ihm ihren Scheitel unters Kinn, um zu verhindern, daß er ihren Blick fände. Er ächzte halb gut-, halb unwillig und rückte die Rolle des Reserveschlafsacks in seinem Nacken zurecht.
Die Fähre hatte mit erheblicher Verspätung abgelegt. Katja und Florian, Torsten und Marlen gehörten zu den letzten, die eingeschifft worden waren. Mit Müh und Not hatten sie dieses Plätzchen ergattert, auf dem Außengang unterhalb des Oberdecks, neben jener scheunentorgroßen Abluftanlage, deren Fauchen und Brummen nie aufhörten. Die Vibrationswellen der vierzigtausend PS starken Motoren rollten durch den Stahlboden, und über ihnen, von zwei Kranarmen gehalten, schwebte ein Rettungsboot. Es war die Backbordseite, und Katja versuchte flüchtig, die aufwühlenden Fernsehbilder der letzten Wochen mit dem friedlichen Dunkel in Einklang zu bringen, das jenseits des schmalen Meeres lag (war der milde, funkelnde Nachthimmel nicht derselbe wie über Bosnien?). Doch gleich darauf leuchtete in ihrem Kopf, den sie an die Schulter ihres frischgebackenen Ehemannes gebettet hatte, wieder der Blick des Traummannes auf. Er, den sie zehn, zwölf Jahre lang erwartet hatte, fuhr auf demselben Schiff wie sie nach Heraklion (und möglicherweise weiter nach Kleinasien).
Der Druck in ihrer Brust entwich mit einem Wimmerlaut, der Unruhe in ihren Hüften auslöste. Ihre Finger zitterten, als sie sich aus dem Schlafsack befreite. Torsten und Marlen schienen in märchenhaftem Tiefschlummer vereint; Florian wisperte schläfrig, und sie flüsterte: »Muß aufs Klo ...« Durch Felder fahlen Neonlichts tappte sie in der nächtlichen Adria-Brise den Gang entlang, der, verengt von all den Nestern der Rucksacktouristen, zu der Feuerschutztür führte.
Die Lounge war geschlossen, desgleichen Restaurant und Self-Service, die kleine Spielhölle und die Diskothek. Im Raum mit den restlos besetzten Pullmansitzen herrschten Dämmer und dösige Ausdünstungen; in den einsamen Korridoren zwischen den Kabinen glommen Nachtleuchten knapp überm buntgemusterten Teppich; im Rezeptionssaal, in den Zwischensalons und den beiden Treppenatrien lagerten inmitten ihrer Burgen aus Taschen und Säcken Schlafende. Torsten hatte geschätzt, neun Zehntel der zweitausendfünfhundert Passagiere seien Türken. Durch den Krieg in Bosnien und Herzegowina, so Torsten, sei ihnen der Autoput versperrt, und so machten sie den Weg in ihren Heimaturlaub auf einem griechischen Schiff. Torsten trug die Miene eines unterm Deckmantel neutralen Interesses feixenden Dritten, und Katja hatte sie nicht zu deuten gewußt, bis Florian ihr Zypern erklärte.
Nach zwei Stunden nächtlicher Tippelei von Back- nach Steuerbord, vom Bug bis zum Heck, vom Ober- bis zum untersten Passagierdeck kam Katja sich dumm vor, verloren und dumm. Eine hübsche kleine Arzthelferin, die kaum verstand, was vor sich ging zwischen Balkan und Elbdeichen, aber unter Hunderten von jungen Männern mit dunkler Haut und dunklem Haar einen bestimmten zu finden hoffte (der zudem vermutlich in einer der Vierbettkabinen unter Deck nächtigte) ...
Morsch fühlte sie sich, als Florian sie weckte; ein Schmerz in der rechten Schläfe begleitete sie in den Waschraum. Doch beim Blick in den Spiegel fiel ihr ein, daß sie wieder einmal vom Traummann geträumt hatte. Nein, schlafvernebelte Erinnerungwar es gewesen, Erinnerung an seinen Blick aus dem Führerhaus. Erneut schlich Taubheit in ihre Bandscheiben. Er war es, da gab es keinen Zweifel; ebensowenig daran, daß er seinerseits sie erkannt hatte. Warum sonst der lange Blick über die bepackten Dächer der Fords und Opels und Toyotas hinweg und das erst erstaunte, dann beinah gelöste Lächeln danach? Hätte ihn nicht der Pfiff des Einweisers aufgeschreckt, der fuchtelnd auf sich aufmerksam machte — wäre er nicht ausgestiegen und zu ihr gekommen? Um sie zu begrüßen, die sie wie erleuchtet auf dem Sozius von Florians Maschine verharrte? Auch daran zweifelte Katja kaum, und so war sie nicht überrascht (sondern bloß fiebrig erregt), als der Steward Torsten und Marlen, Florian und sie zum Frühstück an ebenjenen Tisch im Restaurant placierte, an dem er rauchend wartete.
Diese Fügung befeuerte Katjas Glauben an den Traummann. (Wann immer sie von der Begegnung erzählte — viel später, ab dem Sommer 2001 —, verteidigte sie das Schicksalhafte daran gegen Erzählungen von ähnlichen Zufällen, die nahezu jeder ihrer Zuhörer parat hatte.) Ob im vulkanischen Strandsand von Lentas, am Palmen-Strand von Vai, unter den Kronen der duftenden Eukalyptusbäume von Georgioupolis oder im Schatten der Samaria-Schlucht — die darauffolgenden vier Wochen standen unter dem Stern der Sanftheit in Pavlos' Augen. Pavlos' Blick folgte Katja durch die Gassen von Heraklion und Chania, ins Ida-Gebirge und auf die Hochebene von Lassithi. Sein Blick begegnete ihr in den schweren Rotweinen und im scharfen Raki, und wann immer Katja an einem ähnlich verbrauten Tee nippte wie bei jenem Frühstück auf der El. Venizelos, hörte sie wieder seine unerschütterlich ruhige, leidenschaftliche Stimme. Heimlich zückte sie ihr Reisetagebuch, wann immer ihr etwas von den Antworten einfiel, die er in seinem knarrenden, sparsamen Englisch (»You, I see yesterrday, in the porrt!«) auf ihre hemmungslosen Fragen gegeben hatte: Angehöriger einer griechischen Minderheit im Süden Albaniens (beiläufig wies er durchs Restaurantfenster auf den rundlichen, kargen Hügelzug am sonnigen Meereshorizont, den das Schiff gerade passierte), 1989 vom Militärdienst desertiert, über die Grenze nach Griechenland, Unterschlupf in einem Dorf namens Kouphala an der ionischen Küste, dort Fischer, schließlich Lkw-Fahrer für einen Händler aus Ioannina, der Geschäfte mit italienischer Sanitärkeramik machte ...
Als Torsten ihn auf das Gerücht ansprach, es habe nächtliche Handgreiflichkeiten zwischen Passagieren und Besatzungsmitgliedern gegeben, hob er nur die Schultern, und als Torsten ihn dennoch in ein Gespräch über das heutige Verhältnis der Griechen zu den Türken zu verwickeln versuchte, fragte Katja, ob es schön sei in Kouphala. » Verry beautiful«, sagte er, und seine Augen bekamen einen Perlschimmer. Er fragte, woher sie kämen, und als sie es ihm sagte, begann sein Blick gar zu sprühen. »Hamburg — verry good ...« Sie fragte ihn nach seiner Telefonnummer. Er habe keine, sagte er, und seine Adresse laute: »Pavlos the fisserman, Kouphala.« Seine Zähne waren wirklich wie feinstes Porzellan. Sie ließ sich erklären, wo Kouphala lag. Wie gestriegelt fühlte sich die Haut auf ihrem Handrücken an, wo er sie flüchtig berührt hatte, als er die dünne Serviette entgegennahm, damit er mit rotem Filzstift eine Erinnerungsstütze für sie notieren konnte: Πανλος, PawlosΚονφακαKovfala.
Sie teilte ihr Glück, sie teilte es mit dem ahnungslosen Florian. Noch Jahre später sollte er von ihrer Hochzeitsreise nach Kreta 1993 schwärmen.
II.
Zurückgekehrt, richtete Katja in ihrer gemeinsamen Wohnung ein Stilleben ein, eine kleine Kultstätte auf der Flurkommode. Mittelpunkt war eine rechteckige Vase aus dickem Glas. Hinein gab sie all die Steine, die sie auf ihren langen Strandwanderungen gesammelt hatte. Ob des Reiseballasts hatte Florian sie gefrotzelt, und zu Haus gab sie ihm zunächst insgeheim recht. Die rauhen, grauen Schleier, die auf ihren Kleinodien lagen, enttäuschten Katja, ja verstörten sie. Doch als sie die Vase mit Wasser füllte (sie fügte gar einen Teelöffel Meersalz hinzu), lebten sie auf, leuchteten geradezu: der wie eine Forelle gesprenkelte ovale, flache; der schlammfarbene, krötenförmige; der grünspangrüne mit dem Ockerschatten an der Bruchkante; der lachsfarbene Drops mit den schwarzen Adern; der zweifach geschnürte, taubenblaue Taler; die marmorierten weißen und die geschieferten und all die übrigen Kiesel und Steine. Neben dieses Gefäß postierte Katja eine Sektflöte mit einem Zweig Salbei, ein Tonfäßchen mit Pinienhonig (sie war verrückt danach) und davor, auf ein rundes, weißes Deckchen mit geklöppelter Spitze, ein noch volles jener 20-cl-Fläschchen Ouzo, deren sie eines in fast jeder der heißen Nächte auf den Terrassen ihrer Unterkünfte vor dem Schlafengehen vernascht hatte (unter den imaginären Blicken Pavlos'). Wenn Florian Spätoder Nachtschicht schob, legte Katja manchmal eine Musikkassette ein, bevor sie den Verschluß des Fläschchens aufdrehte, um zu schnuppern; manchmal betrachtete sie das Etikett, und zusammen mit dem Salbei- und Ouzo-Duft und den schwankenden Rhythmen der Bouzouki-Musik stürzte der Anblick der fremdartigen Buchstaben sie in eine heillose Sehnsuchtsumnachtung: ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΡΟΙΟΝ ... ΠΑΡΑΓΩGH ... ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ... Dann schleckte sie ein wenig Pinienhonig und blätterte in dem Fotoalbum mit der Aufschrift Kreta 1993 (die Reue darüber, daß sie seinerzeit versäumt hatte, einen Schnappschuß von Pavlos zu machen, kam ihr selbst seltsam verlogen vor — so als ahnte sie, daß er als reines Erinnerungsbild wertvoller für sie war), und schließlich öffnete sie die Lade mit der Tischwäsche, um die Florian sich nie scheren würde, und zückte ihr verborgenes Reisetagebuch. Darin lag die Serviette, deren rote Aufschrift - Πανλος, PawlosΚονφακαKovfala— ganz allmählich ausbleichte.
Im Frühjahr 1994 erlitt Florians Vater einen Herzinfarkt und starb; kurz darauf ging Dr. Schmidt in Konkurs. Die fünf Wochen ihrer Arbeitslosigkeit nutzte Katja, indem sie an der Volkshochschule einen Kurs für Neugriechisch belegte. Ihre mangelhafte Begabung suchte sie mit Fleiß wettzumachen; sie kämpfte sich durch die zungenbrecherischen Lektionen, und zwar um so zäher, je tiefer Florian in der Trauer um seinen Vater versumpfte (und die Aussicht schwand, in den Ferien aufs griechische Festland zu fahren), doch um so zuversichtlicher, je näher dann der Sommer 1995 rückte. Katja meisterte die frühen Prüfungen ihrer Ehe, indem sie aus den Fehlern lernte, die Marlen mit Torsten beging; indem sie sich in Dr. Quadsens Praxis unentbehrlich machte und Vokabeln paukte, Reiseführer und Landkarten studierte, wenn Florian Schicht- und Wochenenddienst schob oder mit Torsten um die Häuser zog. Und indem sie ihr Stilleben pflegte. Die Serviette gemahnte sie zuverlässig daran, wie sie übers nächtliche Schiff geirrt, aber keineswegs verzweifelt war und am Morgen dafür belohnt wurde.
Für Florian schien Pavlos schnell vergessen unter all den anderen Urlaubsbegegnungen mit Adreßaustausch, zumal Katja ihn aussparte bei ihren Gesprächen über gemeinsame Erinnerungen; regelmäßig aber wärmte sie den Ortsnamen Kouphala auf, wobei sie dessen Quelle geschickt anonymisierte. Und in all ihrem Mühen um ein Glück jenseits der zugigen Straßen und verschlossenen Backsteinbauten Hamburg-Hamms fühlte Katja sich bestätigt, als sie im Sommer 1995 tatsächlich jenes Dorf am Ionischen Meer entdeckten (ohne Torsten und Marlen, die sich getrennt hatten), von einem oleanderbewachsenen Rastplatz an der Europastraße 55 aus: tief unter dem Hochofen der Sonne hingegossen eine gras- und efeu-, moos- und olivgrüne Ebene, getigert von kostbaren Schattenstreifen, durchkreuzt von sandhellen Wegen. Der Südhorizont eine dunstige Gratkette, doch der Westen das Tor zum gleißenden Meer, bewacht von zwei dicht bewachsenen Berghügeln. Zwischen ihnen leuchtete ein saphirblauer Meerbusen, umkurvt von Strand so hell wie Florians Haar, und dessen halben Bogen entlang wiederum schwang sich ein Hain von Eukalyptusbäumen mit angerosteten Kronen. Daran geschmiegt ein Haufendorf, ein schiefes, offenes Labyrinth aus hellen Häuschen und Häusern, fast alle karminrot gedeckt.
Der schöne Fluß entlang der Südwestgrenze, von jenem Aussichtspunkt aus war er hinter Grün und einer Art Mole aus Felsbrocken verborgen; deshalb sahen sie ihn erst bei ihrer Erkundungsfahrt. Der Restaurantgarten der meistbesuchten Taverne lag direkt an seinem Ufer, unter Baumwollpappeln, Eichen und einem Eukalyptusbaum. Katja und Florian quartierten sich ins Gästehaus ein. Die Tage verbrachten sie am heißen Strand, die Nächte durchfeierten sie am Fluß, der schwarz war, frühmorgens aber schimmerte wie ein Fisch, sich mittags pastell- und nach Sonnenuntergang jadegrün färbte. Sie fanden Anschluß an eine Schrauberclique, die jährlich ein- bis zweimal hierherkam. Der Abschied fiel schwer, um so leichter aber die Entscheidung, im nächsten Jahr wiederzukehren.
Gleich am ersten Tag hatte Katja den Tavernenwirt nach »Pavlos the fisserman« gefragt. Er sagte, er sei mit dem Lkw in Italien unterwegs. Natürlich bedauerte sie im stillen, daß sie ihn nicht antraf. Was sich in diese Traurigkeit dreinmischte, war jedoch ein Gefühl, dessen Auftauchen ihr mysteriös vorkam: Erleichterung. Klarer wurde es ihr zu Haus, im Gespräch mit Marlen (der sie wenn auch noch nicht von Pavlos, so doch vom Traummann erzählte): Ihr erhofftes Glück schien so übergroß zu sein, daß es — damit es nicht schon vor der Zeit eingehe — viel Geduld, Schutz und Verzicht benötigte, um wachsen zu können. Das beste Beispiel für dieses Prinzip war Paulchen, den sie im April 1996 gebar (so daß sie erst im September 1997 nach Kouphala zurückkehren konnten — diesmal war Marlen mit von der Partie —; Pavlos aber war wieder in Italien unterwegs, ebenso wie im Juni/Juli 1998 und Juni 1999).
Im Lauf der Jahre veränderte sich der liebliche, unschuldige Charakter Kouphalas teilweise schmerzhaft; nichtsdestotrotz unverbrüchlich schien Katjas Empfindung, in diesem Dorf eine zweite Heimat gefunden zu haben. Daß es eines Tages ihre erste werden könne, hoffte sie, Pinienhonig schleckend, all die verregneten Hamburger Winter glühend (zumal der Traummann nie aufhörte, ihr zu erscheinen). Bei der Ankunft im August 2000 aber schockierte Florian, Marlen und besonders sie, Katja, daß der geliebte Wirt ihrer Stammtaverne unlängst tödlich verunglückt, und im Juni 2001, daß der Fluß verbreitert und sein Ufer betoniert worden war.
Zum ersten Mal wurde Katja ihr Unbehagen augenfällig; ein Unbehagen, das sie von Jahr zu Jahr zunehmend beschlich, weil sie die ursprüngliche Verheißung Kouphalas offenbar ebenso schleichend aus ihrem Herzen ausgelagert hatte — ins Kellerabteil des Hammer Mietshauses. Dort verstaubten, etikettiert mit Jahreszahlen, Keksdosen voller Kiesel. Nur die allererste Sammlung (die ganz selbstverständlich mit in die größere Wohnung umgezogen war) pflegte Katja regelmäßig. Zunächst leerte sie die rechteckige Vase, befreite das dicke Glas von Kalkrändern, trocknete und polierte es auf Hochglanz, und dann füllte sie die Kiesel wieder hinein und begoß sie mit frischem Wasser.