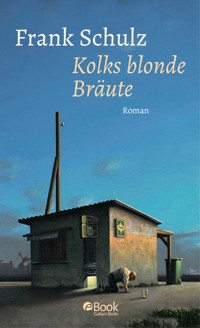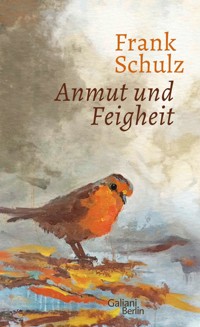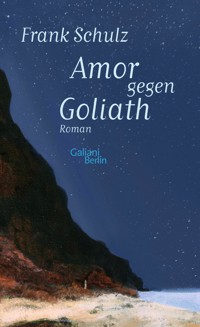
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Roman, der ins Herz der Klimabewegung, auf die Höhen deutscher Sprachartistik und in die Hölle einer Angststörung führt. Cathi Weye, allseits beliebte und geschätzte Psychologin und in ihrer Freizeit klimakrisenkämpferisch hochaktiv, will auf einer griechischen Insel endlich mal richtig ausspannen – und die Beziehung zu ihrem geliebten, aber immer seltsamer werdenden Mann kitten, dem Ex-Bühnenkünstler Ricky Kottenpeter. Der versucht unglückseligerweise vor der Welt und seiner Frau zu verbergen, dass er unter heftigen Angststörungen leidet; statt neue Songs zu komponieren, verkriecht er sich daheim den ganzen Tag in seinem Proberaum und hier im Urlaub auf dem Zimmer, wo er nichts tut außer Beruhigungsmittel zu schlucken und seine Angst vorm Angsthaben zu bekämpfen. Die Zusatzangst, seine vergötterte Cathi zu verlieren, treibt ihn zudem zu zart enervierenden Eifersuchtsaktionen. Nebenan der flamboyante Philipp Büttner, gleich mit zwei Frauen und einer Mission. Der mit allen Wassern gewaschene Journalist und Frauenheld will einen Coup landen: Ein ›Konfusius‹ genannter Zausel sorgt mit seinen bizarren Auftritten und wortmächtigen Strafpredigten wider die naturzerstörende Menschheit für mächtig Wirbel im Internet. Nur weiß niemand, wer er ist und was ihn antreibt. Büttner vermutet ihn auf der Insel und will die große Enthüllungsgeschichte. Bei so viel Erholungsbedarf und gemeinsamem Gesprächsstoff kommen sich Cathi und Büttner bald bedrohlich nahe. Und neben Klima- stehen bald ganz andere Katastrophen ins Haus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1021
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Frank Schulz
Amor gegen Goliath
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Frank Schulz
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Frank Schulz
Frank Schulz, Jahrgang 1957, wurde für seine Romane vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Hubert-Fichte-Preis (2004), dem Irmgard-Heilmann-Preis (2006) und dem Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor (2015). Zwischen 2012 und 2016 erschienen seine drei Onno Viets-Romane Onno Viets und der Irre vom Kiez,Onno Viets und das Schiff der baumelnden Seelen und Onno Viets und der weiße Hirsch. Zuletzt erschien der Erzählband Anmut und Feigheit (2018).
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Ein Roman, der ins Herz der Klimabewegung, auf die Höhen deutscher Sprachartistik und in die Hölle einer Angststörung führt.
Cathi Weye, allseits beliebte und geschätzte Psychologin und in ihrer Freizeit klimakrisenkämpferisch hochaktiv, will auf einer griechischen Insel endlich mal richtig ausspannen – und die Beziehung zu ihrem geliebten, aber immer seltsamer werdenden Mann kitten, dem Ex-Bühnenkünstler Ricky Kottenpeter. Der versucht unglückseligerweise vor der Welt und seiner Frau zu verbergen, dass er unter heftigen Angststörungen leidet; statt neue Songs zu komponieren, verkriecht er sich daheim den ganzen Tag in seinem Proberaum und hier im Urlaub auf dem Zimmer, wo er nichts tut außer Beruhigungsmittel zu schlucken und seine Angst vorm Angsthaben zu bekämpfen. Die Zusatzangst, seine vergötterte Cathi zu verlieren, treibt ihn zudem zu zart enervierenden Eifersuchtsaktionen.
Nebenan der flamboyante Philipp Büttner, gleich mit zwei Frauen und einer Mission. Der mit allen Wassern gewaschene Journalist und Frauenheld will einen Coup landen: Ein ›Konfusius‹ genannter Zausel sorgt mit seinen bizarren Auftritten und wortmächtigen Strafpredigten wider die naturzerstörende Menschheit für mächtig Wirbel im Internet. Nur weiß niemand, wer er ist und was ihn antreibt. Büttner vermutet ihn auf der Insel und will die große Enthüllungsgeschichte.
Bei so viel Erholungsbedarf und gemeinsamem Gesprächsstoff kommen sich Cathi und Büttner bald bedrohlich nahe. Und neben Klima- stehen bald ganz andere Katastrophen ins Haus.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2024, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Wolfgang Hörner
Covergestaltung: Lisa Neuhalfen
Covermotiv: © Stephan Storp
ISBN978-3-462-30287-5
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Stargast:
Christian Meurer
Für Verena
Dies ist ein Werk der Fiktion, sein Stoff jedoch ein Phänomen der Realität. Demzufolge mögen Ähnlichkeiten der fiktiven Charaktere mit realiter lebenden oder toten Personen nicht eben zufällig erscheinen. Nichtsdestoweniger geht es in diesem Roman keineswegs um etwaige reale Individuen, sondern um die literarische Funktion ihrer fiktionalisierten Charaktere.
Prolog I
Kalokaíros, Südkreta
Nacht auf Mittwoch, den 8. September 2021
Murmelnd tappen zwei Schattengestalten die Zementtreppe zum Strand hinab. Tastend folgen sie den tanzenden Kugelblitzen ihrer Handys. Auf den Stufen schmirgeln ihre Sohlen, und aus dem dunklen Tamariskenstrauch zirpt eine einzelne Zikade – apathisch fast, als pfiffe aus dem letzten Loch der große Pan.
Kurz darauf, am Meeressaum (kein Rauschen heut Nacht, bloß Rascheln), lassen sich die beiden Sterblichen nieder. Die Lampen verlöschen, erst die eine, dann die andere. »Krass«, raunt die Frau genüsslich und ehrfürchtig, und ihr Alt schweift über die matte Dünung hin, ein wenig kehlig, weil Kopf im Nacken. Weit und breit kein Mond; umso sahniger leuchtet – quer durch den funkelnden Äther – der gesprenkelte Strom der Milchstraße heim. Als Resonanz ein männliches Brummen voller Bejahung, so wohltemperiert, dass noch die Göttinnen im fernen Olymp dahinschmölzen.
»Nun aber mal, wie sagt man bei euch an der Elbe: Butter bei die Fische«, fügt die Frau hinzu, nahezu hastig, denn wiewohl die Brise ablandig haucht, wirkt das Odeur nach Algen, Laich und Meeresfrüchten eindringlich genug, um aufzurühren: »Wer bist du eigentlich?« Vorhin, in der Taverne – wo Leon soeben die Neonlampen unter der Pergola ausgeknipst hat –, haben sie unpersönlich diskutiert, so unpersönlich es eben ging, auch noch, als die anderen schon gegangen waren.
»Mein Name«, beginnt der Mann, als parodierte er Bourgoisjargon – ein Taschenspielertrick, um den Hochstatus des geheimnisvollen Unbekannten, ebenso demonstrativ wie bescheiden, opfern zu können (für ein noch höheres Ziel, versteht sich) –; »ist Büttner, Doktor phil. Philipp Büttner. Vierundfünfzig Jahre alt, stellungsloser Zeitschriftenredakteur. Verlobt. Geboren und wohnhaft in, genau: Hamburg.« Wechsel der Tonlage. »Und du?«
»Kinder?«
»Äh … nein. Du?«
»›Äh?!‹«
»Nein, nein. Du?«
»Nein. Cathrin Weye … in ein paar Wochen zweiundvierzig … Diplom-Psychologin im Öffentlichen Dienst. Verheiratet. Wohnhaft in Osnabrück.«
»Zweiundvierzig? Nein.«
»Schon gut, danke vielmals.«
»Psychologin.«
»Und?«
»Ja nein. Ich dachte mir schon so was.«
»Ach, echt? Normalerweise kommt so was wie: Oha, da muss ich ja aufpassen, was ich sage.«
»Und? Muss ich?«
»Klar! Ich warne dich! Ich bin Spezialistin für die dunkle Triade!«
Er schnaubt nur, und schon bleibt sie auf der Strecke: Weiß er denn nun, was mit jenem subklinischen Begriff aus der Psychologie gemeint ist, oder nicht?
Er aber fragt: »Was war denn mit deinem Tischherrn, vorhin? Gibt den ganzen Abend keine drei Silben von sich und verschwindet sang- und klanglos noch vorm Digestif …?«
Wow, denkt sie, amüsiert und ein bisschen missmutig zugleich, Digestif. Ist sie schon jemals einem Mann begegnet außer Papa und seinen Spießgesellen, der einen solchen Begriff aus der gehobenen Küche einfach so mal einstreut? Oder war das, vgl. Tischherr, ironisch gemeint?
»Ach«, seufzt sie atonal, »dem geht’s nicht so gut. Kommt hier aber allmählich wieder auf die Füße, sagt er.«
»M-hm …?«
Nach zwei Atemzügen Pause wieder sie: »Und was war mit deinen beiden Verlobten?«
Wieder schnaubt er nur, und wieder wurmt es sie, trotz ihrer Pointe ins Hintertreffen zu geraten. Doch dann sagt er: »Angenommen, du meinst tatsächlich, dass du hier und jetzt dein Fachwissen über die dunkle Triade benötigst, und ferner angenommen, du denkst tatsächlich, dass ich mit beiden äh, was habe … warum bist du dann hier, hier unten am Strand, hier und jetzt, mitten in diesem astronomischen Wahnsinn.« Mit mir, meint er. »Und nicht zum Beispiel bei deinem Mann, wo immer er sein mag.«
Und endlich ist es an ihr, in die laue Nacht hinaus zu schnauben; hinaus in diese deftige Fülle von dunklem Raum, hinein in dies gigantische Himmelbett für Geist und Seele. Dann sagt sie: »Aha. Faktor eins der Triade ist schon mal gegeben: Narzissmus.«
Nun schnaubt wieder er, diesmal weicher. Sie schnauben und schnauben, schnaufen und schnüffeln – Orientierung in der freundlichen Finsternis. Sie hört ihn lächeln.
Nicht dass sie nicht gern streitet. Misst sich gern im Wortgefecht. (Die Familie, aus der sie stammt, ist der reinste Debattierklub.) Doch die vergangenen zwei, zweieinhalb Jahre der Thesen-Meißelei, zänkischen Dekonstruktion und rhetorischen Jonglage mit unterschiedlichen Waaggewichten im alltäglichen ehrenamtlichen Aktivismus sind sehr, sehr anstrengend gewesen – und deshalb die Atempausen in diesem Moment, hier am Meer, eine wohltuende Abwechslung, sogar zum hitzigen, wiewohl witzigen Hin und Her vorhin an der geselligen Tafel voller Wein und Delikatessen. Auch dort ging es, innerhalb dieser glücklichen Fügung von weltanschaulich größtenteils harmonierenden Zeitgenossinnen und -genossen, im Großen und Ganzen um den tauenden Permafrost in Sibirien, um die jüngsten Waldbrände in Kalifornien, Kanada, Portugal und Griechenland, um die Flutkatastrophe, die acht Wochen zuvor über das ureigene Ahrtal hereingebrochen ist, sowie um so etwas wie Hafermilch und etwa die Art und Weise, wie zum Teufel sie alle überhaupt hierher gelangt sind, an diesen ihren hoch geschätzten Urlaubsort (durch die unverhältnismäßige Verbrennung von Kerosin nämlich).
Zur Abwechslung, wie gesagt, sehr wohltuend, hier am Strand: Atmung … Stille … Langsamkeit. Mit Bedeutung aufgeladen jedoch nicht nur dadurch.
»Übrigens«, sagt er nach einer Weile, die bemerkenswerterweise in keiner Weise unangenehm gewesen ist, »keine Ahnung, ob’s dir aufgefallen ist, aber eine meiner Verlobten steht auf deinen stillen Begleiter. Wenn nicht alle beide.«
»Ha!«, hustet sie. »Macchiavellismus. Faktor zwei. Check.«
Jetzt lacht er. Ein Lachen, das ihn geradezu ereilt. Ein sympathisches Lachen; leicht selbstgefällig getönt – doch nicht unsympathisch. Danach ist es wieder still, und beide lauschen sie der Stille. Zehn oder zwanzig Pulsschläge später aber: schluckaufartige Stimmritzenreflexe, sodann ein blasenwerfendes Schnaufen, dann ein Schniefen und dann Ausatmen mit offenem Mund – ein tonloser Seufzer.
»Brauchst du … ein Taschentuch?« Er streckt die Hüfte und wühlt in der Tasche seiner Khaki-Chino.
Und dieses Angebot – die Aufmerksamkeit, die entschärfte Intonation –, dieser nette Wink öffnet die Schleuse. Unter Quellströmen von Tränen angelt sie nach dem hellen Papiertuch, das der Hamburger ihr durch die Dunkelheit reicht, schnäuzt sich und seufzt – und wird aufs Neue von Konvulsionen geschüttelt, aufs Neue übergossen von einem Schwappen aus jenem Fass, das in den vergangenen zwei, zweieinhalb Jahren vollgelaufen ist: mit Beklommen- und Benommenheit, Beklemmung und Bestürzung, Angst und Niedergeschlagenheit, Traurigkeit und Trauer; mit Ingrimm, Wut und Zorn. Ja, auch Freude, Befriedigung, Hoffnung, Liebe hatten geherrscht, punktuell oder phasenweise. Hätte nicht auch all das hin und wieder geherrscht, dann allerdings ohnehin gute Nacht.
Er fragt nicht, er sagt nichts, und er berührt sie nicht – haptisch jedenfalls nicht. Er bleibt nur voller Ruhe neben ihr sitzen im Kies am Libyschen Meer unterm bestirnten Himmel und nimmt an ihrem Schluchzen Anteil. Als sie fertig ist, gibt sie keinerlei Erklärung ab, sondern ein nordwestfälisch gefärbtes Ächzen von sich und sagt: »So, und jetzt erzähl mir einen Witz.«
»Auha«, ächzt er hamburgisch und räkelt sich, um sich zunächst einmal zu vergewissern: »Bist du sehr woke?«
Langsam gewöhnt sie sich an seinen Zungenschlag, frecher hier als noch eben am Debattentisch. »Im Prinzip bemüh ich mich«, seufzt sie. »Im Moment aber, ehrlich gesagt …«
»… eher tired?«
Sie gluckst.
»Na denn«, beginnt er. »Bei den Müllers klingelt’s. Der Hausherr öffnet die Tür. Steht ein Fremder auf der Matte und sagt: ›Gutten Tage, meine Name ieste Umberrrto Pantalone. Bien iech hierr, ume zume Fieckene Ihre Frau.‹ Der Hausherr meint, er hört nicht recht. Brüskiert fragt er: ›Um was??!‹ Und der Fremde genervt: ›Ume-berrrto!!‹«
Wieder haben Cathis Tränendrüsen zu lenzen, für diesmal aus anderen Quellen. Es dauert lächerlich lange, bis die Hyperventilation sich wieder normalisiert hat; bis ihr von immer neuen Kontraktionen strapaziertes, hin und her gezurrtes und rauf und runter massiertes Sonnengeflecht sich halbwegs wieder entspannt hat; bis die biochemischen Folgen des homerischen Gelächters – Endorphin-, Serotonin-, Dopamin- und Oxytocin-Ergüsse – wieder abklingen. Nachdem es ihr gelungen ist, sich zu fassen – ihre aufgescheuchten, aufgereizten Lebensgeister einzufangen und zu bändigen –, legt sie Büttner eine Hand auf den warm behaarten Unterarm. »Wusst’ ich’s doch. Faktor drei.« Und lässt die Hand dort liegen, zwei tiefe Atemzüge lang.
Und im nächsten Augenblick wird sie sehr, sehr schwach.
Und stellt sich vor, sie werde mit dem Hamburger gesehen. Zunächst bloß wahrgenommen – vielleicht als Wärmebildschemen in Spektralfarben –, dann aber beobachtet, durchschaut und erkannt.
Denn: Handelt es sich wirklich nur um einen Fels da drüben in der Dünung, die schwach das Sternenlicht reflektiert – oder nicht doch um den Schädel jenes archaischen Riesen, von dem die Balkonnachbarin sprach? Niedergemetzelt in mythischer Vorzeit, badet er sein versteinertes Gebein. Nächtlicher Wintersturm, sengende Sommerflaute – er badet; badet und badet seit Menschengedenken –; und seit Anbruch dieser Nacht salbt er sein verkarstetes, salzwundes Antlitz mit der Milch der Galaxis.
So spielt er toter Mann, der untote Gigant. Übersinnlich und allwissend, schnalzt er vor sich hin; lauscht in die Nacht, späht nach dem Hamburger aus und nach ihr, Cathi; noch badet er und badet … und leidet mit dem einst so mächtigen Pan.
Kalokaíros, Südkreta
Derselbe Tag, nachmittags
Mikrometer für Mikrometer gleitet das Containerschiffchen auf dem Drahtseil der Kimm von Ost nach West. Das Seil teilt die gerahmte Aussicht, und rechts vom Eckpfeiler der Loggia setzt es sich, nach wie vor wasserwaagerecht, durch ein perspektivisch verzerrtes Blickfeld fort. Oberhalb des Horizonts blanker blassblauer Himmel, unterhalb wimmelt Meereszyan … halblaut untermalt von der Dünung am Strand, der verborgen hinter der Brüstung liegt.
Licht und Schatten führen ein streng geometrisches Regime auf dem Betonbalkon hier. Gammasch hat sich in die Schattennische gequetscht; der rechte Spann versengt bereits. Mühsam löst sie sich vom Anblick des balancierenden Dampfers, saugt aus ihrer Kippe einen letzten Mundvoll, den sie behutsam einatmet, und pustet die Rauchhülle langatmig aus. Sie drückt den Stummel ins Aschebettchen, das die glasierte Tonschale ausfüttert. Heftchen Gizeh-Papier, Päckchen Van Nelle, Wasserglas. Aufgeklappter Klapprechner. Der Bildschirmschoner wirbelt bunte, fraktale Muster umeinander. An die Wand gelehnt ein Thermometer. Die Quecksilbersäule touchiert die 29-Grad-Marke.
Immerhin lindern die Lüftchen, die der Meltemi herbeifächelt, heute stärker als noch neulich. (Herznote des Duftes: wilder Salbei, der auf der abgewandten Hangseite schmort.) Die jüngste Hitzewelle scheint vorerst verebbt. Nichtsdestoweniger – eine menschliche Iris, die es wagte, dem bis zur Weißglut gereizten Sonnengott ins Antlitz zu schauen, sie würde augenblicklich kauterisiert.
Wo ist sie gewesen mit ihren Gedanken, diese Zigarette lang? Wieder einmal kann Gammasch sich nicht erinnern. Wie zu Hause; zu Hause in ihrem viel zu großen Haus. Sie eilt in ein Zimmer, und dann fällt ihr nicht mehr ein, was sie da wollte. Sie muss den Weg von vorn machen, das hilft manchmal. Das Schiff … das Schiff? … nee.
Plötzlich, wie von ungefähr, wendet sie den Blick nach rechts. Er fällt auf das Gläschen, das sie vorhin auf dem längeren Arm der rechtwinkligen Brüstung abgestellt hat. Der Rakí sieht aus wie gekocht. Wie sie auf die Schnapsidee gekommen ist, ihn so früh am Tag bereitzustellen, auch das will ihr nicht mehr einfallen, obwohl es höchstens eine Stunde her sein kann. Abgelenkt späht sie diagonal durch die offene Balkontür des benachbarten Apartments, Room #1. Außer dem atmenden Tuchvorhang sieht man zwar nicht viel, doch es scheint unbelebt. Ob das – nach dem gestrigen Abend noch schwerer definierbare – Paar aus Osnabrück an seinem bevorzugten Strandplatz liegt? Nun, Gammasch ist zu träge, um sich aus dem Plastikstuhl zu wuchten und, über die Brüstung gelehnt, nachzuschauen.
Gegen sechs in der Frühe hatte ihre Blase sie geweckt. Obwohl es spät geworden war an der gemeinsamen Zufallstafel bei Leon und sie noch entsprechend müde, schlief sie nach dem Toilettengang nicht wieder ein. Stand endgültig auf, schlurfte in die Loge und schlürfte die Morgenluft. Und beobachtete unversehens, wie dahinten, da unten am Strand, im Morgengrauenblau – das Sonnenlicht war noch nicht viel mehr als der Silberstreifen am Horizont –, den hübschen Hamburger in den besten Jahren eine hübsche junge Frau umarmte, im Stehen, wohlgemerkt, jedoch immerhin zwei tiefe Atemzüge lang. (Eindeutig identifizierte Gammasch ihn an seiner Robert-Redford-Aura. Philipp hieß er, wenn sie sich recht erinnerte.) Da sie, Gammasch, die nächtliche Tafel als Drittletzte verlassen hatte, errechnete sie, um wen es sich bei der anderen Person handelte.
Nicht um seine aparte Verlobte. Ebenso wenig aber um die andere, die smarte, üppige Blondine. Schwarzhaarig war die hübsche junge Frau; und jetzt, da sie sich für einen Moment herdrehte … ja, klar: die Balkonnachbarin, die Nette aus Osnabrück. (Cathrin, oder? Ja: Cathrin.) Cathrins Freund oder Mann, jedenfalls Reisebegleiter und Zimmergenosse, hatte sich gestern Abend als Erster von der Tafel entfernt – Kopfschmerzen, hieß es.
Ach, das Gelage gestern Abend, drüben, bei Leon! Es war aufregend, anregend gewesen, fast wie früher, nur, dass ein bestimmtes Thema dominierte: Letztlich konnte man fast schon von einem Symposion zur Klimakrise sprechen (und im Übrigen fast schon wieder von uneingeschränkter Geselligkeit nach anderthalb Jahren Maskenspuk im Seuchenpfuhl).
Der Hamburger querte den Strand in Richtung Betontreppe, nicht ohne der Osnabrückerin noch auf halbem Weg aus einer eleganten Drehung heraus zum Abschied zuzuwinken. Neugierig, vage mitfühlend, verfolgte Gammasch, wie Cathrin, Sand von Hosenbeinen und -boden klopfend, die diagonale Route her zu der Treppe aus Feldsteinen in der Böschung einschlug, die auf die Terrasse der Pension Sophia leitet, wo sie logieren – sie, Gammasch, ebenso wie unter anderen Cathrin und ihr Zimmergenosse.
Und bevor Cathrin sie bei ihrer Augenzeuginnenschaft ertappen konnte, hatte Gammasch sich lieber nach drinnen verzogen. Und im Rückzug noch leise Musik vernommen, die aus dem Spalt in der gekippten Balkontür von nebenan drang … jene intensive, todtraurige Harmoniefolge, die ihr inneres Ohr bis zu diesem Augenblick verwurmt. Dann hatte sie sich ins Bett verdrückt und die Ohren mit Ohropax versiegelt, um sich nicht eventuellen Auseinandersetzungen von nebenan auszusetzen.
Vages Mitgefühl mit Cathrin, ja. Aber auch … hm, Trauer, Zorn und … ah, jetzt weiß sie wieder, was der Schnapsidee zu Grunde gelegen hat. Ach, verflucht. Na, wie könnt’s auch anders sein.
Sie tippt auf die breite Leertaste ihres Rechners, und der Bildschirmschoner verschwindet. Die geöffnete Datei heißt Tagebuch_2020+21.docx.
Weißt du noch? Schaust du von Room #1 oder #3 aus, sind’s eigentlich bloß drei Felsen in der Dünung, ein großer (= Schädel) und zwei kleine (= Knie). Doch der Blick von diesem Balkon aus, der setzt den badenden Riesen perfekt ins Bild. Von hier aus betrachtet ist er unverkennbar der versteinerte alte Gigant. Wie eh und je badet er da, unter dieser riesigen, glasigen Azurkuppel, rücklings im Libyschen Meer, und späht über die verquarzten Knie hinweg nach unserem seligen alten Hippiestrand: flache Stirn, verschattet das reptilhafte Lid; Keilnase, kantiger Kiefer. Seine Gurgel netzen die Wellen in Aqua- und Ultramarin, weißt du noch?
Als könnte er kein Wässerchen trüben, unser steinerner alter Gigant. Und doch … ich fühle mich von ihm beobachtet.
Im Übrigen erscheint’s mir zum allerersten Mal in meinem Leben geradezu wahrscheinlich, dass selbst wir Alten noch erleben müssen, wie er – aufsteht …
… ja, jaa … um seine Mami zu rächen, ist klar …
Wieder einmal, wie seit der Scheidung immer mal wieder – mit unerträglich verschärfter Intensität aber seit dem Neujahrstag des Jahres 2020 –, hört sie förmlich seine Stimme. Sie, Ilona Gammasch, siebenundsechzig; Studiendirektorin a.D.; geschieden im Frühjahr 2003 und seitdem alleinstehend. Ihren Jungferntrip auf die Insel tat sie, auch damals alleinstehend, in den Semesterferien 1976. Von den frühen Achtzigern bis in die späten Neunziger aber reiste sie ungezählte Frühlinge, Sommer und Herbste mit ihrem späteren Ehemann her: eben mit ihm, Peer Hulthusen, inzwischen zweiundsiebzig, Rechtsanwalt a.D., seit 2002 Hannoveraner Rechtsradikaler (wenn nicht inzwischen -extremist) sowie, Gammaschs Informantin zufolge (einer wohlgesinnten ehemaligen Referendarin), alle naslang aufs Neue verpartnert. Mit möglichst unpolitischen Hannoveranerinnen, strikt klischeekonform jeweils zwanzig bis dreißig Jahre jünger. (Wie die wohl mit den morgendlichen Geräuschen im Bad zurande kommen? Dürften nicht besser geworden sein. Allein diese mitunter kaugummiähnlich knallenden Schleimblasen vom Rauchen seiner Montecristos … brrrr.)
Ja, er. Ihn hört sie förmlich. Im Stillen stellt sie das schnarrende Timbre nach. Ihr inneres Ohr ahmt nach, wie er diejenigen Zeitgenossinnen nachzuäffen versucht, die er seinerzeit wonnevoll Jutemösen schimpfte. Ahmt nach, wie er deren zugegebenermaßen oft weihevollen, naiven, selbstherrlichen Zungenschlag zu parodieren versucht: Gaaaiaaa …
Ja, versucht, doch wie immer vergebens: Seit jeher stümperhaft waren seine Parodien. Welchen der zahlreichen ihm verhassten Soziotypen, welche Politikerinnen oder Pappkameraden auch immer er zu imitieren versuchte, sie klangen alle wie ein knarrender Kermit der Frosch. Und dieses Keckern am Ende des Monologs! Diabolisch gemeint, doch nichts weiter als ein rachitischer Abklatsch des klamottigen alten JR-Gemeckers aus Dallas. Überhaupt, dieses ewige Bocksgemecker … zum Schluss konnte sie es ohne Würgreiz nicht mehr hören.
Hier, in ebendieser Loggia von Sophias Room #2, war es gewesen – genau hier und nirgendwo anders, daran erinnert sie sich plastisch –, wo der attraktive Rechtsreferendar mit dem ruppigen Charme anno 81 noch ihre Fantasie geteilt hatte, dass es sich bei dem steinernen Riesen um Gaias Sohn Porphyrion handele, niedergemetzelt von Göttervater Zeus und Handlanger Herakles in der einstigen Gigantenschlacht. Und, das weiß sie ganz genau, alle Jahre wieder haben wir die Allegorie gemeinsam aufgegriffen. Da brauchst du jetzt gar nicht …
Und tatsächlich, wie immer dringt es erst nach einer Weile zur Gänze an ihr Bewusstsein, dass sie wieder einmal in die Falle getappt ist. Ewig diese inneren Dialoge. Ewig diese inneren Dialoge mit ihm. Nach all den Jahren noch diese irrwitzigen inneren Dialoge mit ausgerechnet ihm … und wie unfassbar intensiv wieder insbesondere seit dem Neujahrstag 2020.
Schlimm; doch es lässt sich nur endlos wiederholen: Nach fast zwanzig Jahren der Trennung lässt Gammasch sich immer noch und viel zu oft zu imaginären Dialogen mit jenem grandiosen toxischen Narzissten aufstacheln, dessen verhassten Zunamen sie erst kürzlich, endlich, abgelegt hat. Hier auf der erinnerungsverseuchten Insel, die sie nach Jahren wieder besucht, läuft der innere Podcast natürlich in Dauerschleife.
Die übermäßige Zunahme jener inneren Dialoge in den vergangenen bald eindreiviertel Jahren allerdings resultiert nicht nur daraus, dass Peer Hulthusen seit dem 1. Januar 2020 wieder als Kontakt figuriert – wenn auch auf einem obsoleten E-Mail-Konto, wenn auch quasi anonym (d.h. ausschließlich in Form von Hyperlink-Postings). Sondern vor allem aus der Tatsache, dass sie die ersten acht Monate jenes Jahres mit einem Herzensprojekt ihres Pensionärinnendaseins schwanger gegangen war: der Deutschen Zeitschrift für europäisches Denken Merkur einen Aufsatz über Klimawandel anzubieten. (Bevor sie den Gattungsbegriff Essay auch nur zu denken wagt, hört sie bereits sein Bocksgemecker, und es kommt ihr – gespenstisch! – nicht weniger realistisch vor als der Weltuntergang, dass es von Hannover aus bis hierher ans Libysche Meer dringen könnte, dieses widerwärtige Bocksgemecker.)
Tja, so ist es gewesen: Verstohlen hatte sie beobachtet, wie der steinerne Riese sie verstohlen beobachtete, hatte sich hingesetzt und den ersten Satz getippt: Weißt du noch?, und gleich darauf, als sie merkte, was sie da hingetippt hatte, hatte sie sich wieder vom Stuhl erhoben – impulsiv –, hatte sich – in bereits wieder abgekühlter, resignierter Wut – einen Schnaps eingeschenkt, ihn auf die Brüstung gestellt und den steinernen Riesen angestarrt und jenen Albtraum zu vergessen versucht, der ihr Herzensprojekt nach acht Monaten in eine Totgeburt verwandelt hatte, und dann eine Zigarette geraucht, bis dieses Schiff kam, das Schiff des Vergessens.
Das Frottee des Handtuchs, auf dem sie hockt, fühlt sich nach Kleinkindheit an, doch auf dem Polyesterkissen würde ruck, zuck ihr Hintern feucht – geschweige auf dem nackten Polypropylen. Der Schatten hat vollständig abgehoben; sie muss aus der Sonne. Sie stemmt sich aus dem Monobloc, tritt in die siedende Solarflut, schnappt sich das Gläschen und kippt die Zweifingerbreit in den Rachen. Kopfüber wölkt in ihren Eingeweiden ein Atompilz auf.
»Hallo«, murmelt jemand. Mit einem sanften Taumeln öffnet Gammasch die Augen. Auf dem angrenzenden Balkon er, Cathrins blasser Mitbewohner. Schönen Mund hat er ja, hauptsächlich aber rote Augenränder hinter der Nickelbrille, und überhaupt ähnelt seine Miene insgesamt dem Druckmotiv auf seinem T-Shirt: einem schlappohrigen Bassett.
»Ja!«, sagt Gammasch, und ihr – warum auch immer: gefälschtes – Lächeln schmerzt sie selbst. »Hallo!«
Erstes Buch
Schwäne auf der Flucht
Ungefähr zwei Jahre vorher …
Hamburg-Othmarschen
Freitag, den 4. Oktober 2019
Zwei Majestäten
O Elbvororte im Westen der schönen und mächtigen Hansestadt! Meistenteils ja reichlich gediegen; eher kleinbürgerlich allerdings das Areal, wo jener majestätische Baum herrschte. Und zwar keineswegs auf privatem Grund, sondern an der Einmündung von einer Anliegerstraße in die andere.
Keine Welt-Esche, kein Riesenmammut- und auch kein Affenbrotbaum, zählte die Stiel-Eiche (Quercus robur) doch immerhin zweihundertneunundneunzig Jahre. Tiefe Risse, teils grau wie Elefantenhaut, furchten ihre Borke. In Kopfhöhe ein, zwei Amputationsmale. Schief wuchs der Stamm, dick genug, dass ein Liebespaar jemand Drittes benötigte, um ihn zu umarmen. Weiter oben beschrieb er einen Knick, um die Neigung geradezubiegen. Deutlich schlanker ragte er fort und trieb krüppelige, aber sehnige Knüppel aus, die sich naturgemäß ihrerseits verästelten, dann weitschweifig verzweigten und mit Tausenden von Blättern Wasser, Licht und Gase einfingen. Voluminös wie eine Wolke war die Krone … auch um diese Jahreszeit noch.
Gegen Ende dieses nieseligen Herbsttages breitete Ihre Hoheit Alimur Viribus I. ihren Chiffonschatten, kaum zu scheiden vom Dunst der Dämmerung, über Buchsbaumhecke, Rasen und Asternrabatten, über Straßenbäumchen und pfützengescheckten Asphalt. Vornehme Stille, nur zwei, drei Vogelstimmen, das Sausen von Taubenschwingen.
Auch wenn ihr die Sommerdürre zugesetzt hatte – es war ihr gelungen, die Nervatur ihres ledrigen Laubs intakt zu halten. Ihr Sensorium als Ganzes allerdings, ihren gesamten Radarschirm benötigte Murmur (so der Kosename Ihrer Durchlaucht), um zu reflektieren, wie sich von Norden ein Homo sapiens [♀] mit Anhang näherte und von Osten ein Einzelexemplar [♂]. Murmurs sturmfeste, doch zartbesaitete Organe – von den Wipfelknospen über die Zellwände des Blattwerks und die Ringporen im Hartholz bis hinunter zu den Tentakelspitzen ihrer Pfahl- und Seitenwurzeln, die sich ebenso weit in die Tiefe tasteten wie die Sprossachse sich in den Himmel hinein (jeweils an die sieben Stockwerke nämlich) –, all jene Organe nahmen Vorgänge wahr: Turbulenzen in der Homosphäre, seismische Wellen, phylogenetische Resonanzen und so weiter. Lebenserfahrung aus drei Jahrhunderten umschwirrt von Menschenskindern erlaubte ihr nicht nur, die rechtwinklige Annäherung zweier Personenkraftwagen zu verzeichnen, sondern darüber hinaus, was es mit den Insassen auf sich hatte.
Unversehens löste sich eine der Eicheln aus ihrer Kapsel. Allerdings landete das derbe Symbol im Gebüsch anstatt bei unserem Helden auf dem Dach.
Und so touchiert die Stoßstange seines 2000er Mercedes-Coupés, unterm Ruck der Vollbremsung unmerklich, die cremefarbene Fahrertür der gegnerischen Limousine. Cool, deren Hupe. Cool wie der letzte Ton eines Solos von Altsax-Meister Stan Getz. Da Philipp Büttner knapp über Schritttempo gefahren ist, hat der andere gemeint, Büttner warte die rechtmäßige Vorfahrt ab. Büttner aber hat linker Hand zu dem Wohnblock hinübergeäugt, um die Hausnummern zu entziffern. Der Beinaheunfallgegner – dunkles Haar, dunkler Teint, strahlend die Zähne und das Weiße in den dunklen Augen – blickt ihn aus seinem Seitenfenster über die Kühlerhaube des alten Benz hinweg an.
Büttner setzt zurück. Jetzt kann der andere aussteigen, schlank wie Büttner selbst, doch eher sechzig als fünfzig; dafür maßgeschneiderter Anzug; edle Boots, Hemd von Louis Vuitton oder sonst einem Uijuijui. Er lupft die Hosenbeine (alte Schule) und geht in die Hocke, um den Lack innerhalb der eleganten Pseudolaibung des Schlags zu inspizieren. Büttner steigt ebenfalls aus. »Sorry!«, ruft er im Vorhinein, »mea culpa!« Oha, ein Tesla.
Er ist bis auf drei Schritte heran, als sich mit einem NASA-geilen Sausen kurz nacheinander die Fondtüren öffnen. Falcon Wings. Nicht seit-, sondern aufwärts. Lange Beine schwingen heraus. Während dessen ermahnt deren Besitzerin jemanden auf der abgewandten Seite. Dann folgt sie ihren Stiefeletten. Schwarzglänzende Haarmatte, Bundfaltenhose und über lachsfarbener Bluse ein Kaschmirjäckchen im Farbton der Karosserie. In derselben Sekunde, da in Büttners Hippocampus ein Signal geradezu aufblökt, sagt sie: »Phil?«
»Ach äh … Solveig? Solveig. Na so was.«
»Philipp.«
»Wohnst du jetzt hier. Hier in, äh in der äh, Hamma- statt in der Ri-, Ra-, Ratzeburg?« Hör dich an. Jeez.
Mit einem verzeihungheischenden Lächeln – wie nach einem Punktgewinn durch Netzball (fifteen : love) – wendet an den Gegner sich eben er, Büttner; genauer gesagt, seine Majestät das Ich des Dr. phil. Philipp Büttner; übrigens eigentlich kein Held, bestenfalls ein Frauenheld, einer der letzten womöglich, parbleu. Der werte Herr Gegner, Chirurg oder so, präsentiert die gebleechten Zähne.
Unselig strahlt auch Solveig. Und bleibt auf Distanz. Schneewittchen, denkt, wie damals schon, Büttner. Sie scheint keine Sekunde gealtert in jenen wie viel?, acht, neun Jahren?, und das ist seine grundehrliche Ansicht, die auszusprechen ihn die süchtige Zunge juckt. Wie meistens, wenn er einer seiner Exen wiederbegegnet, verspürt er einen Hauch von Bedauern im Magen, der, das weiß er sehr wohl, in einen Wirbelsturm umschlagen kann. (Kann, nicht muss. Alles kann, nichts muss.)
Sie strahlt. Ein radioaktives Strahlen.
Und jetzt ist der ums Heck herum, den sie ermahnt hat: ein Junge; acht, neun Jahre alt. Blond.
Nicht er ist es, den Solveig mit ihren kohlschwarzen Augen ionisiert, sondern Büttner. Auf dass ihr auch nicht ein Elektron seiner Reaktion entgehe, indes der schwarzhaarige Herr Chirurg oder was seine schwarzhaarige Gattin oder was bestrahlt. Indes des mit zweiundfünfzig immer noch sonneblonden Büttners Mundwinkel zu zucken beginnen, als illustrierten sie das Knistern seines inneren Geigerzählers. Indes der Junge ihn beim Versuch hypnotisiert, den Jungen zu hypnotisieren.
Eine kleine Harke
Neuneinhalb Jahre zuvor hatten sie sich kennengelernt. Am Schaalsee, jenem See, durch den mitten hindurch einst die Grenze zwischen BRD und DDR verlaufen war. Folglich auch zwischen Philipp Büttner und Solveig Alerich.
1990, mit sechzehn, war sie einem Jobangebot als Kellnerin am Ratzeburger See gefolgt (bloß weg aus dem Kaff in der Mecklenburger Bucht); 2010 dann, mit sechsunddreißig, nun ja, kellnerte sie wieder in Ratzeburg. Vierunddreißig Semester lang hatte sie in Berlin Kunstgeschichte studiert und in jeder nur denkbaren Hinsicht (Kunst, Drogen, Sex) das Bummbumm der Technoszene durchdekliniert (in jeder nur denkbaren Hinsicht gemeinsam mit ihrer Kommilitonin, Wohngenossin und Nennschwester Pia). Bis sie ihre bürgerlichen Sehnsüchte entdeckte und dem Moloch in die Provinz entfloh. Da ihr die Mecklenburger Bucht gar zu fremd geworden war, wählte sie Ratzeburg, wo sie in den Ferien immer wieder gejobbt hatte.
An einem Sonntag im Mai traf sie sich mit Pia, die mit ihrem Kleinwagen aus der entgegengesetzten Richtung angereist war, im Kaffeegarten der Alten Remise am Ufer des Schaalsees. Am Nebentisch saß Büttner. Faszinierend, ihn, diesen blondschopfigen Vierziger, in den Pausen zu beobachten, in denen er nicht sie beobachtete – denn seine Arztromanarzt-Aura durchkreuzte faustdick sich selbst, sobald er lachte: die jungenhafte Hysterie, das lustbetonte Ringen mit dem inneren Sau- und Schweinehund … mit anderen Worten, er dünstete aus allen Poren nach Sex. Da saß er in wohlgestalter Autonomie am Nebentisch, frühstückte zum Darjeeling Brötchen mit Räuchermaräne und Rührei und Brombeergelee, ja sogar Weintrauben und einen Grappa und lachte über etwas, das er in seiner Sonntagszeitung las – wie sich herausstellte, einen Artikel über die Stintenburginsel hier im See. Die Stasi hatte dort ihre Grenzaufklärer ausgebildet. »Und was ist daran so lustig?«, hatte schließlich Pia, dies noch über zwei Tische hinweg, nachgefragt, und Büttner hatte ihr und Solveig vorgelesen. Die Herren Schergen hatten über eine besondere Ausrüstung verfügt, nämlich Doppelbewaffnung mit MP und Pistole, Diensthund und Motorrad »und!«, betonte Büttner mit Trommelwirbel: »einer ›kleinen Harke zum Verwischen von Spuren‹!«
Ab sofort wurde die Formel bei jeder Gelegenheit neu aufgelegt – Moment, wo ist meine kleine Harke zum Verwischen von Spuren, eben war sie doch noch da; tja, da werden wir wohl eine kleine Harke zum Verwischen von Spuren brauchen; wenn das und das, dann fress ich doch ’ne kleine Harke zum Verwischen von Spuren –; und so zeigten sie sich bis zum späten Nachmittag hin gegenseitig, was eine kleine Harke war.
Dann zeigte Büttner ihnen den von Farnwäldern unterwachsenen Märchenbuchenwald auf dem unweit gelegenen Werder, und spätestens dort war’s um Solveig geschehen. Pia verstand es innig und freute sich neidlos für sie.
An etlichen Wochenenden unternahmen sie etwas zu dritt, doch das Liebespaar bildeten Solveig und Phil. Solveig war derart verknallt in den geschmeidigen Hamburger, dass sie eine bisher ungekannte Eifersucht kultivierte. Und ferner zu jeder vollen Nachtstunde vom Kirchturm oder woher auch immer die biologische Uhr schlagen hörte wie nur irgendeines der Klischeeweibchen, die sie in Prenzelberg noch herzhaft verachtet hatte.
Unweit von der Alte Remise in Seedorf am Schaalsee lag der Seenhager Seegarten im Hundert-Seelen-Dorf Seenhag am Lottensee. Dort war’s genauso schön, preiswerter und ein paar Kilometer näher dran. Mit dem CLK benötigte Büttner, freie Nadelöhre an Dammtor und Alster vorausgesetzt, eineinviertel Stunden von Hamburg-Eimsbüttel. (Pia von Berlin-Mitte aus mit ihrem, wie Büttner ihn nannte, »Fiat Plumpsklo« mehr als doppelt so lange. Was sie sich auf Dauer, übrigens, weder finanziell leisten konnte noch zeitlich wollte.) Solveigs Dachbutze in Ratzeburg lag auf Büttners Weg, und so brachten sie Wochenenden und Ferien eines ganzen Sommers und Herbstes dort zu; hin und wieder gemeinsam mit Pia, was – das blieb Solveig natürlich schwerlich verborgen – Büttner stets hocherfreut begrüßte.
Es war im Winter, als er die Zeit für reif hielt, Solveig mit Engelszungen in seinen letzten, bisher unerfüllten erotischen Wunschtraum einzuweihen: eine Triole, wie Wikipedia sagt. Einen flotten Dreier, wie Tante Gisela sagt. Einen Threesome FFM HD, wie die Menüleiste über dem Pornoportal sagt.
Fortan war Solveig auf der Hut. Nicht dass zu ihren Sturm- und Drangzeiten sie es nicht selbst hätte krachen lassen (vgl. Kunstszene, Klubkultur, Love Parade etc.); darunter eben auch eine Jugendsünde mit Pia. Was Solveig Phil in einem jener Momente berauschender Intimität mal auf die Nase gebunden hatte. Und bereute. (Nicht die Episode, sondern dass sie sie ihm auf die Nase gebunden.)
Fortan fragte sie sich so einiges, unter anderem, warum er sie noch nie zu sich nach Eimsbüttel eingeladen hatte. Warum er, als sie ihn dort einmal überrascht hatte, sich ausgesprochen blaustrümpfig gegeben hatte. Und warum er so überhaupt aber auch rein gar nicht auf ihren letzten unerfüllten erotischen Wunschtraum reagierte, nämlich von ihm geschwängert und geheiratet zu werden. Fortan, mit anderen Worten, war es vorbei mit der Harmonie.
Sie zankten immer häufiger; am bis dato verheerendsten nach dem Skandalfilm Threesome Cowboy Anfang März 2011. Wie ein Vertreter hatte Büttner gelabert, um Solveig ins Kino zu bewegen; sie jedoch nicht die geringste Lust gezeigt, sich dem dekadenten, artifiziellen Neopornchic des Regie-Shootingstars aus Taipeh auszusetzen (und dafür auch noch extra nach Hamburg reinzufahren). Schließlich aber akzeptierte sie den Kompromiss, sich ins Ratzeburger Lichtspieltheater einladen zu lassen. Bei der cineastischen Analyse in der Kneipe aber knallte es. Und sie ihm die Haustür vor der Nase zu.
Drei volle Tage herrschte Funkstille.
Ausgerechnet am darauffolgenden Donnerstag stellte sie fest, dass der Schwangerschaftstest zwei rote Balken aufwies. In der Brandung eines Ozeans aus Serotonin, Oxytocin et cetera surfend, vergaß sie die Zwistigkeiten ad hoc, blockte fürs Wochenende ihrer beider »Nest« im Seenhager und schickte ihm eine entsprechende Versöhnungs-SMS mit der Ankündigung einer »(großen) Überraschung«.
Rückfrage seinerseits:
Bist du etwa … nicht allein?
Ach, du geliebter Hellseher! Und wie typisch für ihn, es auf diese alltagspoetische Weise auszudrücken … Ja, nein, sie war nicht allein, und nie mehr würde sie es sein.
Seit Donnerstag vernebelte ein Glücksrausch ihr Kurzzeitgedächtnis. Das war für sie typisch. Wie von selbst fügte sich ihr zerschelltes Biedermeier-Motiv wieder zusammen, ja gar noch eine Wiege hinzu.
Ab Samstagnachmittag allerdings konnte sie selbst nicht mehr fassen, wie sie achtundvierzig Stunden lang nur so dumm hatte sein können. Nie hatte sie sich schlimmer gedemütigt gefühlt: Da liegt sie, Hand auf Bauch, selig lächelnd auf der Tagesdecke des Boxspringbettes in ihrem Seenhager Nest, als er hereingestürmt kommt, ganz Schampus, Phallus, Vorfreude. Nun – Freude, Phallus, Einkaufstüte, sie verschrumpelten wie geplatzte Luftballons, als er erkannte, dass sie seine Erkenntnis erkannte.
Und wieder warf sie ihn raus und knallte ihm die Tür vor der Nase zu, diesmal die vom Seenhager Nest. Ein Königreich für eine kleine Harke! Frierend rief er sie aus dem Auto an. Sie ging nicht ran. Beim zweiten Mal war das Handy ausgestellt. Er schickte ihr zwei SMS. In der dritten drohte er:
Ich fahr jetzt nach Hause
– und nach fünf Minuten Wartezeit tat er das.
In der darauffolgenden Woche machte er zwei Versuche, aber sie ging einfach nicht ran. (Schon beim zweiten Anlauf, das musste er einräumen, hatte er sich mental darauf eingestellt, nicht um jeden Preis zu ihr zurückzukehren, sondern seine Junggesellenhaut so teuer wie möglich zu verkaufen. Bangte eigentlich bereits darum, dass die Trennung vollzogen sein möge – er als Vater, das konnte er sich denn doch nur schwer vorstellen, jedenfalls jetzt noch nicht; vierundvierzig war das neue vierunddreißig, war er nicht praktisch noch Jugendlicher?)
Wie the fuck war das überhaupt passiert? Sie nahm doch die Pille. Oder nicht? Hatte sie sie heimlich abgesetzt? Oder ihn sogar darüber informiert? Erinnern konnte er sich nicht. Was zugegebenermaßen nicht viel bedeutete.
Den Versuch eines Besuchs in Ratzeburg unterließ er, und nachdem die Sendepause drei Wochen angehalten hatte, legte er die Affäre Solveig in seinem Goldenen Buch der Frauen ab. Nebenbei miterledigt war für ihn die Frage der Schwangerschaftsverantwortung. Wenn sie auf seine Kontaktversuche nicht einging, was blieb da noch zu tun?
Mehrfach meditierte er über die Option, Pia anzurufen (ob Solveig auch sie abgesägt hatte? Möchte daraus ein Coup für die berühmte Büttner’sche Sprezzatura erwachsen?) … doch letztlich erschien ihm das Unterfangen rein kybernetisch denn doch zu konturlos, reboundeffektgefährlich und äh, kurzum, »papperlapup«, wie Opa zu sagen pflegte. Büttner konnte, wie erwähnt, quasseln wie ein Vertreter. Noch besser aber konnte er, was die meisten Quatschköpfe so gar nicht beherrschen: Wenn’s drauf ankommt, einfach mal die Klappe halten.
Tiger Move
Und nun steht er steif nur da. Friert, ohne es zu merken. Steht dieser Schwarzhaarigen aus der Vergangenheit gegenüber, nebst ihrem schwarzhaarigen Herrn Chirurgen. Steht dem blonden Jungen mit den unstillbaren Augen gegenüber, aus dessen Bann sich geschmeidig zu lösen sich Dr. phil. Philipp Büttner sehnlichst sehnt – allein, vergebens. Es braucht einen brutalen Ruck.
Der knackt geradezu in der Halswirbelsäule. Nun schaut er nicht mehr den Jungen an, sondern Solveig. Beziehungsweise durch sie hindurch. Spürt, dass der Chirurg vom einen zur andern schaut wie ein Pokerchampion; spürt, dass weder der noch Solveig, geschweige der blonde Junge, auch nur einen Pieps zur Beendigung der Situation beitragen werden; spürt, dass es ausschließlich an ihm selbst ist, sich aus der Situation zu lösen, wenn er sich aus der Situation lösen möchte, und da schwächelt auf einmal seine Stärke, wenn’s drauf ankommt, einfach mal die Klappe zu halten. Eine Hundertstelsekunde zu früh die Nerven verloren … und so beginnen sie beide gleichzeitig zu sprechen. Solveig sagt: »Was ist denn mit deinem Tiger Move passiert?« Und Büttner sagt: »Wie geht’s denn Pia?«
Obwohl er nur die letzten drei Worte verstanden hat, hat er verstanden.
Sie hingegen muss erst im Stillen rekonstruieren, noch einmal nachlauschen und runterwürgen, was er gesagt hat. Und dann sagt sie: »Das hast du jetzt nicht im Ernst gesagt.« Sie wechselt Stand- mit Spielbein und stemmt die Hände in die Hüften. Und strahlt dermaßen sonnig, dass Büttner sogar noch einen Anflug der fiktiven Erleichterung innerhalb jenes parallelen Raum-Zeit-Kontinuums verspürt, wo sie den ›Witz‹ tatsächlich komisch gefunden hätte. Hat sie aber nicht.
Und? Solveig hat ihn nicht minder düpiert, indem sie den Tiger Move erwähnte. (Eigentlich hat es ihm ja immer gefallen, wenn Frauen auf Pumps mit ihm auf Augenhöhe sind. Oha, den Satz muss er noch einmal überdenken … später; später.) Damals, in jenem Sommer, hatte Pia diese seine motorische Angewohnheit entdeckt, nie still auf einem Fleck stehen zu bleiben – egal, ob er das Insektenhotel an einer Schuppenwand betrachtete, in den Himmel schaute oder mit jemandem sprach: Stets bewegte er sich, aufrecht, entspannt, in engen Zirkeln; führte stets einen lässigen kleinen Tanz auf. Ein Scharren, ein Sidestep, eine der wohlgeformten Schultern zurück, eine vor – hellgrauer Blick aus dem Kontrapost jedoch voll auf die Zwölf, so dass die eine seiner Halssehnen sich splitternackt aufspannt … Dieser Tiger Move, so aufreizend er war, er wirkte niemals nervös oder hochnäsig oder auch nur ungehörig, sondern gewandt: erlaubte er doch beiden Seiten, Blicke ungezwungener auszutauschen, und dem Akteur darüber hinaus jede Menge unverkrampfter Berührungen an der Schulter, Elle, Hüfte des Gegenübers (Hüfte jedoch höchstens federleicht, besser bloß angedeutet wie ein Handkuss); stets fühlte sich dieses Gegenüber ungemein gemeint. Und wenn er eine Pointe setzte, beugte er sich mit Aplomb und grinsend vor – ein rotzfrecher Kratzfuß.
Manche Leute aber trieb er in den Wahnsinn damit. Immer in Bewegung. Immer die Perspektive kalibrieren. Immer wachsam, hungrig, auf dem Sprung.
Jetzt aber hat er dagestanden wie eine Salzsäule. Wie Lots Frau. Und Solveig hat’s gemerkt. Was ist denn mit deinem Tiger Move passiert …?
Immerhin löst sich die Situation. Wortlos wendet Solveig sich ab, fasst ihren goldenen Sohn bei den Schultern, schiebt ihn, der das wortlos mit sich geschehen lässt, in den Fond der Luxuslimousine zurück und schlüpft hinterdrein, nicht ohne Büttner einen Blick ins Gesicht zu schleudern, in dem sich bitteres Amüsement und andererseits Abscheu, Groll, Fassungslosigkeit die Waage halten. Die Falcon Wings sausen, und die Kabine ist versiegelt.
In dem Moment erklingt eine heisere Stimme. Büttner gewahrt, dass sie aus der Fahrertür dringt, und erst jetzt, dass jemand auf dem Beifahrersitz sitzt. »Geht gleich weiter, Mumya«, sagt der Chirurg nach drinnen. Und zu ihm, Büttner, gewandt: »Ist noch mal gut gegangen.« Und fügt, als Büttner ihn versalzen angafft, hinzu: »Kein Schaden.« Er deutet auf die Tür.
»Ah. Ja. Gut. Gott sei Dank. Äh, sorry noch mal, ich war …« Und durchatmend zurück in den Tiger-Move-Modus.
Der Chirurg steigt ein, und der cremefarbene Tesla X strömt davon wie ein Raumschiff. Büttner gafft ihm hinterher. Berliner Kennzeichen.
Supernis alimur viribus
Berliner Kennzeichen? Von Ratzeburg nach Berlin zurück? Gleich damals, oder wie? Folglich nur zu Besuch in Hamburg? Ist der Chirurg überhaupt ihr Mann oder was? Die haben doch kein Wort miteinander gewechselt. Gehört der Tesla vielmehr ihr? Doch noch Galeristin in Mitte und stinkreich geworden – und der Chirurg kein Chirurg, sondern ihr Chauffeur? Chauffeur in Edelzwirn? Der seine Mutter zur Arbeit mitnimmt? Quatsch. Was hatten sie in diesem abwegigen Teil Othmarschens überhaupt zu suchen? Verfranzt? Mit Navi? Quatsch. Oder wohnt sie doch hier in Othmarschen, und er ist der Neue aus Berlin? Und bringt seine Mutter mit, oder was? Quatsch. Oder vielleicht doch. Ausflug übers brückentagverlängerte Wochenende in die Elphi oder so. Oder er wohnt mit seiner Mutter im gediegeneren Teil Othmarschens und ist doch der Chefpilot auf dem Da-Vinci-Roboter an der Asklepios Klinik Altona und sie in Mitte als Galeristin reich geworden, und er steuert den Berliner Tesla hier nur spaßeshalber, weil er mit dem Gedanken spielt, sich auch einen anzuschaffen, oder sich in Hamburg besser auskennt als sie oder weil seiner Mutter im Fond übel wird und Solveig es nicht ausstehen kann, wenn ihre Schwiegermutter oder was auf dem Beifahrersitz sitzt, während sie chauffiert, die echauffierte Solveig. (LOL.) Oder er kann es nicht ausstehen, im Fond mit ihrem –
Blonder Junge. Blitzt vor seinem geistigen Auge auf wie ein Flashback in einem Serienkillerthriller. Und swoosh! – wieder weg.
Büttner fährt den schmalen Albertiweg rauf und runter, bis er einen besseren Platz findet, an dem er seinen Shabby-chic-CLK abstellen kann. Er schaut auf seine Patek Philippe (hoffentlich wird er sie nie versetzen müssen). Zwei Minuten nach sieben. Pünktlich genug noch für den Termin, dessentwegen er hier im Westen der Stadt heute überhaupt nur umherirrlichtert: Emma Reckfeldt, siebzehn. Klimaaktivistin, enge Mitstreiterin von Fridays-for-Future-Führungsfigur Luisa Neubauer. Hat angeblich Kontakt zu Konfusius, jenem Hamburger Phänomen, das gerade auf Youtube Furore zu machen verspricht. Büttner recherchiert auf gut Glück, um eventuell initiativ einen Text anbieten zu können; wem letztlich auch immer.
Er tigert durch die nun mit Druck hereinbrechende Dämmerung zur Hausnummer 36, doch noch auf dem Weg macht es in seiner Sakkoinnentasche Ping.
Hallo Herr Büttner, sorry, schaffe es nicht mehr rechtzeitig! Bin mit ein paar anderen Menschis noch in Polizeigewahrsam! (weinender Smiley) Sorry, sorry, sorry! Stehe aber nach wie vor zur Verfügung! Melde mich, Emma (Herzchen-Emoji)
Er weiß, dass sie an der Blockade der Kattwykbrücke in Moorburg hat teilnehmen wollen, eine Protestaktion gegen die Kohleindustrie. Müsste die zu dieser Stunde nicht längst abgeschlossen sein?
Von einer Sekunde auf die andere seufzt Büttner auf. Menschis. Sorry, sorry, sorry! Vier Ausrufezeichen in fünf Sätzen. Herzchen. Kampf, Kitsch und Selbstironie in hilfloser Umarmung. Das Mädel ist siebzehn, Herrgottnochmal, genau wie Rövers Älteste … Es ist gerade mal ein paar Tage her, dass Röver und er, Büttner, in der Strandperle gehockt und sich über den paternalistischen Greta-Thunberg-Affront jenes malignen Kabarettisten namens Billy Meyer geärgert haben.
Manchmal hauen ihn solche Momente fast aus den Socken. Nur weiß er nicht genau, warum. Mitleid mit den jungen Leuten … for real, Phil? Ist es nicht vielmehr so, dass ihr existenziell verzweifelter Eifer dich beim Suhlen in der Verdammnis stört? Da zelebriert man die ästhetischsten Apokalypsen, und auf den Treppen der Tempelkulissen jault das Schwenkfutter.
Blonder Junge.
Und so hält er inne, Dr. phil. Büttner, just dort, unter Murmurs Schirmherrschaft, während er in leicht zittrigem Tiger Move rotiert und versucht, sich in den Griff zu kriegen. Und in den Griff kriegt er sich – so war es, seit er sich erinnern kann – mit Plänen, Schwüren, Visionen in puncto Frauen.
Und so … nun ja. Also.
Also, Alimur Viribus I. war, wie erwähnt, zweihundertneunundneunzig Jahre alt, und so hatte sie, wie erwähnt, reichlich Erfahrung mit Menschis. Ihren Namen hatte ihr ein gewisser Wilhelm Jacob Rembek verliehen. Wiewohl Professor für Theologie am Altonaer Christianeum, war sein Grund dafür frivoler Natur …
Der Lutheraner war im selben Jahr geboren worden wie der Baum gepflanzt – 1720 nämlich –; das hatte ihm einst sein Vater erzählt, Amtsvorsteher des städtischen Katasters, dessen Othmarscher Landsitz nicht weit entfernt lag. Insbesondere während der Sommerfrische also entwickelte der Jüngling eine innige Verbindung zu der Pflanze, verglich ihr Wachstum über die Jahre mit seinem eigenen und fragte sie im Stillen oft um Rat, als sei sie das Orakel von Dodona; ja er genoss das heidnische Spiel ganz unbefangen, Blasphemie hin oder her – zumindest, bis er zwölf war. Als sowohl die Eiche als auch Professor Rembek einundsechzig Jahre alt wurden, trieb sie erstmals Eicheln aus, und weil der sich wieder einmal unsterblich in einen jungen Adjunkten verrannt hatte, stopfte er sich die Rocktaschen damit voll, um beim Lustwandeln am unweiten Elbufer darin herumsublimieren zu können, und taufte die lebenslang vertraute Stieleiche endlich auf den Namen Alimur Viribus I. Das Siegel des Gymnasiums, an dem er lehrte – das Christianeum, benannt nach dem dänischen König, dem Herzog von Holstein und somit Landesherrn von Altona Christian VI. –, bestand aus dem Emblem eines unter strahlender Sonne erblühenden Pflänzchens sowie dem Lemma SUPERNIS ALIMUR VIRIBUS: Von oben kommt die Kraft, die uns erhält.
Gerade als am Altonaer Rathausmarkt der Jakobinerklub gegründet worden war, starb der Professor. Alimur Viribus I. aber wuchs und gedieh – pinkelte ihr auch der ein oder andere Pferdefuhrwerker ans Bein, der für Baron Caspar von Voght Wurzelballen ausgesuchter Gehölze in den Süderpark Flottbeks transportierte. Als Napoleon I. Altonas Goldener Ära mit der Kontinentalsperre ein Ende setzte, knüpfte sich Bierexporteur Heinrich Peter Broecken an Alimur Viribus’ I. stärkstem Arme auf. Während der schleswig-holsteinischen Erhebung gegen die dänische Krone diente sie als Schirmherrin für zahlreiche Schäferstündchen des Großbauernsohns Claus Christoph Cramer mit der Magd Adele Pottendieck (allerdings nur in den Sommermonaten jenes Jahres 1864), und als im benachbarten Ottensen die Glashütten, Zigarrendrehereien und Gießereien für Dampfkessel und Schiffspropeller zu florieren begannen, blühte auch Alimur Viribus I. unter der steten Zufuhr von deren Kohlendioxidausstoß auf, indes die Lungen der Arbeiter die Motten kriegten (bis heute ist der Stadtteil auch als ›Mottenburg‹ bekannt). Und trotz der nur allzu steten Überdosis von Kohlendioxid aufgrund des Kfz-, Schiffs- und Flugverkehrs der voraufgegangenen siebzig Jahre stand sie am 4. Oktober 2019 immer noch dort, wo sie zweihundertneunundneunzig Jahre zuvor hingepflanzt worden war. Noch.
Ja, sie hatte Pfaffen und Pfeffersäcke, Arbeiter und Bauern, Studenten und Soldaten zu Tausenden unter ihrem Schirm gespürt, darunter nur sehr selten den wahren, per definitionem weisen Homo, doch zu Tausenden und Abertausenden den insipiens und ambitiosus und cerebralisatus, faber und oeconomicus, ludens und amans, loquax und symbolicus und bulla et cetera perge perge. Sie hatte die Resonanzen von deren Wünschen und Zügellosigkeit registriert, von deren Mutlosigkeit und Unentschlossen- und Niedergeschlagenheit, von ihren Lüsten und Leiden, Angst und Gier, Neid und Geiz, Machtgelüsten und Ränken und kriminellen Energien, ja; aber auch von deren Sehnsüchten, Liebe, Neugier, Lebenslust, Mut und Groß- und Edelmut.
Doch was dieses Exemplar eines Homo sexualis hier, jener philologisch promovierte Philipp Büttner aus Hamburg-Eimsbüttel (gebürtig in -Farmsen), angesichts einer von ihm mit Gewissheit erwarteten Apokalypse des Anthropozäns und ungeheuerlichen Götterdämmerung als vordringlichen, heiligen, tröstlichen Vorsatz visualisierte, nachdem er doch gerade eben erst vom Schicksal an diese auf peinlichste Weise verpuffte fixe Idee erinnert und zu allem Überfluss auch noch dem dringenden Verdacht ausgesetzt worden war – erstaunlicherweise erstmals in sechsunddreißig Jahren Promiskuität –, seit acht Jahren unwissentlich Vater eines Sohnes zu sein … will sagen, was ebendieser Mensch als letzten Wunsch vorm Weltuntergang zu verwirklichen wünschte, das hätte selbst die Menschenkennerin Murmur sich nicht träumen lassen: womöglich Klärung nämlich und ggf. Anerkennung der Vaterschaft? Und darüber hinaus Vaterschaft als gelebtes Engagement? Ganz allgemein politisches Engagement, zum Beispiel in puncto Klima und Natur? Mentorat für Betroffene wie Emma? Oder auch nur Privatismen wie etwa Abbitte bei den kollateral geschurigelten aller seiner Exen? (Überhaupt, die Exen mal alphabetisch katalogisieren? Taoist werden oder wenigstens die Bude durchkärchern? Die heiß geliebte Sammlung seiner historischen Kinofilmplakate verkaufen? Karteileichen verbrennen? Datenmüll entsorgen? Testament machen? Das auf Eis liegende Drehbuchprojekt mit dem Arbeitstitel Phobetor auftauen? Queen Mum öfter besuchen? Das Rauchen wieder anfangen?)
Keineswegs.
Sondern vielmehr eine Triole, wie Wikipedia sagt. Einen flotten Dreier, wie Tante Gisela sagt. Einen Threesome FFM HD, wie die Menüleiste über dem Pornoportal sagt. Einen Relaunch mit frischen Protagonistinnen. (Oder wie Emma sagen würde: Boomer cringe.)
Osnabrück-Sonnenhügel
Mittwoch, den 20. November 2019
Irgendwas mit Vögeln
In seinem Saurierhirnchen gab es Nervenzellen, die auf schwächste Mengen Licht ansprachen. Sie weckten ihn schon vor Sonnenaufgang. Kraftraubenden Gesang vermied Jonny auch an diesem Morgen.
Auf menschlichen Gesichtssinn hätte das Gelände um diese Stunde wie ein Holzschnitt gewirkt. Jonny hingegen durchdrang die finsternisverrammelten Gärten und Veranden mühelos, um nach Kernen und Körnern zu suchen, nach Spinnen, Speck und Eierschalen. Zunächst in den benachbarten Gemarkungen entlang des gesamten Südhangs; dann flatterte er – von Eiche zu Platane, von Zaun zu Zaun – wieder heimwärts.
Leider deckte sich sein Revier mit dem Territorium einer Raubkatze. Ramses war ihr Name. Wie üblich verschaffte Jonny sich Überblick, indem er den kahlen Wipfel der Nachbarslinde nutzte. Der Grundriss des Grundstücks glich einem fünfzig mal hundertfünfzig Schritt messenden Teppich, der von der Anwohnergasse aus über einen Zeh des Gertrudenbergs gebreitet worden war. Die Schmalseite a markierten Haupthaus nebst Hofauffahrt, die Seitenlänge b Hinterhaus mit Turm sowie Spielwiese des Kindergartens. Bis ins 20. Jahrhundert hinein hatten, wie Mieter Patrick Kottenpeter sich ausdrückte, »die sympathisch runtergerockten Gemäuer« als Zigarrenfabrik gedient.
Immer noch war es dunkel und diesig, doch Jonny sah konturiert und farbgesättigt. Und Bewegungen zigmal präziser als der Mensch. Sah, wie der Tau sich in der Moosbehaarung der Schindeln sammelte, die das Walmdach auf dem dreigeschossigen Haupthaus deckten. Sah, wie dem Schornstein ein Ringelpiez von Nachtmahren entfleuchte, jeder den Rüssel um den Schwanz des Vorgängers geschlungen. Erkannte selbst aus dieser steilen Perspektive die Ziegelstruktur in den lehmgelb geschlämmten Außenmauern. Sah, dass die Rahmen der teils erleuchteten Fenster grün waren.
Ein Auto näherte sich. Er erkannte sein rotes Dach. Es bog von der kopfsteingepflasterten, entlang der Spundwand des Altstadtbahnhofs verlaufenden Gasse in die Hofauffahrt, hielt an, rollte ein Stück zurück und hielt wieder. Die Handbremse knarzte. Unter der Frontscheibe erschien eine Faust, die einen Handsender ausstreckte. Kurz darauf blinkte ein orangefarbenes Lämpchen an der düsteren Ecke, und das Gittertor glitt quietschend in eine Führschiene an der Wand.
Die Fahrerin leitete die Kindertagesstätte im Hochparterre des Vorderhauses und war abends die Letzte und morgens die Erste. Sie trieb ihr Fahrzeug die S-förmige Serpentine hinauf, die sich zwischen den rechtwinklig versetzten Giebelseiten von Vorder- und Hinterhaus hindurchschlängelte. Im Unterschied zu Ersterem hatte Letzteres mörtelgraue unverputzte Ziegelwände. Zähgrüne ebenso wie vertrocknete Efeuranken bekränzten karminrote Türen und kobaltblaue Fenster. Das längliche Gebäude war zweigeschossig und gipfelte in einem rechteckigen, inklusive Souterrain vierstöckigen Turm. Längsseits parkten fünf der Pkw von Bewohnerinnen und Bewohnern. Die Erzieherin gliederte ihr Fahrzeug ein, stieg aus und – Jonny registrierte es minutiös – fuhr zusammen.
Wieder einmal wegen des zottelbärtigen Kinderschrecks, der auf dem Rückweg vom Zeitungskasten gegen das Gefälle ankämpfte. Er trug seinen königsblauen Kapuzenbademantel – unter der rechten Achsel klemmten die OsNa – und dunkelgraue Gummischuhe mit Belüftung. Fahl leuchteten seine Straußenbeine.
»›tschuldigung«, keuchte er wieder einmal, »ich bin’s nur, der Kinderschreck.«
Die Kindergärtnerin lachte wieder einmal mit sanfter Heuchelei und sagte: »Ach, guten Morgen! Ach, ist ja auch … Wann wohl endlich der Bewegungsmelder repariert wird?«
Der »Riesenschlumpf«, als den Khanya (4) ihn einmal bezeichnet hatte – zur Erheiterung der gesamten Belegschaft –, feierte seine Rente im zweiten Obergeschoss des Turms als Sklave Ramses’ ab. Das Gelände stieg steil genug an, dass seine Lunge mehr als den einen Satz schwerlich bewältigte: ›tschuldigung, ich bin’s nur, der Kinderschreck. Keineswegs zu steil hingegen für Khanya und ihre Freundinnen und Freunde aus der Kita Kunterbunt, wenn sie bei entsprechendem Wetter hinaufzutoben pflegten, um unter Gejohl und Getöse Schaukel, Wippe und Bobbycars zu erstürmen.
Nachdem die Tür des Turms mit einem Knall, die schwerere des Haupthauses mit einem Krachen und das Tor unter Quietschen und Blinken sich selbsttätig geschlossen hatten, befand Jonny die Luft für rein. Die allerwenigsten Homines sapientes sähen ihm an, dass er der klügste, kühnste und flinkste Parus major des Viertels war. In den dreieinhalb Jahren bisheriger Lebenszeit war der Kohlmeisenbock mit seinen sechsundzwanzig Gramm Lebendgewicht dem Sperber viermal und siebenmal Ramses entwischt, ohne auch nur eine Daune einzubüßen. Er war der ausdauerndste Sänger weit und breit, mit Strophen wie vernickelt, und sein Schlips war so schwarz und ausladend, dass er unterhalb des zitronengelben Wamses gleich in die dicke Hose überging.
Die meisten Meisen sind zauderlich und schüchtern und fügen sich in ihre Gruppe ein. Gleichzeitig sind sie brillante Beobachter. Sie vermögen menschliche Hausbewohner und Gartenbesucher nicht nur zu unterscheiden, sondern sich über die jeweiligen Individuen sogar auszutauschen.
Auch Jonny war ein exzellenter Späher. Allerdings wechselte er zwischen den Gruppen hin und her, um Diplomatie zu betreiben, Kontakte und Traditionen zu pflegen, Futterplätze zu erschließen. Um dabei ohne den Schutz des Schwarms auszukommen, brauchte es Wagemut. Wie die anthropogene Psychologie zwischen intro- und extravertierten Persönlichkeiten, so unterscheidet die Ornithologie zwischen vorsichtigen und wagemutigen.
Ja, Ramses war eine Gefahr. Doch besonders im Frühling und Sommer überwogen die Vorteile dieses Hofreviers: unter vielen anderen insgesamt vier Rosskastanien, in deren Laubwerk sich fette Minierlarven aalten, eine tote Eberesche voller Kerbtiere, ein engerlingstrotzendes Laubsilo und ein sechsstämmiger Bergahorn mit drei Nistkästen. Außerdem eine Tränke, die in den letzten beiden tropischen Sommern erfreulich verlässlich beschickt worden war.
Desgleichen ein Futterhäuschen. Dieses ausgerechnet in den kargeren Jahreszeiten allerdings unregelmäßig, wie diesen Herbst wieder. Deshalb hechtete Jonny nun aus dem Lindenwipfel, segelte unter virtuoser Lenkung seiner Hand- und Armschwingen, Schirm- und Steuerfedern quer über die Dachschindeln des Hinterhauses hinunter in den Hof, schwirrte um den Sockel des Turms herum und auf seiner Rückseite wieder hinauf, bis aufs teerpappegedeckte Dach eines morschen Carports – und zwar in einer Kette von Luftsprüngen, deren Anmut selbst im Auge eines menschlichen Betrachters kein Gran einbüßte, wiewohl es die Geschwindigkeit der Bewegungen wie im Zeitraffer des Kintopps empfände. Dann landete Jonny auf dem Firstbalken des strohgedeckten Vogelhäuschens, das – gestützt von einem Dreibock aus Birkenästen – auf dem Garagendach stand. Die roten Plastiknetze waren nach wie vor die längst geleerten.
Jonny schüttelte sein Gefieder, ging in sich, um all seine metaphysische Energie zu bündeln, und sendete, mitten durch die von innen noch vorhangverhängte Verandatürscheibe, eine Botschaft an die Nervenzellen im Hirn des ihm wohlbekannten Bewohners dahinter: Patrick ›Ricky‹ Kottenpeter, 39, Musiker, Komponist und Produzent. Eine Botschaft an jene Nervenzellen, die schwächste Mengen telepathischer Wellen wahrzunehmen vermögen. Wellen, welche dieser spezielle Menschling allerdings nicht selten mit dem Getöse wachsenden Grases oder hustender Flöhe verwechselte. Oder mit dem Widerhall seiner eigenen peristaltischen Seelenregungen, mit den pneumatischen Geräuschen der Salti, Schrauben und Pirouetten seines ruhelosen Geistes – der Vrittis, wie der Yogi sagt. Von derlei Vrittis sollte, zum vitalen Nachteil Jonnys, dieser besondere Vormittag geradezu erdröhnen … bis der Beginn jener fast zwei Jahre andauernden, kritischsten Episode in Kottenpeters bisherigem Leben damit unwiderruflich markiert wäre: das Lampion-Fanal.
So oder so, von der kristallklaren Botschaft Frische Meisenknödel, bitte! kam im Hirn des Schläfers nur irgendwas mit Vögeln an. (Dabei war es niemand anders als er selbst, der ebenjenen Kohlmeisenkumpel im Frühsommer 2018 auf ›Jonny‹ getauft hatte – nach dem genialen Songwriter, Mastermind und Gründer der legendären Weißen Raben, Jonny Magnus Holling, Schöpfer der hinreißenden Hymne mit dem hinreißenden Titel Knödel für die Engel.)
Der Albtraum nach dem Erwachen
»Ricky?«
Der Träumer im warmen Bett, er kann jetzt nicht antworten. Fürchtet, das Idyll zu sprengen. Grad jetzt, da es wohl zwei Dutzend Kohlmeisen gleichzeitig sind, die ins Vogelhäuschen schwirren und im Körnerstreu scharren; sich in die baumelnden Netze krallen, um auf die Knödel einzupicken, oder mit einem Zirpen wieder davonsausen. Alles im fliegenden Wechsel; alle mit weiß geschminkten Bäckchen, kohlschwarzen Sturmhäubchen und gelben Westchen. Seine höchstpersönliche Schutzengelgarde.
»Liebster!?«
Sphärisches Gezwitscher. Sinnliches Flattern mit Miniaturfächern. Glücksbotenstoffe, die in den Arterien des Gratwanderers prickeln.
»Ricky!!Please don’t die!«
Voll die liebe Stimme …? Die Stimme der Liebe. Dunkle, warme Stimme. Ein Alt, wie er im Buche steht. Musik in seinen Ohren. Und doch stört sie das selige Wimmelbild. »Hmm …?«
»Willst du nicht auch mal aus den Federn, so langsam …?«
»Hab so lange wach gelegen, heut Nacht«, hört er sich selbst ins Kopfkissen nuscheln. »Wie spät ist es denn?«
»O je. Na, wie immer, kurz nach sieben.«
»Wann machst du Feierabend heut?« Er fragt das jeden Morgen, um seinen Arbeitstag, wenn möglich, daran anzupassen.
»Früh. Direkt vom Bahnhof geh ich aber zum Vorbereitungstreffen für die Madrid-Demo.«
Irritation. Ein Schatten im Nebel. Dermaaadermario … »Ich denk, du musst heut Abend aufs Podium?«
»Ja, anschließend. Omànnæî.« Flehentlich: »Stehst du mir bei?«
»’türlich, Süße … Wann geht’s noch mal los?«
»Um sieben. Bis dann!«, sagt sie. Und fügt, geflüstert, noch jene postironische Zauberformel aus ihren frühesten Tagen hinzu: »Ily!« Ihr intimes Akronym für I love you. Ausgesprochen wie ai-lai. Wie englisch für Ich lüge.
Kuss, Kuss, Kuss und tock, tock, tock. Der souveräne, sexy Rhythm and Blues einer Frau, die ihrem Tagwerk nachgeht – die ihren Weg geht. Cathrin ›Cathi‹ Weye, am 11. Oktober vierzig Jahre alt geworden. Seine Frau. Seine Traumfrau. Als die Tür einschnappt, fühlt er sich wie ein notdürftig versorgtes Katastrophenopfer. What the fuck!
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: