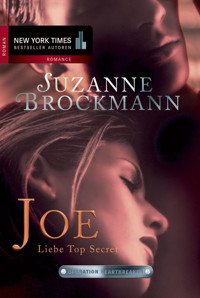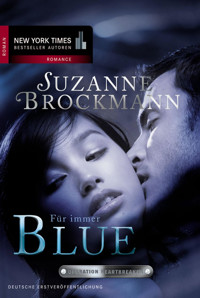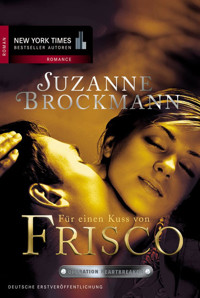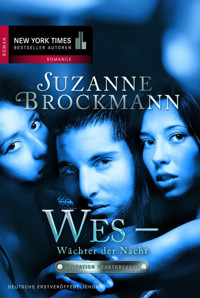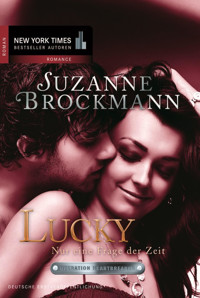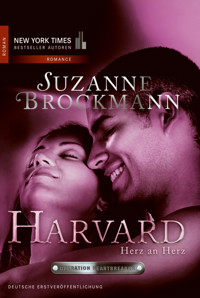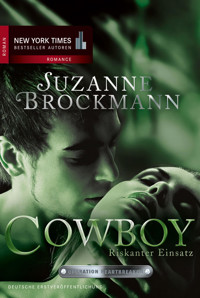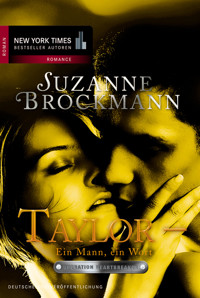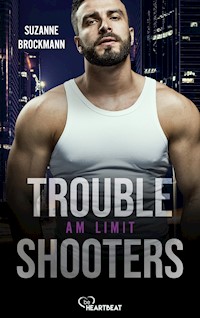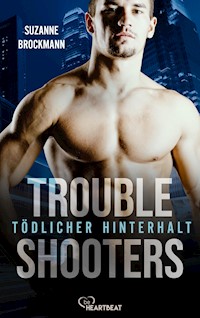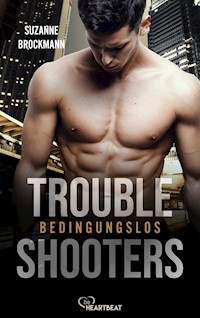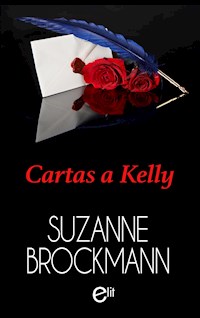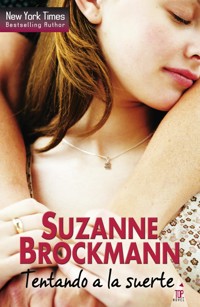Operation Heartbreaker: Joe - Liebe Top Secret / Für immer - Blue (Band 1&2) E-Book
Suzanne Brockmann
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MIRA Taschenbuch
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Joe - Liebe Top Secret
Spezialagent Joe Catalanotto soll einen Prinzen doubeln, der von Terroristen bedroht wird. Nur 48 Stunden hat Medienberaterin Veronica St. John Zeit, um aus dem lässigen Draufgänger einen waschechten Aristokraten zu machen. Der Auftrag wird zur prickelnden Herausforderung für die schöne Tochter aus gutem Hause, denn zwischen Joe und ihr knistert es gefährlich. Andererseits schein Joe kein Mann, der sein Herz so einfach verschenkt …
Für immer - Blue
Für Polizistin Lucy hat die Liebe einen Namen: Blue McCoy. Nachdem er einst die Stadt verließ, um seine Karriere als Navy SEAL voranzutreiben, ist er jetzt zu Besuch in Hatboro Creek - genauso sexy und selbstbewusst wie damals. Für Lucy beginnt alles von vorn: Das Herzklopfen, die Hoffnung und die Angst, dass Blue wieder verschwindet. Doch dann wird sein Halbbruder ermordet. Schnell spricht alles dafür, dass Blue der Täter ist. Und plötzlich liegt es an Lucy den Fall aufzuklären ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 798
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Autorin:
Die international erfolgreiche Bestsellerautorin Suzanne Brockmann hat über 45 packende Romane veröffentlicht, die vielfach preisgekrönt sind. Ehe sie mit dem Schreiben begann, war sie Regisseurin und Leadsängerin in einer A-Capella-Band. Mit ihrer Familie lebt sie in der Nähe von Boston.
Suzanne Brockmann
Operation Heartbreaker 1: Joe – Liebe Top Secret
Operation Heartbreaker 2: Für immer – Blue
MIRA® TASCHENBUCH
1. Auflage: Januar 2017
Copyright © 2017 by MIRA Taschenbuch
in der HarperCollins Germany GmbH
Erste Neuauflage
Titel der amerikanischen Originalausgaben:
Prince Joe
Copyright © 1996 by Suzanne Brockmann
Erschienen bei: Silhouette Books, Toronto
Forever Blue
Copyright © 1996 by Suzanne Brockmann
Erschienen bei: Silhouette Books, Toronto
Published by arrangement with
HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./S.àr.l.
Konzeption/Reihengestaltung: fredebold&partner GmbH, Köln
Umschlaggestaltung: Werbeagentur Hafen gsk GmbH, Hamburg
Umschlagabbildung: Getty Images, München: Gabriela Medina, Pavel Novikov,
Philippe Intraligi, RICOWde
Redaktion: Mareike Müller
ISBN eBook 978-3-95576-702-0
www.mira-taschenbuch.de
Werden Sie Fan von MIRA Taschenbuch auf Facebook!
eBook-Herstellung und Auslieferung:
readbox publishing, Dortmund
www.readbox.net
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Der Preis dieses Bandes versteht sich einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Alle handelnden Personen in dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig.
Suzanne Brockmann
Operation Heartbreaker 1: Joe – Liebe Top Secret
Roman
Aus dem Amerikanischen vonDaniela Peter
Für Eric Ruben,
meinen Schwimmkumpel
Liebe Leserinnen und Leser,
im Stammbaum unserer Familie finden sich viele deutsche Namen: Bose, Shriever, Hopf, Kramer … Denn im späten 19. Jahrhundert wanderten meine tapferen Urgroßeltern von Bremerhaven nach New York aus. Sie waren Bäcker, aber mein Urgroßvater hatte schon immer von einer eigenen Farm geträumt.
Meine Urgroßeltern arbeiteten hart und verkauften ihre Bäckerei in New York, um eine kleine Farm in Spring Valley zu erwerben. Dort wuchsen ihre Kinder auf, darunter auch meine Großmutter. Meine Mutter verbrachte später so manchen Sommer auf der Farm, und sie war noch in Familienbesitz, als ich ein kleines Mädchen war. Ich erinnere mich noch gut daran, wie wir Onkel Hans und Tante Frieda dort besucht haben.
Als Teenager habe ich Bremerhaven kennengelernt und auch das Haus, in dem mein Urgroßvater aufwuchs. Meine Cousins leben heute noch darin und pflegen liebevoll ihren kleinen Garten. Dieser Garten ist wirklich wunderschön, und doch verstehe ich den Lebenstraum meiner Urgroßeltern. Sie wagten es, ihrer Heimat Lebewohl zu sagen und in Amerika völlig neu anzufangen. Sie setzten alles auf eine Karte – und gewannen.
Aber obwohl sie auswanderten, blieben sie doch stets in Kontakt mit der Familie daheim. Und so durfte ich erleben, wie meine deutschen Cousins mich mit offenen Armen und einem warmen Lächeln willkommen hießen.
Gerade deshalb freue ich mich sehr, dass meine Buchreihe über die Navy SEALs jetzt auch in Deutschland veröffentlicht wird, und ich wünsche Ihnen beim Lesen genauso viel Vergnügen, wie ich es beim Schreiben hatte!
Herzlichst Ihre
Suzanne Brockmann
www.SuzanneBrockmann.com
Prolog
Bagdad, Januar
Friendly fire.
„Freundbeschuss“, so nannte man es, wenn die US-Flieger angriffen. Navy SEAL Joe Catalanotto fand es jedoch alles andere als freundlich, als der explosive Regen niederprasselte. Ob von den eigenen Truppen oder von anderen – eine Bombe war immer noch eine Bombe. Und sie zerstörte alles, was sich in Reichweite befand. Wer auch immer sich zwischen den Bombern der Air Force und deren militärischen Zielen aufhielt, war in Lebensgefahr.
Genau dort befand sich die sieben Mann starke Eliteeinheit Alpha Squad. Die Männer waren weit hinter die feindlichen Grenzen vorgedrungen und saßen jetzt viel zu nah bei einer Fabrik fest, in der bekanntermaßen Munition hergestellt wurde.
Joe blickte angespannt auf den Sprengstoff, den Blue, Cowboy und er an der ustanzischen Botschaft befestigten. Dann sah er auf. In der Stadt war es taghell. Um sie herum schienen alle Lichter anzugehen. Feuer und Explosionen erhellten den Nachthimmel. Es wirkte unnatürlich, gespenstisch. Ein Höllenspektakel.
Aber es war real. Verdammt, es war mehr als das. Es war gefährlich – brandgefährlich. Selbst wenn sie vom Beschuss der eigenen Truppen verschont blieben, liefen Joe und seine Männer Gefahr, in die Hände feindlicher Soldaten zu geraten. Wenn man sie gefangen nahm … Zum Teufel, Spezialeinheiten wie die SEALs wurden in der Regel wie Spione behandelt – und exekutiert.
Doch das hier war ihr Job. Für genau solche Situationen waren die Navy SEALs ausgebildet worden. Und jeder von Joes Männern erledigte seine Aufgaben mit der Präzision eines Uhrwerks und mit kühler Zuversicht. Nicht zum ersten Mal mussten sie einen Rettungseinsatz in einem umkämpften Gebiet ausführen. Und es war garantiert nicht das letzte Mal.
Joe begann zu pfeifen, während er mit dem Plastiksprengstoff hantierte. Cowboy, wie sie Lieutenant Harlan Jones aus Texas nannten, hob ungläubig den Blick.
„Cat arbeitet besser, wenn er dabei pfeift“, erklärte Blue über sein Headset. „Hat mich während des Trainings immer ganz verrückt gemacht. Irgendwann habe ich mich daran gewöhnt. Das wirst du auch noch.“
„Wunderbar“, murmelte Cowboy und reichte Joe das Ende der Zündschnur.
Seine Hände zitterten.
Joe betrachtete den jüngeren Mann. Cowboy gehörte noch nicht lange zur Truppe. Er hatte Angst, kämpfte aber dagegen an. Joe sah, wie er die Wangen anspannte und die Zähne zusammenbiss. Seine Hände zitterten vielleicht, trotzdem erledigte der junge Kerl seinen Job. Er stand es durch.
Cowboy erwiderte Joes Blick herausfordernd und wartete auf einen Kommentar.
Den Joe ihm natürlich lieferte. „Luftangriffe machen dich nervös, was, Jones?“, fragte er. Er musste schreien, um verstanden zu werden. Sirenen heulten, Alarmsignale schrillten, und das Feuer der Fliegerabwehr donnerte durch ganz Bagdad. Und natürlich war da auch noch der ohrenbetäubende Lärm der amerikanischen Bomben. Ja, sie befanden sich wirklich mitten in einem verdammten Krieg.
Cowboy öffnete den Mund, um etwas zu sagen, aber Joe hinderte ihn daran. „Ich weiß, wie du dich fühlst“, rief Joe und legte letzte Hand an den Sprengstoff, der ein riesiges Loch in die Grundmauern der Botschaft schlagen würde. „Ich springe aus einem Hubschrauber in eiskaltes Wasser und mit dem Fallschirm aus tausend Metern, ich schwimme zwanzig Kilometer und trage, wenn es sein muss, auch einen Nahkampf mit einem religiösen Fanatiker aus. Aber das hier … Junge, ich sage dir, in Bagdad einzurücken, während es Bomben vom Himmel regnet, das macht mich auch ein bisschen nervös.“
Cowboy prustete. „Sie und nervös? Verdammt, Mr. Cat, es gibt doch nichts auf der Welt, vor dem Sie sich fürchten!“
Joe grinste. „Fertig“, rief er und nickte zufrieden. Sie würden die Wand aufsprengen, hineingehen, die Zivilisten rausholen und dann innerhalb von zehn Minuten auf dem Rückweg sein. Keine Sekunde zu früh. Was er Lieutenant Jones gesagt hatte, stimmte. Zum Teufel! Joe hasste Luftangriffe.
Blue McCoy stand auf und gab dem restlichen Team Handzeichen. Der Boden unter ihnen bebte, als eine Bombe in der Nähe einschlug. Blue begegnete Joes Blick und grinste, während Cowboy eine Reihe von Flüchen ausstieß.
Joe lachte. Er hielt Feuer an die Zündschnur.
„Dreißig Sekunden“, sagte er zu Blue, der es an den Rest des Teams per Handzeichen weitergab. Der Trupp robbte auf die andere Seite der Straße, um in Deckung zu gehen.
Kurz bevor eine Bombe explodiert, dachte Joe, gibt es immer einen Moment, manchmal ist es nur ein ganz kurzer, in dem sich alles zu verlangsamen scheint. Alle warten. Er betrachtete die vertrauten Gesichter seiner Männer. Er sah ihnen an den Augen, an den gespannten Lippen und Wangen an, dass das Adrenalin durch ihre Körper rauschte. Es waren gute Kerle, und wie immer würde er Himmel und Hölle in Bewegung setzen, damit sie lebend aus dieser Stadt herauskamen. Nein, nicht nur lebend. Er würde sie unversehrt aus diesem Inferno herausbringen.
Joe musste nicht auf den Sekundenzeiger seiner Uhr sehen. Er wusste, dass es gleich passieren würde – trotz der Tatsache, dass die Zeit sich zu verlangsamen und unermesslich auszudehnen schien.
Bumm.
Es war eine starke Detonation, doch der Lärm ging fast unter bei all den ohrenbetäubenden Explosionen, die die ganze Stadt erschütterten.
Noch bevor sich die Staubwolke gelegt hatte, war Blue zur Stelle. Er führte die anderen über die vom Krieg beschädigte Straße; wachsam achtete er auf Heckenschützen und huschte geduckt voran. Kopfüber kroch er in den hübschen kleinen Krater, den sie auf einer Seite in die ustanzische Botschaft gesprengt hatten.
Harvard informierte die Luftunterstützung per Funk darüber, dass sie hineingingen. Joe hätte zwar wetten können, dass die Air Force viel zu beschäftigt war, um sich ernsthaft für die Alpha Squad zu interessieren. Aber Harvard erledigte seinen Job, genau wie die anderen SEALs. Sie waren ein Team. Sieben Männer. Sieben der besten und klügsten Männer, die der härtesten Elitetruppe der Welt angehörten. Sie waren dazu ausgebildet worden, zusammenzuarbeiten und zusammen zu kämpfen, wenn nötig bis zum Tod.
Joe folgte Blue und Bobby in den Keller der Botschaft. Cowboy war dicht hinter ihnen, während Harvard und der Rest des Teams ihnen Rückendeckung gaben.
Drinnen war es dunkler als in der Hölle. Gerade rechtzeitig konnte Joe sein Nachtsichtgerät aufsetzen. Um ein Haar wäre sein Gesicht mit voller Wucht gegen Bobbys Rücken geprallt. Dabei hätte er sich unter Umständen die Nase gebrochen, weil der große Mann vor ihm ein Gewehr quer über dem Rücken trug.
„Warte“, flüsterte Bob ihm zu.
Er trug sein Nachtsichtgerät. Genau wie Blue und Cowboy.
Sie waren hier unten allein, abgesehen von den Spinnen, Schlangen und was immer sonst noch über den harten dreckigen Boden krabbelte.
„Die scheiß Zeichnung ist falsch. Hier sollte eine Treppe sein“, hörte Joe Blue murmeln und trat vor, um nachzusehen. Verdammt! Das hatte ihnen gerade noch gefehlt!
Joe zog die Karte aus der Vordertasche seiner schusssicheren Weste, obwohl er sich den Grundriss des Kellers vor langer Zeit eingeprägt hatte. Die Abbildungen, die er in der Hand hielt, gehörten zu einem ganz anderen Gebäude als dem, in dem sie standen. Wahrscheinlich war es die ustanzische Botschaft in einer anderen Stadt, in einem anderen Land auf der anderen Seite der verdammten Erdkugel. Verflucht! Hier hatte wirklich jemand Mist gebaut.
Blue beobachtete ihn, und Joe wusste, dass der Offizier seine Gedanken erriet. Der Schreibtischhengst, der für die Beschaffung des Grundrisses verantwortlich war, würde in einer Woche einen sehr schlechten Tag haben. Vielleicht auch früher. Denn der Commander des SEAL-Teams Alpha Squad würde ihm einen kleinen Besuch abstatten.
Jetzt mussten sie sich allerdings um das akute Problem kümmern.
Es gab drei Gänge, die jeweils in die Dunkelheit führten. Keine Treppe in Sicht.
„Wesley und Frisco“, befahl Blue mit gedehntem Südstaatenakzent, „bewegt eure Ärsche hier rein, Jungs. Wir bilden Zweiergruppen. Wes und Bobby. Frisco, du bleibst bei Cowboy. Ich gehe mit dir, Cat.“
Schwimmkumpel. Blue hatte Joes Gedanken gelesen: Mit Ausnahme von Frisco, der ein Auge auf Cowboy hatte, bildeten jetzt genau die Männer ein Team, die sich am besten kannten – die Schwimmkumpel. Männer, die zusammen durch die Höllenwoche gegangen waren – eine ebenso quälende wie qualvolle Woche während der Ausbildung zum Navy SEAL –, halten zusammen. Daran bestand kein Zweifel.
Wesley und Bobby gingen nach links. Frisco und Cowboy nahmen den rechten Gang. Und Joe ging geradeaus. Blue hielt sich dicht hinter ihm. Mit den Nachtsichtgeräten sahen sie aus wie Außerirdische.
Sie schwiegen jetzt. Joe hörte seine Männer über seinen Kopfhörer leise atmen. Langsam und vorsichtig bewegte er sich voran. Instinktiv achtete er auf Sprengfallen oder Hinweise darauf, dass sich vor ihnen etwas bewegte.
„Vorratskammer“, flüsterte Cowboy ins Mikrofon.
„Dito“, sagte Bobby leise. „Hier sind Konserven und ein Weinkeller. Nichts rührt sich, kein Lebenszeichen.“
Joe sah die Bewegung im selben Augenblick wie Blue. Gleichzeitig entsicherten sie ihre Maschinenpistolen und gingen in die Hocke.
Sie hatten die Treppe nach oben gefunden.
Und dort, unter der Treppe, hockte Tedric Cortere, der Kronprinz von Ustanzien. Zu Tode erschreckt und zitternd wie Espenlaub versuchte er, sich hinter drei seiner Mitarbeiter zu verstecken wie hinter Sandsäcken.
„Nicht schießen“, sagte Cortere in vier oder fünf verschiedenen Sprachen, während er die Hände hoch über seinen Kopf streckte.
Joe richtete sich auf, ließ das Gewehr jedoch nicht sinken, ehe er sicher war, dass die Männer unbewaffnet waren. Erst danach setzte er das Nachtsichtgerät ab und blinzelte. Allmählich gewöhnten sich seine Augen an das schummrige rötliche Licht, das Blue mit einer Stablampe aus seiner Tasche auf die Männer warf.
„Guten Abend, Euer Hoheit“, sagte er. „Ich bin Navy SEAL Lieutenant Joe Catalanotto. Ich bin gekommen, um Sie hier rauszuholen.“
„Kontakt“, gab Harvard in diesem Moment über Funk durch, nachdem er Joes Worte über das Headset mitgehört hatte. „Wir haben Kontakt hergestellt. Wiederhole: Wir haben das Gepäck und steuern die Zielgerade an.“
In diesem Moment hörte Joe, wie Blue lachte.
„Cat“, stieß er gedehnt hervor. „Hast du dir diesen Typen angesehen? Ich meine, Joe, hast du richtig hingeschaut?“
In ein paar hundert Meter Entfernung schlug östlich von ihnen eine Bombe ein. Prinz Tedric presste sich dichter an seine Mitarbeiter, die genauso verängstigt waren wie er.
Wenn der Prinz aufstünde, wäre er ungefähr so groß wie Joe, vielleicht ein bisschen kleiner.
Er trug ein zerrissenes weißes Satinjackett, was ihm eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Elvis-Imitator verlieh. Das Kleidungsstück war erstaunlich kitschig. Es war mit goldenen Epauletten dekoriert, und auf der Brust war eine Reihe von Medaillen und Abzeichen angesteckt – zweifellos für Tapferkeit während des Kampfes. Seine Hose war schwarz und schmutzig.
Aber es lag nicht am Kleidungsstil des Prinzen, dass Joe der Mund offen stand. Es war sein Gesicht.
Den Kronprinzen von Ustanzien anzusehen war, als blickte er in einen Spiegel. Sein dunkles Haar war länger als Joes. Doch davon abgesehen war die Ähnlichkeit geradezu unheimlich. Dunkle Augen, große Nase, ovales Gesicht, ausgeprägte Wangenknochen.
Der Typ sah genauso aus wie Joe.
1. Kapitel
Einige Jahre später
Washington D. C.
Die Kameras aller bedeutenden Nachrichtensender waren auf ihn gerichtet, als Tedric Cortere den Flughafen erreichte.
Diplomaten, Mitarbeiter der Botschaft und Politiker strömten dem Kronprinz von Ustanzien entgegen, um ihn zu begrüßen. Aber der Prinz zögerte einen Moment. Er nahm sich die Zeit, lächelte und winkte in die Kameras.
Er befolgte ihre Anweisungen bis ins letzte Detail. Veronica St. John, Image- und Medienberaterin, unterdrückte ihr erleichtertes Seufzen nicht. Es kam zaghaft, denn für einen Triumph, das wusste sie, war es zu früh. Tedric Cortere war ein Perfektionist. Es gab keine Garantie dafür, dass der Prinz – der Bruder von Veronicas Schulkameradin und absolut bester Freundin – mit dem zufrieden war, was er an diesem Abend in den Nachrichten sehen würde.
Allerdings hatte er jeden Grund zur Freude. Es war der erste Tag seines Staatsbesuchs in den Vereinigten Staaten. Und er zeigte sich von seiner besten Seite. Er versprühte seinen Charme und beeindruckte mit seinen königlichen Umgangsformen. Dabei legte er gerade so viel blaublütige Arroganz an den Tag, dass er die nach Königshäusern verrückte amerikanische Öffentlichkeit begeisterte. Er dachte daran, direkt in die Kameras zu schauen. Er hielt seine Augen ruhig und das Kinn niedrig. Und, dem Himmel sei Dank: Für einen Mann, der zu Panikanfällen neigte, war er regelrecht souverän und ruhig.
Er gab den Teams der Nachrichtensender genau, was sie wollten: die Nahaufnahme eines anmutigen, charismatischen, märchenhaften europäischen Prinzen.
Sie hatte vergessen, „unverheiratet“ hinzuzufügen. Und wenn Veronica Amerikaner richtig einschätzte – und das tat sie, es war schließlich ihr Job –, dann würden Millionen amerikanischer Frauen die Abendnachrichten sehen und davon träumen, Prinzessin zu werden.
Dass sich die Öffentlichkeit nach Märchen verzehrte, konnte die Beziehungen zwischen zwei Regierungen nur verbessern. Das und das kürzlich entdeckte Erdöl, das der trockene Boden Ustanziens barg.
Doch Tedric war nicht der Einzige, der an diesem Morgen für die Kameras schauspielerte.
Veronica beobachtete, wie Senator Sam McKinley den Mund zu einem strahlenden Lächeln verzog, das seine weißen Zähne entblößte. Es wirkte so aufgesetzt und war so offensichtlich für die Reporter bestimmt, dass sie fast in Gelächter ausgebrochen wäre.
Das tat sie natürlich nicht. Denn während ihrer Kindheit und Jugend hatte sie als Tochter eines international agierenden Geschäftsmanns, der jedes Jahr in ein anderes und meist exotisches Land zog, eines gelernt: Diplomaten und hohe Mitglieder der Regierung – besonders königliche – nahmen sich sehr, sehr ernst.
Deshalb biss Veronica sich kaum merklich auf die Lippen, während sie in respektvollem Abstand hinter dem Prinzen stehen blieb. Er führte eine Gruppe Assistenten und Berater an, die zu seinem königlichen Gefolge gehörten.
„Euer Hoheit, im Namen der Regierung der Vereinigten Staaten“, erklärte McKinley mit starkem texanischem Akzent, „möchte ich Sie in der Hauptstadt unseres Landes willkommen heißen.“ Er schüttelte dem Prinzen die Hand und triefte geradezu vor Wohlwollen.
„Ich grüße Sie mit der zeitlosen Ehre und Tradition der ustanzischen Flagge“, erwiderte Prinz Tedric förmlich. „Sie ist in mein Herz eingewoben.“
Das war seine Standardbegrüßung, nichts Besonderes. Trotzdem waren seine Worte bei diesem Publikum sehr effektvoll.
McKinley setzte zu einer längeren Begrüßungsrede an, und Veronica ließ den Blick schweifen.
Sie sah ihr Spiegelbild in den Glasfenstern des Flughafengebäudes, ihr strenges cremefarbenes Kostüm, das leuchtend rote Haar, das sie zu einem französischen Zopf geflochten hatte. Groß, schlank und gelassen. Ihr Ebenbild zitterte leicht, als ein Flugzeug über die Startbahn donnerte und abhob.
Es war eine Illusion. Tatsächlich war sie von einer albernen Nervosität erfüllt, die auf Stress beruhte und dem Wissen, dass sie es war, die die Verantwortung trug, sollte Prinz Tedric ihren Anweisungen zuwiderhandeln und im Fernsehen einen schlechten Eindruck machen. Schweiß perlte zwischen ihren Schulterblättern herunter, ein weiterer Nebeneffekt ihrer Anspannung. Nein, sie fühlte sich weder cool noch gelassen, ungeachtet ihres Auftretens.
Sie hatte diesen Auftrag dank ihrer Freundin bekommen. Prinzessin Wila wusste, wie sehr Veronica darum kämpfte, ihre junge Firma in Gang zu bekommen. Sicher, sie hatte zuvor bereits kleinere, weniger heikle Jobs übernommen. Aber dieser war der erste, bei dem wirklich etwas auf dem Spiel stand. Wenn sie bei Tedric Cortere Erfolg hatte, würde es sich herumsprechen, und sie würde mehr Aufträge bekommen, als sie überhaupt bewältigen konnte. Aber eben genau das: wenn …
Doch Veronica war auch aus einem anderen Grund engagiert worden. Wila hatte ihr den Job vermittelt, weil sie sich Sorgen um die wirtschaftliche Lage von Ustanzien machte. Sie hatte erkannt, wie wichtig dieser Besuch war. Veronica sollte Wilas Bruder, dem nervösen Prinzen, als Image- und Medienberaterin beibringen, wie er unter den wachsamen Blicken der Fernsehteams ruhig und entspannt wirkte. Der Besuch in den USA war die Feuertaufe. Und Wila vertraute darauf, dass ihre Freundin den Job erfolgreich erledigte.
„Ich zähle auf dich, Véronique“, hatte sie am vergangenen Abend am Telefon gesagt. Gewohnt offen hatte sie hinzugefügt: „Die Beziehungen zu den USA sind einfach zu wichtig. Lass nicht zu, dass Tedric es vermasselt.“
Bis jetzt machte Tedric seine Aufgabe gut. Er sah gut aus, und er fand die richtigen Worte. Aber für Veronica war es viel zu früh, um wirklich zufrieden zu sein. Ihr Auftrag lautete, dafür zu sorgen, dass das auch so blieb.
Tedric mochte die beste Freundin seiner Schwester nicht besonders, und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Er war ein ungeduldiger, aufbrausender Mann und daran gewöhnt, seinen Kopf durchzusetzen.
Veronica konnte nur hoffen, dass er erkannte, wie gut es gelaufen war, wenn er später die Nachrichten sah. Falls nicht, würde sie davon erfahren, so viel war sicher.
Jeder Cent ihres Honorars, das ihr der Besuch des Prinzen in den Vereinigten Staaten einbrachte, war hart erarbeitet. Denn auch wenn Tedric Cortere wie ein Prinz aussah und so auftrat, war er auch arrogant und verwöhnt. Und fordernd. Und oft unvernünftig. Und ab und zu nicht besonders nett.
Oh, er kannte die Etikette. Er war in seinem Element, wenn es glamourös wurde, bei Feierlichkeiten, Partys und anderen gesellschaftlichen Auftritten. Über Kleidung und Mode wusste er einfach alles; mit Hingabe pflegte er seinen extravaganten Stil. Tedric konnte mit einer einzigen Berührung japanische Seide von amerikanischer unterscheiden. Er war Weinkenner und Gourmet. Er konnte reiten und fechten, spielte Polo und fuhr Wasserski. Er engagierte unzählige Mitarbeiter und Berater, die um ihn herumtanzten. Sie erfüllten selbst seine kleinsten Wünsche und versorgten ihn genauso gewissenhaft mit allen Informationen, die er brauchte, um sein Land zu repräsentieren.
Veronica beobachtete, wie er den US-Offizieren die Hand schüttelte. Er lächelte charmant. Sie konnte fast hören, wie die Kameras in die Nahaufnahme zoomten.
Der Prinz schaute direkt in die Linsen der Kameras und vertiefte das Lächeln im richtigen Augenblick. Verwöhnt oder nicht, mit seinem gepflegten Äußeren, dem athletischen Körperbau und dem attraktiven Gesicht sah er einfach sehr gut aus.
Er sah gut aus? Nein, dachte Veronica. Ihn einfach nur als gut aussehend zu bezeichnen passte nicht. Wenn sie ganz ehrlich war, fand sie ihn einfach hinreißend. Er war ein Kunstwerk. Er hatte langes, volles, dunkles Haar, das ihm bis zu den Schultern ging. Sein Gesicht war oval und schmal, seine außergewöhnlichen Wangenknochen zeugten von der Verwandtschaft mit der Familie seiner Mutter, die aus dem mediterranen Raum stammte. Seine Augen waren dunkelbraun, seine Wimpern sündig lang. Sein Kiefer war kantig, seine Nase stark und männlich.
Doch Veronica kannte ihn, seit sie fünfzehn war. Er war damals neunzehn gewesen. Natürlich hatte sie sich sofort bis über beide Ohren in ihn verknallt. Allerdings hatte sie nicht lange gebraucht, um zu erkennen, dass der Prinz anders war als seine lustige, kesse, fröhliche und schon früh geschäftstüchtige Schwester. Tatsächlich war Tedric sogar entschieden langweilig – und extrem mit seinem äußeren Erscheinungsbild beschäftigt. Unzählige Stunden hatte er damit verbracht, vor dem Spiegel zu stehen, sich das Haar zu kämmen, die Muskeln anzuspannen und seine perfekten weißen Zähne zu inspizieren. Wila und Veronica waren damals immer von Lachkrämpfen geschüttelt worden.
Trotzdem war Veronicas Schwäche für Prinz Tedric nicht verflogen. Bis sie sich mit ihm unterhalten und hinter die Fassade geblickt hatte. Hinter dem schönen Gesicht und dem gepflegten Erscheinungsbild, dem Charme und seiner sozialen Kompetenz, ganz tief in seinen dunkelbraunen Augen war … nichts.
Jedenfalls nichts, das Veronica interessiert hätte.
Dennoch musste sie zugeben, dass sie sich heute immer noch jemand Großes, Geheimnisvolles und Attraktives unter dem perfekten Mann vorstellte. Jemanden, der ausgeprägte Wangenknochen und schimmernde braune Augen hatte. Jemanden, der Kronprinz Tedric schrecklich ähnlich sah, aber einen wachen Verstand hatte, und dessen Herz für mehr schlug als das eigene Spiegelbild.
Sie war nicht auf der Suche nach einem Prinzen. Genau genommen war sie überhaupt nicht auf der Suche. Veronica hatte keine Zeit für eine Beziehung – zumindest nicht, bis ihre Firma richtig lief.
Während die Militärkapelle mitreißend die ustanzische Nationalhymne schmetterte, blickte Veronica wieder auf die verschwommenen Spiegelbilder. Ein Blitzlicht am oberen Balkon erregte ihre Aufmerksamkeit. Das war seltsam. Dem Flughafenpersonal war der Zutritt zur ersten Etage doch aus Sicherheitsgründen verboten worden.
Sie drehte den Kopf, um genauer hinzusehen, und erkannte starr vor Schreck: Das Blitzlicht, das sie gesehen hatte, war eine Reflektion gewesen. Und zwar auf einem langen Gewehrlauf, der direkt auf Tedric zielte.
„Runter!“, rief Veronica, aber ihre Warnung ging in den Trompeten unter. Der Prinz hörte sie nicht. Niemand hörte sie.
Sie rannte auf Prinz Tedric und all die Würdenträger zu. Sie war sich durchaus im Klaren, dass sie mitten in die Gefahr hineinlief, statt sich in Sicherheit zu bringen. Dieser Mann ist es nicht wert, dass man für ihn stirbt, dieser verrückte Gedanke blitzte für den Bruchteil einer Sekunde in ihr auf. Doch sie konnte nicht warten und zulassen, dass der Bruder ihrer besten Freundin getötet wurde. Nicht, wenn sie in der Lage war, es zu verhindern.
Als der Schuss sich löste, stürzte sich Veronica mit voller Wucht auf Tedric und warf ihn fest zu Boden. Knochen knackten, als wären sie beim Rugby. Ihr Bruder Jules wäre stolz auf sie gewesen.
Sie verletzte sich die Schulter, zerriss sich die Strumpfhose und schrammte sich beide Knie auf.
Aber sie rettete dem Kronprinzen von Ustanzien das Leben.
Als Veronica in den Konferenzraum des Hotels ging, war ihr klar, dass das Treffen bereits vor einer ganzen Weile begonnen hatte.
Senator McKinley saß an einem Ende des großen Konferenztischs. Das Jackett hatte er aufgeknöpft, die Krawatte gelockert und die Hemdsärmel aufgekrempelt. Henri Freder, der Botschafter von Ustanzien, saß neben ihm. Ein weiterer Diplomat und mehrere andere Männer, die Veronica nicht erkannte, hatten die andere Hälfte des Tischs eingenommen. Männer in schwarzen Anzügen standen an Türen und Fenstern, konzentriert und wachsam. Veronica war klar, dass das Agenten waren, Spitzen-Bodyguards von der Federal Intelligence Commission. Sie waren geschickt worden, um den Prinzen zu beschützen. Aber warum diese Elitetruppe, warum die FInCOM? Schwebte Prinz Tedric immer noch in Lebensgefahr?
Tedric thronte am Kopf des Tischs. Er war von einem Dutzend Mitarbeitern und Beratern umgeben. Vor ihm stand ein kühles Getränk. Träge malte er Muster in das Kondenswasser, das sich auf dem Glas abgesetzt hatte.
Als Veronica den Raum betreten hatte, stand Tedric auf, worauf die anderen Männer sich ebenfalls erhoben.
„Jemand sollte Miss St. John einen Stuhl holen“, befahl der Prinz scharf mit seinem charakteristischen Akzent aus britischem Englisch und einem Hauch Französisch. „Sofort.“
Einer der weniger bedeutenden Mitarbeiter seines Stabes trat hastig zurück und bot Veronica seinen Stuhl an.
„Danke“, erwiderte sie und schenkte dem jungen Mann ein Lächeln.
„Setzen Sie sich“, forderte der Prinz sie auf. Seine Miene wirkte wie versteinert, als er wieder Platz nahm. „Ich habe eine Idee, aber dazu brauche ich Ihre Unterstützung.“
Veronica sah den Prinzen unverwandt an. Nach dem Anschlag am Vormittag war er sofort in Sicherheit gebracht worden. Seitdem hatte sie ihn weder gesehen noch etwas von ihm gehört. Er hatte sich bis jetzt nicht die Mühe gemacht, sich bei ihr dafür zu bedanken, dass sie ihm das Leben gerettet hatte, und offensichtlich hatte er das auch weiterhin nicht vor. Sie arbeitete für ihn, deshalb war sie eine Bedienstete. Er erwartete, dass sie ihn rettete. In seiner Welt gab es keinen Grund, ihr dankbar zu sein.
Aber sie war keine Bedienstete. Als seine Schwester im vergangenen Jahr Veronicas Bruder geheiratet hatte, war sie die erste Brautjungfer gewesen. Veronica und der Prinz gehörten praktisch zur selben Familie. Doch Tedric bestand immer noch darauf, dass sie ihn mit „Euer Hoheit“ ansprach.
Sie setzte sich und zog den Stuhl dichter an den Tisch heran. Daraufhin nahmen nun auch die anderen Männer wieder Platz.
„Ich habe ein Double“, erklärte der Prinz. „Er ist Amerikaner. Und ich halte es für das Beste, wenn er für die restliche Zeit meines Staatsbesuchs meinen Platz einnimmt. Das wird meine Sicherheit garantieren.“
Veronica lehnte sich vor. „Entschuldigen Sie, Euer Hoheit. Bitte verzeihen Sie mir die Frage, aber steht Ihre Sicherheit denn immer noch auf dem Spiel?“ Sie blickte über den Tisch und sah Senator McKinley an. „Ist der Attentäter nicht festgenommen worden?“
McKinley leckte sich mit der Zunge über die Schneidezähne, bevor er antwortete. „Ich fürchte nein“, bekannte er schließlich. „Und die Federal Intelligence Commission hat Grund zu der Annahme, dass die Terroristen im Laufe der nächsten Wochen einen weiteren Anschlag auf den Prinzen verüben wollen.“
„Terroristen?“, wiederholte Veronica, blickte von McKinley zum Botschafter und schließlich auf Prinz Tedric.
„Die FInCOM hat die Identität des Schützen festgestellt“, erwiderte McKinley. „Er ist ein altbekannter Killer, der für eine südamerikanische Terrororganisation arbeitet.“
Veronica schüttelte den Kopf. „Warum sollten südamerikanische Terroristen den ustanzischen Kronprinzen töten wollen?“
Der Botschafter nahm die Brille ab und rieb sich müde die Augen. „Gut möglich, dass es ein Vergeltungsschlag ist, weil Ustanzien sich mit den USA verbündet hat.“
„Wir wissen von FInCOM, dass diese Gruppen nicht so leicht aufgeben“, sagte McKinley. „Sogar bei verstärktem Sicherheitsaufgebot werden sie es nach Einschätzung der FInCOM noch einmal versuchen. Unsere Aufgabe besteht darin, eine Lösung dieses Problems zu finden.“
Veronica lachte. Es brach einfach aus ihr heraus, ohne dass sie etwas dagegen tun konnte. Die Lösung lag doch auf der Hand. „Sagen Sie die Reise ab.“
„Das geht nicht“, antwortete McKinley mit fester Stimme.
Veronica warf einen Blick auf die andere Seite des Tischs und musterte Prinz Tedric. Zur Abwechslung blieb er jetzt still. Und er sah nicht besonders glücklich aus.
„Die Publicity für diese Reise ist zu wichtig“, erklärte Senator McKinley. „Sie wissen genauso gut wie ich, dass Ustanzien die finanzielle Unterstützung der USA braucht, um Förderanlagen zu bauen und ihre Ölquellen nutzen zu können.“ Der korpulente Mann lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und klopfte mit seinem Stift auf die Mahagoniplatte. „Die Aussicht auf wettbewerbsfähige Ölpreise reicht allerdings nicht, um die nicht unbedeutenden Geldsummen aufzutreiben, die sie brauchen“, fuhr er fort, ließ den Stift fallen und strich sich durch das lichte graue Haar. „Und offen gesagt: Das Interesse der Öffentlichkeit an einem unbedeutenden kleinen Land wie Ustanzien geht – entschuldigen Sie, Prinz – gegen null, das zeigen die jüngsten Umfragen. Kaum jemand kennt Ustanzien, und die Leute, die es kennen, wollen dort nicht investieren. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Sie werden keinen Cent rausrücken, solange es hier genug Firmen gibt, in die sie ihr Geld stecken können.“
Veronica nickte. Sie war sich nur allzu bewusst, dass der Senator recht hatte. Er sprach Prinzessin Wilas größte Sorge aus.
„Außerdem“, fügte der Senator hinzu, „können wir die Gelegenheit nutzen, um diese Terroristen zu schnappen. Und wenn sie diejenigen sind, für die wir sie halten, dann sollten wir sie auch kriegen. Und zwar um jeden Preis.“
„Aber wenn Sie mit Bestimmtheit wissen, dass sie einen neuen Anschlag verüben …?“ Veronica sah Tedric über die Tischplatte hinweg fest an. „Euer Hoheit, wie können Sie sich einer solchen Gefahr aussetzen und in Kauf nehmen …?“
Tedric schlug ein Bein über das andere. „Ich habe nicht die Absicht, mein Leben in Gefahr zu bringen. Ich werde hier in Washington bleiben, an einem sicheren Ort, bis die Gefahr vorüber ist. Die Reise wird jedoch wie geplant fortgesetzt – nur dass dieser Doppelgänger an meiner Stelle sein wird.“
Plötzlich ergaben die Worte des Prinzen einen Sinn. Er hatte ein Double, jemanden, der genauso aussah wie er. Und er war Amerikaner.
„Dieser Mann“, fragte McKinley, „wie hieß er doch gleich, Sir?“
Langsam und vielsagend zuckte der Prinz die Schultern. „Woher soll ich das wissen? Joe. Joe Irgendwer. Er war Soldat, ein amerikanischer Soldat.“
„Joe Irgendwer“, wiederholte McKinley, während er einen kurzen erschöpften Blick mit dem Diplomaten zu seiner Linken wechselte. „Ein Soldat, der Joe heißt. Es dürfte nur ungefähr fünfzehntausend Männer mit Namen Joe in der US-Armee geben.“
Der Botschafter, der neben McKinley saß, lehnte sich vor. „Euer Hoheit“, sagte er geduldig, „wann sind Sie diesem Mann begegnet?“
„Er war einer der Männer, die meine Flucht aus der Botschaft in Bagdad ermöglicht haben“, antwortete Tedric.
„Ein Navy SEAL“, murmelte der Botschafter an McKinley gewandt. „In dem Fall sollten wir ihn problemlos finden. Wenn ich mich nicht irre, war an der Mission nur ein sieben Mann starkes Team beteiligt.“
„SEAL?“, fragte Veronica, setzte sich auf und legte die Arme auf den Tisch. „Was ist ein SEAL?“
„Die United States Navy SEALs sind eine Spezialeinheit der US Navy“, erklärte Senator McKinley. „Eine Elitekampftruppe. Sie haben die härteste Militärausbildung der Welt absolviert und sind überall einsetzbar – auf See, in der Luft und an Land. Sollte der Mann, der dem Prinzen so ähnlich sieht, tatsächlich ein SEAL sein, dann ist dieser Doppelgänger-Job für ihn ein Spaziergang.“
„Er war allerdings unerträglich vulgär“, sagte der Prinz blasiert und fegte ein paar nicht vorhandene Krümel von der Tischplatte. Er sah Veronica an. „Und da kommen Sie ins Spiel. Sie werden diesem Joe beibringen, wie ein Prinz auszusehen und sich zu verhalten hat. Wir können die Reise um …“, er runzelte die Stirn und wandte sich fragend an McKinley, „… eine Woche verschieben, richtig?“
„Höchstens um zwei, drei Tage, Sir.“ Der Senator verzog das Gesicht. „Wir könnten bekannt geben, dass Sie mit einer Grippe angereist sind, und versuchen, das Interesse der Öffentlichkeit mit Berichten über Ihre Genesung aufrechtzuerhalten. Ich fürchte nur, dass das nach ein paar Tagen niemanden mehr interessiert. Sie kennen ja das Sprichwort: Aus den Augen, aus dem Sinn. Das darf keinesfalls passieren.“
Zwei oder drei Tage. Zwei oder drei Tage, um einen derben amerikanischen Soldaten – einen Navy SEAL, was immer das wirklich bedeutete – in einen Prinzen zu verwandeln. Sollte das ein Witz sein?
Senator McKinley ging zum Telefon und versuchte, den geheimnisvollen Joe aufzuspüren.
Erwartungsvoll sah Prinz Tedric Veronica an. „Schaffen Sie das?“, fragte er. „Können Sie aus diesem Joe einen Prinzen machen?“
„In nur zwei oder drei Tagen?“
Tedric nickte.
„Ich müsste rund um die Uhr arbeiten.“ Veronica sprach ihre Gedanken laut aus. Wenn sie sich auf diesen verrückten Plan einließ, musste sie diesem SEAL auf Schritt und Tritt folgen. Sie dürfte ihn keine Sekunde lang aus den Augen lassen. Die ganze Zeit müsste sie mit ihm üben und bereit sein, jederzeit einzuspringen und seine noch so kleinen Fehler wiedergutzumachen. „Und selbst dann haben wir keine absolute Sicherheit …“
Schulterzuckend wandte sich Tedric an den Botschafter. „Sie kann es nicht“, erklärte er rundheraus. „Wir müssen die Reise absagen. Kümmern Sie sich um meinen Rückflug nach …“
„Ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht kann“, unterbrach Veronica ihn und fügte schnell hinzu: „Euer Hoheit.“
Der Prinz drehte sich wieder zu ihr um und zog eine seiner perfekt gezupften Augenbrauen hoch.
In Gedanken hörte Veronica Wila sagen: „Ich zähle auf dich, Véronique. Die Beziehungen zu den USA sind überaus wichtig.“ Wenn die Reise abgesagt wurde, würden sich Wilas Hoffnungen auf eine rosigere Zukunft in Luft auflösen. Und es wären nicht nur die Hoffnungen ihrer Freundin, die im Keim erstickt würden. Veronica durfte das kleine Mädchen nicht vergessen, das im Saint Mary wartete …
„Nun?“, fragte Tedric ungeduldig.
„Abgemacht“, erwiderte Veronica. „Ich werde es versuchen.“
Schwungvoll legte Senator McKinley den Hörer auf. „Ich glaube, wir haben unseren Mann“, verkündete er breit lächelnd. „Navy Lieutenant Joseph P. …“ Er warf einen Blick auf den Zettel, auf dem er sich während des Telefonats Notizen gemacht hatte. „… Catalanotto. Sie faxen ein Foto.“
Veronica spürte, wie ihr gleichzeitig heiß und kalt wurde. Lieber Gott, was hatte sie gerade getan? Womit hatte sie sich da einverstanden erklärt? Was, wenn sie es nicht durchziehen konnte? Was, wenn es unmöglich war?
Ein schriller Piepton ertönte. Sowohl der Prinz als auch Senator McKinley standen sofort auf und gingen durch die geräumige Suite zu dem Faxgerät, das unter dem Erkerfenster angeschlossen war.
Veronica blieb am Tisch sitzen. Wenn es nicht den Hauch einer Chance gab, müsste sie ihre beste Freundin im Stich lassen.
„Mein Gott“, stieß McKinley impulsiv aus, während das Foto langsam ausgedruckt wurde. „Das ist unmöglich.“
Er zog das Fax aus dem Gerät und reichte es dem Prinzen.
Schweigend starrte Tedric auf den Ausdruck. Ohne ein Wort zu sagen, ging er zurück zum Tisch und gab Veronica die Seite.
Abgesehen von der Tatsache, dass der Mann auf dem Foto einen locker sitzenden Kampfanzug trug, mit oben aufgeknöpftem Hemd und bis zu den Ellenbogen hochgekrempelten Ärmeln … abgesehen von der Tatsache, dass der Mann auf dem Foto dunkles, zerzaustes und halblanges Haar hatte und den Gurt eines Maschinengewehrs über der Schulter trug … abgesehen von der Tatsache, dass die Kamera ihn halb lächelnd, mit humorvollen, intelligenten, funkelnden dunklen Augen eingefangen hatte … abgesehen von all diesen Fakten, hätte der Mann auf dem Foto durchaus der Kronprinz von Ustanzien sein können. Oder zumindest sein Bruder.
Der Bruder, der besser aussah.
Er hatte die gleiche Nase, die gleichen Wangenknochen, den gleichen markanten Kiefer und das gleiche Kinn. Aber ein Teil seines Schneidezahns war abgebrochen. Das würde ihnen allerdings keine Schwierigkeiten bereiten. Den Zahn konnte man bestimmt innerhalb von Stunden überkronen.
Er wirkte schwerer als Prinz Tedric, dieser amerikanische Lieutenant. Schwerer und größer. Stärker. Aus gröberem Holz geschnitzt. Aus wesentlich gröberem Holz, und das in jeder Hinsicht. Lieber Gott, wenn dieses Foto nur die Spitze des Eisbergs abbildete, musste Veronica bei diesem Mann bei den Grundlagen anfangen. Sie müsste ihm zuerst sitzen, stehen, gehen beibringen …
Als sie aufsah, merkte sie, dass Prinz Tedric sie beobachtete.
„Irgendwie habe ich das Gefühl“, sagte er mit seinem feinen Akzent, „dass Sie sich in diesen Job richtig reinknien müssen.“
Auf der anderen Seite des Zimmers nahm McKinley den Telefonhörer ab und wählte. „Ja. Hier ist Sam McKinley, Senator Sam McKinley. Ich brauche einen Navy SEAL Lieutenant namens Joseph …“, er sah wieder auf seine Notizen, „… Catalanotto … Mensch, was für ein Zungenbrecher! Ich brauche diesen Lieutenant hier in Washington, und zwar gestern.“
2. Kapitel
Die Hände hinter dem Kopf verschränkt lag Joe an Deck und betrachtete die blendend weißen Wolken, die sich am kristallklaren, blauen kalifornischen Himmel bauschten. Sie bewegten sich fortwährend, veränderten sich ständig.
Das gefiel ihm.
Es erinnerte ihn an sein Leben – ständig in Bewegung und voller Überraschungen. Er wusste nie, wann sich ein weicher Lufthauch plötzlich in einen wilden Sturm verwandelte.
Aber Joe mochte das. Er fand es gut, nie zu wissen, was ihn hinter einer Tür erwartete – die Lady oder der Tiger. Und zweifellos hatte er beides erlebt, seit er ein SEAL war.
Doch heute musste er sich weder Ladies noch Tigern stellen. Heute hatte er Urlaub, Landgang, wie man es bei der Navy nannte. Witzig, dass er diesen Tag ausgerechnet auf einem Fischerboot verbrachte.
Nicht, dass er kürzlich viel Zeit auf See verbracht hätte. Eigentlich war er in den letzten paar Monaten genau sechsundneunzig Stunden auf einem Marineschiff gewesen, und das war Teil einer Übung gewesen. Einige der Stunden davon hatte er als Ausbilder verbracht, andere als Auszubildender. Das gehörte alles dazu, wenn man ein Navy SEAL war. Egal welchen Rang oder wie viel Erfahrung man hatte, man musste immer lernen, immer wieder trainieren, sich immer wieder mit neuer Technik und neuen Methoden vertraut machen.
Joe war in neun verschiedenen Fachgebieten Experte, aber diese Gebiete veränderten sich stetig. Genau wie die Wolken, die über ihm schwebten. Genau wie er es mochte.
Auf der anderen Seite des Decks diskutierten Harvard und Blue entspannt darüber, wer den deprimierendsten Brief der Woche bekommen hatte. Beide trugen legere Wochenend-Outfits, ähnlich der abgetragenen Hose und dem verwaschenen T-Shirt, das Joe anhatte.
Joe hatte überhaupt keine Post bekommen; nichts, außer natürlich Rechnungen. Das war deprimierend.
Er schloss die Augen und hörte dem Gespräch mit halbem Ohr zu. Er kannte Blue nun seit acht, Harvard seit sechs Jahren. Blue hörte man stark an, dass er südlich der Mason-Dixon-Linie aufgewachsen war. Harvard dagegen sprach nasal und hatte einen vornehmen Bostoner Akzent. Ihre Stimmen waren Joe so vertraut wie seine eigene.
Ihr SEAL-Team bestand aus sieben Männern. Joe und Blue waren die besten Freunde. Daryl Becker, genannt Harvard, stand Blue auch recht nah, was Joe gelegentlich auf die Nerven ging.
Carter „Blue“ McCoy und Daryl „Harvard“ Becker: der Rebell aus dem Süden und der Yankee von der Eliteuniversität. Beide waren SEALs und besser als die Besten. Und beiden war klar, dass es bei den Navy SEALs keine Vorurteile gab.
Weit draußen außerhalb der Bucht funkelte das blaugraue Wasser und glitzerte im Sonnenschein. Joe sog die salzige Luft tief in die Lungen.
„Oh Gott“, sagte Blue, als er die zweite Seite seines Briefs las.
Joe blickte seinen Freund fragend an. „Was ist?“
„Gerry will heiraten“, erwiderte Blue und strich sich durch das sonnengebleichte blonde Haar. „Und zwar Jenny Lee Beaumont.“
Jenny Lee war Blues Highschool-Freundin gewesen. Sie war die einzige Frau, über die er jemals gesprochen hatte – die Einzige, die etwas Besonderes für ihn war.
Nachdenklich wechselte Joe einen Blick mit Harvard. „Jenny Lee Beaumont, hm?“
„Genau.“ Blue nickte, dabei verzog er keine Miene. „Gerry wird sie heiraten. Im Juli. Und ich soll sein Trauzeuge sein.“
Joe fluchte leise.
„Du hast gewonnen“, warf Harvard ein und gab damit nach. „Deine Post ist schlimmer.“
Dankbar, dass er an keine Frau gebunden war, schüttelte Joe den Kopf. Klar, er hatte während der vergangenen Jahre diverse Freundinnen gehabt. Aber er war mit keiner zusammen gewesen, die er nicht hätte verlassen können.
Nicht, dass er Probleme mit Frauen hatte, im Gegenteil: Er mochte sie. Und die Frauen, mit denen er sich für gewöhnlich traf, waren klug und witzig und scheuten sich vor einer festen Beziehung genauso wie er. Joe verabredete sich während seiner gelegentlichen Landgänge mit ihnen und manchmal am Abend, wenn er in der Stadt war und Zeit hatte.
Aber er hatte keiner dieser Frauen einen Gutenacht- und Gutenmorgenkuss gegeben, war dann zurück zum Hauptquartier gefahren und hatte sich dann Tagträumereien über sie hingegeben. Nicht so wie Bob und Wesley, die in Verzückung gerieten, wenn sie über die Collegemädchen sprachen, die sie in San Diego kennengelernt hatten. Joe hatte auch nie so geseufzt wie Harvard, nachdem sie der hawaiianischen Biologin in Guam begegnet waren. Wie hieß sie doch gleich? Rachel. Harvard bekam immer noch diesen traurigen Glanz in seinen braunen Augen, wenn ihr Name fiel.
Die Wahrheit war: Joe hatte Glück gehabt. Weil er sich nie ernsthaft verliebt hatte. Und er hoffte, dass dieses Glück anhielt. Er wäre durchaus zufrieden damit, weiterhin ohne diese besondere Erfahrung durchs Leben zu gehen. Nein, vielen Dank.
Joe stieß den Deckel der Kühlbox mit dem nackten Fuß hoch. Er nahm eine Bierdose heraus und hielt abrupt inne.
Er setzte sich auf. Hörte genau hin und blickte angespannt nach Osten.
Da war es wieder.
Die Geräusche eines sich nähernden Hubschraubers. Joe hielt eine Hand an die Stirn und suchte die kalifonische Küstenlinie mit Blicken ab. Von dort schienen die Propellergeräusche zu kommen.
Harvard und Blue standen schweigend auf und kamen zu Joe. Ohne ein Wort zu sagen, reichte Harvard ihm ein Fernglas.
Mit einer einzigen Bewegung stellte Joe es scharf.
Noch war der Helikopter ein kleiner schwarzer Punkt, aber mit jeder Sekunde wurde dieser Punkt größer. Er flog zweifellos genau auf sie zu.
„Habt ihr eure Pager dabei?“, brach Joe das Schweigen. Sein eigener – und er selbst – waren mit einem Eimer Köder und salzigem Meerwasser übergossen worden.
Harvard nickte. „Ja, Sir.“ Er warf einen Blick auf den Pager, den er am Gürtel trug. „Aber ich habe keine Nachricht bekommen.“
„Meiner zeigt auch nichts an, Cat“, erwiderte Blue.
Wieder setzte Joe das Fernglas an und machte jetzt die Konturen des schwarzen Punkts genauer aus. Es war ein Militärhubschrauber, ein UH-60 Black Hawk. Er flog fast dreihundert Kilometer pro Stunde. Und er steuerte direkt auf sie zu, und zwar schnell.
„Steckt einer von euch in Schwierigkeiten? Irgendwas, das ich wissen sollte?“
„Nein, Sir“, antwortete Harvard.
„Negativ.“ Blue schaute zu Joe. „Wie steht’s mit dir, Lieutenant?“
Während er den Helikopter durch das Fernglas beobachtete, schüttelte Joe den Kopf.
„Das ist merkwürdig“, meinte Harvard. „Warum haben sie es so eilig? Sie könnten uns doch auch einfach eine Nachricht schicken und mit voller Kraft voraus zurück zum Hafen fahren lassen?“
„Muss etwas verdammt Dringendes sein“, erwiderte Joe. Gott, dieser Black Hawk näherte sich ihnen wirklich extrem schnell. Er nahm das Fernglas herunter, als der Hubschrauber so nah war, dass er ihn mit bloßem Auge erkennen konnte.
„Es ist jedenfalls nicht der Dritte Weltkrieg“, erklärte Blue, der seinen Kummer über Jenny Lee zeitweilig vergessen zu haben schien. Er musste schreien, so viel Lärm machte der herannahende Helikopter bereits. „Denn dann würden sie wegen drei lausiger SEALs sicher keinen Black Hawk verschwenden.“
Der Hubschrauber blieb direkt über ihnen in der Luft stehen. Die Geräusche der Rotorenblätter waren ohrenbetäubend, und das kleine Boot wurde auf den Wellen hin- und hergeworfen.
Dann wurde ein Seil aus der offenen Tür geworfen. Es wogte im Wind hin und her und traf Joe direkt an der Brust.
„Lieutenant Joseph P. Catalanotto“, rief eine Stimme über Lautsprecher. „Ihr Landgang ist zu Ende.“
Veronica St. John ging in ihre Hotelsuite und lehnte sich müde gegen die geschlossene Tür.
Es war erst neun Uhr abends, für Diplomaten noch früh. Wäre an diesem Tag alles gelaufen wie geplant, wäre sie jetzt immer noch bei einem Empfang für Prinz Tedric in der ustanzischen Botschaft. Aber heute war nichts gelaufen wie geplant, angefangen mit dem Attentat am Flughafen.
Der amerikanische Präsident hatte sie angerufen, um ihr im Namen des amerikanischen Volks dafür zu danken, dass sie Prinz Tedric das Leben gerettet hatte. Damit hatte sie nicht gerechnet. Dummerweise. Denn sonst wäre sie auf den Anruf aus dem Weißen Haus vorbereitet gewesen. Sie hätte um Hilfe bitten können, damit die Personalakte des geheimnisvollen Lieutenants, der dem Kronprinzen so ähnelte, schneller gefunden wurde.
Niemand, aber auch niemand, mit dem sie gesprochen hatte, konnte ihr dabei helfen, die gesuchten Akten aufzutreiben. Das Verteidigungsministerium verwies sie an die Navy. Die Navy hatte ihr zu verstehen gegeben, dass sämtliche SEAL-Akten in den Abteilungen der Sondereinsatzkommandos verwahrt wurden. Aber die Sekretärin bei den Sondereinsatzkommandos war genauso hilfsbereit und verschwiegen gewesen wie James Bonds persönliche Assistentin. Die Frau hätte ihr nicht einmal bestätigt, dass Joseph Catalanotto existierte – ganz zu schweigen von der Frage, ob sich seine Personalakte in ihrem Büro befand.
Frustriert war Veronica wieder zu Senator McKinley gegangen. Sie hatte die Hoffnung, er könnte seinen Einfluss nutzen, um sich die Daten faxen zu lassen. Aber sogar dem mächtigen Senator war mitgeteilt worden, dass Personalakten von Navy SEALs aus Sicherheitsgründen niemals, aber auch niemals, per Fax verschickt wurden. Überhaupt das Foto zu faxen war schon eine sehr große Ausnahme gewesen. Aber wenn McKinley einen Blick in Joseph P. Catalanottos Akte werfen wollte, musste er schriftlich einen Antrag stellten. Erst danach könnte man innerhalb von wenigstens drei Tagen prüfen, ob er oder Miss St. John berechtigt waren, die Unterlagen zu sichten.
Drei Tage.
Veronica wollte doch nicht Lieutenant Catalanottos tiefste und dunkelste militärische Geheimnisse erfahren! Sie wollte lediglich herausfinden, wo der Mann herkam, in welchem Teil des Landes er aufgewachsen war. Seinen familiären Hintergrund, seine Schulbildung, seinen IQ und die Ergebnisse des Persönlichkeitstests sowie der psychologischen Untersuchung – das war alles, was sie interessierte.
Genau genommen wollte sie wissen, was für ein großes Hindernis dieser Navy SEAL für ihre Arbeit darstellte.
Bis jetzt kannte sie nur seinen Namen. Und sie wusste, dass er wie eine raue, ungebändigte Version von Tedric Cortere aussah. Dass er breite Schultern hatte und ein Maschinengewehr trug, als wäre es ein Baguette. Und dass er ein schönes Lächeln hatte.
Sie hatte keine Ahnung, ob sie die amerikanische Öffentlichkeit täuschen und dazu bringen konnte, ihn für einen europäischen Prinzen zu halten. Bevor sie dem Mann nicht persönlich begegnet war, konnte sie nicht einmal vermuten, wie viel Arbeit es für sie sein würde, ihn in einen Prinzen zu verwandeln. Am besten versuchte sie, nicht länger darüber nachzudenken.
Wenn sie allerdings nicht über die Aufgaben nachdachte, die auf sie zukamen, würde sie am Ende nur noch das Mädchen im Saint Mary vor Augen haben. Ein kleines Mädchen namens Cindy, das dem Prinzen vor fast vier Monaten einen Brief geschickt hatte; Veronica hatte ihn aus dem königlichen Papierkorb gezogen. Cindy, kaum zehn Jahre alt, fragte Prinz Tedric, ob er sie bei seinen Staatsbesuch in den Vereinigten Staaten nicht besuchen könnte.
Veronica hatte den Prinzen schließlich übergangen und sich direkt an König Derrick gewandt. Dann hatte sie den Besuch in der Klinik in den offiziellen Reiseplan eingetragen.
Doch was nun?
Die ganze Tour musste jetzt wohl neu geplant werden. Und Saint Mary und die kleine Cindy würden dann wahrscheinlich nicht mehr auf der Agenda stehen.
Veronica lächelte angespannt. Sie würde dafür sorgen, dass das nicht geschah.
Seufzend zog sie sich die Schuhe aus.
Mit einem Prinzen fertig zu werden kann einen ganz schön fertigmachen, dachte sie und erlaubte sich ein reumütiges Lächeln. Nach dem versuchten Anschlag war ihr Adrenalinpegel volle sechs Stunden lang kein bisschen gesunken. Danach hatte sie sich mit heißem, starkem schwarzen Kaffee wach gehalten.
Und jetzt brauchte sie eine Dusche und zwei Stunden Schlaf.
Sie zog ihr Nachthemd und den Bademantel aus dem Koffer und warf sie aufs Bett. Bisher hatte sie keine Zeit gehabt, auszupacken. Veronica taumelte fast ins Badezimmer. Nachdem sie die Tür geschlossen und das Wasser aufgedreht hatte, schälte sie sich aus ihrem Kostüm und der cremefarbenen Bluse, die sie darunter getragen hatte. Als sie sich die Strumpfhose auszog, riss sie ein Loch hinein. Die zweite an diesem Tag. Die, die sie am Flughafen getragen hatte, war komplett hinüber.
Veronica beeilte sich. Jede Minute, die sie unter der Dusche zubrachte, fehlte ihr an Schlaf. Lieutenant Joseph P. Catalanotto konnte nach Mitternacht jeden Moment ankommen.
Trotzdem hielt es sie nicht davon ab, Mary Chapin Carpenters letzten Hit zu schmettern, während sie versuchte, die Verspannungen in den Schultern zu lösen. Seit ihrer Kindheit sang sie unter der Dusche. Bis heute waren das die Augenblicke, in denen sie richtig abschalten und alles loslassen konnte.
Immer noch singend drehte sie das Wasser ab und trocknete sich ab.
Ihr Bademantel hing an der Tür. Veronica griff danach – und erstarrte mitten in der Bewegung.
Sie hatte den Mantel doch auf dem Bett liegen lassen. Sie hatte ihn nicht an diesen Haken gehängt.
„Nein … Sie haben recht“, ertönte eine tiefe männliche Stimme von der anderen Seite der Tür. „Sie sind nicht allein.“
3. Kapitel
Veronica blieb fast das Herz stehen. Sie schlug die Tür zu und schloss ab.
„Sie haben mich offenbar nicht bemerkt“, fuhr der Mann fort, während Veronica blitzartig in ihren weißen Frotteemantel schlüpfte. „Und ich nahm an, dass Sie nicht nur mit einem Handtuch oder noch weniger bekleidet aus dem Bad kommen wollen. Jedenfalls nicht vor Publikum. Darum habe ich Ihren Bademantel an die Tür gehängt.“
Veronica verknotete den Gürtel fest und zog den Stoff über der Brust zusammen. Nachdem sie tief eingeatmet hatte, stieß sie die Luft langsam wieder aus. Das beruhigte sie und half ihr, mit fester Stimme zu sprechen. „Wer sind Sie?“
„Wer sind Sie denn?“, entgegnete der Mann. Er hatte eine volle, kräftige Stimme und einen mehr als leichten New Yorker Akzent. „Man hat mich hierhergebracht und gesagt, dass ich warten soll. Das habe ich getan. Ich bin von einer Küste zur anderen geschickt worden wie eine Eilzustellung der Regierung. Nur dass mir niemand sagen konnte, warum ich hier bin. Vor der Landung auf der Andrews Air Force Base wusste ich nicht einmal, dass ich nach Columbia fliege. Und wenn ich schon mal dabei bin: Ich bin müde, habe Hunger, und meine Hose ist leider immer noch nicht getrocknet, was meine Laune nicht wirklich hebt. Ich würde tatsächlich einiges dafür tun, um unter die Dusche zu kommen, aus der Sie gerade raus sind. Und übrigens freut es mich, Sie kennenzulernen.“
„Lieutenant Catalanotto?“, fragte Veronica.
„Bingo“, erwiderte er.
„Wie lautet Ihr Vorname?“, fragte sie müde.
„Joe. Joseph.“
„Zweiter Vorname?“
„Paulo.“
Veronica öffnete die Badezimmertür.
Was ihr als Erstes auffiel, war seine Größe. Er war wirklich groß – etwa fünf Zentimeter größer als Prinz Tedric und mit den deutlich sichtbaren Muskeln bestimmt über zehn Kilo schwerer. Er trug das schwarze Haar viel kürzer als Tedric. Und er hatte mindestens einen Zweitagebart.
Er ähnelte dem Prinzen doch nicht so stark, wie sie geglaubt hatte, als sie das Foto gesehen hatte. Nachdenklich musterte Veronica sein Gesicht. Bei näherer Betrachtung war seine Nase ein bisschen anders – er hatte sie sich gebrochen, wahrscheinlich mehr als einmal. Und, falls das überhaupt möglich war, wirkten die Wangenknochen des Lieutenants noch exotischer als Tedrics. Sein Kinn war etwas kantiger, störrischer als das des Prinzen. Und seine Augen … Während er ihrem neugierigen Blick standhielt, senkte er die Lider kaum merklich über seine glänzenden braunen Augen. Es schien fast, als wollte er seine intimsten Geheimnisse vor ihr verbergen.
Aber diese Unterschiede, auch der Größenunterschied, waren im Grunde bedeutungslos. Jemand, der Prinz Tedric nicht besonders gut kannte, würde nichts davon bemerken. Und den zahlreichen Botschaftern und Diplomaten, die Tedric treffen sollte, würde erst recht nichts auffallen.
„Nach dem Schild auf Ihrem Koffer müssen Sie Veronica St. John sein, richtig?“, fragte er und sprach ihren Nachnamen typisch amerikanisch in zwei Wörtern aus, Saint und John.
„Sinjin“, erwiderte sie zerstreut. „Es heißt nicht Saint John, sondern ‚Sinjin‘.“
Er betrachtete sie, musterte sie jetzt genau, wie sie es vorhin mit ihm getan hatte. Unter seinem intensiven Blick fühlte Veronica sich nackt. Was sie unter ihrem Bademantel natürlich auch war.
Mit seiner Kleidung gewann er jedenfalls keinen Blumentopf. Es sah aus, als hätte jemand die Ärmel seines T-Shirts mit roher Gewalt abgerissen. Seine Hose war abgeschnitten und in verwaschene Shorts verwandelt worden. An den Füßen trug er dreckige Segelschuhe, keine Socken. Er sah aus, als hätte er seit Tagen nicht geduscht – und genauso roch er auch.
„Lieber Gott“, sagte Veronica laut, während sie alle Details bemerkte, die ihr beim ersten Blick entgangen waren. Er trug keinen Gürtel. Stattdessen hatte er ein ziemlich dickes Stück Seil durch die Schlaufen seiner Hose gezogen und vorne zusammengeknotet. Er hatte ein Tattoo in Form eines Ankers auf dem linken Oberarm. Seine Hände waren von Arbeiten mit Schmierfett dunkel, die Fingernägel kurz geschnitten und spröde – weit entfernt von Prinz Tedrics sorgfältig manikürten Händen. Gott! Wenn sie diesem Mann als Erstes die Grundlagen der Körperhygiene beibringen musste, konnte sie ihn nie und nimmer innerhalb von drei Tagen in einen Prinzen verwandeln.
„Was ist?“, fragte er und betrachtete sie finster. Seine Worte klangen abwehrend. Seine Augen wirkten plötzlich dunkler. „Erfülle ich Ihre Erwartungen nicht?“
Sie konnte es nicht abstreiten. Sie hatte mit einem Lieutenant in einer steifen, perfekt sitzenden gestärkten Uniform gerechnet – mit jemandem, der weniger roch wie ein Seehund. Wortlos schüttelte Veronica den Kopf.
Schweigend ließ Joe den Blick über sie gleiten. Ihre Augen wirkten so groß. Im Kontrast zu ihrer porzellanhellen Haut wirkte das Blau ihrer Iris unglaublich. Ihre Haarfarbe konnte er nicht richtig bestimmen, weil ihr Haar nass war. Feucht und dunkel klebte es ihr an den Wangen und am Nacken.
Rötlich, vermutete er, vielleicht sogar rotblond, eventuell lockig. Wenn es allerdings doch einen Gott gab und er gerecht war, musste sie langweiliges glattes Haar haben, vielleicht schlammfarben. Joe erschien es nicht fair, dass diese Frau gesund war, einen einflussreichen Job hatte, kultiviertes Benehmen, wunderschöne blaue Augen und auch noch rote Locken.
Ungeschminkt sah sie beunruhigend jung aus. Ihre Gesichtszüge wirkten zart, fast zerbrechlich. Sie war nicht besonders hübsch, zumindest nicht im herkömmlichen Sinn. Aber sie hatte hohe Wangenknochen, die ihre kristallblauen Augen betonten. Und ihr Mund war sinnlich, die Nase klein und vornehm.
Nein, sie war nicht hübsch. Doch sie war auf eine Weise unglaublich attraktiv, die er sich nicht einmal im Ansatz erklären konnte.
Der Mantel war ihr zu groß. Er hob ihre schlanke Figur hervor, unterstrich ihre schmale Hüfte und die zierlichen Knöchel.
Sie wirkte wie ein Kind, das aus Spaß die Kleider der Mutter anprobierte.
Komisch. Joe war angesichts der strengen Kostüme in ihrem Koffer davon ausgegangen, dass diese Veronica St. John älter war. Oder „Sinjin“, wie sie ihm in ihrem entfernt britischen, stark nach vornehmer Gesellschaft klingenden Akzent erklärt hatte. Er hatte mit jemandem Mitte vierzig gerechnet, mindestens, wenn nicht älter. Diese Frau konnte jedoch kaum älter als fünfundzwanzig sein. Verflixt, wie sie jetzt vor ihm stand, gerade aus der Dusche gekommen, und das Wasser tropfte noch aus ihren Haaren – da wirkte sie kaum älter als sechzehn.
„Sie entsprechen auch nicht meiner Vorstellung“, sagte Joe, während er sich auf die Bettkante setzte. „Damit haben wir wohl einen Gleichstand.“
Er wusste, dass es sie nervös machte, wie er so dasaß. Der Gedanke, dass Joe die Bettdecke dreckig machte und dort der Fischgeruch hängen blieb, beunruhigte sie. Blue hatte an diesem Morgen den stinkenden Eimer mit den Ködern umgestoßen … Verdammt noch mal, Joe machte sich doch genau die gleichen Sorgen wie sie!
Und genau das regte ihn auf. Irgendwie war diese Frau dafür verantwortlich, dass er seinen Landgang hatte abbrechen müssen. Ihr schrieb er zu, dass er quer durch das Land gehetzt worden war, ohne wenigstens duschen und andere Kleidung anziehen zu können. Zum Teufel! Sie steckte doch dahinter, dass er jetzt in diesen abgerissenen Klamotten in einem Fünfsternehotel hockte und sich absolut fehl am Platz vorkam.
Er fühlte sich unwohl. Die kaum verhohlene Verachtung im Blick dieses reichen Mädchens gefiel ihm absolut nicht. Er wurde ungern daran erinnert, dass er nicht in ihre Welt passte, in der hauptsächlich Geld, Macht und Klasse wichtig waren.
Nicht, dass er in diese Welt gehören wollte. Er zog sein Leben vor – die Welt der Navy SEALs, wo ein Mann nicht nach seiner Brieftasche, seiner Ausbildung oder seinem Kleidungsstil beurteilt wurde. In seiner Welt zählte, was ein Mann tat, sein Durchhaltevermögen, seine Loyalität und seine Ausdauer. Hier wurde jemand, der es zu den SEALs geschafft hatte, mit Ehre und Respekt behandelt – egal wie er aussah. Oder wie er roch.
Er lehnte sich auf dem großen, extravaganten Doppelbett zurück und stützte sich auf die Ellenbogen. „Vielleicht verraten Sie mir, was ich hier eigentlich mache, Honey.“ Er sah, wie sie bei dem Kosewort zusammenzuckte. „Ich bin ziemlich neugierig.“
Die Augen des reichen Mädchens wirkten plötzlich größer. Sie vergaß tatsächlich ein paar Augenblicke lang, ihn geringschätzig zu mustern. „Wollen Sie mir etwa erzählen, dass Ihnen niemand irgend-etwas gesagt hat?“
Joe setzte sich auf. „Genau das meine ich.“
Sie schüttelte den Kopf. Inzwischen wurde ihr Haar trocken, und es war definitiv lockig. „Aber das kann nicht sein.“
„Isses aber, Sweetheart“, erwiderte er. Sie zuckte wieder zusammen. Einmal wegen seiner Ausdrucksweise, außerdem weil er sie „Sweetheart“ nannte. „Ich bin ohne mein Team in D. C. Und ich habe nicht die geringste Ahnung, warum.“
Abrupt drehte Veronica sich um und ging ins Wohnzimmer, das zu dieser Suite gehörte. Gemächlich stand Joe auf und folgte ihr. An den Türrahmen gelehnt beobachtete er, wie sie ihre Aktentasche durchsuchte.
„Jemand sollte Sie abholen …“ Sie zog einen gelben Zettel aus ihrem Notizbuch und steckte ihn hinter die letzte Seite. „Admiral Forrest?“ Beinah hoffnungsvoll sah sie ihn an.
Der Navy Lieutenant zuckte nur die Schultern, ohne sie aus den Augen zu lassen. Gott, er sah wirklich gut aus! Trotz der Schmutzschichten und seiner finsteren Miene war er wie Prinz Tedric fast unmöglich attraktiv. Und dieser Mann strotzte geradezu vor Kraft und Männlichkeit; davon konnte Tedric nur träumen. Er war extrem attraktiv unter all dem Schmutz … für jemanden, der sich zu ungezähmten und ungehobelten Männern hingezogen fühlte.
Was auf Veronica natürlich nicht zutraf. Bad Boys hatten ihr Herz noch nie höher schlagen lassen. Und wenn sie jetzt kurzatmig wurde, lag es bestimmt an dem Schreck, den er ihr vorhin eingejagt hatte.
Nein, sie gehörte nicht zu den Frauen, die bei einem stahlharten Bizeps und breiten Schultern, einem aufregenden Dreitagebart, einem dunklen Teint, einem gefährlich erotischen Lächeln oder einem Schlafzimmerblick aus unglaublich braunen Augen schwach wurden. Nein. Mit Sicherheit nicht.
Und wenn sie einen zweiten Blick auf ihn warf, dann nur, um sicherzugehen, dass Lieutenant Joseph P. Catalanotto keinesfalls mit einem europäischen Prinzen auf Staatsbesuch verwechselt werden würde.
Jedenfalls nicht heute.
Und morgen auch nicht. Aber für Wila, für ihre eigene Karriere und für die kleine Cindy im Saint Mary würde Veronica sich darum bemühen, Joe in zwei Tagen in einen Prinzen zu verwandeln.
Eins nach dem anderen. Und als Erstes musste sie sich wieder anziehen. Das hatte oberste Priorität. Besonders, weil Lieutenant Catalanotto sich keine Mühe gab, das anerkennende Funkeln in seinen Augen zu verbergen, während er sie betrachtete.
„Warum nehmen Sie sich nicht einen Drink?“, fragte Veronica. Joes Blick schweifte durch den Raum bis zu der kunstvollen Bar, die auf der anderen Seite des Zimmers stand. „Geben Sie mir eine Minute, um mich anzuziehen“, fügte sie hinzu. „Dann versuche ich, Ihnen zu erklären, warum Sie hier sind.“
Er nickte.
Veronica war sich allzu bewusst, dass er sie fortwährend beobachtete, bis sie die Schlafzimmertür hinter sich schloss.
Sein Akzent war scheußlich. Jede Betonung schrie einem förmlich entgegen: Ich komme aus New York City. Aber gut. Mit ein bisschen Einfallsreichtum, gutem Timing und mit einem brauchbaren Plan musste Joe kein einziges Wort sagen.
Was allerdings seine Körperhaltung betraf … Das stand auf einem ganz anderen Blatt. Tedric hielt sich immer sehr gerade – ganz anders als Lieutenant Catalanotto. Und sein Gang! Er schlenderte lässig durch die Gegend – genau so, wie es sich für einen Prinzen absolut nicht ziemte. Wie um alles in der Welt sollte sie diesem Mann beibringen, gerade zu stehen und zu sitzen? Ganz davon abgesehen, dass er lernen musste, auf diese ganz eigene steife, prinzengleiche Art zu gehen, die Tedric perfektioniert hatte.
Veronica nahm saubere Unterwäsche und eine weitere Strumpfhose aus ihrem Koffer; das war an diesem Tag die dritte. Das dunkelblaue Kostüm lag ganz oben, deshalb zog Veronica es an. Anschließend schob sie ihre müden Füße in die dazu passenden Pumps. Ein Hauch Make-up, schnell durch die inzwischen fast trockenen Haare bürsten …
Er könnte Handschuhe tragen, überlegte sie, und ihre Gedanken rasten. Wenn sich das Motoröl nicht löste, könnte er Handschuhe tragen, um es zu verbergen. Niemand würde daran Anstoß nehmen.
Bei Joes Haaren lagen die Dinge völlig anders. Er hatte kurz geschnittenes Haar, während Tedric die Haare bis zu den Schultern gingen.