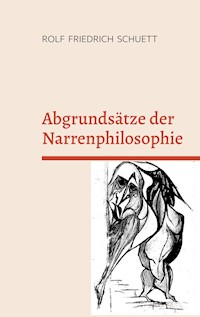Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Der Band bietet eine undemokratische Auswahl von pop-feindlich elitären, kopflastig patriarchalischen, monotheistisch frommen, unnachhaltig umweltfremden, ebenso intransparenten wie inkompetenten und prekär proletarischen Reflexionsmodellen aus dem desengagierten Elfenbeinturm : intellektualistisch verstiegen und einseitig, reaktionär und redundant, dilettantisch und ebenso präpotent wie langweilig. I N H A L T Reisereportage eines Studierstubenhockers Natur und Kultur : Hirten, Bauern oder Bürger? Ist Kunst ein psychoanalysierbarer Wahnsinn, oder veraltet Freud? Bilderverbot : Ist das Wort Gottes auch eine Literaturkritik? Sind "Groschenromane" die Multikultur der "Bildungsferne"? Spirit(ual)ismus heute : Esoterische Mystik oder postmoderne Mystifikation? Belehrt der alte Pauker den Neuen Lehrer? Adorno revisited : Sind alle Sachurteile nur Verurteilungen? Laiendenker : Der kleine Unterschied und das große Ganze Primärlaster und (b)anale Sekundärtugenden 2020 Geistiges Europa : Selbstlose Sachlichkeit zweifelhafter Subjekte? Fragmente zum Witz an der Sache : Warum schrieb Hegel keine "Phänomenologie der Zeitgeistesblitze"? Beerben Metasprachen die alteuropäische Metaphysik? Unverbesserliche Natur : Naturalismus als Intellektualkultur? Hochkultur oder multi-kulturlose Popkultur : E oder U? Geistreiche Franzosen, spirituelle Deutsche oder Spirituosen? Bauchgefühle ohne Kopfzerbrechen, Revolution ohne Religion? Technische Absichten und Aussichten ohne biblische Einsichten?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 335
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Reisebericht eines Daheimgebliebenen
Natur und Kultur
Kulturtechniken Lesen und Schreiben
Soll der Autor wie ein Verrückter schreiben?
Der oberste Kunstkritiker
Kunst auf der Couch
Trivialliteratur
Autor B. bekennt ohne Erkenntnis
Geistreisen : Esoterik und Mystik heute
Vorsicht Satire
: „Wer was kann, tut es; wer nichts kann, lehrt es“
Ungerechte Richtigkeit : Adorno recalled
Es lebe der kleine Unterschied!
Ausdruck und Sekundärtugenden
Objektiver Geist des subjektiven Faktors
Objekte und Projekte, Sein und Geldschein
Witz an der Sache : Weisheit nach dem Wissen
Von Metaphysik zu Metasprache
Über die Natur (hinaus)
Hochkultur oder Popkultur : E oder U?
Spirituell oder geistreich?
Schädel : Dach- oder Sachschaden?
meinen Eltern
in Dankbarkeit
Reisebericht eines Daheimgebliebenen
Diese Reisereportage ist so etwas wie die Quintessenz all meiner Weltreisen, Urlaubsreisen und Lebensreisen, d.h. es war immer ganz gleich, wohin ich reiste. Sind Daheimgebliebene nur Zurückgebliebene?
"Wer eine Reise tut, kann danach ein Gespräch auch nur um eine Viertelstunde ausdehnen." (Paul Valéry)
Wer sich wie die meisten Menschen aufs Reisen gar nicht versteht, gibt das auch deshalb nicht gern zu, weil er es meist gar nicht weiß. Wer weiß schon, wovor er beim Wegfahren eigentlich wegläuft und wohin? Ich Reiseneurotiker gestehe, weder die Feriennoch Lebensreisetechnik zu beherrschen. Ich reise trotzdem nicht. Andere reisen gerade deshalb.
Das Leben ist mir Reise durch die Zeiten genug, um nicht auch noch Reise durch Orte sein zu müssen. In welche Himmelsrichtungen ich auch aufgebrochen bin, welchen wärmsten Empfehlungen enthusiasmierter Vorkoster ich auch willig gefolgt bin, entweder hat es mich überanstrengt oder angeödet oder beides zugleich und wütend oder krank gemacht. Meine Reiseabenteuer waren stets eine Kette von Versuchen, sie zu vermeiden, also von Mißgeschicken, die mich wünschen ließen, nie losgefahren zu sein, und geloben ließen, nie wieder zu einer Reise aufzubrechen, bis eine nächste Urlaubshymne von Bekannten, die gar nicht einsahen, weshalb niemand ihre eigene Enttäuschung teilen sollte, mir das peinliche Gefühl aufdrängte, mein Leben vertan zu haben, wenn ich nicht wenigstens einmal und nie wieder in Lugano oder auf den Seychellen gewesen wäre.
Entweder war es mir zu kalt gewesen oder zu heiß, zu eng oder zu weitläufig, zu öde oder zu laut, zu teuer oder zu primitiv oder alles zugleich. Ich erhebe nichts als den Anspruch, für anspruchslos zu gelten, tue meinen Ratgebern aber nicht den Gefallen, daß es mir irgendwo irgendwann genügend gut gefallen hätte, um die Unternehmung je zu wiederholen, nicht einmal daheim in der Spitzwegmansarde, die nun wirklich eine ständige Aufforderung zur Abreise ist, ein einziger architektonischer Tritt in den Hintern.
Auf Reisen erlebe ich Schlimmes oder gar nichts; eins ist schlimmer als das andere. Es kann nichts passieren, ohne mich zu ärgern, und wenn ich entspanne, bin ich auch schon abgespannt und langweile mich, ohne mich umgekehrt gut zu unterhalten, sobald es etwas (an)spannender wird. Wir Reisenden zerstreuen uns in alle Windrichtungen, um uns nicht konzentrieren zu müssen, auf uns selbst oder etwas Selbstloses. Wir lenken uns selber ab, wenn der Alltag uns gerade nicht ablenkt, und nichts lenkt uns ab von der professionellen Zerstreutheit, dem bekannten Markenzeichen aller Zeitgenossen außer den Professoren.
Jede Urlaubsreise ist ein einziger hübscher Vorwand, ungestraft wieder einmal ungehemmt reden zu dürfen über nichts als Wetter und Wohnen, Kleidung und Körperpflege, Speis und Trunksucht. Die einen erobern die Welt mit Visionen und Divisionen, die anderen mit Visa und Devisen. Aber wirklich Ferien zu machen verstehen nur die, welche die Ferien gar nicht nötig haben, weil sie nicht im Arbeitsprozeß gegen den Menschen stehen und keine Arbeitsweltbürger sind. Wir anderen Teilzeitfaulenzer sind nur Reisedilettanten.
Die dialektische Reglementalität verlangt, daß Urlaub mich von der Arbeitswelt weit genug zu entfernen hat, um meine Arbeitskraft zu regenerieren, aber nicht soweit, daß er mich für sie nicht wieder fit macht, sondern der industriellen Entfremdung heillos entfremdet. Nach der Reise bin ich dann wieder mehr zu Hause als vor der Reise.
Ich reise nicht, weil mich die schöne Fremde anzieht, sondern damit das heimische Kaff mir danach für ein weiteres Jahr wieder erträglich genug ist, daß ich nicht Amok laufe oder aus dem Fenster springe oder auf Nimmerwiedersehen verschwinde. Kurz: Ich verreise, um nicht auswandern zu müssen in Länder, die selbst von Auswanderern fast entvölkert sind, meinen täglichen Mitpassanten auf unserer Straße daheim. Das Schönste an einer Reise ist die Heimreise, wie das Schönste an ihrer Geburt für die meisten Menschen nicht der Akt der Befreiung ist, sondern die lebenslängliche Sehnsucht zurück in den Mutterleib.
Will ich dort mein Geld verdienen, wo ich zu Hause bin, oder fühle ich mich dort zu Hause, wo ich mein Geld verdiene? Wenigstens einmal im Jahr dürfen wir unser Geld an einem anderen Ort ausgeben als dem, wo wir es verdienen. Nicht nur müssen wir zurück, wir dürfen zurück an die Ruderbank der Galeere, die uns vor uns selber schützt. Ortsveränderung ist Weltveränderungsersatz oder umgekehrt. Wir ändern unseren Standort in der Welt, um sie selbst nicht ändern zu müssen, oder bearbeiten wir umgekehrt die Erde, um sie nicht er-fahren zu müssen? Wir wollen Luftstatt Weltveränderung und fragen uns, ob wir lieber oder wenigstens Luftveränderung wollen.
Die Reiselustigsten wenigstens sind die Weltveränderungsfeinde, ob nun als Verwicklungshelfer in Nicaragua oder als Konterrevolutionstouristen in den USA. Ob jung oder alt, wir scheinen nie herauszukommen aus den Tapetenwechseljahren. Wir wollen mal andere Gesichter sehen, wenigstens andere Masken. Die Welt zu sehen, erspart eine Weltanschauung und umgekehrt. Angeblich bereichert Reisen auch und gerade jene, für die alles »Enrichissez-vous!« sinnlos ist.
Vor der Unfähigkeit, mit mir selbst etwas anzufangen, flüchte ich das ganze Jahr hindurch ins Berufs- und Familienleben, während des Urlaubs aber in fremde Länder. Es muß nicht immer Onanie sein, aber die Fähigkeit, im stillen Kämmerlein wirklich etwas anzufangen mit sich und seiner Zeit, wird gewöhnlich beschimpft als sogenannte Flucht in die Innerlichkeit, ein ganz besonders asoziales Laster. Vor dieser sagenumwoben verruchten Innerlichkeit flüchtet jeder nur allzu gern in einen Zerstreuungsbetrieb, der sich dann Engagement nennt und viel mehr dem nützt, der sich einsetzt, als dem, für den er sich einsetzt.
Die Flucht vor der (Flucht in die) Innerlichkeit ist Flucht in die verschämteste Äußerlichkeit. Der Zweifel in die Zurechnungsfähigkeit von Reiseabenteurern und anderen Urlaubsnomaden braucht, um berechtigt zu sein, nicht gleich soweit gehen wie der amerikanische Transzendentalist Ralph Waldo Emerson aus dem letzten Jahrhundert : »Der Weise bleibt zu Hause. Das Reisen ist des Narren Paradies«. Emerson war Narr genug, die große weite Welt als eine einzige Irrenanstalt zu sehen, und darin wollen wir Narren ihm nicht folgen.
Ob wir nun verreisen oder daheimbleiben, ist nicht deshalb eins, weil wir unser liebes Ich ja doch überall hin mitnehmen (statt die Welt in unsere gute Stube zu lassen), sondern unsere viel liebere Ich- und Selbstlosigkeit. Urlaub ist als »Ferien vom Ich« die Suche nach dem wahren Selbst, heißt es.
In Wirklichkeit besteht unser »wahres Selbst« natürlich immer nur in der (bestürzenden oder im Gegenteil erleichternden) Entdeckung, wahrhaft gar nicht selbst da zu sein und auch nie existiert zu haben. Aber wem verhilft eine aben-teure Reise schon zu einem so bereichernden Mangelerlebnis? Ich will stets umso mehr freie Zeit für mich allein, je weniger ich damit anfangen kann. Weiß ich sie zu nutzen, ist das Leben schon fast zu lang. Ich gewinne durch die Technik Zeit, um sie mir vertreiben zu müssen, und spare lebenslang Zeit, um sie totschlagen zu können.
Schopenhauer hatte Recht : Langeweile läßt sich am wirksamsten vertreiben durch Not und Elend. Und das Ende der Not ist für die meisten von uns auch schon der Startschuß für Alleinherrschaft der Langeweile.
Urlaub, Ferien und Freizeit heißt, diesen Kreislauf, dem wir ausgeliefert sind, für kurze Zeit scheinbar in eigene Regie nehmen, also sich freiwillig kleinen Mißgeschicken aussetzen, um in den Genuß zu kommen, sie noch gerade beheben zu können und vor uns selbst zu verbergen, daß wir es selbst sind, die die Hürdenstrecke vor uns aufgebaut haben. To get into trouble and out again is keeping up with the Jones. Viele suchen im Urlaub die freie Natur auf einem Campingplatz an der Sonne. Wer campt, sucht aber das Überleben weniger im Freien als im Überwachungsstaat, der dort en miniature eingeübt wird. Da geht es von Maloch zu Masoch. Auch Drogen-Trips sind Urlaubsreisen, die niemanden recht von der Stelle bringen.
An den Sehenswürdigkeiten des Reiseziels stört uns die steife Würde, und Museen, Galerien, Pinakotheken und Theater besuchen wir zu Hause ja auch nicht. Was ich bei mir zu Hause nicht einmal suche, finde ich, wie ich gebaut bin, erst recht nicht anderswo in der Welt. Der Reisende sieht Land und Leute wie der Zuschauer sein TV-Programm : Das Fernsehen zeigt Bilder wie aus dem Leben gegriffen, seit das Leben der Fernseher wie auf dem Bildschirm abläuft. Unsere Berufsarbeit ist so hart, weil sie so sinnlos ist, und dem Urlaub ist anzusehen, wovon er befreien soll. Was der Geschlechtsverkehr in der Woche, das soll der Reise- und Fremdenverkehr im Jahr sein, also wochenlang Sonntag ohne Woche davor und danach, ein ewiger Feiertag ohne Feierabend.
Am langweiligsten geraten stets die Maßnahmen gegen die Langweiler. Der wahre Tourist ist natürlich einer, der nicht als Tourist reist. Früher reiste man als »Kultourist«, aber das hatte so wenig mit Kultur zu tun wie der heutige »Natourismus« mit Natur. Wir zerstören die letzten unberührten Biotope durch die Versuche, sie zu finden, zu erleben und zu schützen.
Früher verhielt der Begüterte sich zum Minderbemittelten wie der Individual- zum Massentourismus, aber heute ähnelt der Abenteuerurlaub eher einem Überlebenstraining für den rauen Alltag daheim als einem Urlaub von ihm. So häufig von Kulturkritikern nun die bessere gegen die blödere Art des Reisens verteidigt wird, so selten gegen jedes Reisen das schlichte Daheimbleiben. Daheimgebliebene sind Zurückgebliebene. Der Traum des Berufstätigen ist der Traumurlaub, und der Traum des Urlaubers ist die Traumreise. Reisen ins Blaue sind die Utopie der Seßhaften, das Stubenhockgrab ist die Utopie der Wurzellosen, das ist meine Hypothese, und »Hypo-These« heißt Unter-stellung.
Flüchte ich ins Reisefieber vor dem Arbeitsleben oder vor meiner Unfähigkeit, im stillen Kämmerlein endlich das zu tun, wovor ich mich durch den Alltag erfolgreich schütze? Das Reise tut im Urlaub ziemlich genau das, was der Berufsalltag während der übrigen Zeit leistet: mich zu bewahren vor dem Offenbarungseid des N-ich-ts. Die Gebildeten sind den Rechtsaußen verfallen, weil sie zu wenig und nicht etwa zu viel unpolitische Innerlichkeit hatten. Sie hatten diese desengagierte Innerlichkeit nur propagiert und gar nicht kultiviert.
Reisen lenkt so schön ab von Arbeits- und Innenwelt zugleich; die Betriebsruhe fordert den Ruhebetrieb. Satiren haben sattsam verhöhnt, wie wir die Wohnung unserer Gewohnheiten überall mit hinnehmen durch die Art, wie wir sie hinter uns lassen wollen, und wie wir das Unerwartete verpassen durch die Formen, es herbeizulocken. Die Fremde schafft das traute Heim so naturgetreu nach, wie Balkonien daheim die ganze Welt werden kann. Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen : Am beliebtesten sind Gegenden, wo von Einheimischen nur dienstbare Geister zu sehen sind. Unser Verdienst besteht darin, sie an uns verdienen zu lassen, indem wir uns von ihnen bedienen lassen, und wenn das nicht klappt, sind wir bedient.
Beliebte Gegenden im Ausland, gleichsam schöne Auslandschaften, sind meist nur Flucht vor häßlichen Ausländern. Wir brauchen sie, ob wir nun bei ihnen zu Gast sind oder sie bei uns: Sie bedienen mich mal bei uns, mal bei ihnen selbst. Statt das Land kennenzulernen, lernen wir bestenfalls Landsleute kennen, die es auch nicht kennenlernen wollen. Reisebekanntschaften verbindet nur Unvermögen und Unwillen, am Reiseort und bei seinen Bewohnern auch wirklich "anzukommen".
Man reist anders, als man reist.
Die meisten Reiseberichte und Urlaubsdiavorträge von Bekannten verleiden einem das Reisen wie auch die Bekannten. Der größte Luxus ist ein Verzicht auf solche Luxusreisen. Reisende erleben selten etwas, das der Fernseher daheim nicht besser und billiger bietet. Die Unfähigkeit zu reisen wird nur noch überboten von der Unfähigkeit, zu Hause zu bleiben, ohne zu verzweifeln.
»Reisen« hat denselben Wortstamm wie das englische »rise«, aufsteigen, erregt und bewegt sein. Es hängt zusammen mit (ent)rinnen, rennen, rasen und reiten. Der Spott sieht im Reiseverkehr einen GV mit der schönen Fremde(n) und in der wahren Liebe einen Fremdenverkehr. Wer auf Reisen geht, geht fremd mit der Welt, und Fremdeln gilt als Heilmittel gegen Entfremdung seit alters her.
Ich verreise erst wieder, wenn ich zu Hause eines Tages wirklich etwas versäumen sollte. Ich b-leibe und k-lebe. Wer niemals aus seiner Vaterstadt herauskommt, ist deshalb noch kein Immanuel Kant, ich weiß wohl, aber der junge Kierkegaard machte zusammen mit seinem Vater die schönsten Weltreisen als Spaziergänge − in der Kopenhagener Wohnung.
Ich bin ein ewiger »Heimreisender« : Ich reise nicht heim, ich reise nur daheim und verlasse meine Gewohnheiten eher als meine Wohnung. Der chinesische Ur-Taoist Dschuang-Tsi sah jedermanns Seligkeit darin, im Geburtsort zu leben und zu sterben. Mein Brotberuf ist eine Kette täglicher Dienstreisen zur Arbeitsstelle, und auf dem Weg zwischen Wohnzimmer-Sessel und Büro-Drehstuhl fällt mir mehr auf als anderen zwischen Zürich und Acapulco, nämlich nichts − nichts als Leute, die in Zürich und Acapulco gewesen sein wollen und das nie so ganz glaubhaft machen können, wenigstens nicht vor einem, der auf seinen passionierten Nichtreisen wenigstens erlebt, daß seine Mitmenschen auf ihren Weltreisen so rein gar nichts erleben, was der Rede und des Reisens wert wäre. Also erlebe ich daheim doch etwas mehr als andere unterwegs.
Meine Reisen sind Lektüre von Reiseberichten aus der Feder von Leuten, die Geist genug haben, von der Stelle zu kommen, und das Reisegeld nicht besser nach Afrika spenden, statt damit dorthin zu fahren. Ich fühle mich im Leben zu sehr auf bloß flüchtiger Durchreise, um es lohnend zu finden, auch nur meine Koffer auszupacken und mich in der Welt allzu häuslich niederzulassen und breitzumachen. Erfahrungen machen Schriftsteller nicht auf Fahrten, sondern am Schreibtisch, schrieb Max Frisch, der zu viel reiste.
»Wohin denn ich?« fragte Hölderlin. »Wohin anders als anderswohin?« antwortete Baudelaire. »All unser Unglück kommt daher, daß wir nicht ruhig in unserem Zimmer sitzen können«, wußte Pascal schon früher. Luft, Luft schreien wir und haben vergessen, den Gashahn selber aufgedreht zu haben, doch die Luft, die wir Erstickenden brauchen, sind wir füreinander.
Das moderne Lustprinzip ist weitgehend ein Reiselustprinzip, aber moderne Reiseberichte lassen philosophische Zweifel verstehen an der Existenz einer realen Außenwelt überhaupt. Wer kommt noch heraus aus sich und seinen Simulationen und Videologien? Eine Traumreise ist ein Traum von einer Reise. Eine Reise ist nicht überflüssig, weil uns sowieso überall die US-amerikanische Welteinheitskultur empfängt, sondern weil wir ohnehin glauben, daß uns überall auf die gleiche Weise übel (mitgespielt) wird, daß uns Sehen und Hören vergeht und wir nur erfahren, was wir gar nicht erfahren wollten.
»Bildungsurlaub« ist keine Fortsetzung der alten Bildungsreise mit anderen Fortbewegungsmitteln, sondern ein Berufsfortbildungskursus, der anstrengender zu geraten pflegt als der durchschnittliche Berufsalltag. »Bildungsreisen« hießen früher nicht so, weil Ungebildete das nicht bleiben wollten, sondern weil nur Gebildete sie machten, als es noch welche gab.
Der Sinn des Reisens ist die Entdeckung, daß die Welt noch nicht halb so viel hält, wie sie nicht nur auf Reiseprospekten verspricht. Enttäuschend ist weniger die Welt als immer nur die erbitterte Weigerung der Reisenden zuzugeben, daß sie enttäuscht sind und daß sie weniger getäuscht wurden, als sich selber getäuscht haben, weil sie sonst gezwungen wären, mit der Verbesserung ihrer Welt endlich anzufangen, statt die unverbesserte Welt immerfort unverbesserlich zu bereisen. Wir sollen uns in der Welt frei bewegen, aber nur als Belohnung dafür, daß wir sie endlich in Bewegung setzen. Und sie bewegt sich doch, die Erde? Irgendwo hatte die Kirche Recht gegen Galilei.
Niemand ist sterbenslangweiliger als Leute, die sich an ihren Reisezielen nicht zu Tode zu langweilen vermögen. Aber natürlich sind die Menschen verschieden, bevor sie verscheiden. Die einen fühlen sich nur unterwegs zu Hause; andere gewinnen ihre Beweglichkeit erst innerhalb der eigenen vier Wände, gegen die sie unentwegt laufen, oder gar im eigenen Bett. Der Wunsch, etwas Besonderes zu erleben, wird mehr als aufgewogen von der Angst, etwas zu erleben, das man gar nicht erleben möchte, und die Angst vor solchem Wunsch wird zum Wunsch nach dieser Angst und führt auch nicht weiter. Urlaub ist Beschädigung durch die Entschädigung für das ganze Lebensjahr.
Ich hänge im Urlaub daheim herum und mir vor die Tür ein Schild : Verreist. Die schönste Reise ist die nicht angetretene, weil der schlimmste Urlaub der ist, der schön zu sein hat. Wer von den Lesern immer noch glaubt, der Autor dieses Pasquills könne nur ein depressiver Freund pfahlbürgerlichster Reisemuffel sein, hat noch nicht begriffen, daß es nur besser und billiger ist, gleich zu Hause zu bleiben, statt bloß frisch als das blinde und taubstumme Rindviech zurückzukommen, das losgefahren ist. Wenn einer eine Reise tut, dem kann man was erzählen!
1794 beschrieb ein Xavier de Maistre seine "Reise um mein Zimmer", eine herrliche Parodie auf alle Reiseberichte. Der Autor ist mein Mann.
Gute Reise!
Natur und Kultur
Aus Anlaß seiner Kritik an Herders »Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit« (1785) entwickelte Kant 1786 in einem kleinen Aufsatz seine eigenen Ideen über den »Mutmaßlichen Anfang der Menschengeschichte«. Kant wagte die »Lustreise« einer philosophischen Exegese der ersten Kapitel der biblischen Schriften : »Der Leser wird die Blätter jener Urkunde (1. Mose Kap. II bis VI) aufschlagen, und Schritt vor Schritt nachsehen, ob der Weg, den Philosophie nach Begriffen nimmt, mit dem, welchen die Geschichte angibt, zusammentreffe.« (»Von den Träumen der Vernunft. Kleine Schriften zur Kunst, Philosophie, Geschichte und Politik«, Wiesbaden 1979, S. 268).
Friedrich Schiller war von dieser transzendentalphilosophischen Auslegung der religiösen Transzendenz so inspiriert, daß er 1790 in ähnlichem Geist »Etwas über die erste Menschengesellschaft« schrieb. Kant sagt über den ersten Menschen : »Der Instinkt, diese Stimme Gottes, der alle Tiere gehorchen, mußte den Neuling anfänglich allein leiten. Dieser erlaubte ihm einige Dinge zur Nahrung, andere verbot er ihm (Gen 111,2,3).« (269) »So lange der unerfahrene Mensch diesem Rufe der Natur gehorchte, so befand er sich gut dabei. Allein die Vernunft fing bald an sich zu regen ...« (270) »Er entdeckte in sich ein Vermögen, sich selbst eine Lebensweise auszuwählen, und nicht gleich den Tieren an eine einzige gebunden zu sein ... Er stand gleichsam am Rande eines Abgrundes« (271).
Macht euch die Erde, aber nicht einander untertan: Bewanderte bringen die Erde wandernd unter ihre Füße. Kant sieht in der Genesis auch die des Sittengesetzes: »Und so war der Mensch in eine Gleichheit mit allen vernünftigen Wesen, von welchem Range sie auch sein mögen, getreten (Genesis 111,22 ): nämlich, in Ansehung des Anspruchs, selbst Zweck zu sein, von jedem anderen auch als ein solcher geschätzt, und von keinem bloß als Mittel zu anderen Zwecken gebraucht zu werden ... Dieser Schritt ist daher zugleich mit Entlassung desselben aus dem Mutterschoße der Natur verbunden«. (273 f.) »Indessen ist dieser Gang, der für die Gattung ein Fortschritt vom Schlechteren zum Besseren ist, nicht eben das nämliche für das Individuum ... Die Geschichte der Natur fängt also vom Guten an, denn sie ist ein Werk Gottes; die Geschichte der Freiheit vom Bösen, denn sie ist Menschenwerk. Für das Individuum, welches im Gebrauche seiner Freiheit bloß auf sich selbst sieht, war, bei einer solchen Veränderung, Verlust; für die Natur, die ihren Zweck mit dem Menschen auf die Gattung richtet, war sie Gewinn.« (275)
Was für menschliche Gattung und Gesellschaft ein unbestreitbarer Fortschritt sei, bilde für jeden einzelnen Menschen eine fortschreitende Verfallsgeschichte. Auch Kant entscheidet sich für den Fortschritt durch »ungesellige Geselligkeit« und gegen die glückliche Freiheit des autonomen Individuums, also gegen »Gemächlichkeit und Frieden« und für »Arbeit und Zwietracht«. Er gibt zu, daß dieser Prozeß der Vergesellschaftung eine Denaturierung mit sich bringe, hofft aber mit Rousseau auf einen utopischen Zustand, »bis vollkommene Kultur wieder Natur wird« (278), und wenn nicht für das jeweilige Individuum, so doch für die menschliche Gattung.
Niemand teilt heute mehr diese Hoffnung, und doch will niemand mehr ins Naturparadies Gottes zurück. Die »Dialektik der Aufklärung« hat inzwischen die höllischen Züge dieser bürgerlichen Utopie aufgedeckt, ohne deshalb zum goldenen Zeitalter im Reich Gottes zurückzuwollen. Nach Kant ist es die göttliche Stimme der Natur selber, die dazu aufrufe, sich von der bloß rohen Natur zu befreien mit Hilfe der Vernunft, aber er muß zugeben, daß die Vernunft Menschenwerk ist und im Naturinstinkt die Stimme Gottes ihr widerspricht. Kant verfolgt diese Dialektik zwischen dem Wort Gottes und der Stimme der menschlichen Vernunft im welthistorischen Kampf zwischen Nomaden und Seßhaften. Er gibt zu, daß die Nomaden der menschlichen Obrigkeit so opponieren wie seine Seßhaften dem Willen Gottes: »So lange nun noch die nomadischen Hirtenvölker, welche allein Gott für ihren Herrn erkennen, die Städtebewohner und Ackerleute, welche einen Menschen (Obrigkeit) zum Herrn haben (Genesis VI,4), umschwärmten, und als abgesagte Feinde alles Landeigentums diese anfeindeten und von diesen wieder angefeindet wurden, war zwar kontinuierlicher Krieg zwischen beiden, wenigstens unaufhörliche Kriegsgefahr, und beiderseitige Völker konnten daher im Inneren wenigstens des unschätzbaren Guts der Freiheit froh werden − (denn Kriegsgefahr ist auch jetzt noch das einzige, was den Despotismus mäßigt; ...« (280 f.)
In einer Fußnote erläutert Kant das freie >patriarchalische< Verhältnis des Wüstenscheichs zu den nomadischen Beduinen : »Dieser ist keineswegs Herr über sie, und kann nach seinem Kopfe keine Gewalt an ihnen ausüben. Denn in einem Hirtenvolke, da niemand liegendes Eigentum hat, welches er zurücklassen mußte, kann jede Familie, der es da mißfällt, sich sehr leicht vom Stamme absondern, um einen ändern zu verstärken.« (281) Eheliche Vereinigungen zwischen Göttersöhnen und Menschentöchtern in Genesis VI deutet Kant als verbotene Vermischungen der von Gott begünstigten Nomaden, die auf seiner Erde umherziehen nach den Sternen, und der von Gott abgefallenen Seßhaften, die den nach der Paradiesvertreibung verfluchten Acker bestellen. Der Friede zwischen besitzlos müßigem Nomadentum und seßhaftem »Ackern« beende ihren freien Wettkampf und führe zu einer sintflutwürdig himmelschreienden Tyrannei der Laster. Wer keinen Feind mehr zu fürchten habe, entarte auf unserer niedrigen Kulturstufe und gehe naturgesetzmäßig an sich selbst zu Grunde. »Auf der Stufe der Kultur also, worauf das menschliche Geschlecht noch steht, ist der Krieg ein unentbehrliches Mittel, diese noch weiter zu bringen ... und die heilige Urkunde hat ganz recht, die Zusammenschmelzung der Völker in eine Gesellschaft, und ihre völlige Befreiung von äußerer Gefahr, da ihre Kultur kaum angefangen hat, als eine Hemmung aller ferneren Kultur und eine Versenkung in unheilbare Verderbnis vorzustellen.« (283)
Heute, über zwei Jahrhunderte nach der Niederschrift dieser Sätze, sind die Nomaden und die Seßhaften zwar nicht verschmolzen, aber die Seßhaften haben sich an allen Fronten zu Tode gesiegt, und die Nomaden sind praktisch vom Erdboden verschwunden, da sie in unwirtliche Reservate abgedrängt sind, die jeder Bürger freiwillig verschmäht. Kant erinnert daran, daß die Nomaden in ihren Einzelfamilien verstreut und die Seßhaften in ihren Kollektiven zusammengeschlossen leben, die den Beginn von Kunst und Kultur, »Geselligkeit und bürgerlicher Sicherheit« bedeuten.
Wenn Kant auch den »Übergang aus der Rohigkeit eines bloß tierischen Geschöpfes in die Menschheit, aus dem Gängelwagen des Instinkts zur Leitung der Vernunft, mit einem Wort: aus der Vormundschaft der Natur in den Stand der Freiheit« (275) favorisiert, so muß er doch einräumen, daß Gott dem Menschen die paradiesische Naturunmittelbarkeit erhalten will und daß die rationalisierte Welt Babels ursprünglich Teufelswerk sei. Obwohl Kant gegen Herder an der strikten Herrschaft von Vernunft über Natur als Freiheit vom Instinkt festhält, hilft er sich mit der dialektischen Konstruktion, daß die göttliche Stimme der Natur gerade dazu aufrufe, sich von dieser »rohen« Natur so lange zu befreien, bis die Kultur uns zur zweiten Natur geworden sei − auch und gerade gegen Gottes ausdrückliche Warnung.
»Das Hirtenleben ist nicht allein gemächlich, sondern gibt auch, weil es in einem weit und breit unbewohnten Boden an Futter nicht mangeln kann, den sichersten Unterhalt ... So konnte der Ackersmann den Hirten als vom Himmel mehr begünstigt zu beneiden scheinen (1. Mose 3,4).« Der Nomade Abel war von Gott nicht favorisiert, weil er von Bauer Kain erschlagen wurde, sondern wurde umgekehrt von Kain erschlagen, weil er als Nomade Gottes Günstling war. Noch bei Jesus klingt etwas davon nach: »Sehet die Vögel im Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln nicht in die Scheunen; und der himmlische Vater nähret sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie?« (Mt 6,26)
Kulturtechniken Lesen und Schreiben
Muß der Autor die Wünsche des Publikums erfüllen oder ihm gegen Bezahlung etwas bieten, was sie aus eigener Kraft nicht schaffen würden und was über sie hinausgeht? Es gibt Autoren, die auf unsere Träume bereitwillig eingehen, auf unsere Sehnsucht nach Luftveränderung, und andere Autoren, die ihren Kunden etwas zumuten, ihnen Fallen stellen, sie irreführen. Aber auch Kafka und Joyce, Musil und Proust schmeicheln ihrem Publikum, das es nur etwas anspruchsvoller liebt, um sich ernst genommen zu fühlen. Wenn es wirklich schwierig wird, nehmen auch deren Leser schnell Reißaus. Musil hat in seinen »Mann ohne Eigenschaften« ganze philosophische Essays einmontiert. So literarisch aufgelockert überfordert uns die strenge Philosophie nicht, so etwas verlangen wir von uns, um uns wichtig nehmen zu können. Aber für authentische Philosophie ist das zu feuilletonistisch verspielt und für Literatur umgekehrt eben nicht in genügend konkrete Szene gesetzt oder in Handlung aufgelöst.
Ist Kafka eine Ausnahme? Er lockt seine Konsumenten aufs Glatteis, bietet seine ganze Kunst auf, sie in das Zauberreich ihrer eigenen gewohnten Alltäglichkeit zu locken, wo ihnen wohlig warm und heimelig ist, und dann, mit einem Ruck, wenn wir eingelullt nichts Böses mehr ahnen und uns so richtig eingelesen haben und übermütig werden, zack, dieser elegante Genickschlag mit leichter Hand aus heiterem Himmel, die Falltür ins Bodenlose, mitten im schönsten heitergiftigen Arbeitsfrieden. Und plötzlich werden da die einfachsten Alltagsverrichtungen ganz unmöglich, der Tausendfüßler denkt an jedes seiner einzelnen Beinchen und weiß nicht mehr, wie er jemals einen einzigen Schritt hat tun können. Achill holt die alte Schildkröte nie mehr ein, weil er gar nicht mehr weiß, wie er sie jemals überholen konnte mit unendlich vielen, unendlich kleinen Tippelschritten.
Aber der moderne Leser ist inzwischen gewitzt, wenigstens der, welcher sich auf diese Art von Antibüchern überhaupt je einläßt. Er erwartet dieses kleine Falschspiel schon, ist auf doppelte Böden und hundert Erzählebenen abonniert und enttäuscht, wenn alles so platt und plan bleibt, wie es eingangs vorgeführt wurde. Es gibt Autoren, die auch das schon wieder mitberücksichtigen, indem sie die trainierte Erwartung des Lesers, in seinen Erwartungen regelmäßig kunstvoll düpiert zu werden, einfach leerlaufen lassen. Aber auch dieses Spielchen läßt sich nur ein- oder zweimal spielen, dann fällt der Käufer auf diese Masche nicht mehr herein. Wie beim Kriminalroman soll es immer dasselbe Schema sein, doch immer verblüffend neuartig ausgefüllt. Die Kunst ist eine imaginäre Gefühlsgymnastik und kein Lügendetektor.
Das Unerwartete wird erwartet, Ruhe in der Unruhe und Bewegung in der Stille sucht der fortschrittliche, fortgeschrittene Leser. Der andere ist ein volkspädagogisches Problem : Wie bringe ich unverbildete oder auch nur unbefangene Leser dazu, vom Autor etwas mehr zu verlangen, als was sie schon kennen? Wie bringe ich den Leser zum Überdruß an sich selbst und mache ihm nicht nur Appetit auf das Vergnügen, immer wieder bestätigt zu bekommen, daß er so, wie er ist, schon ganz in Ordnung ist. Aber auch der anspruchsvolle Kunde hat seine konformistischen kleinen Clichés, von anderen Autoren geweckte Wünsche zum Beispiel. Man muß kein Trivialliterat sein, um diesen sauber kalkulierten Überraschungserwartungen und Choctrainingswünschen mit nur wenig Vergnügen zu entsprechen. Heutige Literatur von Rang sagt uns oft sehr unangenehme Dinge, aber das ist ja das Angenehme für Leute, die von ihrem Narzißmus verlangen, die Augen vor den Nachtseiten des Lebens nicht zu verschließen und auch noch die Beckett-Rennstrecke als Trimmdichpfad zu meistern. Sie genießen ihre Fähigkeit und Bereitschaft, gefährlichen Widrigkeiten nicht auszuweichen, sich dem Negativen zu stellen, sie verbuchen diese Kühnheit des Autors auf ihr persönliches Konto, ein Sport und Initiationsritus, Männlichkeitsprobe und feministischer Härtetest zugleich.
Kunst, das ist Mord und Totschlag, Kugelregen, Elend und Alpträume, Atomkrieg und ein wohliges Gruseln vom Lehnstuhl aus. Man liefert sich dem reinigenden Stahlbad aus und vergißt für einige Stunden, daß es sich nur um ein Buch handelt, das sich in jeder Sekunde zuklappen läßt und deshalb nicht zugeklappt werden muß. Man wende nicht ein, daß es auch unter die Haut gehende Werke gibt, die nachdenklich machen. Der Leser denkt nie nach. Der Roman läßt ihm die Freiheit, bei der Lektüre seinen trivialen Assoziationen nachzuhängen, alles sofort auf sich zu beziehen, um seine gewohnte Scheiße überall sofort wiederzufinden. Alles im Roman erinnert ihn an das, was er schon sich selbst zurechtgedumpft hat.
Aber es gibt doch Momente unzweifelhafter Betroffenheit, wird man sagen. Der Leser ist nie betroffen genug. Sein Abwehrsystem ist stärker. Er ist es, der darüber bestimmt, wie getroffen er sein möchte. Wenn man einem begeisterten oder erschütterten Leser, der sein Buch gerade geschlossen hat, unter die Schädeldecke schauen könnte! Die Gründe, aus denen große Werke berühmt sind, haben selten etwas zu tun mit ihren wirklichen Schönheiten. Ein Roman von Proust wird nicht geschätzt und bewundert auf Grund seiner eigentümlichen literarischen Qualitäten, sondern wegen seiner Ähnlichkeiten mit einem Buch von Mario Simmel, das in einem Roman vom Range Prousts eben auch enthalten ist. Romane, sofern sie nicht ganz einfach langweilig, d.h. nur schlecht geschrieben sind, müssen ihrem Leser ja schmeicheln, seinem durchschnittlichen Fassungsvermögen weit entgegenkommen, bis er ihnen erlaubt, ein einschleichend winziges Stückchen gegen den Strich gehen zu dürfen, ungestraft, d.h. ohne daß der kopfscheue Leser das Buch gähnend in die Ecke wirft. Für diesen erbärmlichen Ertrag ist der Aufwand des Autors aber eigentlich zu hoch, und diese homöopathische Medizindosis, die er in einen Zuckerwatteberg verpacken muß, wird am Ende nur als raffinierte Delikatesse goutiert, um überhaupt Gnade zu finden beim Publikum, das sich beweist, wieviel Arsenik und Heroin es inzwischen unbeschadet ungerührt überlebt. Der Künstler ist ein Mensch, der seinem Abnehmer unzählige Komplimente machen muß, um eine vorsichtig kandierte All-Gemeinheit sagen zu dürfen, die dann noch als bloße Sottise abgewehrt wird, als habe man umgekehrt eine pure Bosheit als nackte Wahrheit verpackt.
Alles muß eingeschmuggelt und untergemischt werden, Zumutungen, die am Ende dann doch wieder keine sein dürfen, sondern nur verzuckerte Bittermandeln, die das liebe Frustrationstoleranzvermögen testen durften. Der Roman ist unökonomisch : Berge kreißen und gebären Mäuse. Er tut dem Leser zu viel Gutes an, erweist ihm zu viel Ehre, verzärtelt ihn, kriecht ihm in den Hintern. Welcher gute Autor hat Vergnügen daran, seinen Lesern auch nur das Vergnügen zu bereiten, sich ihrer stolzen Bewältigungskräfte zu freuen? Der Leser hat dieses Entgegenkommen nicht verdient und weiß es auch nicht zu würdigen, ihm ist nicht zu trauen. Ginge es ihm wirklich, wie er beteuert, um Form und Stimmigkeit der Werke, würde er keine Mühe scheuen, in ihren Geist und in ihre Eigenlogik einzudringen.
Dann aber wäre auch Philosophie nicht verschrien als Kinderschreck und Brechmittel und Folterwerkzeug. Was wir von philosophischen Werken sagen, gilt genauso von unseren ausgesuchten Lieblingsromanen und Lieblingssachbüchern: Viel Lärm um nichts. Aber der attackierte Leser wird antworten : Der Autor lenkt nur von seiner Impotenz ab, mich zufriedenzustellen, indem er meine Impotenz behauptet, mich vom Autor befriedigen zu lassen. Sind das aber nicht nur Retourkutschen und Ressentiments?
Es gilt eben nicht, König Kunde nach dem Maul zu schreiben, auch nicht dem gutwillig Beflissenen, opferbereit Lernwilligen oder dem, der sich grundlos dafür hält. Beide sind Faulpelze, die es sich nur leicht machen wollen und für ihr bißchen Geld und nachlässige Aufmerksamkeit sogleich auf Händen getragen werden möchten, umworben, verwöhnt, bestochen von raschen, allzu bequemen Genüssen ohne Reue. Sartre hat Unrecht, Lesen ist kein gelenktes Schaffen, es ist gelenktes Abschlaffen. Die Klientel ist geschafft und sucht Erhebung zum Nulltarif. Noch Becketts Ungenießbarkeit wird nur genossen. Ham und Clov, Lucky und Pozzo, Wladimir und Estragon, Molloy und Malone sind sogar mir noch unterlegen, der dem Autor unterlegen ist.
Aber was das endlose Ende aller Gespräche zeigen will, wirkt, gemessen an dem heute üblichen Comic-Sprechblasenkatarrh und Stummeldeutsch-Autismus, schon wieder voller Esprit und Eleganz. Die Klassiker der Moderne sind von der Realität überholt. Kafka? Die maßgerechte Selbstrechtfertigung aller Pechvögel, Tölpel und Vorstadtneurotiker, die aus der Not, den Anschluß an bürgerliche Minimalstandards nicht zu schaffen, ihre geistige Tugend machen müssen. Wer es nicht hinbekommt, darf sich mit Kafka als prestigeträchtiges Opfer irgendwelcher Schlösser und Prozesse fühlen, wenn es weder zum Schloßbeamten noch zum Prozeßgewinn reicht.
Die sinnlichen Künste werden aus Angst vor philosophischer „Verkopfung“ geliebt und umgekehrt diese banalen Weltanschauungstraktätchen und Kompreß-Essays aus Angst vor der Komplexität der großen Kunstwerke. Literatur soll belehren, Philosophie aber launig unterhalten, es ist eine einzige matschige Konfusion. Viel zu viele Autoren rennen viel zu vielen Lesern nach und bequemen sich ihren Voraussetzungen an, indem sie sich pädagogisch auf die begrenzte Fassungskraft ihrer Zöglinge berufen. Der Autor soll sich aber verständlich machen und nicht herablassen. Er soll das Buch so hoch hängen, daß der Leser sich ordentlich recken und strecken muß, aber nicht so hoch, daß kein Springer es je erreichen kann. Ein Schriftsteller sollte für das Schreiben und nicht vom Schreiben leben.
Durch die Industrie wird alter kultureller Bedarf gedeckt und immer neuer materieller Bedarf geweckt. Umgekehrt würde mehr als ein Schuh daraus : Materielle Bedürfnisse wollen gedeckt und neue intellektuelle Bedürfnisse geweckt werden.
Soll der Autor wie ein Verrückter schreiben?
Das »Theater der Grausamkeit« von Antonin Artaud wird oft betrachtet als Reklame für ein utopisches Potential kreativer Schizophrenie. Die Absage an Kommunikation und Konsens gipfelt in der These von Bernd Mattheus : »Der Schriftsteller wird wie ein Schizophrener sein, oder er wird nicht sein.« Unter dem romantisch irrationalen Markenzeichen »Genie und Wahnsinn« wird hier, um die Sprache noch diesseits aller weltabbildenden Funktion sich selbst feiern zu lassen, einmal mehr der Wilde, das Kind, das Tier und der (von der Schulpsychiatrie verratene) Irre gegen das noch in seiner kritisch-analytischen Intention stinknormale bürgerliche Sensorium ausgespielt.
Taugt schizophrene Schreibe wirklich als eines der letzten Schlupflöcher aus dem tristen Sinngefängnis reibungslos funktionierender Überangepaßter, also derer, die sich für das Gegenteil davon halten? Kann eine amtlich attestierte Schizophrenie auch in kritischen Dekompositionsphasen neue Erkenntnisquellen exklusiver Natur erschließen? Alle Sucher nach dem Krypto-Sinn im Irrsinn werden einwenden, Artaud sei geisteskrank geschrieben gewesen, aber nicht jeder Irre sei eben ein Artaud. Das geht sogar so weit, daß es unter den "Schizos" statistisch weniger Genies gibt als unter vergleichsweise Geistesgesunden. Aus der Tretmühle in die Klapsmühle und zurück, das wollen wir nicht, gut, wir wollen den, der durchdreht, weil er durch den Wolf gedreht wurde, den Kliniken entreißen und den Wahn selbst sprechen lassen, statt die Psychiater monopolistisch über ihn reden zu lassen. Befreit aus der Zwangsjacke und Gummizelle sedierender Psychopharmaka und E-Schocks und kasernierender Kategorien wird der, welcher verrückt ist, weil andere ihn für verrückt erklären, unter bloß ärztlicher Reisebegleitung ins gelobte Land neuer Unsäglichkeiten aufbrechen, auch und gerade zum Nutzen einer "nichtaffirmativen Kunst"?
Solche Schwarmgeistereien tauchen immer wieder auf, wenn die aktivistische Hoffnung auf Revolutionierung sozialer Systembedingungen wieder einmal dem Katzenjammer einer >Tendenzwende< geopfert werden mußte. Der berüchtigte Rückzug auf politisch resignierende Innerlichkeit landet am anderen Spektralende der Subjektivität, dort, wo sie schon wieder in ihre objektiven Bestandteile zerfällt, dort, wo das angebliche Rumpf-Ich in seiner Weltlosigkeit depersonalisiert ist, dort, wo die ausgeblendete Konformrealität als blindes factum brutum hinterrücks wieder ins selbstverkrochene Subjekt einbricht und es zum hilflosen Schauplatz undistanzierbarer Selbstaufhebungstendenzen macht. Der Wahnsinnige ist ein Mensch mit gescheiterter Ich-Integration, er ist nicht mehr Herr im Haus der eigenen Haut, er stößt im Herzen seiner eigensten Autonomie auf ichfremde Impulse und verwechselt sich mit dem, was er nicht ist. Er erleidet seine ureigene Spontaneität, als wäre sie die Aggression einer fremden Person gegen ihn.
Kurz, er lebt nach dem paradox logisch gelogenen Schluß : Ich bin anders als ihr, ihr seid anders als ich, also bin ich anders als ich selbst und vielleicht doch wie ihr gerade darin, daß ich nicht wie ihr bin. Ist Autismus die radikalste Ab-Sage an die Gemeinschaft der normalen Menschen und an die Diktatur des Durchschnitts? Leute wie Mattheus begrüßen es, daß autistisch Regredierende die Fähigkeit verlieren, ihre idiosynkratische Privatsprache, mit der sie sich wittgensteinig einschließen, um niemals durchschaut zu werden und um sich einzumauern in illusionäre Unverwundbarkeit, in umgangssprachlich Allgemeinverständliches rückzuübersetzen. Er münzt diesen Verlust in einen Hauptgewinn um, wie der Schizophrene aus der Not, Kommunikation aus Angst vor imaginären Verfolgern abbrechen zu müssen, die Tugend autarker Autonomie und narzißtischer Gigantomanie macht.
Der quasi-schizophrene Autor stellt die Realitätsflucht nicht mehr in den Dienst erhöhten Realitätsbewußtseins, aber die Unkommunizierbarkeit von Sinn und Verstand ist kein Kriterium übersinnlicher Inspiration. Der antike Sophist Gorgias philosophierte : Es gibt keine Wahrheit. Wenn es eine gäbe, wäre sie unerkennbar, und wenn sie erkennbar wäre, wäre sie nicht mitteilbar. Das ist genau die Binsenweisheit aus dem Lande Schizophrenien. Die hermetischen Glossolalien und Neologismen des einsamen Wahns sind motivierte Mystifikationen trivialer Mythen, nur von Spezialisten dechiffrierbar, aber die Präsentation ist ebenso barock bombastisch, wie der maskierte Gehalt dürftig ist, so starr, stereotyp und armselig wie die Formelkonstanten des archaischen Unbewußten überhaupt, immergleiche Strategien, ein punktuell innerstes Heiligtum durch Fassadenlabyrinthe artifizieller Pseudo-Identitäten vor dem Mordanschlag der bösen Außenwelt nachhaltig zu schützen.
Diese Kranken schöpfen aus dem Vollen ihrer Leere und haben keine gloriosen Visionen jenseits konformistischer Erfahrungsschablonen, sondern verbergen vor sich und vor uns, daß sie ein ebenso banales wie formelles Selbst vor einer als Verwundbarkeit erlebten Verständlichkeit verstecken. Allerdings ist es leichter, höchst esoterische Kunstgebilde zu entschlüsseln, als in jahrelanger Kleinarbeit das aus der Allgemeinverständlichkeit exkommunizierte Bewußtseinsmaterial eines Schizos in seinem Sinn zu rekonstruieren. Auch die Rationalisierung der Abwehrhaltungen eines alten Neurotikers gegen die Aufhebung seiner Widerstände ist leichter zu durchschauen, als die geheime Bedeutung schizoider Maskeraden zu dekodieren, aber der klinischen Hermeneutik heute schon gut zugänglich.
Mattheus scheint sich zu begeistern gerade für das bis zum Absonderlichen Besondere der symbolistischen Spezialschöpfungen und der schizoiden Privatmythen, für die Paralogismen, Aporien und Paradoxien der Psychopatho-Logik. Ihn interessiert die kommunikationsabweisende „Unverständlichkeit“ der Attitüden dieser Kranken, aber es hilft nichts, diese >Schizosophien< sind heute durchschauter, als ihren gesunden Ideologen lieb sein dürfte, ihre Strategeme stehen kurz vor der Linnéschen Endklassifikation, es tut mir leid. Man lese Ronald Laings »Knoten« und ahnt das beschränkte Repertoire der Signifikanten hinter dem ornamentalen Reichtum der Larven, die erraten sein wollen. Der Schizo 2000 steht kurz vor der gleichen Entzauberung wie die Hysterikerin um 1900.
Man lese den »Locus solus« von Raymond Roussell. Die bestrickenden Rätselmaschinen im Park dieses Romans sind typische schizoide Konstrukte, Schutzpanzer gegen die rollenden Panzer der Umwelt für das mimosenhaft hinter lebenden Computern und kybernetischen Menschen verschwindende Subjekt. Schizophrenie ist der verzweifelte Selbstrestitutionsversuch des Ich, seine Weltuntergangsleere nach dem Zusammenbruch aller Objektbesetzungen auf niedrigerem Niveau wieder zu füllen mit den wiederbelebten idealisierten »guten Urobjekten« der frühesten Kindheit, wie die nährende Mutterbrust als ein Kruzifix gegen mütterliche Abwesenheit, die als Anwesenheit böser Verfolger erlebt wird.
Am Irren fasziniert den frustrierten Bürger die scheinbare Freiheit der Triebdurchbrüche, das Zerbrechen aller sekundären Überarbeitungen der frei flutenden seelischen Primärprozesse, die anarchischarchaische Aggressivität, die ungekonnte Wut. Am Verrückten wird die Lüge des selbstbeherrschten Ich flagrant, er unterläuft die zur hemmenden zweiten Natur gewordene Zensurkontrolle seiner unwillkürlichen Naturregungen. Aber er wird zum ohnmächtigen Spielball seiner seelischen Rohstoffe, statt sich ihnen angstfrei überlassen zu können, was ein mit Hilfe des Vaters aus der Mutterkind-Symbiose herausdifferenziertes Ich voraussetzt.
Wenn ein Geisteskranker in der Krise anfängt zu schreiben oder zu malen, baut er an symbolischen Dämmen zur Kanalisierung früher libidinöser und destruktiver Affektstürme, die ihn in die Dissoziation der unwirtlichen inneren Natur zurückzerren wollen, denen das Ich biographisch und gattungsgeschichtlich entronnen war. Diese schizoiden Elaborate sind manierierte Bannformel-Litaneien, und wer ihre Funktion im seelischen Haushalt versteht, ist nicht verwundert, daß sie bei aller seriellen Endlosigkeit geschlossenere Zwangssysteme sind als die Anstalten, in denen sie vor sich und vor uns geschützt werden.
Wenn Leute wie Artaud, Hölderlin und Roussel gleichwohl einiges Frappante heraufholen, dann nicht kraft, sondern trotz dieser Katastrophen und gegen ihre Krankheit. Das Rest-Ich muß noch stark genug sein, von seiner Selbstzerstörung profitieren zu können, und der „Schizothyme“ darf nicht schizophren werden, wenn er nicht noch zurückfallen will hinter die dürftigsten Standards der spießigen Talmi-Kultur, wenn er nicht am Lore-Roman seiner selbst schreiben soll. Auf die kreativ gerade noch günstige Konstellation zwischen Versagung und Gewährung in seiner Herkunftsfamilie hat der Einzelne aber keinen Einfluß. Das sei nur gesagt gegen die reizhungrig zivilisationsmüde Glorifizierung des Wahnsinns als eines vermeintlichen Bauchredners einer entfesselten Sprache an sich, die sich im psychotischen Menschen von allen Nutzungszusammenhängen emanzipiert, statt daß er sich in bedeutender Sprache selbst emanzipiert.