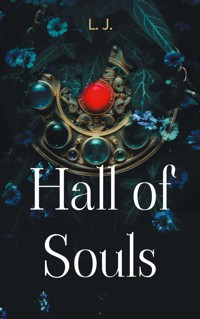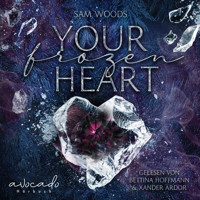3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Diebische Elfen, magische Katastrophen und ein gut gehütetes Geheimnis – Willkommen in Pärlonien!
Seit Jahrhunderten herrschen die unbarmherzigen Xarquen über Pärlonien und unterdrücken das ehemals königliche Volk der Pären. Als sich der Polizeipär Pongo den Befehlen der Obrigkeit widersetzt, muss er fliehen, um sein Leben zu retten. In der kriminellen Elfe Kiffi findet er eine unerwartete Verbündete. Zusammen unternehmen sie den Versuch, ein Holzkästchen, das eine mächtige magische Waffe enthalten soll, vor den Xarquen in Sicherheit zu bringen. Es ist der Beginn einer haarsträubenden Flucht quer durch Pärlonien, denn dem ungleichen Paar wird bald bewusst, dass den Herrschern jedes Mittel recht ist, um das Kästchen zurückzuerobern. Aber kann Pongo Kiffi wirklich vertrauen? Oder verfolgt sie insgeheim ihre ganz eigenen Pläne?
***
Dieses Buch erschien bereits unter dem Titel »Die Herrschaft der Xarquen«.
***
Qindie steht für qualitativ hochwertige Indie-Publikationen. Achten Sie also künftig auf das Qindie-Siegel! Für weitere Informationen, News und Veranstaltungen besuchen Sie unsere Website: qindie.de
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Titelblatt
IMPRESSUM
Qindie
Karte von Pärlonien
Widmung
ZUR TRANSKRIPTION AUS DEM PÄRLONISCHEN
PROLOG
1. Teil
SCHLAFLOSE TAGE
Vor 400 Jahren
KAMPF MIT DEM KOBOLD
RUF AUS DER TIEFE
Vor 400 Jahren
DER GROßE WURF
GETRENNTE WEGE
Vor 400 Jahren
VERZWEIFELTE MAßNAHMEN
RÖRK
HELD IM HANDUMDREHEN
Vor 400 Jahren
PERLEN UND SCHOKOLADE
EINE BARRIERE AUS LUFT
Vor 400 Jahren
VERBRECHER UNTER SICH
2. Teil
ALLEIN IN DER FREMDE
Vor 400 Jahren
EIN PEGACORNUM UND EINE BEICHTE
RONNY DIE ROMANTISCHE RATTE
UM EIN HAAR
Vor 400 Jahren
DER BERG DER KÄTZCHEN
UNTER DER STADT
Vor 400 Jahren
DIE KÄTZCHEN
HILFE VOM HIMMEL
VIELFINGER UND SILBERZUNGE
Vor 400 Jahren
UNTER DER KAPUZE
3. Teil
DER MÜHEN LOHN
Vor 400 Jahren
DAS ENDE EINES LEBENS
EIN UNERKANNTER ERFOLG
Vor 400 Jahren
ELFEN UND WÖLFE
DIE HAUPTPÄREN
Vor 400 Jahren
EIN FREUND IN DER NOT
Vor 400 Jahren
WISSEN UND NICHTWISSEN
Vor 400 Jahren
EIN STEINERNER GEISTESBLITZ
DER WUNSCH DES MAGIERS
Vor 400 Jahren
DIE ZWEITE CHANCE
EPILOG
Weiterlesen
LISA-MARIE REUTER
PONGO
UND DIE ELFENVERSCHWÖRUNG
Ein Roman aus dem Pärloniversum
IMPRESSUM
Unveränderte Neuauflage 2020
Zuerst erschienen 2013 unter dem Titel »Die Herrschaft der Xarquen«
Copyright © des Gesamtwerks
Lisa-Marie Reuter
Bergmeistergasse 4
97070 Würzburg
Alle Rechte vorbehalten.
Das Werk darf – auch teilweise – nur mit schriftlicher Genehmigung der Autorin wiedergegeben werden.
Covergestaltung und Illustration © Lisa-Marie Reuter
unter Verwendung von Bildmaterial von www.pixabay.com
www.lisamariereuter.de
www.paerlonien.com
Danke, dass du dieses E-Book auf legale Weise erworben hast. Du zeigst damit deine Wertschätzung für den Aufwand, den die Autorin und alle beteiligten Personen in das Projekt gesteckt haben, und trägst dazu bei, dass Schriftsteller und Schriftstellerinnen auch in Zukunft ihrer großen Leidenschaft nachgehen können. Ich wünsche dir viel Spaß mit deinem neuen E-Book!
Deine Lisa
Qindie steht für qualitativ hochwertige Indie-Publikationen. Achten Sie also künftig auf das Qindie-Siegel!
Für weitere Informationen, News und Veranstaltungen besuchen Sie unsere Website: www.qindie.de
Für Simone,
die Monster mag, aber nur die guten.
Für Dani,
verdientermaßen.
ZUR TRANSKRIPTION AUS DEM PÄRLONISCHEN
Literatur aus einem Vielvölkerstaat wie Pärlonien, wo neben einer offiziellen Allgemeinsprache noch eine große Anzahl weiterer Idiome mit jeweils eigenen Laut- und Schriftsystemen existieren, stellt für jeden Übersetzer eine besondere Herausforderung dar. Zwar hat sich im Wissenschaftsbetrieb mittlerweile eine internationale Umschrift etabliert, doch zielt diese in der Regel eher auf eine möglichst genaue Wiedergabe der einzelnen Phoneme als auf bessere Lesbarkeit ab. Der vorliegende Entwurf verzichtet deshalb auf hölzerne Diakritika, um dem Leser Wortungetüme wie Kwī’hefÿ, Rrørrkh oder Szzmôrżô zu ersparen. Die Namen wurden stattdessen behutsam an die hierzulande geläufige Schreibung angepasst. Lediglich wo es erforderlich schien, weisen gängige Kennzeichnungsmethoden auf korrekte Betonung oder die getrennte Aussprache von Vokalen hin. Ähnlichkeiten mit bekannten Wörtern sind reiner Zufall.
PROLOG
Schmorzo H. von Krotzenhausen war äußerst zufrieden mit sich selbst. Er rülpste, lehnte sich zurück und ließ seine tückischen gelben Augen über die vor ihm versammelte Tischgesellschaft wandern. Er hatte heute die bösartigsten, hinterhältigsten und hässlichsten Kobolde von ganz Pärlonien zu Gast. Seine Besucher ignorierten ihn nach Kräften, während sie sich schamlos über ihre schmutzigen Geschäfte unterhielten und sich mit ihren Schandtaten gegenseitig zu übertrumpfen versuchten. Ungeniert labten sie sich an seinen Weinvorräten und stopften löffelweise teuren Flusszahnkaviar in sich hinein. Schmorzo ließ sie gewähren. Noch.
Er hatte gewusst, dass es am Ende schnell gehen konnte, und diesen Abend daher von langer Hand geplant. Die Einladungsschreiben waren versandfertig gewesen, das Menü probegekocht und vorgekostet, die Dekoration hatte griffbereit im Keller gestanden. Nun war alles genau so, wie er es sich seit Jahren ausgemalt hatte.
Die Tafel bog sich unter dem Gewicht der erlesensten Speisen, die man in der kurzen Zeit hatte heranschaffen können. Distelspieße waren darunter, gedünstete Schlammmorcheln mit Maikäferkrossies und Tollkirschenbowle. Zur Belustigung der Kobolde flitzten bonbonbunte Zwuusel über die Tischplatte und versorgten die grunzende Meute mit den gewünschten Delikatessen. Wenn es den Gästen nicht schnell genug ging, hielten sie den Kellnern brennende Streichhölzer an die Schwanzfedern, was diese mit einem empörten Quieken quittierten. An der Längsseite der Halle trällerte ein Ensemble aus Nymphen und Sirenen die neuesten Schlager, während funkensprühende Irrlichter für Leuchteffekte sorgten. Und als ganz besonderer Leckerbissen schwebte über den Köpfen der Gesellschaft, grazil und anmutig, ein Schwarm Elfen, auf deren zarten Libellenflügeln sich der Schein der Kronleuchter in schimmernden Facetten brach.
Schmorzo war so zufrieden mit sich selbst, weil er wusste, dass er ab heute der bösartigste, hinterhältigste und hässlichste Kobold von allen sein würde. Was für ein Spaß!
Er räkelte sich genüsslich, furzte ein Mal, kratzte sich im Ohr und dachte glücklich an die vergangene Nacht zurück. Die Nacht, in der er die heiß ersehnte Nachricht erhalten hatte: Sein Werwolfkommando hatte das Holzkästchen endlich gefunden und war auf dem Weg zu seiner Burg. Vor Vorfreude hatte er kein Auge zu tun können. Nur noch Stunden trennten ihn jetzt davon, das mächtigste Wesen Pärloniens zu werden.
Es war ein ehrfürchtiger, fast magischer Moment gewesen, als er den unscheinbaren Gegenstand am Morgen zum ersten Mal in seinen Händen gehalten hatte. Das Kästchen gehörte nun ihm, ihm allein!
Ein halbes Dutzend eilig einbestellter Zauberkünstler war gerade damit beschäftigt, die kleine Truhe zu öffnen. Ärgerlicherweise war sie mit einem Fluch belegt, der einen unvorsichtigen Werwolf unterwegs in ein rosafarbenes Huhn verwandelt hatte. Geschah dem Köter recht, wenn er seine Pfoten nicht bei sich behalten konnte. »Wollte nur einen Blick hineinwerfen!« – wer’s glaubte …
Schmorzo kribbelte es vor Aufregung, wenn er an den mächtigen Gegenstand dachte, den das Kästchen beinhalten musste. Die Legende besagte, dass die Xarquen mit seiner Hilfe die Großen Kriege für sich entschieden hatten. Er war das Fundament ihrer Herrschaft und wer ihn fand, konnte sich seinerseits zum Herrscher über Pärlonien aufschwingen. Doch niemand hatte das berüchtigte Artefakt jemals zu Gesicht bekommen und nicht wenige bezweifelten, dass es überhaupt existierte. Schmorzo jedoch hatte den Geschichten immer geglaubt und er war für seine Hartnäckigkeit belohnt worden. Nun hatte er es tatsächlich gefunden, das Objekt, mit dem er die Zeitenwende herbeiführen würde.
Seine Gäste ahnten nichts von alledem, da die Mission unter strengster Geheimhaltung abgelaufen war. Nicht einmal die Werwölfe wussten, zu welch unvorstellbarer Macht sie ihm verholfen hatten. Schmorzo konnte ein diabolisches Kichern nicht unterdrücken. Macht! Bald würde es ihnen leidtun, wie sie ihn all die Jahre behandelt hatten. Immer wieder hatten sie ihn belächelt, verspottet, nicht für voll genommen. Pah! Damit war es nun vorbei. Ab heute würde er das Zepter schwingen. Es war jetzt beinahe soweit.
Ein Diener huschte in den Saal und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Schmorzos Grinsen wurde breiter. Ein paar Sekunden lang kostete er den historischen Moment im Stillen aus, dann erhob er sich von seinem Stuhl.
Seinen Gästen schien die Bewegung zunächst völlig zu entgehen, denn Schmorzo überragte die Tischplatte auch im Stehen nur geradeso. Nachdem er sich ein paar Mal laut geräuspert hatte, verstummten die Gespräche jedoch eines nach dem anderen und alle Köpfe wandten sich in seine Richtung. Missmutig und gelangweilt warteten die Anwesenden, dass er sie ihre privaten Unterhaltungen wieder aufnehmen lassen würde. Ansprachen gehörten zwar zu fast jedem Festbankett, unter Kobolden kam es allerdings bisweilen vor, dass zu ausschweifende Reden mit dem gewaltsamen Tod des Redners endeten.
Als die Zwuusel merkten, dass das allgemeine Interesse von ihnen abließ, ergriffen sie die Flucht. Der Chor verstummte und die Irrlichter zogen sich in finstere Ecken zurück. Der Elfenschwarm verdichtete sich über Schmorzos Haupt. Er schenkte der Dekoration jedoch keine Beachtung, sondern räusperte sich erneut und begann seine Rede.
»Liebe Freunde!«
Die Kobolde schienen peinlich darauf bedacht, nicht den Eindruck zu erwecken, dass sie sich angesprochen fühlten. Schmorzo fuhr unbeirrt fort.
»Oder sollte ich sagen: Liebes Volk!«
Spätestens jetzt hatte er die ungeteilte Aufmerksamkeit. Alles lief genau nach Plan.
»Euch wird heute die Ehre zuteil, den Anbruch einer neuen Ära mit mir zu feiern. Gebt gut acht!«
Ratlose Mienen. Schmorzo winkte einen greisen Zauberkünstler heran, der hinter einer Säule auf seinen Einsatz gewartet hatte. Bei sich trug er das Kästchen. Der Kobold betrachtete es fiebrig. Es war ein unscheinbares Objekt – flach und kaum größer als ein Buch. Runen und Zauberformeln, die es vor Verwitterung und anderen schädlichen Einflüssen schützten, überzogen das honigfarbene Holz. Die silbernen Beschläge glänzten im Kerzenschein. Der Magier legte das Kästchen behutsam vor Schmorzo auf den Tisch. Der große Augenblick war da.
»Öffne!«, befahl der Burgherr mit lauter Stimme.
Der Zauberer zog ein goldenes Stäbchen aus einer Tasche seines Gewandes und machte sich mit zittrigen Fingern an dem filigranen Schloss zu schaffen. Ein Klicken, als sich im Inneren ein Mechanismus löste, das gedämpfte Klimpern von Metall auf Metall. Schmorzo trommelte auf seine Stuhllehne. Ein Raunen ging durch die Menge.
PAMM.
Der Magier jaulte auf und hielt sich die Hand. Blut tropfte zu Boden.
PAMM. PAMM.
Weitere Schüsse. Einige Gäste gingen unter dem Tisch in Deckung.
Ehe Schmorzo orten konnte, woher die Geschosse kamen, sprangen ihn mehrere Elfen aus der Luft an und nagelten ihn mit schier unglaublicher Kraft am Boden fest. Andere schnappten sich das Kästchen, auf dessen Deckel einige Blutspritzer zischend verdampften.
Eine der Elfen schwebte heran und ließ sich auf Schmorzos Brust fallen. Er stierte sie perplex an. Sie war gerade halb so groß wie die grünen Weinflaschen, die seine festliche Tafel übersäten, doch das konnte nicht einmal auf den ersten Blick darüber hinwegtäuschen, dass sie brandgefährlich war. Sie trug eine schwarze Hose und ein kurzes, ärmelloses Oberteil in derselben Farbe. Ihre langen, blonden Haare waren ungekämmt und ihre nackten Füße verrieten, dass sie eine Bergelfe war. In ihren Händen hielt sie ein winziges silbernes Blasrohr. Aus dem vorderen Ende qualmte es noch. Sie grinste ihn fies an.
»Was wollt ihr?«, krächzte der Kobold entsetzt.
»Wir?« Sie lachte. »Siehst du das nicht? Wir wollen das Kästchen.«
»Wer bist du?«
Sie grinste erneut und er konnte spitze Zähnchen erkennen.
»Ich bin Kiffi«, sagte sie, »Kiffi die Killerelfe. Du hast bestimmt schon von mir gehört.« Die nächsten Worte richtete sie an den Rest des Schwarmes. »Wir sind hier fertig! Begebt euch in Formation!«
Die Elfen setzten sich in Bewegung, nahmen das Holzkästchen in die Mitte und folgten ihrer Anführerin durch ein offenes Fenster hinaus in die laue Abendluft. Einen Wimpernschlag später waren sie verschwunden. Und mit ihnen Schmorzos glorreiche Zukunft. Verflixt!
Der Hausherr rappelte sich auf und blickte in Dutzende versteinerte Gesichter. Er nahm sich vor, demjenigen, der die Elfen bestellt hatte, den Kopf abzubeißen.
1. TEIL
DIE DIEBIN
SCHLAFLOSE TAGE
Einheit 4 war wie immer als erste am Tatort. Ihre Aufgabe bestand darin, das Gebäude abzuriegeln und Zeugenaussagen aufzunehmen. Ein Knochenjob. Die aufgebrachten Kobolde veranstalteten einen Tumult, der selbst eine ausgewachsene Wirtshausschlägerei in den Schatten stellte. Obwohl sich die zehn Polizeipären nach Kräften bemühten, die Menge unter Kontrolle zu bringen, wuchs das Chaos mit jeder Minute.
Oberpär Graul stand in der Mitte des Festsaales und brüllte seinen Leuten Befehle hinterher, ohne sich der Hoffnung hinzugeben, dass ihm jemand zuhörte. Ihnen blieb nicht viel Zeit, um die Situation in den Griff zu bekommen. Die Jäger der Einheit 3 waren sicher bereits unterwegs. Und wenn die einen solchen Saustall hier vorfanden, konnte er sich wieder einmal auf einen langen Nachmittag im Befragungsraum einstellen, wo er sich eine gute Ausrede für dieses Debakel einfallen lassen durfte.
Graul schnaubte. Wie er diese aufgeplusterten Wichtigtuer aus den oberen Einheiten verabscheute! Sollten die sich doch selbst mit Dutzenden überdrehten Kobolden herumschlagen. Kobolde, ausgerechnet! Aber die Jäger würden erst erscheinen, wenn der Tatort ausreichend gesichert war. Die Polizeipären würden sie mit den nötigen Informationen versorgen, ihnen hinterhersehen, wenn sie zur Jagd aufbrachen, und sie bei ihrer Rückkehr pflichtbewusst bejubeln. Wie jedes Mal.
Graul schüttelte den Gedanken ab. Selbstmitleid brachte ihn jetzt nicht weiter. Er hatte eine Idee, doch dafür brauchte er Unterstützung. Pongo war genau der Richtige dafür; ein pflichtbewusster, besonnener Pär, der es verstand, selbstständig zu arbeiten. Er reckte den Hals, um nach ihm Ausschau zu halten. Ah, da war er ja!
*
Pongo sah sich schlaftrunken in der Halle um. Welche Ironie, dachte er, dass sie sich alle zur Unzeit aus dem Bett gequält hatten, nur um in diesem Albtraum zu landen. Der Notruf hatte seine Pärenstation kurz nach Mitternacht erreicht. Gleich danach war das Signal zum Ausrücken ertönt. Der straffe Fußmarsch zum Ort des Geschehens hatte jedoch nicht ausgereicht, um die Polizisten vollends aufzuwecken. Sie tapsten den Kobolden unkoordiniert und schwerfällig hinterher und rieben sich immer wieder verstohlen die Müdigkeit aus den Augen.
Um sich nützlich zu machen, gesellte sich Pongo zu einem Mitglied seiner Truppe, das gerade unbeholfen versuchte, einen Kobold an der Flucht zu hindern. Die Kreatur zappelte und wollte sich befreien, indem sie nach dem Gesicht des Pären kratzte. Dabei stieß sie ein schrilles Lachen aus. Pongo schüttelte sich unwillig. Kobolde waren die einzigen Geschöpfe, denen die Pären keinen Respekt einflößten. Obwohl sie ihre unzivilisierten Verwandten, die Bären, deutlich überragten und ein Maul voller langer, rasiermesserscharfer Zähne sowie vier klauenbewehrte Pranken besaßen, gelang es ihnen kaum, die potenziellen Zeugen des Verbrechens zum Reden zu bringen.
Pongo war jetzt nur noch ein paar Schritte von seiner Kollegin entfernt. Es war eine junge Pärin namens Amba. Sie war neu in der Truppe und dies war ihr erster richtiger Einsatz. Bereits am Morgen waren ihm ihre niedlichen Ohren aufgefallen und wie sie tapfer versucht hatte, sich die Unsicherheit der ersten Tage nicht anmerken zu lassen.
Sie hätte etwas Besseres verdient, dachte Pongo verdrossen.
Als Amba ihn sah, atmete sie erleichtert auf und lächelte ihm zu. Pongo lächelte zurück und versuchte, das Gefühl in seinem Magen zu deuten.
»Vielen Dank, dass Sie mir helfen«, sprudelte sie los. »Ich werde mit diesen Kobolden einfach nicht alleine fertig. Sie sind so … so widerlich, irgendwie, und dieses Lachen, ich bekomme Gänsehaut von diesem Lachen … Sie nicht auch? Dann noch der Schleim auf ihrer Haut … man traut sich gar nicht, sie anzufassen, und sie stinken so fürchterlich …«
»Schon in Ordnung«, unterbrach Pongo ihren Redefluss. »Ich war bei meinem ersten Einsatz auch ziemlich überfordert. Obwohl das damals nicht so schlimm war wie hier. Wir mussten einen Schwarm geflügelter Kreischbeißer einfangen, die hatten sich in einem Einkaufszentrum eingenistet und fielen dort regelmäßig über einen Süßwarenladen her. Das war auch recht schnell erledigt … Vorsicht, er bekommt keine Luft mehr!«
Ambas Kobold war blau angelaufen und machte schnappende Geräusche. Hastig lockerte sie ihren Griff. Sofort wollte der Gefangene die Flucht ergreifen, aber Pongo schnappte ihn sich geistesgegenwärtig am Kragen. Gemeinsam schleppten sie ihn zu zwei bedauernswerten Pären, die die Aufgabe erhalten hatten, die Kobolde in faltbare Knick-und-Knast-Käfige zu sperren und diese an einer Seite des Festsaales zu stapeln. Das Murren in der Truppe war groß gewesen, als sie kurz vor dem Ausrücken die Order erhalten hatten, die sperrigen Käfige in den Ausrüstungswagen zu laden; nun aber leisteten sie ihnen unschätzbare Dienste. Letztendlich hatten sie einsehen müssen, dass es unmöglich war, aus den Kobolden auch nur ein vernünftiges Wort herauszubekommen. Wenn sie die Lage schon nicht aufklären konnten, sollte beim Eintreffen der Jäger wenigstens Ruhe herrschen.
Mit vereinten Kräften schafften sie es, den Kobold mit vier seiner Artgenossen in einen Käfig zu stecken und das Gitter zu schließen, bevor der ganze gackernde Haufen wieder entkommen konnte.
»Puh«, schnaufte Amba, als die Kobolde endlich sicher verstaut waren. »Das war wirklich nett von Ihnen, ich hätte alleine nicht mehr weitergewusst. Diese grässlichen Kreaturen …«
»Gern geschehen«, entgegnete Pongo und um die günstige Situation zu nutzen, schob er hinterher: »Mein Name ist übrigens Pongo.«
»Sehr erfreut, ich bin Amba« Sie lächelte schüchtern und Pongo stellte fest, dass er sie mochte.
»Du hast gerade erst angefangen, nicht wahr?«
Sie nickte. »Ich bin seit einer Woche dabei. Meine Mutter hat geweint, als ich den Brief bekommen habe, und mein Vater hat gebrüllt, das sei nicht fair. Sie hatten sich wohl beide mehr erhofft, nachdem ich in meiner Ausbildungszeit ziemlich gut war.«
Pongo erinnerte sich noch genau an den Tag, an dem er seinen Brief erhalten hatte. Die jungen Pären erfuhren auf diese Weise, welcher Einheit sie zugeteilt wurden, und damit auch, welche Bedingungen ihr Leben fortan bestimmen würden. Die Reaktion seiner Eltern war so ähnlich ausgefallen wie die Ambas und wahrscheinlich die aller Eltern, die erfahren mussten, dass ihr Kind von nun an einer der unteren beiden Einheiten angehören würde. Auch Pongo war damals sehr enttäuscht gewesen. Insgeheim hatte er sich mindestens dritte Einheit erhofft, wenn nicht gar zweite. Immerhin hatte er sich damit trösten können, nicht der fünften Einheit, den Gefängnisaufsehern, zugeteilt worden zu sein.
Er versuchte, ein paar aufmunternde Worte für Amba zu finden, als er hörte, wie jemand seinen Namen rief. Es war Oberpär Graul. Er warf Amba einen entschuldigenden Blick zu und trottete in Richtung seines Truppenleiters. Wie die meisten seiner Kollegen schätzte er Graul und war der Meinung, dass kaum ein Pär besser für diesen Posten geeignet war. Mehr als einmal hatte er für einen seiner Leute die Pranke ins Feuer gelegt. Wenn ein Polizeipär Schwierigkeiten bekam, dann war es Graul, der die Vorgesetzten beschwichtigte, um seinem Untergebenen die Strafe zu ersparen. Das war bei Weitem keine Selbstverständlichkeit in einem Volk, das den täglichen Machtkampf verinnerlicht hatte wie kein zweites.
»Gibt es schon Anhaltspunkte, Herr Oberpär?«, erkundigte sich Pongo, sobald er an seiner Seite angelangt war.
Graul nickte. »Das waren die Killerelfen, ganz sicher«, stellte er düster fest und bestätigte damit die Vermutung, die auch Pongo insgeheim gehegt hatte. »Es ist ihre Handschrift. Die Jäger sind bereits unterwegs.«
»Hat jemand den Fluchtweg ausfindig machen können?«
»Genau da liegt unser Problem«, knurrte Graul und blickte mürrisch auf das Durcheinander, das nach wie vor in der Halle tobte. »Wenn wir keinen brauchbaren Informanten in die Hände bekommen, bevor die dritte Einheit hier ist, wird das für uns alle ein böses Nachspiel haben.«
Pongo wusste genau, wovon sein Chef sprach. Die oberen Einheiten lechzten geradezu danach, die weniger einflussreichen unteren Einheiten bei den Xarquen anzuschwärzen.
»Wir müssen dringend einen Sündenbock finden. Wissen Sie, wem diese Burg gehört?« Als Pongo den Kopf schüttelte, fuhr Graul fort. »Es ist ein Kobold namens Schmorzo von Krotzenhausen. Ein ekelhafter Kerl, sogar für Seinesgleichen. Er wird von seinen Artgenossen gemieden, aber er ist ambitioniert. Wenn mich nicht alles täuscht, dann war das hier keine gewöhnliche Party. Schmorzo plant etwas. Und er ist verschwunden.«
»Verschwunden, Oberpär? Hat er uns etwa nicht gerufen?«
Graul verneinte. »Einer der Gäste hat uns informiert. Sie wissen, wie diese Kobolde sind. Sicher war es ihm eine Freude, seinem Gastgeber ins Handwerk zu pfuschen – was immer der auch vorhatte, bevor der Raubzug seine Feier beendet hat.«
»Wir haben versucht, die Kobolde zu vernehmen, Oberpär, aber sie machen sich einen Spaß daraus, uns an der Nase herumzuführen.«
»Deshalb brauchen wir Schmorzo. Wenn überhaupt jemand Interesse daran hat, die Elfen dingfest zu machen, dann er. Wahrscheinlich haben sie etwas mitgehen lassen, das ihm gehört.«
»Aber warum versteckt er sich dann?«
»Alle Kobolde sind Feiglinge«, sagte Graul verächtlich. »Ich gehe davon aus, dass er sich irgendwo in der Burg verkrochen hat. Wir müssen ihn aufscheuchen.«
»Er wird nicht kooperieren, Oberpär«, gab Pongo zu bedenken.
»Darum sollen sich die Jäger kümmern«, erwiderte Graul nicht ohne Genugtuung. »Sie haben ihre Methoden. Vorausgesetzt, wir finden ihn rechtzeitig.«
Pongo versuchte sich zu erinnern, welchen Eindruck das Gebäude von außen auf ihn gemacht hatte. Es schien sich um eine kleine Variante der Fertigburgen zu handeln, die seit einigen Jahren wie Pilze aus dem Boden schossen. Sie waren erschwinglich, brachten jedoch kaum Extras wie Folterkammern oder Geheimgänge mit. Das würde ihnen die Suche beträchtlich erleichtern.
»Verstehe, Chef. Sie können sich auf mich verlassen.«
»Das tue ich, glauben Sie mir. Ich würde Amba mit Ihnen schicken«, er zwinkerte, »aber ich kann hier unten keine weiteren Leute entbehren.«
Pongo fühlte sich ertappt und nickte, während er nach einer unverfänglichen Antwort suchte. Graul lächelte grimmig – es war eher ein Verziehen der Mundwinkel – und half ihm mit einem »Beeilen Sie sich!« aus der Patsche. Der Polizeipär ergriff die Gelegenheit dankbar und trabte zum Ausgang der Halle, um Schmorzo zu finden.
*
Kiffi führte ihren Schwarm durch die Nacht.
Über ihr spannte sich der wolkenlose Himmel. Unter ihr wogte ein schimmerndes, mondbeschienenes Meer aus Grashalmen – die ersten Ausläufer der Ebene von Yarroth, die sich stumm und staubig gen Norden erstreckte. Wie der Atem eines schlafenden Wüstentieres schlug ihnen von dort eine warme Brise entgegen. Der Wind zerzauste das feine Haar der Elfen, die sich in ordentlicher Formation hinter ihrer Anführerin aufgereiht hatten.
Kiffi liebte es, im Dunkeln zu fliegen. Sie hatte dann das Gefühl, unsichtbar für alle zu sein, während sie selbst das Land, das sich unter ihr in all seiner Pracht ausbreitete, unbemerkt beobachten konnte.
Hier in Yarroth gab es keine Städte. Die Region war fast unberührt; eine Tatsache, die, wie so vieles andere auch, von der letzten entscheidenden Schlacht mit den Xarquen rührte, in der die Menschen Pärloniens, deren Heimat Yarroth bis dahin gewesen war, gänzlich vernichtet worden waren. Ihre Siedlungen waren damals von der Armee der Xarquen geplündert und niedergebrannt worden, doch kein zivilisiertes Volk wäre auf den Gedanken gekommen, die verlassenen Gegenden für sich zu beanspruchen. Es war ihre Art, den Despoten mitzuteilen, dass sie nicht vergessen würden, was man ihren Landsleuten angetan hatte.
Manchmal fragte sich Kiffi, wie eine Welt ohne die Xarquen hätte aussehen können. Hätte es einen Unterschied gemacht? Immerhin waren es nicht die anonymen Herrscher selbst, die Kiffi und ihren diebischen Gefährtinnen das Leben schwermachten. Die Pären waren das eigentliche Problem. In ihrer langen kriminellen Laufbahn war Kiffi nur allzu oft mit ihnen aneinandergeraten und konnte ein Lied davon singen, wie schwierig es war, sich diesem dichten Netz von brutalen Ordnungshütern immer wieder zu entziehen. Wachsam richtete sie daher ihren Blick nach unten, um potenzielle Gefahren sofort auszumachen.
Wie alle Elfen konnte sie ausgezeichnet im Dunkeln sehen, eine Fähigkeit, die sich noch verstärkt hatte, da sie und ihr Schwarm oft wochenlang nur nachts flogen und sich tagsüber auf Bäumen oder in verlassenen Tierbauten verbargen. Allerdings war sie nun seit fast vierundzwanzig Stunden wach und der Schlafmangel der vergangenen Tage tat sein Übriges dazu, dass ihre Augen mittlerweile vor Müdigkeit brannten. Auf der Flucht konnte ein Moment der Unachtsamkeit fatale Auswirkungen haben, deshalb war sie froh, dass sie nicht alleine unterwegs war. Das war bei Weitem nicht immer der Fall gewesen.
Nachdem sie vor einigen Jahren aus ihrer Heimat geflohen war, hatte sie völlig neu anfangen müssen. Auf der Suche nach Gesellschaft und einem Lebensunterhalt hatte sie fast ganz Pärlonien bereist, bis sie nach und nach andere Elfen getroffen hatte, die sie für ihren riskanten, aber lukrativen Beruf hatte begeistern können. Bald schon hatte sie einen bunt zusammengewürfelten Schwarm befehligt, der rasch zu einer festen Größe in Pärloniens Unterwelt aufgestiegen war. Anfangs hatten sie nur einsame Reisende überfallen, mit steigender Anzahl auch größere Gruppen, und sich schließlich, wie heute Abend, auf Burgen und ganze Siedlungen spezialisiert. Die Nachricht von den plündernden Elfen hatte sich schnell in den zwielichtigen Spelunken des Landes herumgesprochen und versorgte sie mit einem nicht abreißenden Strom von Aufträgen. Sehr zum Verdruss der Pären.
Eine Bewegung in der Ferne erregte Kiffis Aufmerksamkeit. Sie bedeutete den Elfen, langsamer zu fliegen, und kniff die Augen zusammen. Als sie Nox erkannte, den sie zu Beginn des Abends als Vorhut vorausgeschickt hatte, signalisierte sie Entwarnung.
Er war der einzige Mann im Schwarm und obwohl ihm das gelegentlich zu Kopf stieg, war Kiffi froh, ihn dabeizuhaben. Er war eine der mutigsten Elfen, die sie kannte. (In Gedanken nannte sie ihn immer »Elfe«, obwohl er fest darauf bestand, ein »Elfer« zu sein.) Mehr als einmal hatte er Seite an Seite mit ihr gegen Falken, Ratten und manch anderes Getier gekämpft, das den Schwarm in der Hoffnung auf leichte Beute angriff. Meistens teilte sie ihn als Späher ein, zum einen, weil sich die übrigen Elfen dann besser auf ihre Aufgaben konzentrierten, zum anderen, weil sich Nox mit seinen dunklen Fledermausflügeln viel schneller fortbewegen konnte als die restlichen Schwarmmitglieder.
»Wie sieht es da vorne aus?«, fragte sie, als er in Rufweite war.
»Wenn es noch ruhiger wäre, würden wir über einen Friedhof fliegen.« Er runzelte die Stirn. »Aber genau genommen tun wir das ja.«
Kiffi nickte düster. Sie hatten vor dem Raubzug lange debattiert, ob sie Yarroth als Fluchtweg wählen sollten. Die Vorteile lagen auf der Hand, doch ihnen allen machte das anerzogene Unwohlsein zu schaffen, das der verlassene Landstrich in ihnen auslöste. Letztlich hatten die Elfen knapp dafür gestimmt, aber sie planten dennoch nicht, länger als unbedingt nötig hier zu verweilen.
»Die Geisterstunde ist immerhin vorbei«, fuhr der Elfer fort und grinste über seine eigene Überleitung. »Ich habe einen guten Landeplatz gefunden, den wir erreichen können, bevor es hell wird. Und, mit Verlaub, du siehst aus, als könntest du etwas Schlaf gebrauchen.«
»Das können wir alle«, entgegnete Kiffi, obwohl sie seine Andeutung durchaus verstanden hatte. »Bring uns hin.«
Sie ließ sich zurückfallen, froh, die Führung für eine Weile an Nox übergeben zu können. Sie hatte Kopfschmerzen und sehnte sich nach einer warmen Mahlzeit.
Es waren diese verflixten Träume, die sie seit Tagen wach hielten. Natürlich war »Träume« das falsche Wort. »Visionen« traf es eher, aber sie vermied den Begriff für gewöhnlich, selbst in Gedanken. Es war nicht die erste dieser Phasen und sie wusste, dass es irgendwann von alleine aufhören würde. Aber dieser Auftrag war zu heikel, als dass sie sich die Ablenkung erlauben konnte. Sie durfte den Schwarm keinesfalls durch ihre eigenen Probleme in Gefahr bringen. Auch wenn ihr die Vorstellung nicht gefiel – sie musste sich ihren Dämonen stellen, und zwar bald.
Kurz darauf landeten sie. Nox hatte eine Gruppe größerer Steine ausfindig gemacht – womöglich die verwitterten Überreste eines Gebäudes –, die genügend Schutz boten. Ein einsamer Baum würde während des kommenden Tages für Schatten sorgen. So weit im Norden herrschte bereits im Mai sengende Hitze, während es im Süden noch Nachtfrost geben konnte. Nachdem sie ein halbes Dutzend Elfen auf die Jagd geschickt hatte, flog Kiffi zur Spitze des Baumes und ließ sich auf einem dünnen Ast nieder. Sie musste nachdenken.
Im Kopf überschlug sie die Zeit, die sie bereits mit diesem Auftrag verbracht hatten. Viel zu lange, entschied sie, und das Ende kam gerade erst vage in Sicht. Dabei hatte er nicht anders begonnen als unzählige Raubzüge zuvor. In einer düsteren Kaschemme am Langen Fluss, tief im kalten Süden des Landes, hatte ihr Geschäftspartner sie angesprochen. Sie hätte schon damals auf ihr Gefühl hören und den Handel ausschlagen sollen. Bis heute war sie sich nicht sicher, ob sie ihrem Kontaktmann – ein wortkarger Hüne, der sich strikt geweigert hatte, den dunklen Umhang abzulegen, der sogar sein Gesicht bis zur Unkenntlichkeit verhüllt hatte – wirklich vertrauen konnten. Doch sein Auftrag hatte leicht verdientes Geld versprochen und das hatte sie schließlich ihre Zweifel in den Wind schlagen lassen. Bisher war alles nach Plan verlaufen, fast ein wenig zu reibungslos, wenn sie recht darüber nachdachte. Und diese grässlichen Träume …
»Ah, hier hast du dich versteckt!«
Ertappt schaute sie auf. »Nox!«
Verflucht, warum klang ihre Stimme so quietschig? Das war nicht die Kiffi, die sie kannte.
»Du hast wieder gegrübelt«, tadelte er und ließ sich neben ihr auf dem Ast nieder. Seine Flügel knisterten leise, als er sie auf dem Rücken zusammenfaltete.
Kiffi wusste, sie waren sein ganzer Stolz, obwohl er ihretwegen seine Heimat hatte verlassen müssen. Es waren keine transparenten Libellenflügel, wie die meisten Elfen sie hatten, sondern schwarze, ledrige Schwingen von enormer Größe und Spannweite. Zu seinem Unglück war er in den Träumenden Sümpfen zur Welt gekommen, wo, wie allgemein bekannt war, ein besonders konservativer Schwarm Elfen siedelte. Jede moderne Elfe wusste, dass eine solche Anomalie bisweilen vorkam und nichts zu bedeuten hatte, doch die altertümlichen Sumpfelfen hatten darin ein böses Omen gesehen.
»So offensichtlich?«, fragte sie kleinlaut und zog die Knie an die Brust.
Nox nickte streng. »Die Elfen haben mich gebeten, mit dir zu reden. Wir machen uns Sorgen, Kiffi. Wir wissen alle, dass man deine Träume ernst nehmen muss. Nur du scheinst nicht daran zu glauben.«
»Ich arbeite daran«, entgegnete sie unwillig. »Ich hab nie um diesen Hokuspokus gebeten, wenn du dich erinnerst.«
»Nun, du hast ihn. Und wie es aussieht, wirst du ihn behalten.« Er lehnte sich in ihre Richtung und sagte eindringlich: »Kiffi, wenn wir dir irgendwie helfen können …«
»Das könnt ihr nicht«, erwiderte sie schroff und stand auf. »Gibt es schon Essen? Ich sterbe vor Hunger.«
»Kiffi!« Nox umfasste ihr Handgelenk, um zu verhindern, dass sie zurück ins Lager flog. »Ich möchte, dass du mir versprichst, auf diese Träume zu hören. Ich weiß, dass es dir nicht leicht fällt, aber … versprichst du es? Bitte.«
Sie wich seinem Blick aus. »Ich kümmere mich darum.«
»Das ist nicht dasselbe.«
»Na schön, ich werde auf meine Träume hören. Ich verspreche es. Zufrieden?«
Nox zog skeptisch eine Augenbraue hoch, beließ es aber dabei. »Lass uns wieder nach unten gehen.«
Kiffi nickte und schob ihren Ärger von sich. Er meinte es schließlich nur gut und tief in ihrem Inneren wusste sie, dass er Recht hatte. Sie hangelten sich durch das Geäst zum Boden. Vor allem Nox war schon vermisst worden. Wie sich herausstellte, war es den Jägerinnen gelungen, zwei wohlgenährte Kaninchen zu erbeuten, außerdem hatten sie auf dem Rückweg essbare Beeren gefunden. Die Routine des allmorgendlichen Lageraufschlagens tat gut. Während das Frühstück zubereitet, Schlafplätze hergerichtet und Wachen eingeteilt wurden, fühlte sich Kiffi fast wie in ihren unbeschwerten Phasen. Sie war in ihrem Leben mit so vielen Dingen fertig geworden. Sie würde auch diese Träume in den Griff bekommen. Die Kaninchen schmeckten vorzüglich und im Kreise ihrer ausgelassen schnatternden Weggefährten schienen ihr die düsteren Gedanken bald nur noch wie undeutliche Erinnerungen. Mit vollem Magen schmiegte sie sich schließlich in ihre weiche Wolldecke. Das Rauschen der Blätter sang sie in den Schlaf.
Zwei Stunden später schreckte sie schweißgebadet hoch und lauschte zitternd ihren eigenen keuchenden Atemzügen.
Vor 400 Jahren
Der Magier runzelte besorgt die Stirn und beugte sich tiefer über seine Sehende Kugel. Minutenlang verharrte er in dieser Position und es schien fast so, als ob sich die Falten unauslöschlich in sein Gesicht eingegraben hatten. Die Nebelschwaden im Glas wallten und wogten, teilten sich und verbanden sich zu immer neuen Figuren. Schatten entstanden, die sich bedrohlich umkreisten, um gleich darauf von den wirbelnden Massen verschluckt zu werden.
Tengor, Hauptmann in der königlichen Armee der Pären, lief knurrend in seinem Zelt auf und ab und warf dabei verdrießliche Blicke auf den Menschen-Seher, den ihm der Ältestenrat zugeteilt hatte.
Es missfiel ihm zutiefst, dass sie sich schlussendlich doch mit dem Volk hatten verbünden müssen, das ihnen immer wieder die Herrschaft über Pärlonien streitig gemacht hatte. Ihre Durchtriebenheit war berüchtigt. Unzählige Rebellionen hatten sie niederschlagen, die Menschengebiete mit harter Hand regieren müssen. Doch so vehement er sich auch vor dem Rat gegen die Durchführung dieser letzten verzweifelten Maßnahme gewehrt hatte – insgeheim wusste er, dass es keine andere Möglichkeit gab, wenn sie verhindern wollten, dass die Xarquen endgültig die Oberhand in diesem Krieg gewannen.
Während sich der Zauberer stumm bemühte, die magischen Schutzwälle ihrer Widersacher zu durchdringen und einen Blick auf das feindliche Treiben zu erhaschen, ging Tengor zum Ausgang des Zeltes. Mit zusammengekniffenen Augen versuchte er, zur anderen Seite des Talkessels hinüberzuspähen, wo die Gegner ihr Lager aufgeschlagen hatten. Der Sturm, welcher Schnee, Regen und Hagelkörner durch die Luft peitschte, machte es ihm jedoch unmöglich, mehr als ein paar Meter weit zu sehen. Auf dem hölzernen Wachturm, der neben dem Zelt in die Höhe ragte, bog sich eine Standarte im Wind. Unter der Eiskruste konnte Tengor gerade noch das Wappen der königlichen Familie erkennen – die kühn gereckte Pärentatze, durch deren Ballen sich eine Winterbeerenranke schlängelte. Es war ein Symbol der Stärke und des Überdauerns, das Herrschaftsemblem seines Volkes, dessen Anblick jeden Pären mit Stolz erfüllte. Noch hielt es dem Tosen stand. Aber dieser Winter war länger und dunkler als alle anderen und ob auf sein Ende je ein neuer Frühling folgen würde, war ungewiss.
Als Tengor seinen Kopf bereits wieder zurückziehen wollte, nahm er in einiger Entfernung eine verwaschene Bewegung wahr. Die Gestalt eines weiteren Pären kämpfte sich durch das heulende Tosen zu ihm heran. Obwohl sich der Soldat mit aller Kraft gegen den reißenden Orkan stemmte, taumelte er bei jedem Schritt haltlos hin und her. Seine Beine waren schlammverkrustet und in seinem Fell hatten sich Eiskristalle gesammelt. Mit unverhohlener Erleichterung trat er schließlich unter der Zeltplane hindurch, die Tengor ihm aufhielt.
»Ich d-d-danke Euch, Hauptmann«, schlotterte er, während er seinen nassen Pelz schüttelte. Er war ein einfacher Rekrut, ein junger Bursche, der kaum den Erwachsenenstatus erreicht haben konnte. »Man hat mich geschickt, um Euch zu einer Besprechung zu rufen.«
»Komm erst einmal herein«, wies Tengor ihn an. »Ziemlich leichtsinnig, dich durch dieses Inferno laufen zu lassen.«
Er nahm sich vor, dem Hauptmann, der das veranlasst hatte, die Leviten zu lesen.
Der Soldat rückte näher an das Feuer. »Spielt das denn noch eine Rolle? Für die meisten von uns ist es ohnehin die letzte Nacht unseres Lebens.«
Darauf wusste Tengor zunächst keine Antwort. Es stimmte, dass im Morgengrauen die alles entscheidende Schlacht beginnen würde: Im Falle einer Niederlage würden die Xarquen sie höchstwahrscheinlich alle versklaven oder für immer aus ihrer geliebten Heimat vertreiben. Auch Tengor machte sich keine Hoffnungen mehr, dass er den nächsten Tag überleben würde. Trotzdem wies er mit dem Kopf auf den Magier und sagte: »Noch ist nicht alles verloren. Vielleicht gelingt es ihm und seinen Kumpanen, die Tarnzauber der Xarquen zu überwinden.«
»Nach all den Jahren, Hauptmann? Ihr wisst so gut wie ich, dass das nicht geschehen wird. Noch nie hat jemand einen Xarquen zu Gesicht bekommen. Warum sollten sie kurz vor ihrem endgültigen Triumph einen so fatalen Fehler machen?«
Wieder musste Tengor ihm im Stillen zustimmen. Sie kämpften gegen einen Feind, den sie noch nicht einmal richtig kannten. Ohne Vorwarnung hatten die Xarquen das Land angegriffen, das die Pären über Jahrhunderte regiert hatten. Bis heute wusste niemand, woher sie gekommen waren und wie sie die mordenden Bestien gefügig machten, die an ihrer Stelle die Drecksarbeit verrichteten. Die Xarquen machten sich nicht die Hände schmutzig, oh nein! Sie duckten sich hinter einem schier unerschöpflichen Heer aus seelenlosen Schergen und zogen von dort die Fäden. Ihre Zauber waren so kühn und so komplex, dass sie nicht selten auf halbem Weg in sich zusammenbrachen und eine Schneise der Verwüstung in ihre eigene Armee schlugen. Viel zu oft jedoch ging die waghalsige Rechnung auf und brachte den Pären Tod und Verderben. Ernsthafte Gegenwehr war nicht möglich – kein Soldat würde sich auf ein Schlachtfeld schicken lassen, auf dem er davon ausgehen musste, dem Leichtsinn der eigenen Befehlshaber zum Opfer zu fallen. So waren die Verteidiger gezwungen, sich an die Regeln zu halten, die die unberechenbare Magie ihnen auferlegte. Manchmal fragte sich Tengor, ob der Preis dafür nicht zu hoch war.
»Wir dürfen uns nicht aufgeben«, widersprach er dennoch und deutete erneut auf den Magier. »Wenn selbst er weiterkämpft, dann sind wir es uns erst recht schuldig.«
Diesmal war es an dem Soldaten, nachdenklich zu schweigen. Obwohl keiner von ihnen echte Sympathie für die Menschen empfand, konnten sie nicht umhin, ihren Kampfgeist zu bewundern. Die Letzten von ihnen bereiteten sich dort draußen auf den Zusammenstoß mit so ungeheuerlichen Mächten vor, wie es sie in der Geschichte Pärloniens bisher nicht gegeben hatte. Selbst wenn der Krieg zu ihren Gunsten entschieden wurde, waren sie bereits jetzt so stark dezimiert, dass sie wohl nie wieder eine bedeutende Rolle in diesem einst so glanzvollen Königreich spielen würden.
Wie auf ein Stichwort hob der Magier den Kopf. Es kostete ihn sichtbare Anstrengung, seinen weit entfernten Geist zurück in seinen Körper zu rufen. Seine Hände zitterten.
»Hattest du Erfolg?«, fragte Tengor ungeduldig.
Der Mensch schüttelte müde den Kopf. »Ihre Schutzzauber sind einfach zu stark. Ich habe mein Bestes gegeben, aber es gibt keine Möglichkeit, sie zu überwinden. Es tut mir leid.«
»Verflucht!«, knurrte Tengor. Altbekannte Verzweiflung wallte in ihm auf, doch er unterdrückte das Gefühl vehement. Als Hauptmann musste er seinen Untergebenen mit gutem Beispiel vorangehen. Bis zum Schluss.
»Versuch es in deinem eigenen Zelt weiter«, wies er den Seher an. »Ich muss zu einer Besprechung.« An den Soldaten gewandt fragte er: »Wo findet das Treffen statt?«
»Bei Hauptmann Fenbar.«
Tengor runzelte die Stirn. Fenbar war ein Mensch und damit den Pären untergeordnet. Er sollte eigentlich nicht das Recht haben, ihn zu sich zu zitieren.
»Richte ihm aus, dass ich gleich komme«, sagte er dennoch zu dem Soldaten und dieser zog sich nach einer knappen Verbeugung zurück.
Tengor zögerte, den kurzen, aber beschwerlichen Weg zum Ort der Versammlung auf sich zu nehmen. Er hatte eigentlich gehofft, vor der großen Schlacht noch etwas Schlaf oder zumindest Ruhe zu finden. Was konnte Fenbar wollen? Alle Details waren längst mit dem Rat besprochen worden. Jeder kannte seine Anweisungen. Sollte er die Aufforderung nicht besser ignorieren?
Schließlich aber siegte seine Neugier. Er wappnete sich innerlich gegen die Urgewalten, die gleich über ihn hereinbrechen würden, biss die Zähne zusammen und folgte dem anderen Pären hinaus in den Sturm.
KAMPF MIT DEM KOBOLD
Pongo nahm sich einen Leuchtzauber aus dem gemeinschaftlichen Ausrüstungsbeutel und verließ die Halle durch ein Portal an der Westseite. Die beiden Torflügel fielen krachend hinter ihm ins Schloss und erstickten damit das Geschnatter der Kobolde und die Rufe der Pären. Unsicher verharrte er auf der Türschwelle und ließ den Blick durch den Korridor wandern. Ein Schwarm Fledermäuse löste sich aus den Schatten im Deckengewölbe und umflatterte ihn eine Weile lautlos. Als er sich den ungefähren Grundriss der Burg ins Gedächtnis gerufen hatte, setzte er sich behutsam in Bewegung. Der Leuchtzauber schwebte als stummer Lichtball neben ihm her.
Nach wenigen Metern stieß er auf einen Türrahmen. Der Gestank, der ihm daraus entgegenschlug, war fast unerträglich, doch kneifen galt nicht. Er gelangte in einen weitläufigen Raum, offensichtlich die Koboldversion einer Küche. Essensreste faulten in gusseisernen Töpfen und Pfannen vor sich hin, in einer Ecke türmten sich Tierinnereien zu einem Haufen und unter den Tischen wucherten Schimmelpilze in prächtigen Farben und Formen. Fliegenschwärme kreisten träge über der Szenerie. Immerhin gab es hier etwas mehr Licht, denn in einem Herd glommen noch einige Kohlereste.
Mit zusammengebissenen Zähnen tastete Pongo sich vorwärts. Er öffnete sämtliche Schränke, die ihm groß genug erschienen, um Schmorzo als Versteck dienen zu können. Als er in diesen nicht fündig wurde, inspizierte er zur Sicherheit auch die kleineren. Anschließend bückte er sich unter die Tische und steckte den Kopf in die erkalteten Feuerstellen. In den Innereien zu wühlen, brachte er nicht über sich.
Er zog weiter. Die anderen Zimmer im Erdgeschoss verlangten ihm weniger Selbstdisziplin ab, erwiesen sich aber ebenfalls als Sackgassen. Mühsam kämpfte er sich durch verrümpelte Vorratskammern, heruntergekommene Wohnstuben und einen engen Dienstbotentrakt, ohne auf etwas Größeres als einige fettgefutterte Ratten zu stoßen.
Eine gewundene Steintreppe am Ende des Flures führte hinauf ins erste Stockwerk. Irritiert stellte er fest, dass es mit dem unteren fast identisch war. Er hatte nie nachvollziehen können, was alle Welt an diesen Fertigburgen fand. Möglichst schnell, aber ebenso erfolglos, setzte er seine Suche fort und gab sich Mühe, das leise Gruselgefühl zu ignorieren, das sich allmählich in ihm breit machte. Wo waren alle? Lief er geradewegs in einen Hinterhalt oder lebte Schmorzo wirklich ganz alleine hier?
Aus seiner Ausbildungszeit wusste er, dass die meisten Kobolde in der Tat ziemliche Einzelgänger waren. Die anderen Völker Pärloniens mieden sie und auch untereinander konnten sie sich für gewöhnlich nicht ausstehen, sodass sie selten eine andere Wahl hatten, als sich von der Außenwelt abzuschotten. Graul hatte Schmorzo überdies als ein besonders unbeliebtes Exemplar seiner Gattung beschrieben, weshalb es nicht sehr wahrscheinlich schien, dass ihm benachbarte Grundbesitzer Unterschlupf gewährt hatten. Er musste hier irgendwo stecken. Zunehmend frustriert hebelte Pongo eine weitere Tür auf und steckte den Kopf durch den schmalen Spalt.
Was. War. Das?
Er schüttelte sich, aber der Anblick blieb derselbe. Auf langen Metalltischen, die den Raum fast vollständig ausfüllten, summten Hunderte altertümliche Maschinen vor sich hin. Verflixt, wie hießen diese Dinger noch? Und welche Bedrohung stellten sie dar? Pongo kramte fieberhaft in seinem Gedächtnis, doch Geschichte hatte nie zu seinen Lieblingsfächern gehört.
Komunen. Nein.
Kanuter. Nein.
Die Geräte waren alle eingeschaltet und ihre matt glühenden Oberflächen tauchten die Umgebung in ein gespenstiges Licht. Ihre Energie bezogen sie offenbar aus einem Elektrizitätszauber – eine Kugel mit dem Durchmesser eines dicken Baumstamms, die nur aus bläulichen Funken zu bestehen schien und aus der in unregelmäßigen Abständen weiße Blitze zuckten – mit dem sie über dünne, schwarze Seile verbunden waren.
Campunen. Nein.
Es war bei Weitem nicht das erste Mal, dass Pongo einen Elektrizitätszauber sah – fast jeder gehobene Haushalt in Pärlonien hatte einen – doch er bezweifelte, dass die legale Größe für Private Magische Anwendungen der Klasse III hier eingehalten worden war. Wenn sie es geschickt anstellten, konnten sie die Aufmerksamkeit der Jäger möglicherweise auf den vorliegenden Gesetzesverstoß lenken, um die Abwesenheit ihres Kronzeugen irgendwie …
Computer! Das war das Wort.
Uralte Speichergeräte, die mittlerweile nicht einmal mehr auf dem Flohmarkt gehandelt wurden. Völlig ungefährlich, zum Glück.
Seit die Einwohner Pärloniens gelernt hatten, sich die Magie in kontrolliertem Maße nutzbar zu machen, waren diese und andere Technologien in Vergessenheit geraten. Was mochte Schmorzo mit seiner kuriosen Sammlung bezwecken? War es vielleicht nur eine Leidenschaft des Kobolds, alte technische Geräte zu horten? Immerhin hatte dieser Trend in den letzten Jahren verstärkt um sich gegriffen. Da war es zwar nicht gerade naheliegend, aber zumindest denkbar, dass Schmorzo ebenfalls sein Interesse für Antikes entdeckt hatte. Aber warum sollte er die Maschinen dann am Laufen halten wollen? Nur ein äußerst talentierter Magier wäre in der Lage, einen Elektrizitätszauber dieser Größe zu erschaffen, und talentierte Magier waren rar gesät. Nein, etwas sagte Pongo, dass der Kobold mit diesen Computern ein ganz bestimmtes Ziel verfolgte. Nur, welches Ziel konnte es geben, das nicht mit Magie noch viel einfacher zu erreichen war?
Es juckte Pongo in den Tatzen, der Sache auf den Grund zu gehen, und nur die Loyalität gegenüber seinem Vorgesetzten hielt ihn davon ab, die Geräte näher zu begutachten. Er begnügte sich daher auch hier mit einer raschen Inspektion der möglichen Verstecke und nahm sich dann den Rest der Etage vor. Ein verlottertes Schlafzimmer. Eine Toilette, die der Küche ernsthafte Konkurrenz machte. Eine eingestaubte Bibliothek. Doch nirgends auch nur die geringste Spur des Schlossherrn. Am Ende des Korridors wandte er sich nach links, um eine weitere Treppe zu erklimmen, und flehte innerlich, im zweiten Stock möge er mehr Glück haben – doch da war keine Treppe. Nichts als solides Mauerwerk und ein hohes Fenster. Die furchtbare Tragweite dieser Entdeckung sickerte langsam in sein Bewusstsein.
Versagen. Scham. Strafe.
Was nun? Es blieb ihm nichts anderes übrig, als die ganze Burg noch einmal zu durchkämmen. Er konnte unmöglich mit leeren Händen zu Graul zurückkehren. Durch einen Blick aus dem Fenster versuchte er, ein ungefähres Gefühl für die Uhrzeit zu bekommen. Die Burg stand etwas erhöht am Ende eines flachen Tals, das sich mehrere Meilen nach Westen zog. In der anderen Richtung begrenzte eine Hügelkette die Aussicht, hinter der bereits ein zarter goldener Schimmer zu erkennen war. Kurz vor Sonnenaufgang. Ihre Frist lief ab.
Was war das? Pongo kniff die Augen zusammen und starrte durch das angelaufene Glas. Bildete er sich die hüpfenden Pünktchen, die sich von Westen her der Burg näherten, nur ein? Nein, kein Zweifel. Einheit 3 war schon fast hier.
Panik krallte sich in seinen Magen. Die Jäger kamen und sie standen mit nichts da, außer ein paar gackernden Kobolden in Käfigen! Das würde ein Nachspiel haben, soviel war sicher.
Wenn die Jäger mit der Leistung der Polizeipären nicht zufrieden waren – und das waren sie selten –, hatten sie das Recht, die Untergebenen »angemessen« zu bestrafen. In den meisten Fällen teilten sie die betroffenen Pechvögel als Lastenträger für ihre nächsten Einsätze ein, erwirkten Essenskürzungen für die ganze Truppe oder verordneten Toilettendienst in öffentlichen Einrichtungen. Vor allem junge, rangniedere Pären wurden bei solchen Gelegenheiten besonders schikaniert. Wenn er daran dachte, wie Amba mit einer Zahnbürste das Quartier eines Jägerkommandos schrubbte, wurde ihm schlecht.
Wütend und hilflos schlug Pongo nach dem Nächstbesten, was sich ihm bot: ein rosafarbener Wandbehang. Wie um ihn noch zusätzlich zu verhöhnen, löste sich dieser durch den Hieb aus seiner Aufhängung und stürzte auf ihn herab. Rüde befreite er sich aus der Umarmung des Stoffes und warf ihn schnaubend zu Boden. Als er wieder aufsah, traute er seinen Augen nicht. Hinter dem Vorhang war eine kleine, staubige Tür zum Vorschein gekommen. Hoffnung keimte zaghaft in ihm auf. War das möglich?
Pongo berührte zögernd den goldenen Knauf. Die alten Scharniere quietschten leise, als die Tür nach innen schwang. Eine schmale Wendeltreppe führte von hier nach oben.
Schmorzo, du Schlingel!
Allem Anschein nach hatte der Kobold beim Bau seines Schlosses doch nicht gänzlich auf Extras verzichten wollen. Behutsam erklomm Pongo die ersten Stufen. Ein strenger Geruch hing in der Luft und in Gedanken sah er unwillkürlich das Gesicht von Frau Hinkelrich vor sich, seiner Biologielehrerin, die seit Jahren tot war. Er schauderte. Plötzlich war er nicht mehr so entschlossen, da hinaufzusteigen.
Reiß dich zusammen, schalt er sich selbst. Es ist deine letzte Chance. Graul zählt auf dich!
Darauf bedacht, kein verräterisches Geräusch zu verursachen, schob er sich weiter. Er passte kaum durch den engen Gang und riss sich an den unverputzten Backsteinen etliche Büschel Fell aus. Am oberen Treppenabsatz verharrte er wieder. Die Tür war hier nur angelehnt und durch den Spalt konnte Pongo einen Teil des dahinterliegenden Raumes sehen.
Es schien sich um eine Art Labor zu handeln. Auf Holztischen türmten sich fremdartige Gerätschaften, die summende oder tickende Geräusche von sich gaben. Dazwischen standen bauchige Phiolen, die grell gefärbte Substanzen enthielten. Staunend bemerkte Pongo, dass sich ein purpurfarbenes Elixier durch den Boden seines Gefäßes gefressen hatte und nun zischend die Tischplatte in Angriff nahm. An den Wänden präsentierte sich auf wackeligen Regalbrettern ein Sammelsurium unterschiedlicher Glasbehälter, in denen grausige Präparate schwammen. Er zog es vor, da lieber nicht so genau hinzusehen.
Ein Murmeln erregte seine Aufmerksamkeit. Es war aus dem Teil der Kammer gekommen, der sich außerhalb seines Blickfeldes befand. Unendlich behutsam schob er seinen Kopf durch den Türspalt. Er wagte kaum zu atmen. Nur wenige Schritte von ihm entfernt saß ein Kobold auf einem Holzschemel und hatte ihm den Rücken zugewandt. Unablässig brabbelnd wippte er mit dem Oberkörper vor und zurück und machte dabei einen so debilen Eindruck, dass Pongo es für sicher hielt, sich von seinem Platz an der Tür zu lösen und näher an ihn heranzuschleichen. Nun konnte er auch verstehen, was die Kreatur sagte: »Elfe … Killerelfe … mein Kästchen … verrotten soll sie … oh, diese Schmach … mein Kästchen …«
Pongo hob eine Pranke. Wenn es ihm gelänge, den Kobold bewusstlos zu schlagen, hätte er leichtes Spiel. Er durfte jetzt nur keinen Fehler machen.
Ruhe bewahren. Zielen. Schlag.
Doch just in dieser Sekunde fuhr Schmorzo herum, mit einer Schnelligkeit, die sein plumpes Äußeres nicht vermuten ließ. Er sah seinen Angreifer, kreischte schrill und sprang ihm ins Gesicht. Pongo brüllte, mehr vor Überraschung als vor Schmerz, und schüttelte seinen Kopf heftig hin und her. Schmorzo flog gegen einen Tisch, den er durch seinen eigenen Schwung mit sich riss. Geräte fielen scheppernd zu Boden und Glasflaschen ergossen ihren Inhalt über den Kobold. Er rappelte sich auf und stolperte durch die Scherben zum Ausgang. Pongo streckte sich, um ihn noch zu fassen, aber er hatte zu wenig Platz, um sich vollständig umzudrehen. Seine Beute entwischte ihm.
»Stehenbleiben, das ist ein Befehl!«, rief er, während er weitere Tische umwarf, um sich Raum zu schaffen. Als er sich durch die Tür zwängte, war Schmorzo bereits zur Hälfte die Treppe hinunter. Pongo knurrte entschlossen und setzte ihm nach. Im Korridor würde er ihn einholen. Der Kobold stolperte den breiten Flur entlang und auch er schien zu wissen, dass sein Verfolger hier im Vorteil war. Pongo preschte triumphierend hinter ihm her, doch bevor seine ausgestreckten Krallen zupacken konnten, warf sich Schmorzo durch eine der zahlreichen Türen. Der Pär folgte ihm und fand sich im Schlafzimmer des Schlossherrn wieder. Eine Sackgasse.
»Das Spiel ist aus, mein Freund«, grollte er und baute sich im Türrahmen auf. Als er in die angstvoll geweiteten Augen seines Opfers schaute, fühlte er sich fast ein bisschen wie ein Jäger.
Schmorzo unternahm einen letzten Fluchtversuch, indem er über das Bett zum Fenster hechtete, aber sein Verfolger war schneller. Pongo überrumpelte die vor Wut spuckende und kratzende Kreatur, nicht ohne selbst noch einige Blessuren einzustecken, doch schließlich gelang es ihm, den Kobold in eine Bettdecke zu wickeln und das Bündel fest zu verschnüren. Schmorzo zappelte wie von Sinnen und stieß die übelsten Verwünschungen aus, die Pongo je gehört hatte.
»Ruhe da drin«, raunzte er. »An deiner Stelle wäre ich nicht so vorlaut. Du hast nämlich eine Verabredung mit einem Jägerkommando. Und glaub mir, die stinken noch viel schlimmer als du.«
*
Oberpär Graul wurde allmählich nervös. Von seinem Standort an einem Fenster der Festhalle waren die Jäger der Einheit 3 bereits deutlich zu erkennen. Vor seinem inneren Auge sah er sie herangaloppieren: zehn massige Muskelberge, deren gewaltige Pranken über die Erde trommelten, den Blick starr und unerbittlich auf Schmorzos Burg gerichtet und in ihren Mienen glühende Vorfreude auf die bevorstehende Jagd.
Fröstelnd drehte er sich weg und bedeutete einem anderen Pären, die Rolle des Ausgucks zu übernehmen. Er wollte sicherheitshalber noch einen Kontrollgang durch den Saal machen, bevor ihre Vorgesetzten eintrafen.
Dies war ganz sicher nicht irgendein Jägerkommando. Der Fall hatte mittlerweile eine derartige Brisanz entwickelt, dass die Xarquen die schnellsten und zähesten Pären geschickt haben mussten, die in der Kürze der Zeit hatten verfügbar gemacht werden können. Nicht weniger als die Stabilität des Reiches stand auf dem Spiel.
Die Killerelfen führten die Gesetzeshüter seit Jahren so schamlos an der Nase herum, dass die spöttischen und aufrührerischen Stimmen im Volk immer lauter wurden. Weit über die Landesgrenzen hinaus waren die Pären stets dafür bekannt gewesen, Ruhe und Ordnung durchzusetzen wie in keinem anderen Staat der bekannten Welt. Wer auch nur einen Schritt aus der Reihe trat, wurde zur Strecke gebracht. Dies war das große Gebot, auf das sich das Zusammenleben in Pärlonien gründete.
Die Elfen hatten jedoch einen Weg gefunden, die Reihe dauerhaft zu verlassen. Stets schienen sie ihren Verfolgern einen Schritt voraus zu sein. Man hatte mit cleveren Tricks versucht, den Schwarm zu ergreifen, mit roher Gewalt und mit einer Mischung aus beidem, aber ohne Erfolg. Jetzt entstanden bereits erste Unruheherde in verschiedenen Teilen des Landes. Die Macht der Pären, so glaubte man offenbar, schien zu bröckeln. Im Augenblick gelang es ihnen noch, die Schwelbrände auszutreten, doch ein Moment der Unachtsamkeit konnte ein Inferno zur Folge haben.
Graul hatte seine Runde beendet. Sie hatten die Situation zum Glück in den Griff bekommen. Alle Kobolde waren letztlich in Knick-und-Knast-Käfige gesteckt und diese ordentlich an einem Ende der Halle gestapelt worden. Er wusste allerdings, dass sich die Jäger auch dadurch nicht davon ablenken lassen würden, dass die Polizeipären der Einheit 4 keine brauchbaren Informationen zum Verbleib der Elfen beschafft hatten. All seine Hoffnungen ruhten nun auf Pongo. Wenn sich ihre Vorgesetzten an Schmorzo abreagieren konnten, kämen er selbst und seine Leute womöglich ungeschoren davon.
»Oberpär Graul, sie sind hier!«, meldete sich einer der Polizisten von seinem Platz am Fenster. »Sie durchschreiten gerade das Burgtor.«
Graul nickte düster und signalisierte der Truppe, Haltung anzunehmen. Er fragte sich, ob man ihm die Anspannung ebenso ansah wie seinen Pären.
Das Portal öffnete sich mit einem Knall und er konnte nicht verhindern, dass er zusammenzuckte. Reglos schaute er zu, wie die Jäger hereinströmten und sich mit den üblichen Drohgebärden vor ihren rangniederen Kollegen aufbauten. Sofort sah er seine Vorahnung bestätigt; diese Pären waren nicht nur die schnellsten und zähesten ihrer Einheit, sondern auch die brutalsten. Viele von ihnen hatten bei anderen Einsätzen so große Heldentaten vollbracht, dass jedes Kind in Pärlonien ihre Namen kannte. Die Elfen würden diesmal nichts zu lachen haben.
Ihr Oberpär trat vor und salutierte knapp. Graul erwiderte den Gruß pflichtbewusst, bevor er den Blick wieder senkte. Er spürte, wie der andere ihn abschätzend musterte. Sein Name war Shank, allerdings wurde er hinter seinem Rücken nur Shrank genannt. Er war größer als die meisten Jäger und überragte sicher auch so manches Mitglied der oberen beiden Einheiten. Mit seinem Brustkorb hätte er Bäume umrammen können und Graul vermutete, dass er nur durch seine pure Masse ein kleineres Pferd erdrücken konnte.
»Oberpär Graul?«, brüllte er, und schleuderte dem Polizeipären damit eine Wolke fast unerträglichen Mundgeruchs entgegen.
»Eben der«, antwortete der Angesprochene und versuchte möglichst unauffällig, nicht durch die Nase zu atmen.
»Informationen. Aber zackig.«
Graul schluckte. Offenbar war Shrank kein Freund überflüssiger Etikette. Jetzt hieß es, Zeit schinden.
»Nun, wir haben uns natürlich die allergrößte Mühe gegeben …«
»Drücken Sie sich klar aus, Mann!«, herrschte Shrank ihn an.
»Natürlich, Oberpär. Ich … wir … einer meiner Leute …«
»Haben Sie Informationen oder nicht?«
»Wenn ich Ihnen die Lage kurz schildern darf … wir haben alle Kobolde, die wir finden konnten …«
»In welche Richtung sind die Elfen geflohen?«
»Geflohen, Oberpär?«
»Ich fasse es nicht.« Shrank schnaubte vor Wut. »Wie kann man derart unfähig sein, Graul? Können Sie mir wenigstens darauf eine Antwort geben?«
Graul biss die Zähne zusammen. Wo blieb Pongo?
»Da seht ihr es, Männer«, rief der Jäger seiner Truppe zu. »Warum sollte man Polizeipären etwas tun lassen, wenn sogar blinde und taube Schlammwürmer es besser hinbekämen?«
»Wir haben unser Bestes versucht, Oberpär …«, hörte Graul sich winseln.
»Ach, stellen Sie sich doch in eine Ecke und heulen Sie!«, blaffte Shrank. »Wir übernehmen jetzt, verstanden? Also, Männer, nachdem diese Bande von stummelzähnigen Plüschpranken es nicht geschafft hat, aus ein paar Kobolden herauszubekommen, wo …«
»Owerher Glaul, Owerher Glaul, ig haw ihn!«
Der Jäger hob verärgert den Kopf, um zu sehen, wer ihn da so schamlos unterbrochen hatte. »Wer zum …?«
Graul fühlte, wie ihm eine Zentnerlast von den Schultern genommen wurde. Da war Pongo und trabte mit einem zappelnden Wäschebündel im Maul durch die Reihen der Jäger auf ihn zu. Graul konnte geradezu die triumphierenden Fanfaren hören, die seinen Einzug begleiteten. Die anderen Truppenmitglieder stießen erleichterte Rufe aus, während Pongo das Bündel in ihre Mitte schleifte und es mit stolzgeschwellter Brust auf dem Fußboden ablegte.
»Hier ist er, Oberpär«, schnaufte er. »Passen Sie auf, wenn Sie ihn auspacken, er ist kaum zu bändigen.«
Graul nickte ihm stolz zu. »Ich wusste, dass ich mich auf Sie verlassen kann, Pongo. Gute Arbeit!«
»He, was soll das?«, mischte sich Shrank ein, dem es anscheinend gar nicht passte, nicht mehr im Zentrum der allgemeinen Aufmerksamkeit zu stehen.
»Oberpär Shank«, sagte Graul mit fester Stimme, »ich präsentiere Ihnen den Burgherrn, Schmorzo von Krotzenhausen. Unser Hauptaugenzeuge.«
»Und der ist da drin?« Shrank deutete misstrauisch auf das hüpfende Knäuel. Niemand schien wirklich erpicht darauf, den angriffslustigen Kobold zu befreien. Bevor der Jäger jedoch Gefahr lief, vor versammeltem Publikum das Gesicht zu verlieren, gab er sich einen Ruck und schlug den Stoff zurück.
Schmorzo sprang auf die Füße und taumelte einige unbeholfene Schritte durch den Raum. Seine angstvoll geweiteten Augen huschten über die massigen Leiber der Pären, die ihn umzingelten und ihm sämtliche Fluchtwege versperrten. Angesichts der erdrückenden Übermacht stellte er sich kurzerhand tot.
»Kobolde«, murmelte Shrank angewidert. »Einfach unfassbar.«
Er rempelte die schlaffe Gestalt unsanft mit einer Pranke an, brachte sein zahngespicktes Maul ganz nahe an Schmorzos Ohr und brüllte aus vollem Hals: »STEH! AUF!«
Der Kobold begann zu schluchzen.
*
Schmorzo wusste nicht, was er tun sollte. Warum ließen sie ihn nicht in Ruhe?
Er lag zitternd auf dem Boden. Eine Bestie hatte sich über ihn gebeugt und sprach zu ihm. Sie bewegte die Lippen, aber sein Geist war vor Angst so gelähmt, dass er den Sinn der Worte nicht verstand. Sie fragte etwas. Sie fragte nach einem Weg. Warum sollte Schmorzo einem Pären den Weg zeigen? Welchen Weg?
»Na, sag schon, Quallengehirn«, fauchte das Monster. »Wo ist die Killerelfe hingeflogen?«
Killerelfe! Dieses Wort kannte er.
Kiffi die Killerelfe, so hatte sie sich genannt. Hatte ihn beraubt, gedemütigt, verspottet. Und diese Pären wollten sie haben.
Ja, kriegen sollten sie sie! Sollten sie in das tiefste Verlies sperren und dort verrotten lassen. Ein Fingerzeig von ihm genügte und die Pären würden kurzen Prozess mit ihr machen. Schmorzo hob eine bebende Hand.
Doch halt! Das Kästchen. Kiffi hatte es und wenn die Pären sie fingen, dann wäre es für immer verloren. Sein Kästchen! Das durfte er nicht zulassen, um keinen Preis. Wenn er es zurückhaben wollte, dann musste er auf eigene Faust danach suchen. Die Pären durften Kiffi nicht finden!
Schmorzo ballte die Hand zusammen. Streckte einen Finger aus und zeigte – nach Süden.
*
Shrank grunzte zufrieden.
»Na also, Kobold. Das war doch gar nicht so schwer, oder?« Er kehrte Schmorzo den Rücken zu und schien ihn im selben Augenblick vergessen zu haben. »Wie ich vermutet hatte, Männer. Der Schwarm ist nach Süden geflohen. Wir brechen sofort auf, dann erwischen wir ihn vielleicht vor Einbruch der Dunkelheit.«
Graul gestattete sich ein verhaltenes Aufatmen. Es sah ganz so aus, als seien sie für heute davongekommen.
Auf dem Weg zum Ausgang gab Shrank den Jägern weitere Anweisungen. »Ihr arbeitet zu zweit im Team. Die Karten mit den Planquadraten habt ihr. Solltet ihr die Killerelfen sichten, alarmiert ihr den Rest der Truppe. Es gibt keine Alleingänge, merkt euch das! Ich werde in der Zwischenzeit die südlichen Pärenstationen benachrichtigen. Vielleicht können wir sie einkesseln und auf diese Weise …«
»Verzeihung, Oberpär.«
Shrank schaute verdutzt auf. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Minuten war er mitten im Satz unterbrochen worden.
Einer seiner Jäger war vorgetreten und wartete offenbar, dass ihm das Wort erteilt wurde. Es war ein junger, schneidiger Bursche, der vor Selbstbewusstsein nur so strotzte. Graul spitzte die Ohren. Das konnte interessant werden. Er kannte diese Sorte. Gerade erst die Ausbildung abgeschlossen, ein, zwei gute Bewertungen bekommen und schon fühlten sie sich zu Höherem berufen.
Shrank musterte den Pären einen Wimpernschlag lang und fragte dann kühl: »Möchten Sie etwas loswerden, Graupelz?«
»Graufell, Herr Oberpär. Tronk Graufell. Gestatten Sie mir die Anmerkung: Wie können wir sicher sein, dass der Kobold die Wahrheit sagt? Es könnte ein Ablenkungsmanöver sein, um uns in die Irre zu führen. Sollten wir nicht auch Leute nach Norden schicken?«
Graul zog die Augenbrauen hoch. Das konnte er unmöglich ernst meinen. Im Norden lagen Manturas und die lebensfeindliche Ebene von Yarroth, wo niemand freiwillig einen Fuß hinsetzte. Viel wahrscheinlicher erschien es da, dass Tronk seine Scharfsinnigkeit ein wenig zur Schau stellen wollte, um Punkte für die nächste Bewertung zu sammeln.
Shrank musste zu einem ähnlichen Schluss gekommen sein, denn er entgegnete gefährlich leise: »Stellen Sie mein Urteilsvermögen infrage, Tronk?«
Graufell legte die Ohren an. »Keineswegs, Oberpär. Aber in Anbetracht der Lage sollten wir doch bestimmt nicht das Risiko eingehen …«
Shrank schnitt ihm mit einer herrischen Geste das Wort ab. »Sie sind ein Teil dieser Einheit seit … wie lange, Tronk?«
»Vier Monate und acht Tage, Oberpär.«
»Danke. In dieser Zeit haben Sie elf schriftliche Verbesserungsvorschläge für die Grundausbildung eingereicht, drei Mal um Ihre Versetzung in einen Hauptstadtbezirk gebeten und sich für eine Anhörung durch den Hauptpären beworben. Sie streben nach Größerem, nicht wahr, Tronk?«
»Ich … ich möchte lediglich ein vorbildlicher …«
»Und jetzt wollen Sie Ihrem Vorgesetzten sagen, wie er seine Arbeit zu machen hat. Und wissen Sie was …?«
»Herr Oberpär, ich bitte um Verzeihung. Es war nicht meine Absicht, Sie …«
»Sie haben Recht.«
»… zu beleidigen. Ich habe Recht?«
Graul war zu lange im Dienst, um auf Shranks Finte hereinzufallen, aber Tronk atmete vor Erleichterung auf.
»Ich möchte Ihnen keine Steine in den Weg legen, mein Junge«, fuhr der ältere Jäger fort. »Ihr Einsatz für unser Land und für unsere Einheit ist mehr als mustergültig. Sie bekommen heute Ihre Chance, sich zu beweisen.«
»Danke, Oberpär.«
»Sie gehen nach Norden.«
Tronks Gesicht erstarrte.
»Allein. Ich kann hier niemanden mehr entbehren. Viel Glück, Graupelz.«
Kaum hatte er die Anordnung ausgesprochen, war der stammelnde, bettelnde Jäger Luft für ihn. Shrank ließ einen Teil der Ausrüstung für den Zurückgelassenen beiseite stellen, wartete, bis sich der Rest seiner Truppe in Formation begeben hatte, und führte die Pären dann in straffem Tempo aus dem Festsaal.