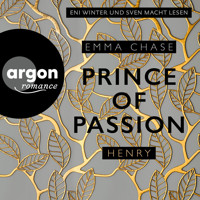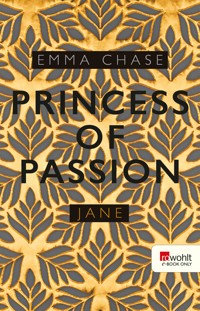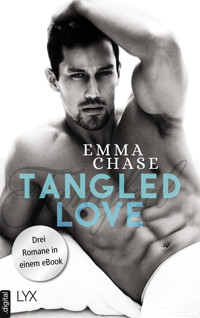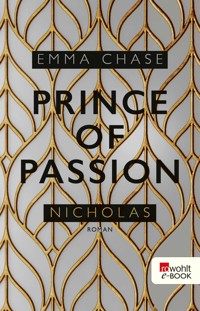
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Prince-of-Passion-Reihe
- Sprache: Deutsch
Royal Romance – das ultimative Märchen. Der erste Band der Erfolgstrilogie um zwei Prinzen und ihren Bodyguard. Für alle, die mal eine Pause von der Realität brauchen … Ich heiße Nicholas Arthur Frederick Edward Pembrook, Kronprinz von Wessco. Meine Fans nennen mich His Royal Hotness. Meine Großmutter, die Königin, nennt mich einen störrischen Jungen. Sie will, dass ich meine Pflicht tue, heirate und Erben in die Welt setze. Und ich weiß, dass sie recht hat. Es ist das, was Prinzen tun. Aber meine Gnadenfrist von fünf Monaten will ich noch voll auskosten. Und was könnte köstlicher sein als die Lippen einer selbstbewussten New Yorker Kellnerin, die nicht den geringsten Respekt vor mir oder meinem Titel hat?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2019
Sammlungen
Ähnliche
Emma Chase
Prince of Passion – Nicholas
Roman
Über dieses Buch
Ich heiße Nicholas Arthur Frederick Edward Pembrook, Kronprinz von Wessco. Meine Fans nennen mich His Royal Hotness. Meine Großmutter, die Königin, nennt mich einen störrischen Jungen. Sie will, dass ich meine Pflicht tue, heirate und Erben in die Welt setze. Und ich weiß, dass sie recht hat. Es ist das, was Prinzen tun. Aber meine Gnadenfrist von fünf Monaten will ich vorher noch voll auskosten. Und was könnte köstlicher sein als die Lippen einer selbstbewussten New Yorker Kellnerin, die nicht den geringsten Respekt vor mir oder meinem Titel hat?
Vita
Emma Chase lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort in New Jersey, USA. Sie hat 2013 ihren ersten Liebesroman veröffentlicht, der ein sofortiger Erfolg wurde. Seitdem schaffen es ihre Bücher regelmäßig auf die Bestsellerlisten der New York Times und der USA Today. Über das Romance-Genre sagt die Autorin Folgendes: «Diese Bücher sind wichtig, besonders jetzt. Weil sie uns Erholung und Zuflucht bieten. Weil sie uns stärken, erfrischen und bereit machen für alles, was das Leben uns in den Weg wirft.»
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel «Royally Screwed».
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg bei Reinbek // «Royally Screwed» Copyright © 2016 by Emma Chase LLC
Redaktion: Susann Rehlein, Berlin
Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung deckorator/shutterstock
ISBN 978-3-644-40318-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Prolog
Meine erste Erinnerung unterscheidet sich kaum von der anderer Menschen. Ich war drei Jahre alt, und mein erster Tag in der Vorschule stand bevor. Aus mir unbekannten Gründen ignorierte meine Mutter die Tatsache, dass ich ein Junge war, und steckte mich in ein grauenhaftes Outfit aus Latzhose, Rüschenhemd und Lacklederschuhen. Mein Plan war, diesen Aufzug schnellstmöglich mit Fingerfarben zu beschmieren.
Doch noch tiefer hat sich mir etwas anderes ins Gedächtnis gegraben.
Der Anblick einer auf mich gerichteten Kamera war für mich damals bereits so normal wie der eines Vogels am Himmel. Ich hätte daran gewöhnt sein müssen – und war es wohl auch. Doch an dem Tag war alles anders. An diesem Tag waren Hunderte von Kameras auf mich gerichtet. Gehweg und Straße waren überfüllt, und am Eingang zur Schule drängte sich eine dichte Traube einäugiger Monster, die nur darauf warteten, sich auf mich zu stürzen. Ich erinnere mich noch an die beruhigende, beständige Stimme meiner Mutter, die sanft auf mich einredete, während ich mich an ihre Hand klammerte, auch wenn ich nicht verstehen konnte, was sie sagte. Ihre Worte gingen im Gebrüll der Fotografen unter.
«Nicholas! Nicholas, hierher! Lächeln! Schau hoch zu mir, mein Junge! Nicholas! Hier drüben!»
Damals bekam ich zum ersten Mal eine Ahnung, dass ich – und meine Familie – anders war. Im Laufe der Zeit wurde mir klar, wie anders wir sind. Meine Familie ist international bekannt, wir werden immer sofort erkannt und fabrizieren mit allem, was wir tun und lassen, Schlagzeilen.
Normalerweise schwillt Ruhm an und ebbt ab wie die Gezeiten. Die Leute werden von ihm überschwemmt und mitgerissen, bis ihre Bekanntheit schließlich wieder abnimmt und das einstige Objekt der Begierde zu jemandem degradiert wird, der mal wer war und es heute nicht mehr ist.
Für mich gilt das nicht. Mich kannte man schon, ehe ich geboren wurde, und mein Name wird noch in den Geschichtsbüchern stehen, wenn ich selbst schon längst zu Staub zerfallen bin. Berüchtigt ist man vorübergehend, auch der Prominentenstatus ist flüchtig, aber Mitglied des Königshauses ist man für die Ewigkeit.
1
Jedes Klischee hat seinen Ursprung in einem winzigen Körnchen Wahrheit. Ich hege schon lange den Verdacht, dass das Klischee des selbstgefälligen, blasierten, streitsüchtigen Dieners in Fergus seinen Ursprung hatte.
Alt genug ist der faltige Bastard jedenfalls.
Er richtet sich neben meinem Bett zu voller Größe auf, zumindest, soweit sein gekrümmtes, uraltes Rückgrat es zulässt. «Das wurde auch Zeit. Glauben Sie etwa, ich habe nichts Besseres zu tun, als abzuwarten, bis Hoheit geruhen aufzuwachen? Ich war kurz davor, Sie zu treten.»
Er übertreibt. In Bezug darauf, dass er Besseres zu tun hätte – nicht, was den Tritt betrifft. Der ist ihm zuzutrauen.
Ich liebe mein Bett. Es war ein Geschenk zum achtzehnten Geburtstag vom König von Genovia. Ein Kunstwerk mit vier gedrechselten Säulen, im sechzehnten Jahrhundert aus einem einzigen Stück brasilianischen Mahagonis gefertigt, dunkel und warm glänzend. Die Bettdecke ist mit ungarischen Gänsedaunen gefüllt, der Bezug aus feinster ägyptischer Baumwolle – und ich habe nur den einen Wunsch, mich umzudrehen und mich darunter zu verstecken wie ein Schulkind, das sich weigert aufzustehen.
Doch Fergus’ krächzende Zurechtweisung schabt an meinem Trommelfell wie Sandpapier.
«Sie werden in fünfundzwanzig Minuten im Grünen Salon erwartet.»
Mich unter der Bettdecke zu verstecken ist keine Option. Das rettet einen weder vor furchteinflößendem Personal noch vor einem prallen Terminkalender.
Manchmal glaube ich, ich bin schizophren. Dissoziativ. Eine gespaltene Persönlichkeit. Das wäre nicht ungewöhnlich. In königlichen Stammbäumen tummeln sich alle möglichen Arten von Gestörten – Bluter, Insomniker, Wahnsinnige … Rothaarige. Wahrscheinlich sollte ich froh sein, nicht in eine dieser Kategorien zu fallen.
Mein Problem sind Stimmen. Und zwar höre ich nicht fremde Stimmen – es sind eher Eigenproduktionen: Worte, die in krassem Gegensatz zu dem stehen, was ich sage. Denn ich sage im Grunde nie, was ich denke. Manchmal ist mein Kopf so randvoll mit fiesen Entgegnungen, dass es mir eigentlich zu den Ohren rauskommen müsste. Aber es ist vermutlich besser so. Ich denke nämlich, dass die meisten Menschen Vollidioten sind.
«Hier sind wir wieder für Sie, live aus dem Palast, und sprechen heute mit Seiner Königlichen Hoheit, Prinz Nicholas.»
Wo wir gerade von Idioten reden … Der schmächtige Brillenträger mit dem schütteren Haar, der mir im Grünen Salon gegenübersitzt und dieses weltbewegende Fernsehinterview führt, ist Teddy Littlecock. Kein Witz. Er heißt wirklich Teddy Kleiner Schwanz. Und nach allem, was ich gehört habe, ist sein Name kein Oxymoron. Es muss schlimm gewesen sein, mit so einem Namen zur Schule zu gehen. Er könnte einem fast leidtun. Aber nur fast. Denn Littlecock ist Journalist – und gegenüber Journalisten hege ich ganz besonderen Abscheu. Die Medien glauben, es sei ihre Aufgabe, die Mächtigen vornüberzubeugen und ihnen ihre Verfehlungen in die adeligen Ärsche zu rammen. Was in gewisser Weise in Ordnung ist – die meisten Aristokraten sind wirklich Arschlöcher erster Güte; das ist allgemein bekannt. Aber oft genug passiert es unverdient und hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Ist nirgendwo schmutzige Wäsche zu finden, zerren die Medien, ohne mit der Wimper zu zucken, ein frisch-gestärktes Oberhemd durch den Dreck und fabrizieren ihre Schmutzwäsche selbst. Journalistische Integrität ist auch so ein Oxymoron. So was gibt’s nicht.
Der gute alte Teddy ist übrigens nicht irgendein Reporter – er ist offizieller Hofberichterstatter. Das bedeutet, der kleine Schwanz hat direkten Zugang zu uns – siehe dieses Interview – und stellt im Gegenzug die dümmsten, langweiligsten Fragen der Welt. Es ist nervtötend.
«Wie verbringen Sie Ihre Freizeit? Welchen Hobbys gehen Sie nach?»
Verstehen Sie, was ich meine? Es ist wie bei den Busenwunder-Interviews im Playboy: «Ich liebe Schaumbäder, Kissenschlachten und ausgedehnte Nacktspaziergänge am Strand.» Nein. Tut sie nicht. Aber die Fragen dienen ja auch nicht der Information, sondern dazu, die Phantasien der Typen anzustacheln, die ihre Fotos als Wichsvorlage benutzen.
Ich mache es genauso. Ich grinse und zeige meine Grübchen – Frauen werden bei meinen Grübchen ganz schwach.
«Ich lese gerne. Meistens abends.»
Ich ficke gerne. Eine Antwort, die meine Fans mit Sicherheit viel lieber hören würden. Doch wenn ich das sage, würde der sowieso stets besorgte Hof den Verstand verlieren. Aber zurück zum Ficken. Ich mag es lange, hart und oft. Die Hände um einen niedlichen, strammen Hintern gelegt, besorge ich es ihr so lange, bis ihr Stöhnen von den Wänden widerhallt und sie, mit meinem Schwanz in ihrer Muschi, zuckend kommt. Diese alten Gemäuer haben eine phantastische Akustik.
Während viele Männer Frauen suchen, deren Muschi rund um die Uhr geöffnet hat, bevorzuge ich solche, die in der Lage sind, rund um die Uhr die Klappe geschlossen zu halten. Diskretion und eine absolut wasserdichte Geheimhaltungsvereinbarung halten die meisten schmutzigen Wahrheiten aus den Zeitungen raus.
«Außerdem mag ich Reitsport, Polo und nachmittags ab und zu ein bisschen Tontaubenschießen mit der Queen.»
Außerdem stehe ich auf illegale Autorennen, Freeclimbing, Fliegen, guten Scotch, B-Movies und ab und zu einen zynischen Wortwechsel mit der Queen.
Vor allem Letzteres hält die alte Schachtel bei wachem Verstand – meine scharfe Zunge ist ihr Jungbrunnen. Abgesehen davon ist es eine gute Übung für uns beide. Wessco ist eine konstitutionelle Monarchie, und im Gegensatz zu unseren auf zeremonielle Funktionen reduzierten Nachbarn ist die Königin neben dem Parlament gleichberechtigter Teil der Regierung. Das macht die Mitglieder der königlichen Familie automatisch zu Politikern. Und Politik ist ein schnelllebiges, schmutziges, schrilles Geschäft, bei dem jeder Schreihals sich dessen bewusst ist, dass er zum Faustkampf am besten ein gutgewetztes Messer mitbringt.
Ich verschränke lässig die Arme vor der Brust und bringe meine wohlgebräunten, muskulösen Unterarme unter den hochgerollten Ärmeln des blassblauen Maßhemdes zur Geltung. Es heißt, meine Unterarme hätten auf Twitter eine eigene Fangemeinde – so wie ein paar andere Körperteile von mir. Dann erzähle ich Littlecock die Geschichte meiner ersten Schießübung. Meine Fans lieben diese Geschichte. Ich könnte sie im Schlaf runterbeten, und so ähnlich fühlt es sich auch an. Am Ende lacht Terry verhalten – an der Stelle, als mein ungezogener kleiner Bruder Henry das Abschussgerät statt mit einer Tontaube mit einem Kuhfladen bestückte.
Danach rückt Littlecock die Brille zurecht und gibt damit das Signal, dass es ernst wird. «Dieses Jahr im Mai jährt sich zum dreizehnten Mal der tragische Flugzeugunfall, bei dem der Prinz und die Prinzessin von Pembrook ums Leben kamen.»
Sag bloß. Ich nicke stumm.
«Denken Sie oft an Ihre Eltern?»
Das geschnitzte Teakarmband liegt schwer um mein Handgelenk. «Ich habe viele glückliche Erinnerungen an meine Eltern. Von größter Bedeutung ist jedoch für mich, dass sie durch ihr Wirken weiterleben, durch ihre Wohltätigkeit, durch die Stiftungen, die ihren Namen tragen. Das ist ihr Vermächtnis. Ich werde dafür Sorge tragen, dass meine Eltern über die Stiftungen, die sie zu ihren Lebzeiten gründen konnten, für immer im Gedächtnis der Menschen bleiben.»
Worte, Worte, Worte. Bla, bla, bla. Das kann ich wirklich gut.
Es vergeht kein einziger Tag, an dem ich nicht an meine Eltern denke. Aber emotional zu sein liegt uns nicht – stets aufrecht, lautet die Devise, immer wacker voran, der König ist tot – lang lebe der König. Doch während meine Eltern für die Welt das Thronfolgerpaar von Wessco waren, waren sie für Henry und mich schlicht und ergreifend Mum und Dad. Sie waren herzlich und lustig und sehr, sehr real. Sie nahmen uns oft in den Arm. Sie waren klug und freundlich und liebten uns sehr – und das ist in unseren Kreisen etwas sehr Besonderes.
Teddy hat wieder angefangen zu reden. Ich höre nicht zu, aber das muss ich auch nicht – es reicht, die letzten Worte mitzukriegen. «… Lady Esmerelda letztes Wochenende?»
Ich kenne Ezzy seit unserer Schulzeit in Briar House. Sie ist schwer in Ordnung – laut und rüpelhaft. «Lady Esmerelda und ich sind alte Freunde.»
«Nur Freunde?»
Nun, die Tatsache, dass Ezzy überzeugte Lesbe ist, will ihre Familie mit allen Mitteln aus der Presse heraushalten. Ich bin ihr Lieblingsalibi. Unsere Dates, von denen wir beide profitieren, werden über die Koordinierungsstelle des Palastes arrangiert.
Ich lächle charmant. «Ich bin der Diskretion verpflichtet.»
Teddy beugt sich vor, nimmt Witterung auf, ahnt eine Story. Die Story. «Gehe ich recht in der Annahme, dass sich da möglicherweise etwas Ernsteres zwischen Ihnen anbahnt? Damals hat das ganze Land an der Liebesgeschichte Ihrer Eltern Anteil genommen. Die Menschen warten gespannt auf Sie, Prinz Nicholas. Das Volk brennt darauf, dass ‹His Royal Hotness›, wie Sie in den sozialen Netzwerken genannt werden, endlich die Frau seines Herzens trifft und sesshaft wird.»
Ich zucke die Achseln. «Nichts ist unmöglich.»
Aber das schon. Ich werde in absehbarer Zukunft garantiert nicht sesshaft. Da kann Littlecock seinen kleinen Schwanz drauf verwetten.
Sobald der heiße Strahl des Schweinwerfers erlischt und das rote Aufnahmelämpchen der Kamera blinkend ausgeht, stehe ich auf und nehme den Mikrophonclip vom Kragen.
Teddy erhebt sich ebenfalls. «Vielen Dank für Ihre Zeit, Hoheit.» Er deutet mit leichtgeneigtem Hals eine Verbeugung an – exakt nach Protokoll.
Ich nicke. «War mir ein Vergnügen, Littlecock.»
Das hat garantiert noch keine Frau zu ihm gesagt.
Bridget, meine Privatsekretärin – eine supertüchtige und bestens organisierte Frau mittleren Alters –, taucht mit einer Flasche Wasser neben mir auf.
«Danke sehr.» Ich drehe den Schraubverschluss auf. «Wer kommt jetzt?»
Die Palaststrategen waren der Meinung, die Zeit sei günstig für eine kleine PR-Kampagne – das bedeutet Tage, randvoll mit Interviews, Reisen und Fotoshootings. Mein ganz persönlicher vierter, fünfter und sechster Ring der Hölle.
«Teddy war für heute der Letzte.»
«Dem Himmel sei Dank!»
Im Gleichschritt eilen die korpulente Frau und ich über den mit Teppich ausgelegten Flur, der zu Guthrie House führt – meinem Privatflügel im Residenzpalast von Wessco.
«Lord Ellington wird in Kürze eintreffen. Die Vorbereitungen für ein Abendessen im Bon Repas sind getroffen.»
Mit mir befreundet zu sein ist härter, als man glaubt. Mit mir kann man sich nicht einfach mal kurz auf ein Bier treffen oder an einem Freitagabend im neuesten Club aufkreuzen. Diese Dinge müssen genau geplant und strikt durchorganisiert werden. Spontanität ist der einzige Luxus, der für mich unerreichbar bleibt.
«Gut.»
Damit biegt Bridget in Richtung Verwaltungsflügel ab, und ich betrete meine Privatgemächer. Drei Stockwerke, eine ultramoderne Küche, ein Morgensalon, eine Bibliothek, zwei Gästezimmer, Dienstbotenquartiere, zwei herrschaftliche Suiten mit Balkonen und atemberaubendem Blick über die Ländereien. Alles vollständig restauriert und modernisiert – wobei Mauerwerk, Farbgestaltung, Tapeten und Einrichtung die historische Integrität bewahren. Guthrie House ist die offizielle Residenz des Prinzen oder der Prinzessin von Pembrook – der Nummer eins in der Thronfolge von Wessco. Vor mir war Guthrie House die Residenz meines Vaters und davor die meiner Großmutter. Royals sind grundsätzlich ganz groß im Vererben von abgelegten Dingen.
Ich gehe nach oben in mein Schlafzimmer und knöpfe mir in Vorfreude auf den prickelnd heißen Wasserstrahl aus acht Duschköpfen das Hemd auf. Meine Dusche ist der Knaller.
Doch so weit komme ich nicht.
Fergus erwartet mich am Ende der Treppe. «Sie wünscht, Sie zu sehen», krächzt er. Sie bedarf keiner weiteren Erklärung. Ich fahre mir mit der Hand über das Gesicht und den dunklen Fünf-Uhr-Bartschatten auf meinem Kinn.
«Wann?»
«Was glauben Sie denn?», spöttelt Fergus. «Gestern. Wann sonst?»
Natürlich.
In den guten alten Zeiten galt der Thron als Symbol der Macht des Monarchen. Auf alten Gemälden ist er manchmal mit der aufgehenden Sonne im Hintergrund dargestellt, Wolken und Sterne darunter – der Sitz eines Abkömmlings von Gott persönlich. War der Thron Wahrzeichen der Macht, so war der Thronsaal jener Ort, an dem diese Macht ausgeübt wurde. Hier wurden Dekrete erlassen, Strafen verhängt und Todesurteile gesprochen.
Früher.
Heute wird die echte Arbeit im Royal Office erledigt – der Thronsaal wird nur noch für Touristenführungen geöffnet. Der Schreibtisch ist der Thron von heute. Je größer, desto mächtiger; daran zumindest hat sich nichts geändert. Im Augenblick sitze ich vor einem glänzenden, soliden Mahagonischreibtisch von grotesker Größe. Wäre meine Großmutter ein Mann, würde ich ihr unterstellen, dass sie versucht, etwas zu kompensieren.
Christopher, der Privatsekretär Ihrer Majestät, bietet mir Tee an, doch ich winke ab. Er ist jung, etwa dreiundzwanzig, und hat die Figur eines Actionfilmstars. Er macht sich als Sekretär nicht schlecht, auch wenn er nicht der Hellste ist. Ich glaube ja, meine Großmutter hält ihn sich vor allem zum Vergnügen – sie genießt seinen Anblick, das verdorbene alte Mädchen. Ich vermute, wenn sie ihm befehlen würde, für den Rest seines Lebens nichts als Fliegen zu essen, würde er fragen, Flügel dranlassen oder abmachen? Das ist echte Ergebenheit, Leute.
Mit einem Mal öffnet sich die Tür zum angrenzenden Blauen Salon, und Ihre Majestät Königin Lenora steht im Türrahmen.
Im kolumbianischen Regenwald existiert eine indigene Affenart, deren Vertreter zu den niedlichsten Tieren gehören, die man sich vorstellen kann – sie sind putziger als sämtliche Hamster und Hündchen, die das Internet zu bieten hat. Solange man nichts weiß von den verborgenen rasierklingenscharfen Zähnen und ihrem Appetit auf menschliche Augäpfel. Wer sich von dem entzückenden Äußeren der Biester blenden lässt, hat so gut wie verloren.
Meine Großmutter ist diesen bösartigen kleinen Äffchen ziemlich ähnlich. Sie sieht aus wie eine Großmama aus dem Bilderbuch. Klein und zierlich, mit weichem, fluffigem Haar, zarten Händen, schimmernder Perlenkette, feinen Lippen, die auch über schmutzige Witze lachen können, und einem faltigen Gesicht, das große Altersweisheit ausstrahlt. Es sind ihre Augen, die sie verraten.
Ihre geschützmetallgrauen Augen.
Augen, die früher ganze Armeen in die Flucht geschlagen hätten.
«Nicholas.»
Ich stehe auf und verbeuge mich. «Großmutter.»
Sie rauscht an Christopher vorbei, ohne ihn eines Blickes zu würdigen. «Lassen Sie uns allein.»
Ich setze mich, nachdem sie sich gesetzt hat, den Knöchel über das Knie gelegt, den Arm lässig um die Stuhllehne geschlungen.
«Ich habe dein Interview gesehen», sagt sie. «Du solltest mehr lächeln. Du warst früher so ein fröhlicher Junge.»
«Ich werde mich bemühen, daran zu denken, Fröhlichkeit vorzutäuschen.»
Sie wendet sich dem Computer auf dem Schreibtisch zu und fängt an zu tippen. «Hast du die Abendschlagzeilen gelesen?»
«Nein. Noch nicht.»
Sie dreht den Bildschirm zu mir herum. Dann klickt sie zügig durch die Nachrichtenwebsites.
PARTYPRINZ FEIERT IN PLAYBOY-VILLA
HENRY, DER HENGST
ROYAL AUF SEXTOUR
WILD, WOHLHABEND UND KEIN BISSCHEN WASSERSCHEU
Die letzte Schlagzeile ist mit einem eindeutigen Foto von meinem Bruder versehen, der gerade in einen Swimmingpool springt – nackt, wie Gott ihn geschaffen hat.
Ich beuge mich blinzelnd vor. «Henry wird ausrasten. Die Beleuchtung ist absolut unvorteilhaft – man kann seine Tätowierung kaum erkennen.»
Die Lippen meiner Großmutter werden schmal. «Findest du das etwa witzig?»
Vor allem finde ich es lästig. Henry ist unreif und unmotiviert. Er lässt sich durchs Leben treiben wie eine Feder. Wohin die Brise ihn weht, ist ihm völlig gleichgültig. Ich zucke die Achseln. «Er ist vierundzwanzig, er hat gerade seinen Wehrdienst hinter sich gebracht …» Jeder Bürger von Wessco – ob männlich, weiblich oder königlich – muss zwei Jahre Dienst an seinem Volk ableisten.
«Die Entlassung aus dem Dienst liegt Monate zurück», fällt sie mir ins Wort. «Und seitdem reist er mit achtzig Huren um die Welt!»
«Hast du versucht, ihn anzurufen?»
«Natürlich.» Sie schnalzt mit der Zunge. «Er geht ans Telefon, macht alberne Geräusche und behauptet, der Empfang sei schlecht und er könne mich nicht hören. Dann sagt er, er liebt mich, und legt auf.»
Ich muss unwillkürlich grinsen. Der Rotzlöffel ist witzig – das muss man ihm lassen.
Die Augen der Queen werden dunkel. «Henry befindet sich momentan in Las Vegas und plant offenbar, in Kürze nach New York weiterzureisen. Ich möchte, dass du in die USA fliegst und ihn nach Hause holst, Nicholas. Es ist mir gleich, ob du ihm dazu eins über den Schädel ziehen und ihn in einem Kartoffelsack herschleifen musst. Der Junge muss dringend zur Vernunft gebracht werden.»
Ich habe so gut wie alle Großstädte dieser Erde bereist – und hasse keine so sehr wie New York.
«Mein Terminkalender …»
«Es ist bereits alles arrangiert. Du wirst dort ein paar Empfänge absolvieren. Ich werde hier gebraucht.»
«Ich vermute, du wirst inzwischen das House Of Commons bearbeiten? Die Typen da dazu überreden, endlich ihren Job zu machen?»
«Ich bin froh, dass du das Thema ansprichst.» Großmutter verschränkt die Arme. «Weißt du, was mit einer Monarchie passiert, die keine stabile Thronfolge hat, mein Junge?»
Ich kneife misstrauisch die Augen zusammen. «Ich habe Geschichte studiert – selbstverständlich weiß ich das.»
«Ich höre.»
Ich hebe die Schultern. «Ohne einen anerkannten Erben entsteht ein Machtvakuum. Unterschiedliche Adelshäuser könnten versuchen, es auszufüllen, die Gefahr eines Umsturzes besteht. Das kann bis zu einem Bürgerkrieg führen …» Mir stellen sich die Nackenhärchen auf. Meine Hände werden schweißnass; dieses Gefühl, das man bekommt, kurz bevor man den ersten Gipfel der Achterbahn erreicht hat. «Worauf willst du hinaus, Großmutter? Wir haben eine eindeutige Thronfolge. Sollten Henry und ich durch irgendeine Katastrophe dahingerafft werden, gibt es immer noch Vetter Marcus.»
«Vetter Marcus ist ein Schwachkopf. Er hat eine Schwachsinnige geheiratet. Seine Kinder sind doppelt zum Schwachsinn verdammt. Sie werden dieses Land niemals regieren.» Sie rückt sich die Perlenkette zurecht und reckt das Kinn. «Es gibt Gerüchte, das Parlament strebe an, uns in eine parlamentarische Monarchie zu verwandeln.»
«Gerüchte gibt es immer.»
«Aber nicht in dieser Vehemenz», entgegnet sie scharf. «Diesmal ist es anders. Sie führen die Außenwirtschaft ins Feld, die steigende Arbeitslosenquote, zu niedrige Löhne.» Sie tippt auf den Bildschirm. «Da sind solche Schlagzeilen wenig hilfreich. Die Leute haben Zukunftsängste, während ihr Prinz fröhlich seinem Luxusleben frönt. Wir müssen der Presse dringend etwas Positives liefern. Wir müssen den Menschen Grund zum Feiern geben. Und wir müssen dem Parlament beweisen, dass wir die Dinge absolut unter Kontrolle haben.»
Ich nicke. Wie eine dämliche Motte, die direkt auf die Flamme zu taumelt. «Wie wäre es mit einem Feiertag zu Ehren des Königshauses?», schlage ich vor. «Wir könnten die Ballsäle fürs Volk öffnen und eine Parade abhalten. Die Leute lieben so was.»
Sie tippt sich gegen das Kinn. «Ich hatte etwas anderes im Sinn … etwas Größeres. Etwas, das die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf sich zieht. Das Jahrhundertereignis.» Ihre Augen blitzen vor Vorfreude – sie sieht aus wie der Henker vor dem Schwingen der Axt.
Und dann fällt sie nieder, die Axt.
«Die Hochzeit des Jahrhunderts.»
2
Mein ganzes System verfällt in Schockstarre. Ich glaube, meine Organe versagen. Meine Stimme ist rau vor sinnloser, unlogischer Hoffnung.
«Will Großtante Miriam wieder heiraten?»
Die Königin verschränkt die Hände auf dem Tisch. Ein schreckliches Zeichen. Es bedeutet, ihre Meinung steht fest, und nichts kann sie von ihrem Kurs abbringen.
«Als du ein kleiner Junge warst, habe ich deiner Mutter versprochen, dass ich dir den Freiraum geben werde, dir deine Frau selbst auszusuchen, so wie deinem Vater einst. Den Freiraum, dich zu verlieben. Also habe ich zugesehen und gewartet, aber jetzt ist Schluss mit der Warterei. Deine Familie braucht dich. Dein Land braucht dich, Nicholas. Und deshalb wirst du auf einer Pressekonferenz den Namen deiner Verlobten verkünden … und zwar am Ende dieses Sommers.»
Ihre Erklärung reißt mich aus der Schockstarre, und ich springe auf. «Das sind gerade mal fünf verfluchte Monate!»
Sie zuckt die Achseln. «Ich wollte dir dreißig Tage geben. Du kannst dich bei deinem Großvater bedanken. Er hat es mir ausgeredet.»
Ich blicke hoch zu dem Porträt ihres Mannes an der Wand hinter ihr. Mein Großvater ist seit zehn Jahren tot.
«Vielleicht solltest du dir weniger Sorgen um mein Privatleben machen», sage ich, «und stattdessen lieber darüber nachdenken, was geschieht, wenn die Presse herausfindet, dass du mit Gemälden sprichst.»
«Die Gespräche mit ihm trösten mich.» Sie erhebt sich ebenfalls. Die Hände auf den Tisch gestützt, fügt sie nach vorn gebeugt hinzu: «Außerdem spreche ich nur zu diesem einen Bild – sei nicht so garstig, Nicky.»
«Ich kann nicht anders.» Ich sehe sie herausfordernd an. «Ich hatte den allerbesten Lehrmeister.»
Sie ignoriert den Seitenhieb und nimmt wieder Platz. «Ich habe dir eine Liste geeigneter junger Damen zusammengestellt – einige kennst du bereits, andere nicht. Dies ist für uns die beste Vorgehensweise, es sei denn, du hast deine Wahl bereits getroffen.»
Tja. Mir fällt dazu nichts ein. Politisch und PR-mäßig hat sie recht – eine königliche Hochzeit schlägt sämtliche Fliegen mit einer Klappe.
«Ich will nicht heiraten.»
Sie zuckt die Achseln. «Ich mache dir keinen Vorwurf. Ich wollte die Tiara deiner Ur-Urgroßmutter Königin Belvidere an meinem einundzwanzigsten Geburtstag auch nicht aufsetzen – das Ding ist unförmig und viel zu schwer. Doch wir müssen alle unsere Pflicht tun. Das weißt du. Und jetzt ist die Reihe an dir, Prinz Nicholas.» Das ist nicht die Bitte einer Großmutter – es ist der Befehl einer Königin.
Pflicht ist ein Synonym für Mist, so viel weiß ich. Meine Erziehung, in der sich von Anfang an alles nur um Verantwortung, Vermächtnis, Geburtsrecht und Ehre drehte, macht jeden Widerspruch unmöglich. Ich brauche Alkohol. Sofort. Verfluchter Mist!
«Ist das alles, Eure Hoheit?»
Sie starrt mich ein paar Sekunden lang wortlos an, dann nickt sie. «Ja. Das ist alles. Ich wünsche dir eine gute Reise. Wir unterhalten uns, wenn du zurück bist.»
Ich erhebe mich, neige den Kopf und wende mich zum Gehen. Kurz bevor die Tür sich hinter mir schließt, höre ich ein Seufzen. «Oh, Edward, sag mir, was haben wir falsch gemacht? Wieso sind sie nur so schwierig?»
Eine Stunde später sitze ich im Wohnzimmer von Guthrie House vor dem Kamin und reiche Fergus das leere Glas zum Nachfüllen. Zum wiederholten Nachfüllen.
Nicht dass ich nicht wüsste, was von mir erwartet wird – das weiß die ganze Welt. Ich habe nur einen Job: meine königlichen Gene an die nächste Generation weiterzugeben. Einen Erben zu zeugen, der mich eines Tages ersetzen wird, so, wie ich meine Großmutter ersetzen werde.
Trotzdem hat sich das bis jetzt immer so theoretisch angefühlt. Irgendwann, in ferner Zukunft. Die Königin hat eine Rossnatur und wird in absehbarer Zeit nirgendwo hingehen. Aber nun das! Eine Hochzeit … Jetzt ist der Mist plötzlich real geworden.
«Da steckst du!»
Die Menschen, denen ich wirklich vertraue, lassen sich an einer Hand abzählen – Simon Barrister, vierter Graf von Ellington, ist einer davon. Er begrüßt mich mit einer Umarmung, einem heftigen Schlag auf den Rücken und einem strahlenden Lächeln. Und das ist wörtlich gemeint: Sein Gesicht leuchtet tomatenrot.
«Was zum Teufel ist mit dir passiert?»
«Die verfluchte Karibiksonne hatte es auf mich abgesehen. Trotz höchstem Sonnenschutzfaktor hat sie mich gegrillt!» Er rempelt mich an. «Hat die Flitterwochen jedenfalls bereichert, Wund- und Brandgel hat nämlich durchaus sinnliche Seiten, wenn du weißt, was ich meine.»
Simon hat letzten Monat geheiratet. Ich war an seiner Seite – auch wenn ich vorher Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hatte, ihm die Sache auszureden.
Er verfügt über ein großes Herz und ein brillantes Gehirn, aber bei Frauen hatte Simon es nie leicht. Die roten Haare, der blasse Teint und der Rettungsring um die Taille, dem weder Tennis noch Radfahren etwas anhaben können, sind auch nicht unbedingt hilfreich. Doch dann kreuzte Frances Alcott seinen Weg. Franny mag mich nicht und ich sie nicht. Sie ist atemberaubend – das muss man ihr lassen: dunkle Haare, braune Augen, ein Engelsgesicht und die Haut einer Porzellanpuppe. Sie scheint mir eine dieser Puppen zu sein, deren Kopf sich einmal um die eigene Achse dreht, ehe sie dich unters Bett zerrt, um dich zu erwürgen.
Fergus bringt Simon einen Drink, und wir setzen uns.
«Was hab ich gehört? Hoheit hat in Sachen Heirat endlich den Hammer fallen lassen?»
Die Eiswürfel klimpern in meinem Glas, als ich den Inhalt hinunterstürze. «Das ging schnell.»
«Du weißt doch, wie es ist. Die Wände haben Ohren und riesengroße Mäuler. Und? Wie lautet der Plan, Nick?»
Ich hebe mein Glas. «Rapider Absturz in den Alkoholismus.» Ich zucke die Achseln. «Ansonsten? Kein Plan.» Ich drücke ihm die Unterlagen in die Hand. «Sie hat eine Liste potenzieller Kandidatinnen für mich zusammengestellt. Ist das nicht nett?»
Simon blättert durch die Seiten. «Könnte lustig werden. Du könntest sie vorsprechen lassen – wie bei X Factor: ‹Und wie steht es mit Ihren Doppel-D-Qualitäten?›»
Ich dehne meinen verspannten Nacken. «Zur Krönung des Tages müssen wir auch noch nach scheiß New York fliegen und Henry an die Leine legen.»
«Ich weiß wirklich nicht, weshalb du New York so hasst – gute Shows, tolles Essen, Models mit meterlangen Beinen.»
Meine Eltern waren auf dem Rückweg aus New York, als ihr Flugzeug abstürzte. Es ist kindisch und dumm, das weiß ich selbst – aber was soll ich sagen? Ich hege einen persönlichen Groll gegen die Stadt.
Simon hebt die Hand. «Moment mal. Wir? Wir müssen nach New York fliegen? Was willst du mir damit sagen?»
«Männerausflug. Geteiltes Leid ist halbes Leid.»
Außerdem schätze ich Simons Meinung und sein Urteilsvermögen. Wären wir bei der Cosa Nostra, er wäre mein Consigliere.
Versonnen blickt er in sein Glas, als enthielte es die Geheimnisse der Welt – und die der Frauen. «Das wird Franny aber gar nicht gefallen.»
«Dann bringst du ihr eben ein bisschen Glitzerkram aus eurem Laden mit.»
Simons Familie ist im Besitz von Barrister’s, der größten Kaufhauskette der Welt.
«Außerdem habt ihr gerade einen ganzen Monat miteinander verbracht. Du musst die Nase voll von ihr haben.» Nicht dass ich diesbezüglich groß Erfahrung hätte, aber ich war immer schon der Meinung, das Geheimnis einer langen, erfolgreichen Beziehung besteht darin, sich regelmäßig rar zu machen. Das hält die Dinge frisch und lebendig – weil sich die ansonsten unausweichliche Langeweile gar nicht erst breitmachen kann.
«In einer Ehe gibt es keine Auszeiten, Nick.» Er kichert. «Wie du schon bald selbst feststellen wirst.»
Ich halte ihm den Mittelfinger hin. «Vielen Dank für dein Mitgefühl.»
«Dazu sind Freunde da.»
Ich leere mein Glas. Schon wieder. «Dinner ist übrigens gestrichen. Mir ist der Appetit vergangen. Ich habe den Leibwächtern gesagt, dass wir den Rest des Abends im Goat verbringen.»
Das Horny Goat ist ein Pub im ältesten, aus Holz erbauten Haus der Stadt. Einst war das Horny Goat das Freudenhaus des zum Schloss gehörigen Ortes, in dem Soldaten und Dienstboten lebten. Die Wände sind schief und das Dach undicht, doch für mich ist es das beste Pub im ganzen Land. Ich habe keine Ahnung, wie Macalister, der Besitzer, es anstellt, ob durch Erpressung oder Bestechung – jedenfalls ist nach einer Nacht, die ich oder mein Bruder im Goat verbrachten, noch nie eine Geschichte zur Presse durchgesickert.
Und die Nächte dort können ziemlich wild sein.
Als der Wagen vor dem Goat vorfährt, sind Simon und ich bereits sturzbetrunken. Logan St. James, Chef meiner persönlichen Leibgarde, öffnet die Wagentüren und scannt gleichzeitig die Umgebung.
Im Goat stinkt es nach abgestandenem Bier und Rauch, doch auf mich wirkt dieser Geruch so tröstlich wie der von Plätzchen, frisch aus dem Ofen. Die Decke ist niedrig, und der Boden klebt. Auf der kleinen Bühne im hinteren Teil des Ladens steht eine Karaoke-Box, vor der sich ein blondes Mädchen zum neusten Adele-Song wiegt. Simon und ich setzen uns an die Theke, und Meg, Macalisters Tochter, wischt sie mit einem anzüglichen Lächeln für uns ab.
«Guten Abend, Hoheit.» Simon kriegt ein Nicken und ein nicht ganz so erotisches Lächeln. «Lord Ellington.» Dann ruhen ihre hellbraunen Augen sofort wieder auf mir. «Ich habe dich heute Nachmittag im Fernsehen gesehen. Du sahst gut aus.»
«Danke sehr.»
Sie schüttelt ganz leicht den Kopf. «Ich wusste gar nicht, dass du gerne liest. Lustig. Ich habe bei dir noch nie auch nur ein einziges Buch gesehen.»
Meg ist mehr als einmal mit meinem Schwanz in ihrer zuckenden Muschi gekommen. Eine von ihr unterschriebene Geheimhaltungsvereinbarung liegt sicher verwahrt in meinem Wandtresor. Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich Meg niemals damit konfrontieren muss, aber man weiß ja nie. Das erste «Aufklärungsgespräch» zwischen meinem Vater und mir handelte nicht von Blümchen und Bienen, sondern davon, dass es immer besser ist, eine Geheimhaltungsvereinbarung zu besitzen, die man nicht braucht, als eine zu brauchen, die man nicht hat.
Ich grinse. «Du warst ja auch nicht zum Vorlesen bei mir, Süße.»
Frauen, die von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck leben, können besser mit unverbindlichem Sex umgehen als Frauen aus meinen Kreisen. Die weiblichen Mitglieder des Adels sind verwöhnt, fordernd – schließlich haben sie immer alles bekommen, was sie wollten – und reagieren auf Zurückweisung schnell mal mit Rachsucht. Mädchen wie meine hübsche Barfrau dagegen wissen, dass die Dinge nun mal so sind, wie sie sind.
Meg lächelt – warmherzig und wissend. «Was möchtest du trinken? Das Übliche?»
Gar keine so leichte Frage. Keine Ahnung, ob es an dem vollen Tag liegt oder an dem Scotch, den ich mir bereits reichlich hinter die Binde gekippt habe, jedenfalls schießt mir plötzlich das Adrenalin durch die Adern, und mein Herz schlägt schneller. Die Erkenntnis trifft mich wie ein Schlag: Die Königin hat mich an den Eiern, mir bleibt nur wenig Zeit.
Deshalb liegt die Antwort glasklar auf der Hand: «Nein, Meg. Ich möchte heute mal was anderes – was völlig Neues. Überrasch mich.»
Wenn die Welt, die ich kenne – das Leben, wie ich es kenne –, in fünf Monaten für immer vorbei ist, sollte ich aus der Zeit, die mir bleibt, das Beste machen. Solange ich noch kann, werde ich es treiben, so wild es geht – und zwar mit allen. Bis meine Zeit dann abgelaufen ist.
Sieht so aus, als hätte ich einen Plan.
3
Tage, die das Leben verändern, passieren normalen Menschen so gut wie nie. Ich meine, kennen Sie etwa wen, der im Lotto gewonnen hat, beim Einkaufen von einem Schauspielagenten entdeckt wurde oder von einer lange verloren geglaubten, verstorbenen Großtante eine schuldenfreie, einzugsbereite Villa geerbt hat?
Ich auch nicht.
Die Sache ist nur die: Wenn für die wenigen vom Glück Geküssten tatsächlich so ein Tag anbricht, geschieht es unbemerkt. Wir wissen nicht, dass das, was in diesem Augenblick passiert, episch ist, monumental, lebensverändernd. Erst im Nachhinein – wenn alles perfekt ist oder endgültig in Stücke gebrochen –, wenn wir zurückschauen, erkennen wir den Augenblick, der unsere Geschichte und unser Herz in zwei Teile geteilt hat – in ein Vorher und ein Nachher. Im Nachher hat sich nicht nur unser Leben verändert. Wir haben uns verändert. Für immer.
Ich weiß, wovon ich rede. Der Tag, der mein Leben veränderte, war nämlich einer dieser Tage. Einer von den ganz miesen. Normale Menschen haben ständig solche Tage.
Es fängt damit an, dass ich die Augen aufschlage – vierzig Minuten zu spät. Mistwecker! Der müsste ja wohl wissen, dass mit vier Uhr nicht vier Uhr nachmittags, sondern vier Uhr morgens gemeint ist. Wer zum Teufel darf bis vier Uhr nachmittags pennen? Niemand. Google sollte lieber mal den Arsch hochkriegen und sich um selbstdenkende Wecker kümmern als um selbstfahrende Autos.
Die Abwärtsspirale meines Tages setzt sich fort, indem ich mich im Halbschlaf in die einzigen Klamotten stürze, die ich zurzeit überhaupt trage: meine Arbeitskluft. Weiße Bluse, verwaschener schwarzer Rock, fädenziehende Nylonstrumpfhosen. Ich zwinge meinen Schopf nicht zu bändigender Haare in einen Dutt und stolpere mit noch immer halbgeschlossenen Augen nach nebenan in unsere Miniküche. Dann schütte ich mir eine extragroße Portion Cinnamon Toast Crunch – die besten Frühstücksflocken der Welt – in die Schüssel, aber als ich mich umdrehe, um die Milch aus dem Kühlschrank zu nehmen, ergreift Bosco, unser Teufelsköter, die Gelegenheit und verschlingt mein Frühstück innerhalb von drei Sekunden.
«Du Mistvieh!», zische ich wütend und möglichst leise, weil meine Schwester und mein Vater erst in ein paar Stunden aufstehen müssen.
Bevor er zu uns kam, war Bosco ein Straßenköter, und so sieht er auch aus. Er hat den Körperbau eines Chihuahua, die weit auseinanderstehenden Augen eines Mops und das braune, struppige Fell eines räudigen Shih Tzu. Er ist so hässlich, dass er schon wieder niedlich ist. Ich frage mich manchmal, ob er das Ergebnis eines perversen Hundedreiers ist. Meine Mutter hat ihn als Welpen in der Gasse hinter unserem Coffee Shop gefunden. Damals war Bosco ein unfassbar verfressenes kleines Wollknäuel, und er würde sich heute noch zu Tode fressen, wenn man ihn ließe.
Ich greife nach der Schachtel, um die Schüssel neu zu füllen – sie ist leer.
«Sehr nett!», sage ich zu Bosco.
Der notorische Dieb sieht mich aus todtraurigen Augen an, springt vom Tresen, auf dem er nicht sein dürfte, lässt sich zur Seite kippen und entblößt reuevoll seinen Bauch.
Die Masche zieht bei mir nicht, das könnte er inzwischen eigentlich wissen. «Los, steh auf! Hast du überhaupt keinen Stolz?»
Nach einem alternativen Frühstück aus Apfel und Toast greife ich nach Boscos rosaroter Glitzerleine – meine Schwester hat sie für ihn gekauft, als hätte das arme Geschöpf nicht schon genug Grund für Komplexe – und mache sie an seinem Halsband fest.
Unser Haus stammt aus den zwanziger Jahren. Es war ursprünglich ein Mehrfamilienhaus, doch um die Zeit, als JFK Präsident wurde, hat man das Erdgeschoss zu einem Restaurant umgebaut. Es gibt eine zweite Treppe, die direkt in die Küche des Coffee Shops führt, aber weil für Bosco dort der Zutritt verboten ist, gehe ich mit ihm zur Vordertür hinaus und die schmalen, grün gestrichenen Stufen zur Straße hinunter.
Heiliger Strohsack, ist das kalt! Damit hatte ich nicht gerechnet. Heute ist offensichtlich einer dieser fiesen Märztage, die immer dann kommen, wenn man sich bereits von milden Temperaturen hat einlullen lassen, in der falschen Annahme, der Winter wäre vorbei. Kaum hat man Pullover, Stiefel und Winterjacken weggepackt, sagt Mutter Natur «Sorry!» und knallt einem den eisigen Nordostwind um die Ohren. Der Himmel ist grau, und es weht ein fieser Wind. Dann springt mir zu allem Überfluss auch noch die hastig zugeknöpfte Bluse auf. Direkt vor den Augen von Pete, dem perversesten Müllmann von ganz Brooklyn. Mein weißer Spitzen-BH könnte durchsichtiger nicht sein, und meine Nippel bezeugen die arktischen Temperaturen in all ihrer Pracht.
«Siehst gut aus, Baby!», brüllt er mir zu und lässt obszön die Zunge wackeln. «Komm schon, lass mich an deinen süßen Dingern saugen! Ein Schuss warme Milch für meinen Kaffee käm mir jetzt gerade recht.»
Igitt!
Er hält sich mit der einen Hand an der Stange des Müllwagens fest und greift sich mit der anderen in den Schritt. Mein Gott! Männer sind echt Schweine! Wäre das hier ein halbwegs anständiger Trashfilm, würde er jetzt in die Klappe stürzen und von der Müllpresse genüsslich zermalmt werden. Leider ist das hier nur mein kleines persönliches Leben.
Aber ich bin New Yorkerin, hier geboren und aufgewachsen, und eine waschechte New Yorkerin kennt in so einem Fall nur eine einzige angemessene Reaktion: «Fick dich!», brülle ich und recke beide Arme mit gestreckten Mittelfingern hoch.
«Jederzeit, Süße!»
Während der Müllwagen weiter die Straße hochrumpelt, lasse ich jede obszöne Geste vom Stapel, die ich kenne. Den Daumen-Schneidezähne-Flip, den Kinnschnipser, die Hörner und den Bizeps-Ellbogen-Handkantenschlag, auch als italienischer Gruß bekannt – so, wie Oma Millie es immer gemacht hat.
Leider lasse ich beim Handkantenschlag die Leine los, und Bosco schießt davon wie ein Höllenhund. Während ich gleichzeitig versuche, mir die Bluse zuzuknöpfen und Bosco hinterherzurennen, habe ich nur einen Gedanken: Misttag! Und dabei ist es noch nicht mal fünf Uhr morgens.
Und das war erst die Spitze des scheiß Eisbergs.
Ich brauche drei Blocks, um den miesen kleinen Ausreißer wieder einzufangen. Als ich endlich zurückkomme, hat es angefangen zu schneien. Winzige Schneeflocken rieseln wie Schuppen vom Himmel.
Früher mochte ich Schnee – eigentlich liebe ich ihn immer noch. Der Schnee deckt alles mit einem Tuch aus funkelnden Kristallen zu, und plötzlich sieht die Welt wieder neu und unberührt aus. Laternen werden zu Skulpturen und die Stadt zum magischen Winterwunderland.
Aber das war früher. Vor den Rechnungen, die bezahlt werden müssen, und vor der Verantwortung für ein Geschäft. Wenn ich jetzt Schnee sehe, denke ich nur daran, dass wieder nichts los sein wird und dass kein Geld in die Kasse kommt … Das einzig «Magische» sind die weggezauberten Kunden.
An der Tür zum Coffee Shop klebt ein roter Zettel. Die Ankündigung einer Zwangsvollstreckung – schon die zweite. Shit! Von den unzähligen Anrufen und E-Mails ganz zu schweigen, die zusammengefasst nur eines sagen: Her mit der Kohle! Tja. Ich hab aber keine Kohle. Alles schon der Bank gegeben. Was jetzt noch reinkommt, geht für Personal und Lieferanten drauf. Ich pflücke den roten Brief von der Tür und bin nur froh, dass ich ihn entdeckt habe, bevor die ersten Kunden auftauchen. Dann gehe ich rauf, um Bosco zurück in die Wohnung zu lassen, und wieder nach unten in die Küche.
Jetzt fängt mein Tag richtig an. Ich schalte den uralten Backofen an und heize ihn auf 200 °C vor. Dann stecke ich mir die Kopfhörer in die Ohren. Meine Mutter war ein Riesenfan der Achtziger – Musik und Filme. So was kommt nie wieder, hat sie immer gesagt. Als kleines Kind saß ich hier in dieser Küche auf einem Hocker und schaute ihr zu. Sie war eine echte Künstlerin, kreierte ein köstliches Meisterstück nach dem anderen, während im Hintergrund dröhnend die Powerballaden von Heart, Scandal, Joan Jett, Pat Benatar und Lita Ford erschallten. Die gleichen Songs, die noch heute meine Playlists füllen und mir jetzt in den Ohren dröhnen.
In New York City gibt es über tausend Coffee Shops. Um uns gegen Schlachtrosse wie Starbucks und The Coffee Beanery zu behaupten und irgendwie über Wasser zu halten, brauchen wir kleinen Familienklitschen eine Nische – ein Alleinstellungsmerkmal. Hier bei Amelia’s sind das unsere Pies. Jeden Tag frisch-gebackene, zu hundert Prozent hausgemachte gefüllte Obstkuchen. Die Rezepte hat meine Mutter von ihrer Großmutter und den Großtanten aus der sogenannten alten Welt geerbt.
Welches Land der alten Welt genau, ist nicht bekannt. Wenn ich nach unserer Herkunft fragte, sagte meine Mutter immer: ein bisschen was von allem und durchmischt wie ein gutgekneteter Kuchenteig.
Während Vixen über gebrochene Herzen singt, vermenge ich in einer Schüssel die Zutaten. Eigentlich ist es eher ein Kessel als eine Schüssel. Danach knete ich mit bloßen Händen den klebrigen Teig, presse, drücke und falte ihn immer wieder. Ein ziemlich gutes Workout gegen Schlabberarme. Sobald der Teig sandfarben ist und die richtige Konsistenz hat, kippe ich die Schüssel um und rolle die riesige Kugel auf dem mit Mehl bestäubten Küchenblock aus. Als der Teig gleichmäßig dünn ausgerollt ist, schneide ich perfekte Kreise aus, sodass es genau für sechs gefüllte Pies reicht. Diese Prozedur werde ich, ehe der Shop öffnet, noch viermal wiederholen. Dienstags, donnerstags und samstags gibt es zusätzlich zu den Stammsorten Apfel, Kirsche, Blaubeere und Pfirsich auch noch Schokolade, Bananencreme und Zitronenbaiser.
Nachdem die Böden in ihren sechs Formen liegen, wasche ich mir die Hände, gehe zum Kühlschrank und hole die sechs Pies heraus, die ich gestern vorbereitet habe. Sie kommen jetzt in den Ofen, um auf Zimmertemperatur aufgewärmt zu werden. Pies schmecken am zweiten Tag grundsätzlich am besten. Dann hatte die Kruste genug Zeit, sich mit dem mit braunem Zucker gesüßten Fruchtsaft vollzusaugen. Während die Pies aufwärmen, wende ich mich den Äpfeln zu. Ich schäle und schneide so schnell wie die japanischen Köche in einem Hibachi-Restaurant. Im Umgang mit Messern besitze ich ziemlich irre Fähigkeiten – der Trick besteht in rasiermesserscharfen Klingen. Nichts ist gefährlicher als ein stumpfes Messer. Wer unbedingt einen Finger verlieren will, sollte es damit versuchen. Ich bestäube die Äpfel mit weißem und braunem Zucker, dann mit Zimt und Muskat und stelle den Topf auf den Herd. Sämtliche Handgriffe könnte ich mit geschlossenen Augen vollführen, seit Jahren habe ich weder ein Rezept nachgelesen noch Zutaten abgewogen.
Das Backen war mal Meditation für mich, aber es hat schon lange nichts Entspannendes mehr. Immer schwingt die Sorge mit, dass das Geschäft nicht läuft, dass der letzte funktionierende Boiler im Keller auch noch den Geist aufgibt, dass wir auf der Straße landen.
Ich kann förmlich spüren, wie sich hässliche Sorgenfalten in mein Gesicht graben. Ich weiß, dass man mit Geld kein Glück kaufen kann, aber Schuldenfreiheit und ein eigenes Haus würden mir definitiv Sorgenfreiheit bringen.
Als die dicke, buttrige Fruchtfüllung durch die blütenförmigen Löcher in den Pies blubbert, nehme ich sie aus dem Ofen und stelle sie auf den Küchenblock.
«Guten Morgen, Schwesterherz.» Ellie kommt in die Küche gehüpft. An Ellie hüpft eigentlich alles – der lange, blonde Pferdeschwanz, ihre energetische Persönlichkeit und … die Silberohrringe mit den Perlen, die mir verdammt bekannt vorkommen.
«Sind das meine?», frage ich, wie nur eine Schwester fragen kann.
Sie klaut sich eine Blaubeere aus der Schüssel auf dem Tresen, wirft sie in die Luft und fängt sie mit dem Mund.
«Mi casa es su casa. Technisch betrachtet sind es unsere Ohrringe.»
«Die in meinem Schmuckkästchen in meinem Zimmer liegen!» Es sind die Einzigen, von denen ich keine grünen Ohrläppchen kriege.
«Tz. Du trägst sie doch nicht mal. Du gehst ja nie aus, Livvy.» Sie hat nicht die Absicht, gemein zu sein – sie ist einfach nur ein siebzehnjähriger Teenager. Da ist Gemeinsein unvermeidlich. «Außerdem müssen Perlen getragen werden. Das ist eine Tatsache. Sonst verlieren sie ihren Glanz.» Ständig wirft Ellie mit irgendwelchen schrägen Fakten um sich, die außer regelmäßigen Jeopardy!-Kandidaten kein Mensch kennt. Ellie ist die «Kluge» von uns beiden – Begabtenförderung, Stipendium, vorzeitige Zulassung zur Uni. Aber Faktenwissen und gesunder Menschenverstand sind zwei Paar Stiefel. Ich glaube nicht, dass meine Schwester, von der Bedienung der Waschmaschine mal abgesehen, irgendeinen Schimmer hat, wie die echte Welt funktioniert.
Sie schlüpft in einen abgetragenen Wintermantel und setzt sich eine riesige Strickmütze auf. «Ich muss los – hab in der ersten Stunde einen Mathetest.»
Ellie wirbelt zur Hintertür raus und gibt sich dort mit Marty, unserem Kellner, Spüler, Rausschmeißer und unübertrefflich kompetenten Hausmeister, quasi die Klinke in die Hand.
«Welcher Vollidiot hat vergessen, dem Winter zu sagen, dass er vorbei ist?» Er schüttelt sich einen Zentimeter weißen Schneematsch von den schwarzen Locken. Inzwischen schneit es wie verrückt – vor der Tür ist eine Wand aus weißen Punkten. Marty hängt seinen Mantel an den Haken, während ich den ersten Filter des Tages mit frischgemahlenem Kaffee fülle. «Liv, du weißt, dass ich dich liebe wie die kleine Schwester, die ich so gerne hätte …»
«Du hast eine kleine Schwester. Drei sogar.»
Es sind Drillinge – Bibbidy, Bobbidy und Boo. Martys Mutter stand angeblich noch total unter Drogen, als es ums Ausfüllen der Geburtsurkunden ging, eine kleine Fehldosierung der Medikamente während der Geburt. Und Martys Vater, ein Rabbi aus Queens, war klug genug, sich nicht mit einer Frau anzulegen, die soeben das Äquivalent zu drei Wassermelonen aus sich herausgepresst hatte.
«Ja, aber du nervst mich nicht so wie echte Schwestern. Und weil ich dich liebe, als wärst du Familie, kann ich dir auch sagen, dass du nicht aussiehst, als wärst du gerade aus dem Bett gefallen, sondern als wärst du gerade aus der Mülltonne gerollt.»
Genau das, was eine Frau am Morgen hören will.
«Ich hab verschlafen.»
«Du brauchst Urlaub. Dringend. Oder wenigstens mal einen freien Tag. Du hättest gestern Abend mitkommen sollen. Ich war in dieser neuen Bar in Chelsea und habe einen unglaublichen Kerl kennengelernt. Die Augen von Matt Bomer und das Lächeln von Shemar Moore.» Er wackelt mit den Augenbrauen. «Wir treffen uns heute Abend wieder.»
Bevor ich etwas dazu sagen kann, fährt der Lieferwagen rückwärts in die Gasse hinter dem Haus. Ich drücke Marty den Kaffeefilter in die Hand und verbringe die nächsten zwanzig Minuten damit, einem übergewichtigen Schwachkopf zu erklären, weshalb ich ihm die angeschimmelten Plunderteilchen, die er mir andrehen will, weder abnehmen noch bezahlen werde. Um Punkt 6:30 Uhr schalte ich die Außenbeleuchtung ein und wende das Türschild von GESCHLOSSEN auf OFFEN. Aus reiner Gewohnheit drehe ich auch den Knauf am Türschloss um, dabei ist es seit Monaten kaputt.
Anfangs sieht es noch gar nicht so aus, als würde der Schneefall für uns zum Desaster werden – die üblichen Stammgäste schauen auf dem Weg zur Arbeit kurz herein, um ihre Koffeinsucht zu befriedigen. Aber um neun starren Marty und ich bereits frustriert zum Fenster raus und sehen zu, wie sich der Schneefall zum Schneesturm und weiter zum Jahrhundert-Blizzard mausert. Kein Kunde weit und breit. Draußen ist alles tot. Ich schalte den Fernseher ein, damit wenigstens irgendwas los ist. Schließlich gebe ich auf.
«Hast du Lust, mit mir den Kühlschrank zu putzen und mal wieder hinter dem Ofen sauber zu machen?» Ein bisschen Hausarbeit schadet nie.
Marty hebt die Kaffeetasse. «Nach dir, Darling.»
Um zwölf Uhr schicke ich Marty nach Hause. Um eins wird der lokale Notstand ausgerufen – auf den Straßen sind ab sofort nur noch Einsatzfahrzeuge zugelassen. Um zwei kommt Ellie wie ein Wirbelwind zur Ladentür herein, hocherfreut, weil der Nachmittagsunterricht ausfällt, und wirbelt sofort wieder hinaus, um den Sturm bei ihrer Freundin auszusitzen. Nachmittags verirren sich ein paar vereinzelte Kunden in den Laden, um ihre Kuchenvorräte aufzustocken und damit den Sturm zu überleben.
Um sechs sitze ich über der Buchhaltung – das heißt, dass ich Rechnungen, Geschäftsbücher und Kontoauszüge auf einem der Tische ausbreite, mich davorsetze und sie anstarre. Die Zuckerpreise sind gestiegen – Arschlöcher! Kaffee ist auch raufgegangen – Schweine! Vom Obst ganz zu schweigen. Aber ich weigere mich, an den Früchten zu sparen. Jede Woche schicke ich Marty in den Norden zu Maxwell Farms – die bauen das beste Obst der Gegend an.
Um halb zehn kann ich die Augen kaum mehr offen halten, und ich beschließe, endlich Feierabend zu machen.
Ich stehe gerade in der Küche und verstaue einen in Frischhaltefolie gewickelten Pie im Kühlschrank, als die Ladenglocke klingelt. Ich höre zwei Typen, die sich streiten, auf diese unnachahmlich angeberische Weise, wie es nur Männer können.
«Meine Fingerspitzen sind halb abgefroren. Ich kann mir keine Erfrierungen leisten. Meine Finger sind Franny der drittliebste Teil an mir.»
«Dein Bankkonto ist Frannys liebstes, zweitliebstes und drittliebstes Teil an dir, du Weichei. Wir sind überhaupt nicht weit gelaufen.»
Beide Männer sprechen mit Akzent, aber die zweite Stimme ist tiefer und ungleich weicher als die erste. Sie macht mich neugierig. Vielleicht, weil sie wie eine warme Badewanne nach einem harten, langen Tag klingt.
Ich trete durch die Schwingtür – und bleibe überrascht stehen. Da stehen insgesamt vier Kerle. Der Mann mit der attraktiven Stimme trägt einen perfekt anliegenden Smoking, nur die schwarze Fliege hängt ihm offen um den Hals. Die beiden obersten Knöpfe des makellos gestärkten weißen Hemds stehen offen und geben den Blick frei auf seine bronzefarbene Brust. Er wirkt insgesamt athletisch, aber was mich umhaut, ist sein Gesicht: wohlgeformte Wangenknochen und eine Kieferpartie wie aus Marmor gemeißelt – ungelogen, wie gemeißelt! Das Kinn ist kräftig und so perfekt geformt, dass ein GQ-Model dafür morden würde. Die Nase ist gerade, und der vollkommen geschwungene Mund sieht aus, als würde er mit Vorliebe schmutzige, verdorbene Dinge flüstern. Männlich dichte Augenbrauen sitzen über den graugrünen Augen, die von üppigen Wimpern umrahmt sind. Er hat dunkles, dichtes Haar. Ein paar Strähnen sind ihm in die Stirn gefallen und verleihen ihm das lässige, völlig unbeschwerte Aussehen eines Typen, dem die Welt zu Füßen liegt.
«Hi!?» Meine Verwunderung ist deutlich zu hören.
«Hm …» Sein Mundwinkel zieht sich kaum merklich nach oben, als würde ihm gefallen, was er sieht. Was für ein sexy Typ. «Hallo, wen haben wir denn da!» Mit seinem Akzent klingen die Worte … beinahe unanständig.
Der etwas untersetzte Mann neben ihm – rote Haare, strahlend blaue Augen – sagt: «Bitte sagen Sie mir, dass es hier heißen Tee gibt. Ich zahle, was Sie wollen.»
«Ja, gibt es – kostet auch nur zwei Dollar fünfundzwanzig.»
«Sie sind meine Rettung.»
Die beiden suchen sich einen Tisch an der Wand. Der Dunkelhaarige bewegt sich mit großem Selbstverständnis – als würde ihm der Laden gehören. Nein. Er bewegt sich so, als würde ihm die Welt gehören. Er nimmt Platz, lehnt sich zurück und mustert mich wie mit Röntgenblick.
Die beiden anderen Männer in den dunklen Anzügen sind rechts und links der Ladentür stehen geblieben. «Setzen Sie sich nicht?», frage ich, obwohl das mit Sicherheit Bodyguards sind, darauf verwette ich meinen Trinkgeldkrug. Ich habe in dieser Stadt schon genug reiche und berühmte Leute erlebt, um ihr Gefolge zu erkennen – auch wenn die beiden ziemlich jung aussehen.
«Nein. Nur wir», sagt der Dunkelhaarige.
Wer der Kerl wohl ist? Vielleicht der Sohn eines ausländischen Investors? Oder ein Schauspieler? Gesicht und Körper dafür hat er jedenfalls. Und außerdem so eine unfassbare Präsenz. Dieses nicht genauer zu benennende Charisma, das besagt: Pass bloß auf – mich vergisst du nicht so schnell wieder.
«Ganz schön mutig, euch bei diesem Wetter vor die Tür zu wagen.» Ich lege zwei Speisekarten auf den Tisch.
«Oder dämlich», murrt der Rotschopf.
«Ich habe ihn rausgezerrt», sagt der Dunkelhaarige. Seine Aussprache klingt leicht verwaschen. «Die Straßen sind leer, und ich kann mich frei bewegen.» Er senkt verschwörerisch die Stimme. «Sie lassen mich nur ein paarmal im Jahr aus dem Käfig.»
Ich habe zwar keine Ahnung, wovon der Typ spricht, aber es ist trotzdem das Aufregendste, das mir den ganzen Tag passiert ist. Wie erbärmlich.
Der Rothaarige mustert die Karte. «Was ist Ihre Spezialität?»
«Unsere Pies.»
«Pies?»
Ich klopfe mit dem Bleistift auf den Block. «Obstkuchen. Von mir persönlich gebacken. Die besten der Stadt.»
«Mmmmh», macht der Dunkelhaarige. «Erzählen Sie mir von Ihrem Pie. Ist er köstlich?»
«Ja.»
«Saftig?»
Ich verdrehe die Augen. «Sparen Sie sich das.»
«Was meinen Sie?»
«Sparen Sie sich Ihre Anspielungen.» Ich senke die Stimme, imitiere ein paar der dämlichen Sprüche, die ich schon zu oft gehört habe. «‹Ist dein Pie extrafeucht?›, ‹Ich könnte deine Pie-Formen die ganze Nacht lang auslecken, Baby!› Alles schon gehört.»
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: