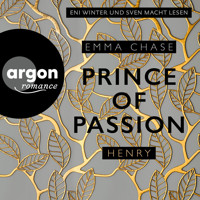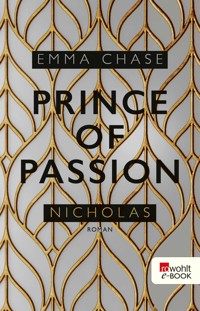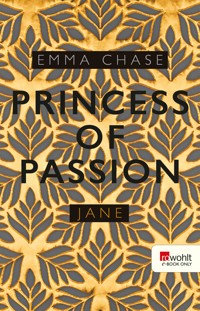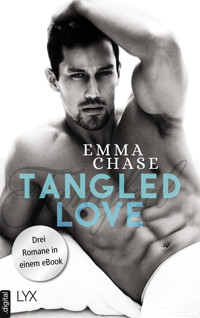9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Prince-of-Passion-Reihe
- Sprache: Deutsch
Jede Dynastie hat einen Anfang, jede Legende beginnt mit einer Geschichte! Prinzessin Lenora Celeste Beatrice Arabella Pembrook wurde von Kindesbeinen an darauf vorbereitet, Königin zu werden. Die erste Königin von Wessco. Als sie 1956 mit neunzehn Jahren gekrönt wird, ist sie also bereit, zu regieren. Lenora ist charmant, klug, selbstbewusst und – wenn nötig – skrupellos. Doch eins ist sie nicht: verheiratet. Plötzlich hat niemand mehr etwas anderes als ihre Heirat im Sinn. Der Kronrat. Das Parlament. Das Volk. Lenora hat keinerlei Verlangen danach, sich an einen Mann zu binden – vor allem an keinen, der sie nur ihrer Krone wegen will. Doch Pflicht ist Pflicht. Selbst für eine Königin. Besonders für eine Königin. Also lässt sie sich auf eine Zweckehe ein. Nur hat sie nicht mit einem Mann wie dem Herzog von Anthorp gerechnet … Die unabhängige Vorgeschichte zur Prince-of-Passion-Trilogie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Emma Chase
Queen of Passion – Lenora
Roman
Über dieses Buch
Für die Krone, für die Liebe!
Prinzessin Lenora Celeste Beatrice Arabella Pembrook wurde von Kindesbeinen an darauf vorbereitet, Königin zu werden. Die erste Königin von Wessco. Als sie 1956 mit neunzehn Jahren gekrönt wird, ist sie also bereit zu regieren. Lenora ist charmant, klug, selbstbewusst und – wenn nötig – skrupellos. Doch eins ist sie nicht: verheiratet.
Plötzlich hat niemand mehr etwas anderes als ihre Heirat im Sinn. Der Kronrat. Das Parlament. Das Volk. Lenora hat keinerlei Verlangen danach, sich an einen Mann zu binden – vor allem an keinen, der sie nur ihrer Krone wegen will. Doch Pflicht ist Pflicht. Selbst für eine Königin. Besonders für eine Königin. Also lässt sie sich auf eine Zweckehe ein. Aber sie hat nicht mit einem Mann wie dem Herzog von Anthorp gerechnet …
Vita
Emma Chase lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort in New Jersey, USA. Sie hat 2013 ihren ersten Liebesroman veröffentlicht, der ein sofortiger Erfolg wurde. Seitdem finden sich ihre Bücher regelmäßig auf den Bestsellerlisten der New York Times und der USA Today wieder und wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Auf die Frage, welche Bedeutung Liebesromane heutzutage haben, antwortet sie Folgendes: «Für manche Leute ist es leicht, auf das Romance-Genre herabzublicken, weil viele Bücher (aber bei weitem nicht alle) humorvoll, temporeich und nicht sehr anspruchsvoll sind. Aber deshalb sollte man sie nicht einfach abtun. Diese Bücher sind wichtig. Weil sie uns Erholung und Zuflucht bieten. Weil sie uns stärken, erfrischen und bereit machen für alles, was das Leben uns in den Weg wirft.»
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel «Royally Yours».
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Royally Yours» Copyright © 2018 by Emma Chase LLC
Published by Arrangement with Emma Chase
Redaktion Susann Rehlein, Berlin
Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung deckorator/Shutterstock
ISBN 978-3-644-00393-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Prolog
Keine Frau wird als Königin geboren,egal welchen Namen sie bei ihrer Geburt erhält oder welche Titel man ihr verleiht. Könige werden gekrönt. Aber Königinnen … Königinnen erheben sich. Sie steigen auf aus den Tiefen von Trauer und Kummer, sie sprengen mit eisernem Willen ihre Ketten, geschmiedet durch Verrat und Niedertracht. Sie erheben sich, schwingen sich empor in Triumph und Freude, und dann herrschen sie. Ihren Gemahl an ihrer Seite. In guten wie in schlechten Zeiten, in Gesundheit und Krankheit. Die Herrschaft ist ihr Vermächtnis für ihre Nachkommen. Für die meisten bedeutet dieses Geburtsrecht Pflicht, Tradition und Loyalität.
Aber wir beide waren anders. Von Anfang an und in jeder Hinsicht. Da war so viel Leidenschaft, dass sie die ganze Welt um uns herum umstürzen konnte. Liebe, die sich nicht ignorieren oder leugnen ließ. Hingabe, die ein ganzes Leben überdauern würde. Das würde unser Vermächtnis sein – unser Geschenk an jene, die in unsere Fußstapfen treten würden. Es würde ihnen in Herz und Seele eingebrannt sein. Nur wussten wir das damals noch nicht. Jede Dynastie hat einen Anfang. Jede Legende beginnt mit einer Geschichte.
Dies hier ist unsere.
1
Averdeen, 1945
«Du hättest sie sehen sollen, Alfie. Sie war so verdammt beeindruckend. Würdevoller als irgendeiner dieser Säcke im Parlament je sein könnte.»
Mein Vater, Reginald William Constantine Pembrook, der König von Wessco, spricht oft über mich, als wäre ich nicht im Zimmer. Meine Mutter nennt es eine bedauerliche Angewohnheit. Aber mir macht das nichts aus, besonders wenn er wie heute stolz auf mich ist.
«Meine Ratgeber», fährt er fort und spuckt das Wort förmlich aus, «die verstehen das Volk überhaupt nicht. Verdammte Narren, alle miteinander.»
Vaters Ratgeber sprechen auch über mich, als wäre ich nicht im Zimmer. «Mit ihren acht Jahren ist sie zu jung», hatten sie gesagt. «Sie wird sich blamieren», hatten sie gewarnt. «Die Kronprinzessin ist schließlich nur ein kleines Mädchen.»
Als der Krieg letzten Monat endlich zu Ende ging, hatten wir eine Parade in der ganzen Stadt. Es gab Musik und Süßigkeiten, Spruchbänder und Luftballons, und goldenes Konfetti flog, wohin man auch sah. Die Menge winkte und jubelte und hieß die Männer zu Hause willkommen, als sie in ihren schmucken Uniformen die Straße entlangmarschierten.
Heute Morgen waren die Übrigen nach Hause gekommen, doch diesmal jubelte niemand. Die Dudelsäcke spielten, und ein Meer trauriger Menschen – weinende Mütter und Väter und kleine Brüder und Schwestern – war zugegen, als die mit Flaggen drapierten Särge in einer endlos scheinenden Parade aus den Flugzeugen geladen wurden.
Ich wollte auch weinen. Mein Herz fühlte sich an wie eine bleierne Kugel, und mein Magen krampfte sich angesichts der Schrecklichkeit des Ganzen zusammen. Aber ich ließ es mir nicht anmerken. Ich passte auf, dass meine Augen trocken blieben und mein Gesicht beherrscht. Ich nickte ihnen zu und sagte ihnen, dass wir ihre tapferen Söhne niemals vergessen würden. Und ich denke, meine Anwesenheit dort, meine Worte, haben es für sie besser … ein bisschen weniger schrecklich … gemacht.
Genau wie Vater es vorausgesagt hatte.
«Ich bin froh, dass es so funktioniert hat, Reggie», antwortet Alfie Barrister vom Ledersessel am Kamin aus.
Alfie ist Vaters bester Freund. Ich mag ihn sehr. Er ist groß und rund und fröhlich – wie ein rothaariger Weihnachtsmann.
«Ein Anruf, Eure Majestät», sagt ein Diener hinter mir.
«Ich werde ihn im Arbeitszimmer annehmen.»
Ich höre, wie sich die Tür der Bibliothek hinter Vater schließt, als er den Raum verlässt, aber ich schaue weiter aus dem Fenster. Über den Teppich aus grünem Gras hinweg blicke ich zum hinteren Teil des sonnendurchfluteten Gartens, wo eine Schaukel vom dicken Ast eines mächtigen, alten Baumes hängt, der wie ein Ungeheuer aussieht.
Die nette Art von Ungeheuer.
Schaukeln ist mir das Liebste an den Besuchen bei Alfie. Denn obwohl unser Palast Hunderte Zimmer und endlose Flure hat, und Springbrunnen und Gärten mit Blumen in allen Farben, die man sich nur vorstellen kann, hängt in keinem der verdammten Bäume da eine Schaukel.
Ich soll verdammt nicht laut sagen, aber manchmal fühlt es sich gut an, es in meinem Kopf zu sagen.
Alfie kommt neben mich und schaut auch aus dem Fenster.
«Möchtest du gern schaukeln gehen, Küken?»
Ich grinse breit zu ihm hoch und nicke.
Keine zehn Minuten später sind wir draußen, und Alfie schiebt mich auf der Schaukel an, und es ist, als würde ich fliegen – als wäre ich ein Vogel, der überall hinfliegen kann – Sonne auf dem Gesicht und Wind in den Haaren. Mein marineblaues Kleidchen ist unter meine Beine geklemmt, damit es nicht hochflattert.
«Hast du die Schaukel für dich selbst aufgehängt, Alfie?», frage ich. Das Holzbrett, aus dem der Sitz besteht, ist groß genug für ihn.
Er lacht. «Nein. Die ist für meine Kinder.»
Ich drehe mich auf dem Sitz um, starre ihn mit offenem Mund an. «Du hast Kinder?»
«Ganz recht. Zwei Jungs und ein kleines Mädchen.»
Ich drehe mich auf der Schaukel wieder nach vorne und denke über diese unerwartete Neuigkeit nach.
«Ich glaube, ich mag Kinder nicht. Sie kommen mir verwirrend und ungezogen vor.»
Genau genommen kenne ich keine Kinder – nicht offiziell. Meine Schwester Miriam geht zur Schule und trifft da welche, wohingegen ich im Palast unterrichtet werde.
«Aber ich bin sicher, deine würde ich mögen, Alfie.» Ich schaue hoch, um den Garten abzusuchen. «Sind sie hier? Warum habe ich sie noch nie getroffen, wenn wir zu Besuch sind?»
«Sie leben in Schottland, bei ihrer Mutter», erklärt Alfie.
«Warum lebt ihre Mutter in Schottland und nicht hier bei dir?»
Alfie denkt einen Moment lang darüber nach und seufzt dann. «Nun ja … Ich war kein sehr guter Ehemann. Mit dem Geschäft verheiratet und so.»
Alfies Geschäft Barrister’s ist das größte von ganz Wessco – dort gibt es Spielzeug und Kleider und alle möglichen tollen Sachen. Ich habe ihn zu Vater sagen hören, dass er bald nach London expandiert, und sobald er damit fertig ist, die Welt zu übernehmen, wird er so nett sein und Vater Wessco behalten lassen.
«Fehlen sie dir?», frage ich.
«Ja.» Alfie nickt. «Aber meine Frau ist in Schottland bei ihrer Familie glücklicher. Und Kinder gehören zu ihren Mums.»
Meine Mutter ist wunderschön, hat eine sanfte Stimme, lange dunkelbraune Haare wie ich und Augen, die genau dieselbe Farbe haben wie der Himmel an einem sonnigen Tag.
«Ich bin fast nie bei meiner Mum», sage ich leise.
Wenn ich nicht mit meinen Lehrern zusammen bin, dann bin ich bei Vater. Manchmal, wenn sie glauben, ich könnte sie nicht hören, nennt mich die Dienerschaft Seinen Königlichen Schatten.
«Ja, ich weiß», antwortet Alfie und klingt dabei ein bisschen traurig. «Aber du bist etwas Besonderes, Küken.»
Ich bin etwas Besonderes, weil ich eines Tages Königin sein werde. Das hat Vater gesagt. Es gab zwei Babys vor mir, und eins davon war ein Junge. Aber sie kamen zu früh, wurden zu klein geboren und haben nicht überlebt. Nachdem meine jüngere Schwester Miriam auf die Welt kam, war Mutter sehr krank, und die Ärzte sagten Vater, dass es keine weiteren Babys geben würde.
Und das bedeutete, ich würde die erste regierende Königin sein, die Wessco je hatte.
Es ist wichtig, dass ich gut darin bin.
«Warum nennst du mich Küken, Alfie?», frage ich beim Aufschwung.
«Weil ich dich in jener Nacht gesehen habe, als du in Ludlow Castle zur Welt kamst. Ich war dabei, als dein Vater dich zum ersten Mal im Arm gehalten hat – und genau so hast du damals ausgesehen. Wie ein blasses, piepsendes Küken ohne Federn.»
Die Beschreibung ist verstörend. Ich runzele die Stirn.
«Ich hoffe, jetzt sehe ich nicht mehr wie ein Küken aus.»
Alfie tritt vor die Schaukel und betrachtet mich. Dann wiegt er den Kopf hin und her, und seine blauen Augen funkeln. «Hm … kommt auf die Lichtverhältnisse an.»
Mir bleibt der Mund offen stehen. «Al-fie!»
Sein Bauch wackelt im Takt zu seinem tiefen Gelächter. «Das ist ein Spitzname, Lenora. Ein Kosename. Jedes Kind sollte einen haben. Und ob du es glaubst oder nicht, Hoheit, du bist tatsächlich ein Kind.» Mit einem Kopfschütteln dreht Alfie sich zum Haupthaus um, und ich höre ihn leise sagen: «Gott weiß, dass wenigstens einer dich wie ein Kind behandeln sollte.»
Guthrie House, Palast von Wessco, 1953
Die Farbe der Kleidung ist wichtig. Sie ist das erste, das die Leute an einem bemerken. Schwarz ist düster, Weiß frömmelnd, Fuchsia zu grell, alles in Pastell zu mädchenhaft. Muster sind ebenfalls wichtig. Pünktchen sind zu frivol, Blumen zu banal, Streifen und Karos können sich gut eignen – aber man darf es nicht übertreiben damit.
Und für die tägliche Garderobe … grau.
Meiner persönlichen Sekretärin Miss Crabblesnitch zufolge ist Taubengrau die perfekte Farbe für mich. Nicht zu trist, nicht zu kühn, sanft, aber nicht schwach, attraktiv, aber nicht oberflächlich.
Ich werde wahrscheinlich in einem grauen Kleid sterben. Und das wird dann mein Gewand als Gespenst sein. Für immer.
«Das da heute, Megan.» Miss Crabblesnitch zeigt auf das Ensemble in der linken Hand der Zofe – ein kurzärmeliges Tweedkleid mit bauschigem Petticoat und dazu passendem Jäckchen. In grau. Natürlich.
Nachdem ich angekleidet bin, setze ich mich an den Schminktisch, und Megan beginnt, meine langen Haare zum üblichen Knoten zu stecken, mit zur Seite gestrichenem Pony und ein paar losen Strähnen, um den Look weicher zu machen.
«Guten Tag, Ladys.» Mutter rauscht ins Zimmer, elegant und lächelnd, in einem schmalen dunkelblauen Seidenkleid mit zartem weißen Blumenmuster. Miriam folgt ihr auf den Fuß, in Blassgrün, mit passendem Haarreif in ihren hellbraunen Locken.
«Danke, Megan. Ich übernehme das hier», sagt Mutter und nimmt den Platz der Zofe hinter mir ein. Miss Crabblesnitch und Megan knicksen und verlassen den Raum.
«Lass dir nie die Haare schneiden, Lenora», sagt Mutter, während sie die Haarnadeln in meine Frisur schiebt. «Sie sind so wunderschön.»
Mutter ist die Einzige, die mich schön und süß und hundert andere Worte nennt, die mir ein herrliches Gefühl geben. Die mir das Gefühl geben … normal zu sein. Oder wie ich mir normal vorstelle.
Sie frisiert mein Haar fertig, dann fängt sie meinen Blick im Spiegel auf und rümpft die Nase. «Miss Crabblesnitch hat wieder mal Grau gewählt?»
Ich seufze theatralisch. «Grau wie der trübe Himmel von Wessco … und meine Seele.»
«Ach, mein Mädchen.» Mutter lacht. Dann dreht sie sich um und betrachtet das schimmernde, bauschige Abendkleid, das neben der Tür meines Ankleidezimmers hängt. «Wenigstens wirst du heute Abend bei deinem Geburtstagsball für Abwechslung sorgen können.»
Ich stehe auf und schiebe den Stuhl zurück. «Ja, weil Silber ja so viel anders ist als Grau.»
Mutter legt mir ihre weiche Hand an die Wange. «Es unterstreicht deine Augen. Du wirst umwerfend aussehen.»
«An meinem Geburtstag will ich einen Schwarz-Weiß-Ball», tönt Miriam. «Und alle kommen in Schwarz und Weiß – nur ich trage Knallblau. Und ich werde die Liebe meines Lebens treffen, und wir werden tanzen und tanzen und tanzen. Und keiner wird Lenora ansehen.»
Meine vierzehnjährige Schwester streckt mir die Zunge raus. Das ist wirklich reizend.
«Du kannst die Blicke gern alle haben», sage ich zu ihr. «Ich wäre absolut glücklich, wenn nie mehr irgendwer in meine Richtung sehen würde.»
Mutter schaut auf ihre Uhr. «Kommt jetzt, Schätzchen. Euer Vater ist unten, und ihr wisst, dass er es hasst, wenn man ihn warten lässt.»
Vater steht am Fuß der Treppe, kerzengerade, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Er ist viele Jahre älter als Mutter, mit Falten im Gesicht und mehr Weiß als Braun in den Haaren. Aber zusammen sind sie ein atrraktives Paar, und als er zu ihr hochschaut, strahlen seine graublauen Augen wie die eines viel jüngeren Mannes.
Wir warten nicht auf Komplimente vom König, und er gibt uns keine. Das ist nicht seine Art. Aber er bietet Mutter seinen Arm, und zu viert gehen wir durch das prächtige Marmorfoyer zum Wagen, der uns ins Parlament fahren wird, wo wir beim Lunch meinen Geburtstag feiern.
«Vergiss nicht, Lenora – heute Abend wird nicht getanzt», sagt Vater, ohne sich umzudrehen.
«Oh, Reggie. Es ist ihr sechzehnter Geburtstag», protestiert Mutter.
«Ganz genau. Ich will keine Gerüchte über sie und diesen oder jenen kecken Sohn eines Lords, mit dem man sie zu eng hat tanzen sehen.»
Ein Gerücht ist wie eine Delle durch einen Vorschlaghammer; man kann sie ausbügeln, aber es wird nie wieder so wie vorher. Das hat der Erzbischof von Dingleberry einmal zu meinem Vater gesagt. Er hat ein verkniffenes, sauertöpfisches Gesicht, wie ein Stück verdorbenes Obst, und man sieht ihm einfach an, dass seine Mutter ihm nie Süßigkeiten erlaubt hat, als er klein war.
Mutter versucht es erneut. «Um Himmels willen, wir haben doch nicht mehr das neunzehnte Jahrhundert.»
Und mein Vater sagt eines der wahrsten Dinge, die ich je hören werde: «Innerhalb dieser Mauern schon.»
Das Parlamentsessen verläuft genau so, wie ich es bei einem Raum voller alter Männer, die nichts so sehr lieben wie den Klang ihre eigenen eintönigen Stimmen, erwartet habe. Ich schaue hoch zu der aufwendig bemalten Decke und bete um einen Akt Gottes, der mich von meiner Langeweile erlösen würde. Nichts Pompöses wie ein Erdbeben oder einen Vulkanausbruch, aber vielleicht eine kleine Plage? Frösche wären gut. Ich würde mich auch mit Heuschrecken zufriedengeben. Aber Gott hat mich verlassen, denn der Nachmittag zieht sich ohne Unterbrechung weiter hin.
«Warzen.»
Schon komisch, wie es immer genau dann, wenn man denkt, es könnte nicht schlimmer werden, doch so kommt.
«Wie bitte?»
Der Bart des Marquis von Munster ist so verwildert, dass ich seinen Mund kaum erkennen kann. Aber ich kann die Reste seines Mittagessens sehen: kleine Schinken- und Käsestückchen baumeln in den grauen, drahtigen Haaren wie grausiger Weihnachtsschmuck.
Ich würge nicht. Oder verziehe das Gesicht. Meine Selbstbeherrschung ist hervorragend. Ich sollte mir selbst eine Medaille verleihen.
«Ich war früher der beste Reiter im Parlament», brummt er, «aber jetzt muss ich kürzertreten, wegen der Warzen an meinen Füßen. Sprießen wie Unkraut. An meinem großen Zeh ist eine so groß wie eine saftige Weintraube.»
Mein Würgereflex wird wirklich auf die Probe gestellt.
«Möchten Sie sie gern sehen, Hoheit?»
«Sehen?», wiederhole ich, denn das hat er gerade nicht wirklich gesagt, oder?
«Sie ist echt ziemlich prächtig – medizinisch gesehen.» Und er greift nach seinem rechten Stiefel.
«Äh, ich …»
«Guten Tag, Lord Munster!» Miriam, meine liebste Schwester auf der ganzen Welt, kommt an meine Seite gehüpft und hakt sich bei mir unter. «Ich fürchte, ich muss meine Schwester kurz entführen. Frauengespräche. Das verstehen Sie sicher.»
«Oh, ja, natürlich.» Munster verbeugt sich. «Wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Geburtstag, Prinzessin Lenora.»
«Danke.»
Beieinander untergehakt rauschen Miriam und ich davon.
«Du bist mir was schuldig», flüstert sie. «Ich möchte heute Abend beim Ball dein Saphircollier tragen.»
«Du kannst das Collier haben und die Ohrringe noch dazu. Die hast du dir verdient.»
«Hat er versucht, dir seine prächtige Warze zu zeigen?»
«Woher weißt du das?»
«Dasselbe hat er letzten Monat bei Elizabeth Montgomery versucht, bei der Erhebung ihres Onkels in den Ritterstand! Ich glaube, es ist eine Art bizarres Paarungsritual.»
«Was soll das bitte bedeuten?», schnaube ich.
«Nun, zuerst zeigt er dir seinen Zeh, aber das ist nur der Anfang. Eh du dich’s versiehst, heißt es: ‹Lass mich dir alle meine anderen Körperteile zeigen, die Warzen haben!›» Sie wackelt anzüglich mit den Augenbrauen, ich pruste los, und wir schütteln uns in einem heftigen Kicheranfall. Manchmal, wenn ich mir erlaube, darüber nachzudenken, kann ich es beinahe nicht glauben, wie seltsam dieses Leben ist. Und ich sehe aus dem Palastfenster auf die Stadt und frage mich, ob es eigentlich für jeden seltsam ist – wenn auch vielleicht nicht auf dieselbe Weise wie für mich.
Dann betritt ein junger Mann den Raum, und ich bin sicher, dass ich ihn noch nie zuvor gesehen habe. Er ist blass, mit dichtem, dunklem, sauber geschnittenem Haar und jungenhaften Zügen hinter einer eckigen, schwarz gefassten Brille. Er bewegt sich durch den Saal wie ein neugieriges Hündchen in einem neuen Garten – mit staunender, eifriger Begeisterung.
«Miriam, wer ist der Junge?»
Klatsch ist trivial, aber in der Welt der Politik ist er auch unverzichtbar. Ich versuche, auf dem Laufenden zu bleiben, doch Miriams Wissen lässt mich immer wieder dumm dastehen. Verdammt, sie würde sogar einen Spion des MI6 dumm dastehen lassen!
«Er ist der neue Herzog von Anthorp», flüstert sie zurück.
Herzog von Anthorp ist der Titel der Familie Rourke, ein Name, der in Wessco ebenso alt und ehrwürdig ist wie Pembrook.
«Er ist noch so jung.»
«Nur ein Jahr älter als du.» Sie nickt. «Vater musste ihm eine Ausnahmegenehmigung erteilen, damit er den Sitz seiner Familie im House of Lords einnehmen konnte. Hat er dir das nicht erzählt?»
Ich schüttle den Kopf.
Und Miriam zieht vom Leder. «Oh, das ist absolut pikant! Der neue Herzog ist eigentlich der zweite Sohn der Rourkes. Sein Bruder, acht Jahre älter, hat sich mit dem alten Herzog überworfen, als er gegen den Wunsch seines Vaters in den Krieg ging. Als der Krieg vorbei war, kam der ältere Sohn wieder nach Hause, und der Herzog bot an, ihn wiedereinzusetzen. Aber er wollte nichts davon wissen! Er ist fortgegangen!»
«Fortgegangen?» Das kann ich kaum glauben. Seinem Zuhause, seiner Familie, seiner Pflicht den Rücken zu kehren, ist für mich ebenso unvorstellbar, wie ohne Kleider die Straße entlangzulaufen.
«Wo ist er hingegangen?»
«Wohin er eben wollte.» Miriam seufzt. «Es heißt, er hat die ganze Welt bereist, Berge bestiegen, Urwälder erforscht, und er hält einen Rekord im Tiefseetauchen. Er sucht Schätze.»
«Schätze? Die Rourkes haben ebenso viel Geld wie wir.»
«Aber deshalb ist es ja so traumhaft! Er sucht die Schätze nicht, weil er muss – sondern nur, weil er es kann. Er spendet sie an Wohltätigkeitseinrichtungen. Es heißt, einmal hat er einem Waisenjungen, der auf der Straße bettelte, einen seltenen Diamanten geschenkt. Hat natürlich dessen Leben verändert.»
Oh, das ist ziemlich traumhaft.
«Der alte Herzog hat vor ein paar Monaten den Löffel abgegeben.» Miriam schnippt mit den Fingern. «Es heißt, der Ältere ist zur Beerdigung nicht nach Hause gekommen, aber die beiden Brüder sollen sich angeblich sehr nahestehen. Und jetzt ist der jüngere Bruder der Herzog von Anthorp.»
Einen Moment lang beobachte ich den Jungen, wie er lächelnd mit den alten Männern plaudert, die sich um ihn drängen, als versuchten sie, durch bloße Nähe etwas von seiner Jugend abzuzapfen. Da ist eine Offenheit in seiner Miene, eine Sorglosigkeit in seiner Haltung, die hier selten ist. Er wirkt … gütig. Und aufrichtig.
Das Parlament wird ihn bei lebendigem Leib auffressen.
«Wie heißt er?», frage ich.
«Thomas.»
Mein Geburtstagsball erweist sich als gewaltige Verbesserung zu dem Lunch vor ein paar Stunden. Ich fühle mich großartig in meinem silbernen Kleid, das Haar zu schimmernden Locken auf meinem Kopf aufgetürmt. Und ich habe noch kein einziges Mal das Wort Warzen gehört.
Es ist eine luxuriöse Veranstaltung: lange Tafeln, beladen mit Kaviar und prickelndem Champagner in Kristallflöten. Die vergoldeten Spiegel an den Wänden des Ballsaals reflektieren das regenbogenfarbene Durcheinander aus Ballkleidern, funkelnden Juwelen, Zylindern und Frackschößen, und ein zwanzigköpfiges Orchester in Bestform spielt beschwingte Musik. Unter den Gästen befinden sich ein ehemaliger amerikanischer Präsident, Mitglieder aller Königshäuser Europas und alle adeligen Familien Wesscos.
Ich stehe abseits an der Wand neben einer Marmorstatue und wippe mit dem Fuß im Takt der Musik, zu der ich nicht tanzen werde. Gelegentlich bleibt ein Gratulant stehen, um zu plaudern, wie Mr. Elvin Busey, ein Geschäftsmann mittleren Alters, der mir auch wirklich alles über seine neue Polsterfirma erzählt, für den Fall, dass ich investieren möchte. Ab und zu kommt, entweder mit einem Ausdruck gieriger Lust oder nervöser Unbehaglichkeit auf dem Gesicht, ein Junge der Oberschicht vorbei, der Sohn eines Herzogs oder eines Grafen oder einer der zahlreichen ausländischen Prinzen.
«Dieses Kleid ist spitze, Lenora!» Meine Cousine Calliope zeigt mir zwei erhobene Daumen, als sie mit ihrem Gefolge an mir vorbeirauscht.
Calliopes Hobby ist es, detaillierte Horrorgeschichten über das grausige Ableben aller Mitglieder der königlichen Familie zu schreiben, die zwischen ihr und dem Thron stehen. Mich eingeschlossen.
Doch abgesehen von diesen kleinen unaufrichtigen Begegnungen bleibe ich allein mit der Statue neben mir. Der Rest der Gäste zieht es vor, mich von der anderen Seite des Saals aus unauffällig zu beobachten. Aber die Aufmerksamkeit ist greifbar – etwas, das man spüren kann. Unvermittelt stehe ich steifer, aufrechter, und meine Züge werden zu dieser unlesbaren Maske der Gleichgültigkeit.
«Amüsierst du dich, Liebling?», fragt meine Mutter. Sie sieht heute Abend wie ein strahlendes Juwel aus. Ihr Kleid ist aus rotem Samt, und überall in ihrem dunklen Haar funkeln Rubine.
«Ja, ich amüsiere mich.»
Auf dieselbe Weise, wie sich wohl ein Fabergé-Ei amüsiert, wenn es in seiner bewachten Museumsvitrine bewundert wird.
Lachen und Geplauder kommen von einer Gruppe junger Adeliger hinter uns. Mutter hört es auch. Sie legt mir den Arm um die Hüften und drückt mich mit sanfter Kraft. «Deine Zeit wird kommen, Lenora.»
«Ich weiß.» Ich zucke mit den Schultern.
«Ich meine nicht, dass du Königin sein wirst. Ich meine deine Zeit für Lachen … für Liebe. Freude und Aufregung. Das wird für dich auch noch kommen. Da bin ich mir sicher.»
«Wie kannst du dir da sicher sein?»
Hinter vorgehaltener Hand erzählt man sich über die Großtante meiner Mutter, Portia, sie wäre wunderlich gewesen, und ihre Träume hätten sich manchmal bewahrheitet. Wer weiß, ob meine Mutter nicht auch über irgendwelche seherischen Gaben verfügt.
Sie nimmt mein Gesicht in die Hände. «Weil du, mein liebes Mädchen, in jeder Hinsicht außergewöhnlich bist. Es ist nur logisch, dass dein Leben ebenfalls außergewöhnlich werden wird.» Sie küsst mich auf die Stirn. «Ich bin so stolz auf dich … so stolz darauf, deine Mutter zu sein.»
Ich verbringe nicht viel Zeit mit Mutter, nicht so viel, wie ich gerne möchte. Aber wann immer wir zusammen sind, vertreibt sie meine Traurigkeit so mühelos, als wäre sie eine Fee mit glitzerndem Zauberstab.
«Danke, Mum.»
Sie schaut über meine Schulter, und das Lächeln fällt ihr aus dem Gesicht. «Oh Mist … Der Marquis von Munster hat die Königinmutter von Spanien erwischt. Wenn er ihr diesen verdammten Warzenfuß zeigt, gibt es am Ende noch Krieg.»
Während meine Mutter davonhastet, um einen internationalen Zwischenfall zu verhindern, entdecke ich erneut den jungen Herzog von Anthorp. Er lehnt zwei Säulen weiter an der Wand, und seine Haltung ist beinahe das Spiegelbild von meiner. Und weil er höchstwahrscheinlich spüren kann, dass ich ihn ansehe, dreht er den Kopf in meine Richtung und kneift die Augen zusammen, als könne er mich trotz der dicken Brille auf seiner Nase nicht richtig sehen.
Und dann schlendert er in meine Richtung, die Hände hinter dem Rücken gefaltet. Als er mich erreicht, lehnt er sich neben mich an die Wand, neigt den Kopf und schenkt mir den Ansatz eines Lächelns.
«Alles Gute zum Geburtstag, Prinzessin Lenora.»
«Danke, Herzog Anthorp.»
Er zuckt zusammen. «Bitte, nennen Sie mich Thomas. Oder Rourke. Jedesmal, wenn ich den Titel höre, sehe ich mich nach meinem Vater um. Er war ein elender alter Mistkerl, als er noch lebte, und ich glaube nicht, dass zwei Monate Totsein seinem Charakter zuträglich gewesen sind. Also ist der Gedanke, ihn in der Nähe zu haben, geradezu verstörend.»
Ein Lachen sprudelt in meiner Kehle empor. Wie ungewöhnlich ehrlich, so etwas zu sagen!
Ich nicke. «Wie finden Sie das Parlament, Thomas?»
«Herausfordernd. Ich habe gehört, in der Politik gibt es keine Freunde, nur Feinde und Männer, von denen man noch nicht weiß, dass sie Feinde sind. Ich fange an zu verstehen, wie zutreffend das ist.» Er schüttelt den Kopf. «Ich muss mich einfach zurechtfinden. Ich bin das jüngste Mitglied des Parlaments; es ist wichtig, dass ich meine Sache gut mache.»
«Ja, ich kenne das Gefühl.»
Eine Welle der Sympathie für ihn steigt in mir hoch. Wie wenn man ein Reh im Wald entdeckt und weiß, dass Wölfe in der Nähe sind.
«Der Trick ist, seine Meinung für sich zu behalten», sage ich ihm. «Niemanden wissen zu lassen, was man denkt. Sie sollten an Ihrem Pokerface arbeiten.» Und weil er so jung und einsam wirkt, biete ich an: «Ich könnte Ihnen dabei helfen. Sie einweisen, sozusagen. Ihnen ein paar Tipps geben.»
Er schaut drein, als hätte ich ihm die ganze Welt angeboten. «Das würden Sie für mich tun? Das ist sehr liebenswürdig.» Er blickt hinüber zur Tanzfläche, und seine Stimme wird leiser. «Ich habe nicht viele Freunde – besonders nicht hier in der Stadt. Ich bin eher ein einsamer Wolf, wissen Sie? Ein Rebell.» Dann zuckte er mit den Schultern und schenkt mir ein selbstironisches Lächeln. «Na ja … Sonderling wäre wohl zutreffender. Ein komischer Vogel.»
Ich lächle. «Auch das Gefühl kenne ich.»
Thomas rückt seine Brille zurecht. «Darf ich Sie etwas fragen?»
«Natürlich.»
«Das ist Ihre Party – warum tanzen Sie nicht?»
Meine Schwester, die uns offensichtlich belauscht hat, streckt ihren Kopf hinter der Säule hervor.
«Sie darf nicht.»
«Warum darf sie nicht?», fragt Thomas.
«Kaugummi», klärt Miriam ihn nur zu gern auf.
«Ja, natürlich.» Thomas nickt. «Ich verstehe.»
Und dann wird sein Nicken zu einem Kopfschütteln.
«Nein, Moment mal, ich verstehe nicht. Was hat Kaugummi damit zu tun?»
Ja, es ist so lächerlich, wie es klingt.
«Eine Lady ist wie ein Streifen Kaugummi», leiert Miriam herunter. «Süß und unberührt, aber wenn man nicht aufpasst, wird jeder Junge ihn kosten.»
«Und kein anständiger Mann», fahre ich fort und imitiere dabei den Tonfall eines mürrischen alten Knackers, «wird sich schon mal gekauten Kaugummi in den Mund stecken wollen.»
Thomas sieht aus, als würde er ernsthaft über diese Analogie nachdenken. «Das ist der größte Mist, den ich je gehört habe», sagt er dann entschieden. «Wer hat das gesagt?»
«Der Erzbischof von Dingleberry», antworte ich. «Mein Vater findet es einleuchtend.»
«Dingleberry, was? Das bedeutet doch Blödbeere. Dann sagt der Name schon alles, nicht wahr?», meint Thomas augenzwinkernd.
Und ich lache laut auf.
Miriam ebenfalls, dann greift sie Thomas’ Handgelenk. «Also, Lenora mag zwar nicht tanzen dürfen, aber ich schon. Und das ist eins meiner Lieblingslieder. Tanzen wir, Herzog!»
Thomas wirkt überrascht. «Nun, in Ordnung.»
Und Miriam zerrt ihn auf die Tanzfläche.
Zwei Tänze später kommen sie zurück.
«Wir haben einen Plan!», flüstert meine Schwester laut.
Oh nein.
Ich schüttele den Kopf. «Das letzte Mal, als du einen Plan hattest, saß ich am Ende beim Essen neben Stinky Winky. Nein, vielen Dank auch.»
Thomas schaut zwischen uns hin und her. «Stinky Winky?»
«Der Viscount von Winkerton», erklärt Miriam.
«Der Mann riecht wie ein Schweinearsch», füge ich hinzu.
Thomas lacht.
«Aber das hier ist völlig anders!» Aufgeregt hüpft Miriam hin und her. «Dieser Plan wird wirklich funktionieren! Ich sorge für ein Ablenkungsmanöver; darin bin ich gut. Und du bekommst eine Gelegenheit zu tanzen, Lenora.»
Thomas’ sanfte grüne Augen suchen meine. «Jeder sollte an seinem Geburtstag tanzen dürfen.»
In meinem Magen kribbelt es vor Aufregung, und obwohl ich nicht will, muss ich lächeln. «Das sollte ich nicht tun.»
«Genau deshalb macht es Spaß», beharrt Thomas.
«Ich weiß nicht …»
«Ach, komm schon!», bettelt meine verführerische Schlange von einer Schwester. «Um Himmels willen, gönn dir doch mal was.»
Verstohlen sehe ich mich im Saal nach den neugierigen Blicken um, die mir stets folgen, dann hole ich tief Luft und nicke. «Also gut.»
«Ausgezeichnet!» Miriam klatscht in die Hände, dann sieht sie Thomas an. «Warten Sie auf das Signal.»
Sie saust davon zu meinem Vater und zieht den König auf die Tanzfläche. Die Blitzlichter der Palastfotografen flammen auf, und man kann praktisch den ganzen Saal seufzen hören, was für ein schöner Anblick es doch ist, den König von Wessco mit seiner jüngsten Tochter tanzen zu sehen.
Thomas steht neben mir und starrt geradeaus, seine Hand nur Zentimeter von meiner entfernt. «Abwarten … noch nicht … gleich …»
«Oh nein!», kreischt Miriam, und falls bisher noch nicht alle Augen auf sie und meinen Vater gerichtet waren, dann sind sie es jetzt.
«Los!», flüstert Thomas, packt meine Hand und zieht uns durch die Tür hinter uns, während Miriam pausenlos jammert, einen ihrer geliebten Saphirohrringe verloren zu haben, die ein Geschenk des Königs von Bermuda waren.
Der Raum, in den Thomas und ich stürzen, ist der in Mauve und Gold gehaltene Salon, der früher den Damen vorbehalten war, die in ihren Korsetts alle naselang ohnmächtig wurden. Heute Abend ist er leer.
Thomas späht durch den Türspalt, lauscht – und nach einem Moment lächelt er. «Die Luft ist rein.»
Für die meisten Leute wäre das hier eine alberne, unbedeutende Sache. Aber ich bin nicht wie die meisten Leute. Ich war meinem Vater gegenüber noch nie ungehorsam – ich war noch nie irgendjemandem gegenüber ungehorsam.
Und ich fühle mich … lebendig. Vielleicht so lebendig wie noch nie. Die schöne Musik dringt deutlich durch die Wände, eine fröhliche, schnelle Jig.
Thomas rückt Smokingjacke und Brille zurecht. Dann verbeugt er sich und streckt seine Hand aus. «Darf ich um die Ehre dieses Tanzes bitten, Prinzessin Lenora?»
Und zum ersten Mal bei jemandem, der nicht mein Vater oder ein direkter Verwandter ist, antworte ich: «Es wäre mir ein Vergnügen.»
Thomas nimmt meine rechte Hand in seine, winkelt unsere Arme an und legt seine andere Hand an meine Taille. Und dann, unter dem trüben goldenen Kronleuchter, tanzen wir. Wir hüpfen und drehen uns, wirbeln und stampfen. Einmal fallen wir fast hin, und Thomas tritt mir auf die Zehen … mehr als einmal.
«Autsch!»
«Entschuldigung.»
«Au!»
«Meine Schuld. Kommt nicht wieder vor.»
Als das Lied zu Ende geht, fühlt sich mein Kopf schwindlig an, und mein Herz rast. Nicht auf die schmachtende, romantische Weise, sondern alberner, süßer. «Sie sind nicht besonders gut im Tanzen, Thomas.»
Er grinst keuchend. «Ja, ich hätte Sie vermutlich warnen sollen. Aber ich dachte mir, schlechtes Tanzen ist immer noch besser als gar kein Tanzen.» Er langt in seine Tasche, um ein kleines Gerät aus Metall herauszuholen, es sich in den Mund zu stecken und tief einzuatmen. Ich habe darüber gelesen: eine neue Methode, Inhalationsmedizin zu verabreichen.
Langsam stößt er den Atem wieder aus, dann zuckt er mit den Schultern. «Asthma.»
Ich nicke, während er das Gerät wieder in die Tasche steckt. Und als ein neues Lied beginnt, zieht Thomas seine Augenbrauen hoch. «Wollen Sie es noch mal versuchen?»
Ich nicke und lege meine Hand wieder in seine.
Aber wir haben erst ein paar Schritte getan, als aus dem Saal ein spitzer Schrei erklingt. Die Musik bricht ab. Und eine starre, unheimliche Stille hüllt uns ein.
Thomas und ich sehen einander an, und dann rennen wir zur Tür.
Die Gäste stehen dicht zusammengedrängt auf der Tanzfläche. Ich zwänge mich vor, in ihre Mitte, und dort, auf dem Boden, wiegt mein Vater meine Mutter in seinen Armen.
«Anna, Anna!»
Sie antwortet nicht. Ihre Augen sind geschlossen, und ihr Gesicht ist reglos, ein Rinnsal dunkelroten Blutes sickert aus ihrer Nase.
«Anna …»
Miriam klammert sich an mich und verbirgt ihr Gesicht an meinem rechten Arm. In meinen Ohren rauscht die Brandung eines Ozeans. Es ist, als würde ich mich über den Rand einer Klippe lehnen, kurz davor, in den Schlund der dunklen, bodenlosen See zu stürzen. Aber dann legt sich eine Hand auf meine linke Schulter, warm und stark.
Ich reiße meine Augen von meinen Eltern los und fange Thomas’ sanften grünen Blick auf. Sein Griff verstärkt sich, hält mich fest, lässt mich wissen, dass ich nicht allein bin, dass er da ist.
Er wird mich nicht fallen lassen.
2
«Eure Mutter ist tot.»
So traurige Worte. Schreckliche Worte – die entsetzlichsten Worte, die ich je gehört habe.
«Eure Mutter ist tot.»
Der König schien zehn Jahre zu altern, als er sie aussprach. Und ich sah, wie alle Freude aus Miriams blitzenden Augen wich.
«Eure Mutter ist tot.»
Nichts würde jemals mehr so sein wie zuvor. Niemand würde mich jemals mehr süß oder schön nennen.
Ein Hirnaneurysma, sagte der Arzt. Ein tragisches Ereignis. Es hatte keinerlei Vorzeichen gegeben, sodass auch keine Maßnahmen ergriffen werden konnten, es zu verhindern.
Mein Vater ist ein guter König, ein Gentleman. Aber er ist kein sanfter Mann. Deshalb belehrte er uns am Tag nachdem meine Mutter gestorben war, in festem, schroffem Tonfall, was von uns erwartet wurde. Wir würden durch alle Straßen Wesscos hinter Mutters Sarg hergehen, wie es Tradition war. Mutter war vom Volk innig geliebt worden, und die Menschen würden am Boden zerstört sein, und es war unsere Aufgabe, sie durch ihre Trauer zu führen.
Unsere eigene Trauer würde im Privaten erfolgen – nicht vor den Augen der Zimmermädchen oder Sekretäre oder Sicherheitsleute. Nach außen dürfen wir nur Gefasstheit zeigen. Stärke. Würde.
«Eure Mutter ist tot.»
Und so ließ mir das Zimmermädchen am Morgen der Beerdigung meiner Mutter mein Bad ein. Allein in dieser Porzellanwanne, glitt ich unter Wasser und weinte, bis ich keine Tränen mehr in mir hatte.
«Darf ich dich etwas fragen, Vater?»
Eine Woche nach Mutters Beerdigung verbringen wir das Wochenende bei Alfie und angeln Karpfen im großen Teich auf seinem Anwesen. Laut meinem Vater ist es wichtig für mich, in allen möglichen männlichen Freizeitaktivitäten bewandert zu sein, denn dort werden Abmachungen getroffen. An Kartentischen und in Jagdrevieren und an Fischteichen. Er würde mich auf ein Rugbyfeld schicken, wenn er glauben würde, damit Erfolg zu haben.
«Du darfst mich alles fragen, Lenora.»
Mein Blick zuckt zu Alfie neben mir und dann wieder zurück zu meinem Vater. «Es ist etwas Persönliches.»
«Nur zu.»
Ich schaue hoch zu diesem Mann – meinem Vater, meinem König, meinem Mentor –, bei dem ich die meiste Zeit das Gefühl habe, ihn überhaupt nicht zu kennen.
«Hast du sie geliebt? Mutter?»
Er wirft die Leine ins Wasser aus, und seine stahlgrauen Augen verdunkeln sich.
«Ich weiß, du hast viel für sie empfunden, aber hast du sie geliebt? Wirklich geliebt?»
Mein Vater hat eine Art, jemandem etwas beizubringen, ohne dass es sich wie eine Lektion anfühlt. Seine Stimme ist ein weiser, volltönender Bariton, wie die Stimme eines Gottes, die einen dazu bringt, ihm folgen und gehorchen zu wollen.
«Deine Mutter war eine gute Frau. Gütig … fröhlich. Wenn man auf dem Thron sitzt, will jeder ein Stück von dir abhaben – ein Stück für das Volk, ein Stück für die Presse, ein Stück für das Parlament, ein Stück für den Ehepartner, ein Stück für die Kinder. Am Ende muss man sich in so kleine Stücke aufteilen, dass man das Gefühl hat, es bleibt nichts von einem übrig. Aber deine Mutter hat mir das nie übelgenommen.» Er dreht den Kopf und legt mir die Hand auf die Schulter. «Für dich wird es anders sein, Lenora. Ein Teil deines Ehemannes wird dir immer grollen.»
«Warum?»
«Du bist ein kluges Mädchen – sag du mir, warum.»
Ich denke über alles nach, was ich weiß und was ich gesehen habe, und die Antwort ist nicht schwer.
«Männer unterwerfen sich nicht gern. Niemandem. Aber besonders nicht einer Frau – ihrer Ehefrau.»
Mein Vater klopft mir auf die Schulter und nickt, dann kehrt sein Blick wieder zum Teich zurück. «Wenn die Zeit für dich kommt, zu heiraten, dann werden wir einen guten, gierigen Mann für dich finden.»
«Gierig?»
«Ein gieriger Mann wird dich für den Reichtum und die Macht schätzen, die du ihm schenkst. Und weil er von deiner Gunst abhängt, weiß ich, dass er dich gut behandeln wird.»
Wenn einem nichts Kluges einfällt, das man sagen kann, dann ist stets Verlass auf Sarkasmus.
«Gier, Reichtum und Macht? Du meine Güte – das ist ja wie im Märchen. Mir schwinden gleich die Sinne.»
Mein Vater holt seine Schnur ein. «Füll dir den Kopf nicht mit Märchen, Kind. Oder mit Gedanken an Liebe. Die sind nichts für uns. Die werden dir nur Kummer bringen.»
Mit diesen Worten geht er weg, zu unserem Diener, um seinen Köder zu wechseln. Ich starre seinen Rücken an.
«Er hat meine Frage nicht beantwortet», sage ich zu Alfie.
«Natürlich hat er das», erwidert Alfie freundlich. «Er hat deine Mutter geliebt, sehr sogar.»
Ich neige den Kopf. «Woran merkst du das?»
«Dein Vater würde dich nie anlügen … und er hat nicht nein gesagt.»
«Warum hat er dann nicht einfach ja gesagt?»
«Weil Liebe verdammt schrecklich ist, Küken. Und phantastisch. Eine wunderschöne, schreckliche, chaotische Sache. Sie wird dir an einem Tag das Gefühl geben, fliegen zu können, und dir am nächsten Tag die Eingeweide herausreißen. Sie ist kompliziert.» Alfie zuckt mit den Schultern. «Und dein Vater möchte, dass du es so einfach wie möglich hast. Weil er weiß, dass ohnehin schon eine ganze Krone von Komplikationen nur darauf wartet, dir aufs hübsche Haupt gesetzt zu werden.»
Am nächsten Morgen sitze ich wieder im Palast an meinem Schminktisch, während Megan zwei Ensembles hochhält, damit Miss Crabblesnitch eines davon auswählen kann. Doch es fühlt sich an, als wäre ein ganzes Leben vergangen. Als hätte sich so viel verändert seit dem vorherigen Mal.
Als hätte ich mich verändert.