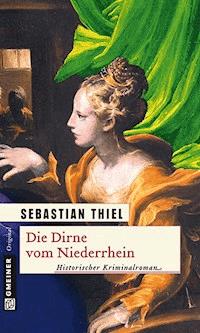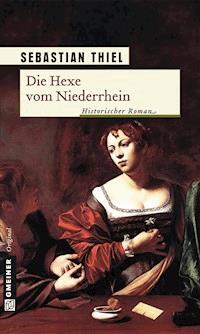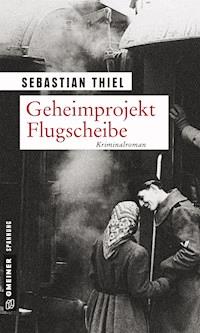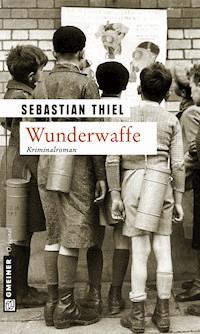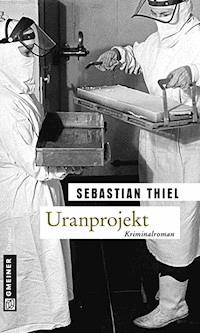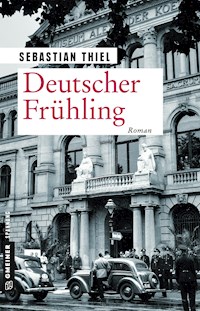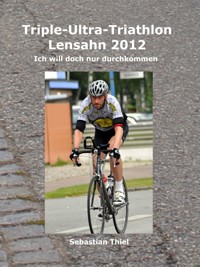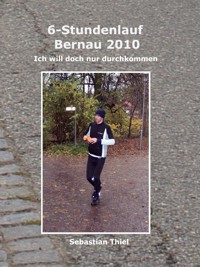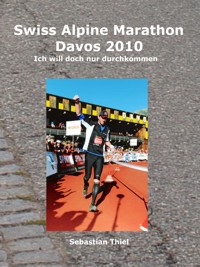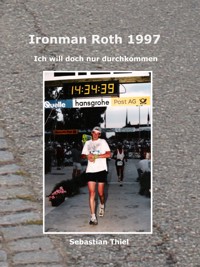4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Märchen-Thriller
- Sprache: Deutsch
Ich hätte niemals überleben dürfen ...
Es ist Heiligabend, und der kleine Ort Tannwald liegt unter einer frischen weißen Schneedecke begraben. Die junge Mira steht auf dem Kirchturm der Abtei. Sie will ihrem Leben ein Ende setzen - zu schwer wiegt die Last auf ihren Schultern. Mira, die wegen ihrer langen, blonden Haare Rapunzel genannt wird, hat jahrelang im Tannwälder Heim für schwer erziehbare Kinder gelebt. Dort wurde sie verraten, verleugnet und man brach ihr das Herz. Damit ist jetzt Schluss. Doch dann passiert etwas, das nie passieren dürfte: Sie überlebt. In der Silvesternacht wacht sie wieder auf - und in ihr reift ein verzweifelter Plan: Rapunzel wird sich rächen. Doch dazu muss sie die düsteren Pfade ihrer Vergangenheit erkunden ...
Ein neuer spannender Thriller von Sebastian Thiel, der dich tief in die Abgründe der menschlichen Seele ziehen wird.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Prolog – Das Ende
1 – Ohne Erinnerung
2 – Phönix
3 – Vertrauen
4 – Unerwarteter Besuch
5 – Ameisen
6 – Irgendwo anders
7 – Familie
8 – Ein falsches Leben
9 – Schatten der Vergangenheit
10 – Miras Tod
11 – Der Prinz
12 – Maria
13 – Der Kuss des Prinzen
14 – Kaputte Menschen
15 – Partygeflüster
16 – Ungesühnte Verbrechen
17 – Familie
18 – Drei Hexen
19 – Keine Prinzessin
20 – Maskenball
21 – Märchentod
22 – Sünde und Vergebung
23 – Die Königin und ihre Macht
24 – Grausame Wiederholungen
25 – Vier Hexen
26 – Im Reich der Gargoyles
27 – Mütter und Töchter
28 – Hexentanz
Über den Autor
Weitere Titel des Autors
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Ich hätte niemals überleben dürfen ...
Es ist Heiligabend, und der kleine Ort Tannwald liegt unter einer frischen weißen Schneedecke begraben. Die junge Mira steht auf dem Kirchturm der Abtei. Sie will ihrem Leben ein Ende setzen – zu schwer wiegt die Last auf ihren Schultern. Mira, die wegen ihrer langen, blonden Haare Rapunzel genannt wird, hat jahrelang im Tannwälder Heim für schwer erziehbare Kinder gelebt. Dort wurde sie verraten, verleugnet und man brach ihr das Herz. Damit ist jetzt Schluss. Doch dann passiert etwas, das nie passieren dürfte: Sie überlebt. In der Silvesternacht wacht sie wieder auf – und in ihr reift ein verzweifelter Plan: Rapunzel wird sich rächen. Doch dazu muss sie die düsteren Pfade ihrer Vergangenheit erkunden ...
Ein neuer spannender Thriller von Sebastian Thiel, der dich tief in die Abgründe der menschlichen Seele ziehen wird.
eBooks von beTHRILLED – mörderisch gute Unterhaltung!
Sebastian Thiel
Rapunzel will Rache
Thriller
Prolog – Das Ende
Mein Leben kotzt mich an.
Wieso um alles in der Welt wurde ich überhaupt geboren? Den ganzen Schmerz und das Leid hätte ich mir am liebsten erspart. Zumindest, wenn ich wählen dürfte. Gott, sollte dieser sadistische Drecksack wirklich existieren, hätte er oder sie Trailer einführen sollen. Wie im Kino:
Bevor man auf diese Welt kommt, dürfte die Seele einen kurzen Blick auf das kommende Leben erhaschen. Wenn es einem nicht gefällt, geht man einfach nicht rein. Wäre fair, wie ich finde.
Nicht in einer Million Jahren hätte ich meine Geburt gewählt, wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt. Den Fehler werde ich jetzt korrigieren.
Der Wind zerrt an meinen langen blonden Haaren, als ob er mich vom Dach stoßen möchte. Sie wirbeln um mich herum wie ein wilder goldener Schleier. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals kurze Haare getragen zu haben. Immer waren sie so lang, dass sie fast meinen Po erreichten.
Deshalb nannte man mich so – Rapunzel.
Mein Leben allerdings ist alles andere als ein Märchen. Und wenn, dann nur der Anfang, wenn es den Mädchen dreckig geht. Ohne Happy End, ohne Prince Charming auf weißem Ross, ohne rettende Zauberkräfte und tierische Freunde, die für einen einstehen.
Das ist alles unwichtig an diesem schneebedeckten Heiligen Abend. Noch einmal zieht es meinen Blick in Richtung des Himmels. Die Nacht ist nicht ganz vorübergeschlichen und der Tag nicht vollends erwacht. Ich befinde mich irgendwo dazwischen. Wie sooft.
Mich erfassen die rot glühenden Strahlen der Morgenröte, während Sterne mit den Lichterketten an den Häusern um die Wette funkeln. Bald schon wird die Kirchenglocke zur achten Stunde läuten, und die Menschen werden die wohlige Wärme ihrer Häuser verlassen, um die letzten Besorgungen für den festlichen Tag hinter sich zu bringen.
Wenn alles klappt, wenn mein Entrinnen von Erfolg gekrönt ist, wird es für die Unglückseligen ein ziemlich versautes Weihnachtsfest. Denn sie werden mich finden. Auf dem kalten, mit Streusalz überzogenen Bordsteinpflaster des Marktplatzes wird mein toter Körper liegen.
Aufgeplatzte Haut und kalter Blick. Sie sollen sehen, wie dreckig es mir erging. Zumindest einmal die Augen nicht verschließen können. Genau hier soll mein Ende sein, vor der Kirche und der alten Abtei, die ihren Namen niemals verdient hat. Eigentlich muss sie doch Schutz bieten, eine starke Hand über die Körper der Schwächsten ausbreiten und ihnen etwas geben, das ihnen im Leben bisher verwehrt blieb. Das Gegenteil ist der Fall.
Jeder soll meinen Leichnam sehen, besonders jene, deren Gesichter sich wie Male in meine Erinnerungen eingebrannt haben. Der tote Leib soll sich in ihre Überlegungen schmelzen und die Messe am heutigen Abend überschatten, mit einer dunklen alles verzehrenden Aura, die sich in die Gemüter eines jeden Einzelnen einnisten soll.
Vielleicht ändert mein Tod ja etwas?
Die Presse wird in wenigen Minuten nicht mehr wegschauen können, ebenso wenig die Polizei, und auch die Staatsanwaltschaft muss endlich aktiv werden. Zumindest hätte mein Tod dann einen Sinn.
Langsam schleiche ich zur Kante und blicke von dem altehrwürdigen Gebäude der früheren Abtei und heutigen St.-Georgius-Einrichtung für schwer erziehbare Kinder hinunter in die Tiefe.
Welcher Schmerz, welches Leid lauert noch hinter diesen Mauern und wird immer noch vorhanden sein, wenn ich das Paket des Lebens abgelegt habe? Wenn ich schon kein Glück besaß, unter Umständen haben es die armen Mädchen und Jungen im Inneren des riesigen Blocks am Marktplatz.
Der Gedanke flößt mir Mut ein. Ich verdränge das Rauschen des Windes und fasse die Packung mit den Tabletten fester. Nacheinander drücke ich sie aus dem Blister, lasse das Plastik einfach los und sehe zu, wie es vom Wind erfasst wird. Rotierend senkt es sich der Erde zu. Es dauert einige Sekunden, bis es den Boden erreicht.
Gut so, ich will sichergehen, dass es bald schon vorbei ist. Tabletten einwerfen und dann springen. Hätte ich noch eine Waffe besorgen können, ich würde mir den Lauf an die Schläfe setzen und abdrücken.
Als eine Windböe meinen zitternden Körper erfasst, muss ich mich an den grimmigen Wasserspeiern festklammern. Gerade so kann ich mich fangen, muss mit den Armen rotieren, um nicht hinabzustürzen.
Noch nicht. Den Zeitpunkt will ich bestimmen. Die Bühne ist vorbereitet, das Publikum bald schon versammelt. Nur die Hauptdarstellerin möchte den Vorhang noch nicht heben.
Zumindest einmal, in einem Leben voller Bevormundung und Herrschern, will ich über mein Schicksal entscheiden. Die dunklen Gedanken sind so heftig, dass alleine der Schmerz mich in die Knie zwingen könnte. Sie sind stumme Zeugen der Macht, die meine Peiniger über mich ausüben wollten.
Ich habe es so satt und werde das tun, wozu sie nicht imstande waren. Jedoch nach meinen Regeln. Nur dieses eine Mal.
Behutsam setze ich die Füße an den Abgrund und spähe hinab. Ein Schwindelgefühl erfasst mich und lässt meine Umgebung drehen. Meine Finger verkrallen sich in den Stein der Figur. Der mit Schnee bedeckte, steinerne Wasserspeier glotzt mich an, als ob er wütend wäre, dass ich auf seinem Dach bin.
»Ich bin bald weg«, sage ich sanft und streiche dem Fabelwesen über den Kopf. »Verzeihung.«
Bald ist es vorbei, Mira. Nur Mut.
Ich werfe alle Tabletten auf einmal ein, nehme etwas Schnee von den Flügeln des Gargoyles und vermische alles im Mund. Es tut gut zu spüren, wie aus dem eiskalten Schnee langsam Wasser wird und es sich mit den Tabletten vermengt.
Schon paradox, dass es für Selbstmord mehr als eine Handvoll Webseiten gibt, die mit hundertprozentiger Sicherheit werben. Noch immer hallen die Slogans in meinem Kopf wider.
Seien Sie kein Anfänger, sterben Sie wie ein Profi!
Das Natrium-Pentobarbital schmeckt bitter, lässt sich aber erstaunlich leicht schlucken. War auch gar nicht mal teuer, und selbst der Würgereflex bleibt aus. Bequem bezahlt, online mit Bitcoin, frei Haus versendet an eine Packstation meiner Wahl. Sterben war noch nie so einfach.
Es ist das Leben, das mir Schwierigkeiten bereitet.
Ich spüre, wie die Mischung aus frisch geschmolzenem Wasser und Tablettenpampe die Speiseröhre herabkriecht und auf einen leeren Magen trifft. Ein leichtes Aufstoßen stoppt für einen Moment meine Bewegungen, ich unterdrücke das aufkommende Sodbrennen und schlucke trocken.
Wenn man dem Verkäufer auf der Webseite Glauben schenken soll, werden innerhalb von wenigen Augenblicken die Vitalfunktionen heruntergefahren. Erst das Nervensystem, dann allmählich mein Herz-Kreislauf, und schließlich entspannen die Atemmuskeln. Die Rezeptoren der Tabletten benötigen nur wenig Zeit, um an die neuronalen Organe anzudocken und ihre Funktion einzuschränken.
Gut so, der erste Teil wäre geschafft. Ich habe von der Welt nichts mehr zu erwarten – und sie auch nicht von mir. Nur noch eine letzte Aufgabe, um den Fokus der Stadt für den Bruchteil einer Sekunde auf das Unrecht und die Pein zu wenden, welche die Hilflosen seit Generationen ertragen müssen.
Ich war eine von ihnen.
Doch das ist jetzt vorbei. Endgültig.
Die Finger beginnen zu zittern. Ob vom Wetter oder von den Tabletten ist mir einerlei. Mir ist nicht kalt, allerdings verspüre ich eine nicht greifbare Angst, während ich mich aufrichte und noch einmal zum finster dreinblickenden Wasserspeier sehe. Meine wehende blonde Mähne verdeckt mir fast die Sicht. Ich lächle ihn an, und für einen kurzen, kaum wahrnehmbaren Zeitraum meine ich, dass er zurücklächelt.
Nur noch einmal mutig sein – ein verdammtes Mal.
Langsam lasse ich seine Flügel los, breite die Arme aus, fast als würde ich selbst abheben wollen. Ich schließe die Augen und merke, wie mein zierlicher Körper über die Kante schwebt.
Es ist vorbei. Endlich.
Der Wind umgibt mich mit seinem dunklen Rauschen. Er begleitet meine letzten Herzschläge auf dieser ungerechten Welt. Ich habe das Gefühl, als würde mein Blut aufhören zu rauschen, das Gehirn endlich das Grübeln einstellen und die Atmung stillstehen. Ein Hochgefühl erfasst mich, so stark, dass ich meine, selbst durch geschlossene Augen ein Licht wahrzunehmen. Ich lächle dem Tod entgegen und ...
Der Aufprall kommt unerwartet, und mit der wundervollen Ruhe ist es augenblicklich vorbei.
Ich dachte, der Fall würde länger dauern. Plötzlich ist alles wieder da. Die Kälte, die sich unbarmherzig in mich frisst, und meine Gedanken, die nie wirklich Ruhe geben wollen. Mein Puls pumpt so schnell, einem reißenden Fluss gleich, ja sogar mein Blick ist klar, und ich spüre das Streusalz der glatten Kopfsteinpflaster in den Augen brennen.
Als ein ferner, schriller Schrei einer mir unbekannten Person ertönt, wird mir etwas auf grausame Art und Weise klar: Fuck! Ich lebe noch.
1 – Ohne Erinnerung
4387 Tage vor dem Ende
Ich warte. Ich warte lange.
Das tue ich heute leider öfter. Immer, wenn ich in großen Häusern sitzen muss und Erwachsene über mich reden. So ist es auch heute.
Die Betreuerin, Frau Mathilda, hat gesagt, dass ich nicht mehr länger im Krankenhaus bleiben soll. Schade eigentlich, hat mir dort gut gefallen. Die Krankenschwestern waren nett. Haben mir immer Kuchen gebracht, wenn sie etwas übrig hatten. Dabei weiß ich gar nicht mehr so genau, warum ich eigentlich im Krankenhaus war. Irgendwie ist alles verschwommen, als würde ich träumen und dann auch wieder nicht.
»Das arme Kind«, haben sie immer gesagt und mir über die langen, blonden Haare gestreichelt. »Das arme, arme Kind.«
Beinahe jeder hat es gesagt. Die Frau vom Jugendamt, die Ärzte in ihren schicken weißen Kitteln, und selbst die Empfangsdame sah mich irgendwie an, als würde sie mich ganz doll drücken wollen.
Eigentlich ein schönes Gefühl, wenn jeder einen umarmen möchte. Ich mag das sehr. In meinem Magen kribbelt es dann so herrlich. Ich kuschle auch gerne mit Stoffel, meinem Hasen, der mir geschenkt wurde. Nur von wem eigentlich?
So genau kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
Langsam reibe ich über Stoffels plüschiges Fell und sehe nach draußen. Manchmal stelle ich mir vor, er wäre lebendig und würde mit mir reden. Zumindest heute wäre es schön. Immerhin ist Heiliger Abend.
Der Geruch von Weihrauch liegt in der Luft und wabert durch die Gänge dieses großen Hauses am Marktplatz einer Stadt, in der ich noch nie war. Draußen haben sie hübsch geschmückt. Die Menschen lachen und trinken Glühwein, und der feine Schein des mit Lichterkerzen geschmückten Weihnachtsbaums spiegelt sich auf dem dunklen Kopfsteinpflaster wider.
Die Sterne stehen an diesem Abend stechend hell am Nachthimmel. Ein Lichtermeer aus tausend kleinen Glühwürmchen. Eigentlich bin ich froh, hier zu sein. Vor allem, weil Frau Mathilda gesagt wird, dass jetzt alles besser wird. Und dann wieder: »Das arme, arme Kind.«
Wieso sagen das nur immer alle?
So schlecht geht es mir doch gar nicht. Gut, mein Rücken tut noch wirklich weh. Besonders wenn ich mich strecke oder zu lange auf ihm liege. Wenn ich nur wüsste, warum das so ist?
Jetzt redet sie schon eine ganze Weile mit dem Mann in seinem Büro. Er muss der Pfarrer oder so sein, weil hier überall Kirchenbilder hängen. Aber Frau Mathilda sagte, dass es nur eine Abtei war, die jetzt etwas anderes ist. Komisch, aber das werde ich wohl noch mal nachfragen müssen.
Bis jetzt höre ich nur seine tiefe, melodische Stimme, während ich im Gang warten muss und die liebe Mutter Gottes mich aus ganz vielen Statuen ansieht. Irgendwie unheimlich, aber auch schön.
Ein komisches Gefühl macht sich in mir breit. Dabei habe ich gar nichts zu befürchten, wie Frau Mathilda nicht müde wurde zu betonen. Tannenwald ist sehr schön, hat sie gesagt. Umgeben von dichtem Baumbestand, führen nur zwei Straßen raus und rein. Hier hat man seine Ruhe, wiederholte sie immer wieder und machte wie zum Beweis das Fenster auf, um ab und zu die frische Luft zu atmen.
Ich tue es ihr nach, rieche allerdings nichts außer dem stickigen Rauch und puste Stoffel gelangweilt ein paar Staubflusen aus dem Gesicht, als endlich die Tür aufschwingt und Frau Mathilda mich mit einem großen Lächeln empfängt.
»Mira«, sagt sie. »Du hast großes Glück, musst du wissen. Eigentlich gibt es eine lange Warteliste, aber der Herr Kaplan de Vries ist bereit, für dich eine absolute Ausnahme zu machen.« Ihre Augen funkeln mit den Sternen draußen um die Wette, und ich merke, dass auch ich lächeln muss. »Sozusagen ein Weihnachtsgeschenk für dich.«
Ich nicke und komme näher, als sie mich mit der Hand anweist, ins Büro zu kommen.
Es riecht nach alten Büchern und Kerzen. Ein Tee dampft auf einem ausladenden Schreibtisch, während ganz alte, gläserne Bilder in die steinernen Wände eingelassen sind. Erst jetzt entdecke ich den älteren Herrn auf einem ledernen Sessel sitzend. Seine Finger sind überkreuzt, und er lächelt so gutmütig wie der Weihnachtsmann. Dabei trägt er keinen Bart, sondern hat sogar eine dunkle Halbglatze, welche dieselbe Farbe hat wie seine Robe. Nur der weiße Kragen oder wie das heißt sticht ein wenig aus dem vom gelben Kerzenschein erhellten Raum heraus.
»Das ist Mira Schwarz, Herr Kaplan.«
Was ist ein Kaplan? Ich nicke ihm zu und sehe ihn mit großen Augen an, während er sich von seinem Sessel erhebt und näher kommt. Langsam schreitet er um den Tisch, lässt mich nicht mehr aus den Augen und kniet sich herab zu mir.
»Hallo, Mira. Es ist schön, dich kennenzulernen.« Er nimmt meine Hand mit seinen warmen Fingern und kommt so nah an mich heran, dass ich den Weihrauch noch stärker rieche. »Und sie hat wirklich keine Angehörigen mehr?«
»Nein, Herr Kaplan de Vries«, antwortet Frau Mathilda und schüttelt bekräftigend den Kopf. »Ihre Eltern ... nun ja, die Akte haben Sie ja gelesen. Es ist ein Wunder, dass die Kleine überlebt hat.«
»Ja, ja, ein Wunder.« Er beginnt meine Hand zu streicheln und tätschelt mir über das Haar. »Und wer ist der junge Freund?«
»Das ist Stoffel«, antworte ich und erhebe den Hasen, damit der Kaplan ihn besser sehen kann. »Er begleitet mich überall mit hin, damit ich nie alleine bin.«
»Das ist gut.« Der Mann erhebt sich und sieht Frau Mathilda an. »Wissen Sie, eigentlich ist unsere Einrichtung bis zum Bersten gefüllt. Jedoch konnte das Ehepaar Metternich einfach nicht wegsehen, nachdem sie die Akte und somit den traurigen Fall der kleinen Mira studierten.«
Frau Mathilda scheint aus allen Wolken gefallen. Ich frage mich warum, der Kaplan hat doch gar nichts Wichtiges gesagt.
»Diana und Tadeus Metternich haben sich persönlich den Fall angesehen?«
Er nickt und sieht auf mich herab. »Ja, sie sind wirklich ein Segen für unsere schöne, alte, ehemalige Abtei. Gerade um die Weihnachtszeit bekommen wir vom Jugendamt viele Ausreißer und arme Seelen überstellt, die noch nicht volljährig sind und deshalb nicht in Wohngruppen oder Obdachlosenunterkünfte übergeben werden können.«
Hastig, als ob sie ihm ganz schnell zustimmen möchte, nickt Frau Mathilda. »Das ist uns allen sehr bewusst, Herr Kaplan, und wir sind Ihnen und der St.-Georgius-Einrichtung für schwer erziehbare Kinder äußerst dankbar, dass sie so kurzfristig noch jemanden aufnehmen können. Speziell im Fall der kleinen Mira. Sie ist ein ganz besonderer Sonnenschein und arbeitet noch mit dem Abwehrmechanismus der Verdrängung.« Sie legt mir eine Hand auf die Schulter, und ihre Augen sind so feucht, dass ich fast das Gefühl habe, sie würde gleich weinen. »Sie braucht besondere Fürsorge.«
»Sicherlich«, sagt der Priester so leise, dass ich Mühe habe, ihn zu verstehen, und reibt sich über das Kinn. »Ein besonderes Kind benötigt besondere Betreuung.«
Die beiden reden noch einige Zeit, während ich mitten im Raum stehe und nicht so recht weiß, was ich machen soll. Zwei Türen gehen von dem Büro ab. Ich wüsste zu gerne, was sich dahinter befindet. Außerdem riecht es hier komisch. Fast so ähnlich, als würde man an einer Kneipe vorbeigehen Nur viel leichter und nicht so brennend in der Nase.
»Und ihre Verbrennungen?«, will der Mann wissen, während er mich weiter beäugt.
Ich höre kaum hin, sehe aber, wie Frau Mathilda ihm eine Salbe in die Hände drückt.
Dabei verziehe ich die Nase. Schon wieder diese stinkende Creme. Ich weiß gar nicht, warum ich die brauche. Aber alle Schwestern und Ärzte meinten, es wäre total wichtig, dass sie meinen Rücken damit einschmieren.
»Siebenmal in der Woche«, antwortet Frau Mathilda. »Und natürlich müssen die Arzttermine wahrgenommen werden. Das Irmgardis-Krankenhaus ist bereits im Bilde.«
»Ausgezeichnet.« Der Mann richtet seine schwarze Kleidung. Sieht komisch aus. Als würde er Katzenhaare von ihr streichen wollen, die gar nicht existieren. »Dann wäre ja alles geklärt.«
Frau Mathilda verabschiedet sich, dabei macht sie fast einen Knicks vor dem Mann und zeichnet mit der Hand ein Kreuz vor ihrer Stirn nach. Es sieht so aus, als wäre sie unendlich dankbar, dass ich an dem Ort unterkommen kann. Komische Sitten haben sie hier.
Ein letztes Mal kniet sich Frau Mathilda zu mir herab, küsst meine Stirn und packt meine Hand so feste, dass ihre beinahe weiß anläuft.
»Versprich mir, dass du artig bist, Mira. Ab jetzt wird alles besser. Du wirst ein braves Mädchen sein, hörst du?«
Ich nicke, dabei weiß ich gar nicht so genau, warum ihre Stimme immer zittert. Eigentlich ist es doch schön hier. Ich habe Stoffel, alle streichen mir über den Kopf, und das Abenteuer, in einem riesigen, alten Haus zu leben, schreit nach Spannung. Vielleicht gibt es hier sogar Kinder, mit denen ich spielen kann.
Allerdings merke ich auch, dass irgendetwas nicht stimmt. Besonders immer dann, wenn die Erwachsenen sich von mir wegdrehen und mit leiser Stimme tuscheln, während sie mich mitleidig ansehen. Vielleicht ist das so, wenn man groß ist. Alles muss man immer schlecht sehen, dabei fühle ich mich gar nicht so übel. Bis auf das Jucken auf meinen Rücken, natürlich. Aber dafür gibt es ja die stinkende Creme.
»Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll.« Frau Mathilda steht in der Tür und grinst so breit, dass ich das Gefühl habe, ihre Mundwinkel würden reißen, dabei hat sie immer noch feuchte Augen. Eine komische Mischung.
Der Mann reicht ihr die Hand und schließt langsam die Tür. »Das wird der Allmächtige schon tun. Auf bald!«
»Guten Abend, Herr Kaplan.«
Die Tür schließt so leise, dass man es kaum vernehmen kann. Ein paar Sekunden atmet der Mann durch, begibt sich dann zu seinem Schreibtisch und öffnet eine Schublade. Heraus kommt eine Flasche mit brauner Flüssigkeit. Er stellt ein Glas auf den Tisch, gießt sich ein und trinkt, während er mich nicht aus den Augen lässt.
Locker lehnt er am Schreibtisch und lächelt sanft. »Wie alt bist du, Mira?«
»Sechs Jahre«, antworte ich und bin sogar stolz, dass ich es direkt weiß.
Er nickt und trinkt gemächlich. »Und weißt du, warum du hier bist?«
Ich zucke mit den Schultern. »Weil Frau Mathilda es sagt?«
Er wird von einem kurzen, traurigen Lachen geschüttelt. »Ja, das ist wahr.« Wieder greift er in seine Schublade, diesmal kommen Zigaretten zum Vorschein. Er trinkt die Flüssigkeit und zündet sich eine von den Dingern an.
Sargnägel, hat Frau Mathilda dazu gesagt, und jetzt weiß ich auch, warum mich der Gestank immer an die Kneipen erinnert, von denen ich fortgezogen wurde.
Von wem eigentlich?
Einen kurzen Moment versuche ich mich zu konzentrieren, kneife dabei sogar die Augen zusammen, doch irgendwie sind meine Erinnerungen nur verschwommene Bilder und wollen nicht so recht zusammenpassen.
»Weißt du, ich werde noch ein wenig im Amt sein«, sagt der Kaplan und kniet sich herab. Jetzt kann ich den Geruch noch deutlicher riechen. »Zwölf Jahre noch, vielleicht dreizehn.« Mit der Hand, die die Zigarette hält, knufft er mir in die Schulter und streichelt im Anschluss Stoffel. »In der uns verbleibenden Zeit machen wir es uns schön.« Er zwinkert mir zu und lächelt.
Beinahe hätte ich auch gelacht, aber der Qualm brennt mir in den Augen, und der fiese Gestank vom Schnaps beißt in der Nase.
Ich nicke und will Stoffel von ihm zurückziehen, als es an der Tür klopft. Der Kaplan wirkt ein wenig genervt, erhebt sich wieder, drückt die Zigarette aus und stellt das Glas in die Schublade des Schreibtischs. Erst als er die Asche von seinem schwarzen Hemd gestrichen hat, wendet er sich der Tür zu.
»Herein!«
Als die Tür aufschwingt, trifft mich fast der Schlag. Ich sehe in die Gesichter von zwei Superhelden. In wundervoller Kleidung, werden sie von einem Windhauch begleitet, der die ganze schlechte Luft kräftig wegweht. Mein Mund steht weit offen.
»Das Ehepaar Metternich. Womit haben wir die Ehre verdient?«
»Ist sie das?«, will die Frau wissen und lächelt so wundervoll, dass ich verschämt Stoffel vor mein Gesicht ziehe.
»Ja, Frau Metternich. Das ist die kleine Mira. Wurde gerade vom Jugendamt an uns überstellt.«
Die beiden treten näher. »Entschuldigen Sie bitte den Aufzug, wir kommen gerade von der Messe.« Sie kniet sich zu mir herab und reicht mir die Hand. »Du bist also Mira. Hallo, ich bin Diana Maria.«
Sie gibt sich so, wie die Frauen in den Zeitschriften sind, und lächelt noch toller als die feinen Damen im Fernsehen. Dazu trägt sie ein schwarzes Kleid, viel glitzernden Schmuck, einen dicken, kuscheligen Mantel und schwarze Lederhandschuhe. Die braunen Haare sind zu einer schicken Frisur gemacht worden.
»Hallo«, piepse ich und will ihr augenblicklich in die Arme fallen.
Auch ihr Mann tritt näher. »Diana, meine Liebe. Du überforderst die junge Dame.« Er sieht einfach umwerfend aus, und auch der Anzug ist toll. Die Krawatte, das Tuch, die Socken, alles wirkt super chic. Er trägt einen Mantel, auf dem allmählich die weißen Schneeflocken schmelzen. Auf den braunen, mit Gel in Form gebrachten Haaren ist der Schnee schon nicht mehr zu sehen. So soll einmal mein Mann aussehen, wenn ich heirate.
»Ja, bestimmt«, sagt die Frau und steht auf. Dann wirft sie dem Kaplan einen bösen Blick zu und tut so, als würde sie mit der Hand nicht erkennbaren Rauch wegdrücken. »Sie sollten sich schämen, Herr de Vries. Uns ist durchaus bewusst, dass sie aus einer Zeit stammen, in der Rauchen und Alkohol noch völlig legitim waren. Aber das schadet den jungen Seelen, finden Sie nicht?«
Kraftlos lehnt der Kaplan gegen seinen Schreibtisch und nickt. »Ja, Frau Metternich. Sie haben recht.«
Ich sehe, wie ihr Mann näher kommt und den Arm um seine Frau legt. »Reg dich nicht auf, Darling.«
Darling. Wie cool.
So was sagen nur die Leute in den Filmen. Ich sehe ihn mit großen Augen an und knete vor Aufregung Stoffels Ohren.
»In ein paar Jahren wird der Herr Kaplan in seinen wohlverdienten Ruhestand treten, und den Kindern wird es besser gehen. Wenn es nach mir geht, lieber früher als später. Und dann können wir jemanden an seiner statt installieren, der sich etwas ... kooperativer verhält.«
»Wie Sie meinen«, antwortet der Mann, und plötzlich sieht er ganz winzig aus. Als wäre er in sich zusammengefallen.
Die drei gucken sich an, als ob sie sich verschlingen möchten. Sekundenlang geht das so ... oder auch viel länger. Auf jeden Fall kommt es mir wie eine Ewigkeit vor, bis sich Frau Metternich wieder zu mir kniet.
»Wie sieht es aus, Mira, möchtest du beim Kaplan bleiben, oder soll ich dich lieber erst mal in deinem neuen Zuhause rumführen?«
Ich sehe kurz zu dem stinkenden Kaplan, der mit roter Nase und Händen in den Taschen wie ein Trauerkloß am Schreibtisch lehnt, dann wieder zu der strahlenden Gestalt vor mir. Ihr Mantel duftet so toll, dass ich am liebsten die ganze Zeit daran gerochen hätte.
»Stoffel und ich würden gerne mit Ihnen gehen.«
»Das freut mich«, sie nimmt meine Hand. »Wir beiden machen es uns schön, und du kannst ruhig Diana sagen.« Noch einmal dreht sie sich um, ergreift dabei meine Hand und führt mich zur Tür. »Wir kümmern uns jetzt erst mal um das arme, arme Mädchen.«
2 – Phönix
8. Tag nach dem Ende
Die Wärme umschließt mich mit ihrer sanften Hand.
Ich existiere in einem Kokon aus Wärme und Glück. Alle bösen Gedanken sind fort, und es bleibt eine reine Seele zurück. Zufriedenheit durchströmt mich, und ich taumle dem Licht entgegen. Ich kann spüren, wie es mich berührt, mich zu sich hinzieht. Um nichts in der Welt würde ich ihm lieber nachgeben, mich einfach fallen lassen, sodass der Schein mich durchdringt.
Er glänzt in allen Farben des Regenbogens, und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als ein Teil davon zu sein. Endlich, nach so langer Zeit.
Doch etwas lässt mich nicht gehen. Einem dicken Stein gleich, tief in die See sinkend, der mit einem Seil an mein Bein gebunden ist und den ich vergessen habe zu lösen. Es zieht mich hinab, bis das Licht abnimmt und der Schmerz erneut von mir Besitz ergreift.
Mit seiner gemeinen, unbarmherzigen Macht prescht er in meinen Leib und verdrängt die zarten Gefühle von Glückseligkeit. Die Farben nehmen weiter ab und werden von einem dunklen Grau übertüncht. Es ist, also würde mir verweigert, den Lichterbogen zu passieren. Der Stein, der schwer und mahnend an meinem Bein hängt, wird übermächtig. Habe ich etwas vergessen? Wieso darf ich noch nicht gehen?
Jegliche Farbenspiele des Lichts erlöschen, und finstere Explosionen erschüttern mich. Erst sind sie ganz weit entfernt und kündigen ihr Unheil nur durch dumpfes Pochen an, doch bald schon sind sie ganz nah, und ich meine, in Kratern aus einem Bombenhagel zu verweilen.
Der Schmerz nimmt zu, wird übermächtig. Der Stein wirkt nun riesengroß. Ich atme viel zu schnell, immer wieder, bis ich es nicht mehr aushalte und aus dem Grau erwachen will.
»Fuck!«
Was? Was zum Teufel ist hier los?
Ich sollte tot sein. Nur diese eine Sache war noch wichtig. Stattdessen liege ich in einem Zimmer, und bunte Lichtblitze beleuchten den Raum, während ein Donnerschlag nach dem anderen mich zum Zucken bringt. Durchdringendes Piepen prescht in meine Ohren. Wo liege ich hier? Menschen jubeln in der Ferne, und weitere Explosionen trommeln durch die Nacht. Mein Herz scheint der Aufregung nicht gewachsen und pocht mit den Geschossen um die Wette, als eine Tür aufgerissen wird und Licht den Raum erfüllt.
»Du bist wach.«
Die Stimme der Frau klingt überrascht. Einige Sekunden treffen sich unsere Blicke, und ich kann nicht sagen, wessen Augen mehr Fragen beherbergen.
»Ja«, murmle ich. Erst jetzt fällt mir auf, wie schwach meine Stimme ist. Fast als würde ich sie zum ersten Mal benutzen. »Aber warum nur?«
»Warum was?«
»Warum bin ich am Leben?« Wieder und wieder zucke ich zusammen, wenn eine neue Rakete vor meinem Fenster explodiert. Ich blicke panisch dorthin und will mich am liebsten unter der Decke verkriechen. Meine Kehle ist staubtrocken und rau. Sie fühlt sich an, als hätte ich kiloweise Wüstensand mit Scherben geschluckt.
»Na, weil du unglaubliches Glück hattest.« Sie drückt das Telefon ans Ohr und legt nach einigen Sekunden auf. »So ein Mist, sind wahrscheinlich alle schon besoffen.« Dann fallen ihre pechschwarzen Augen wieder auf mich. »Ich kann nicht glauben, dass du kaum Verletzungen davongetragen hast.«
Die Frau, die ich nach messerscharfer Kombinationsgabe als Krankenschwester erkenne, kommt näher und drückt wie wild auf ihrem Telefon herum, während sie meinen Schweiß von der Stirn wischt. Sie ist von dunkler Hautfarbe, hat eine Glatze und ist vielleicht ein paar Jahre älter als ich. In ihren goldenen Kreolohrringen spiegeln sich die zuckenden Explosionen wider, und als sie bemerkt, dass ich es bei jeder Detonation mit der Angst zu tun bekomme, zieht sie die Vorhänge vor die Fenster.
»Ja, ich konnte Silvester auch nie leiden. Ich spende lieber an Tierheime, anstatt Raketen in den Nachthimmel zu jagen.« Sie schüttelt den Kopf und streicht mir übers Gesicht, als ob ich Frankensteins Monster wäre, das gerade zum ersten Mal das Licht der Welt erblickt.
»Ich meine, 2019 gab es diese Fallschirmspringerin aus Kanada«, fährt sie fort. »Ihre beiden Fallschirme öffneten nicht, und sie fiel ungebremst aus anderthalb Kilometern zu Boden.« Sie legt mir eine Manschette um den Oberarm, misst den Puls und anschließend hört sie mit ihrem Stethoskop den Herzschlag ab. Die Schwester redet schnell und aufgeregt, betastet mich hier und da, leuchtet mir in die Augen und versucht immer wieder, den Arzt zu erreichen. Offensichtlich vergebens.
»Die Fallschirmspringerin trudelte von einem Baum in den nächsten und landete schließlich schwer verletzt in dicht gewachsenen Dornenbüschen. Das rettete ihr das Leben.« Sie lässt hörbar Luft aus dem Mund entweichen und beäugt mich, einer besonders interessanten Spezies gleich. »Aber du bist von einer Abtei direkt auf den Marktplatz aufgeschlagen und hattest fast nichts.« Sie drückt mir auf den Bauch, woraufhin mir ein leichter Schmerzschrei entweicht.
»Ah, hast du sie noch alle?«
»Na ja, bis auf ein paar Quetschungen natürlich.« Sie sieht sich meine Akte an. »Tatsächlich war die Entgiftung gefährlicher als der Sturz. Beinahe hättest du es nicht geschafft.«
Langsam kriechen die Erinnerungen zurück in meinen Verstand. Sie versteinern mein Antlitz, und ich sehe ruhig dem farbenfrohen Feuerwerk entgegen. »Ich bin nicht tot.«
»Nein, aber du hast alles dafür getan, dass du es bist«, entgegnet die Krankenschwester und wählt wieder die Nummer des Arztes. »Warst auch beinahe erfolgreich, und du dürftest ziemliche Schmerzen haben, sollten die Schmerzmittel nachlassen.«
»Wieso habt ihr das getan?«, entfährt es mir, ohne sie anzusehen. Endlich habe ich die Kraft, die Bettdecke zu lüften und erkenne, dass ich zwar von Schläuchen umgeben bin und mir Zugänge gelegt wurden, allerdings kann ich keine OP-Narben erkennen. Nur meine Haut schimmert in den wildesten Grün- und Blautönen, aber das bin ich ja durchaus aus anderen Gründen gewöhnt.
»Nun, es ist unser Job.« Ihre Stimme wird zunehmend zickiger. »Wieso geht der Idiot nicht ran?«
Plötzlich fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Wenn ich am Leben bin, habe ich noch ganz andere Probleme.
Noch einmal sehe ich an den Vorhängen vorbei nach draußen. »Heute ist Silvester?«
»Nein.« Sie schüttelt den Kopf, legt schnaubend auf und deutet mit dem Telefon nach draußen. »Seit ein paar Minuten nicht mehr. Frohes neues Jahr, übrigens.«
»Fuck!« Mit der Endgültigkeit eines Sensenhiebs von Gevatter Tod setze ich ganz allmählich die Puzzleteile meiner Erinnerung wieder zusammen. Das Gesamtbild gefällt mir so gar nicht. Plötzlich fühle ich mich, als wäre ich von einem Vorschlaghammer getroffen. »Ich liege im Irmgardis-Krankenhaus in Tannenwald, oder?«
Sie hält inne, leuchtet mir in die Augen und untersucht, ob sich meine Pupillen erweitern. »Ja, liegst du, und ich würde dich bitten, ganz ruhig zu bleiben, bis ich den Arzt ...«
»Oh Gott.« Den Ort kenne ich bereits. Ich wusste, dass mir die Einrichtung seltsam vertraut vorkommt. Sie haben die Innenwände neu gestrichen und ein wenig modernisiert, jedoch haftet dem flachen Bau aus den Siebzigerjahren immer noch der Mief von gewaltsamer Unterdrückung und der Essenz des Unaussprechlichen an. Auch wenn der Anstrich neu ist, der Boden und das Wäldchen, in das sich das Krankenhaus schmiegt, ist es nicht. Hier wurde vor langer Zeit unendliches Unrecht begangen und niemals gesühnt.
Plötzlich ist es, als ob sich ein dunkler Schatten meiner Seele bemächtigt, und ich will nichts wie weg von diesem Ort.
»War jemand da?«, schießt es aus mir hervor. Ich sitze aufrecht im Bett, sehe, wie sie zurückschreckt, und irgendetwas in ihren Augen verrät mir, dass ich mit meiner Annahme gar nicht so falsch liege. »Hat jemand nach mir gefragt?«
»Ja«, sagt sie lang gezogen und sieht mich unsicher an. »Fast jeden Tag kam jemand. Unterschiedliche Leute, aber die Polizei war bis vor ein paar Stunden noch hier. Jetzt haben sie zu Silvester ihre Kräfte abgezogen.«
»Es ist also bekannt, dass ich hier bin?« Die Aussage geht mehr an mich selbst als an die Krankenschwester.
Sie wählt noch einmal die Kurzwahltaste auf dem Telefon. »Natürlich. Du hast einen Sprung vom Dach eines dreistöckigen Gebäudes überlebt. Das stand nicht nur im Tannenwälder Kurier. Online war es selbst den überregionalen Medien eine Meldung wert.«
»Scheiße«, stammle ich und schaue auf den Zugang an meinem Arm.
»Du bist so etwas wie eine Berühmtheit.«
»Riesige Scheiße.«
Sie drückt das Telefon fest ans Ohr »Wenn es davon ein Video gäbe, würde es sofort viral gehen.«
»Unglaublich riesige Scheiße.« Ich sehe ihr tief in die dunklen Augen und ergreife ihre Hand. Erst jetzt bemerke ich, wie kalt meine Finger sind. »Sie werden wiederkommen, wenn das Medieninteresse abflacht und die Polizei nicht mehr vor Ort ist.«
»Wer?« Sie sieht angstvoll aus, ihre Nervosität wächst sichtlich. »Bist du in Gefahr?«
»Frauen und Männer der Gemeinde, vielleicht sogar die Polizei selbst. Was weiß ich.« Immer wieder blicke ich voller Unbehagen zur Tür. Ob sie die Anonymität des Neujahrsmorgens ausnutzen? Meine ohnehin schon krächzende Stimme wird leise. »Das werden sie nicht auf sich sitzen lassen.« Ich spüre, wie meine Kraft versiegt und mein Rachen schmerzt. »Ich habe Dinge gesehen und gespürt, die nur meinen Tod bedeuten können.«
Unsere Blicke treffen sich. Für diese eine Sekunde habe ich das Gefühl, als würde sie mich verstehen. Sie zieht die makellose, schwarze Haut in Falten. »Okay.« Das Wort betont sie, als ob sie mit einer Verrückten reden würde.
Vielleicht tut sie es ja auch, wer kann das schon sagen?
»Ich muss hier weg.« Mit Nachdruck fasse ich ihre Hand fester, der Ton wird flehender. »Sie sind mächtig und werden eine Möglichkeit finden, mich zu töten.« Mein Blick fällt auf ihr Namensschild. »Bitte, hilf mir, Schwester Fayola.«
Die Pflegekraft wartet lange, bevor ihre Lippen sich öffnen. Ich weiß nicht, warum sie mir glaubt. Vielleicht sind es meine Augen, vielleicht hat sie so etwas schon einmal erlebt, oder vielleicht weiß sie, was es heißt, ungerecht behandelt zu werden.
»Wie heißt du?«, will sie wissen und fasst nun auch meine Hand.
»Mira Schwarz.«
»Hallo Mira, ich bin Fayola Ritare. Sag mir bitte, dass es wirklich ernst ist und du keine durchgeknallte Irre, die mich in die Bredouille bringt?«
Es tut mir leid, dass ich ihr das aufbürden muss. »Ich kann dich zu gut verstehen. Immerhin bin ich eine Fremde. Eingeliefert vor acht Tagen, weil ich mich umbringen wollte und seitdem im Koma. Plötzlich durch das Knallen der Silvesterböller erwacht, und dann tische ich dir solche Geschichten auf.«
Sie nickt kaum merklich. »Ja, so ungefähr.«
»Ich schwöre dir, ich bin wirklich in Gefahr«, flehe ich. »Sie werden es nicht offensichtlich tun. In einigen Tagen werde ich an Herzversagen sterben oder einfach verschwinden – so etwas in der Art. Bitte, es ist die einzige Chance, dass ich hier lebend rauskomme.«
Noch immer klingt mir das Freizeichen des Telefonapparats in den Ohren. Die Explosionen am Fenster lassen langsam nach, der Jubel verebbt.
»Du bringst mich in eine Scheißsituation«, stöhnt sie.
»Sorry, aber nur du kannst mich retten.«
»Schon komisch, dieser Gedankengang, von jemandem, der sich vor nicht allzu langer Zeit selbst von einem Häuserdach gestürzt hat und so viele Pillen schluckte, dass es eigentlich für ein Mammut reichen sollte.«
Eine Träne kullert mir die Wange hinunter. »Ich weiß. Aber das war die einzige Sache, die ich in meinem Leben noch kontrollieren konnte. Selbst das habe ich nicht hinbekommen. Irgendwann werde ich dir alles erklären. Aber ich möchte verdammt sein, wenn sie erneut über mich entscheiden. Damit ist ein für alle Mal Schluss. Also, hilfst du mir?« Meine Stimme bricht beinahe. »Bitte!«
Hastig zieht sie Luft in die Lungen, als endlich jemand am anderen Ende der Leitung abnimmt und sich mit tiefer Stimme meldet.
»Hallo? Arnold, hier. Ich höre! Gibt es einen Notfall?«
Ihre Hand zittert ein wenig. »Nein, Herr Doktor. Tut mir leid, feiern Sie weiter, ich habe mich vertan.« Dann legt sie in Zeitlupe auf, und ein Lächeln erfasst meine Lippen.
Ich habe ganz vergessen, wie es ist, wenn jemand nett zu mir ist. Kam nicht oft vor in meinen Leben und fühlt sich irgendwie ganz komisch an, ganz tief in der Magengrube.
»Warte hier.« Fayola reißt sich selbst aus ihrer Lethargie und stürmt zur Tür hinaus. »Ich hole dir ein paar Sachen.«
Sie ist keine zwei Sekunden verschwunden, bis ich die Decke zu Boden gleiten lasse und die Beine vom Bett schwinge. Elegant will ich von der Matratze steigen und merke erst jetzt, dass die Füße ihren Dienst so gar nicht antreten wollen.
Polternd falle ich zu Boden. Dabei spannt der Zugang samt Beutel mit Flüssigkeit, und auch der Katheder sitzt an Stellen, wo man keine Schläuche haben möchte. »Shit.«
Nur mit Mühe gelingt es mir, mich aufzurichten. Ich beiße auf die Zähne, ziehe mir selbst Zugang und Katheder. Anschließend sehe ich dem Blut dabei zu, wie es zu Boden tropft.
Mir ist schwindlig, kotzschlecht, und ich habe so viel Durst, dass ich einen ganzen Kasten trinken könnte. Nur gut, dass in dem Zeug, das sie mir verabreichten, offenbar eine gute Portion Schmerzmittel zu finden war. Obwohl meine Haut in allen Farben des Regenbogens erstrahlt, fühle ich nicht das allzu bekannte Pochen der blauen Flecken.
Zumindest etwas, denke ich mir, während ich mich an der Wand abstütze und zum Bad hinke. Ich trinke minutenlang aus dem Wasserhahn, erleichtere mich auf der Toilette und wasche mich, so gut es geht.
Meine langen, blonden Haare sehen aus, als wären sie in Fett getränkt, aber darum kann ich mich jetzt nicht kümmern. Ein paar Ohrfeigen später bin ich etwas klarer im Kopf, und auch die Röte auf meinen Wangen kehrt zurück.
»Alles in Ordnung?«, will Schwester Fayola wissen, als sie mit einem Beutel und einem Rucksack zurückkehrt. »Du siehst ...«
»... beschissen aus. Ich weiß. Aber für ein Make-up und eine perfekte Beinrasur fehlt mir leider die Zeit.« Bleierne Schwere erfasst mich. Ich zwinge mich, aus dem Bad zu treten. »Und leider auch die Kraft.«
»Da habe ich was für dich.«
Die Nadel der Spritze glänzt im fahlen Licht der Krankenhausbeleuchtung. Im Hintergrund verhallen die letzten krachenden Explosionen am ersten Morgen des neuen Jahres, und ich ahne, dass es ganz anders wird als mein vorheriges. Zumindest hoffe ich es inständig. Nie wieder soll jemand über mich entscheiden. Nie wieder.
»Was ist das?«, will ich wissen. Von Spritzen und Drogen habe ich eigentlich die Nase voll.
»Vitamine und Schmerzmittel.« Fayola wirft den Beutel auf das Bett und legt den Rucksack ab. »Eigentlich solltest du in deiner Verfassung im Bett bleiben.«
Irgendetwas sagt mir, dass ich ihr vertrauen kann. Eine innere Stimme, die in den letzten Jahren viel zu oft unterdrückt wurde. Ich setze mich, befreie meinen Arm von Stoff. »Ja, aber ich habe keine andere Wahl. Tu es.«
Während sie die Spritze setzt und kalte Flüssigkeit in meine Venen dringt, durchwühle ich mit der freien Hand den Beutel. »Was ist das?«
»Fundsachen«, antwortet sie konzentriert. »Ich hoffe, es ist deine Größe. Ich habe nur schnell ein paar Klamotten zusammengesucht.«
Nachdem sie den Einstich versorgt hat, ziehe ich mir unbeholfen eine viel zu große Jeans, einen Pullover, Socken, Sneaker und eine dunkelgrüne Bomberjacke über. Kaum zu glauben, was die Menschen alles vergessen. Als passende Krönung verstecke ich die blonden Haare unter einer Jamaika-Beanie. Ein Blick in den Spiegel verrät mir, dass ich aussehe wie ein Nazi-Rastafari, doch das ist mir völlig gleichgültig.
»Ich nehme nicht an, dass du irgendwo hinkannst?«
So weit hatte ich noch gar nicht gedacht. Langsam schüttle ich den Kopf. Die Erkenntnis ergreift mein Herz und drückt allmählich zu, als wäre es in einen Schraubstock gespannt.
»Bis auf die Leute in der Einrichtung kenne ich niemanden, dem ich vertrauen würde.«
Sie schnalzt mit der Zunge und kritzelt Buchstaben auf ein Blatt Papier. »Das ist die Adresse meiner WG in Düsseldorf. Das müsste weit genug weg sein, damit sie dich nicht finden. Du kannst ein paar Tage bleiben, wenn du willst.« Sie zögert, weiß nicht, ob sie das Richtige tut. Kaum zu glauben, dass sie mir hilft. »Mein Mitbewohner Joseph ist ein ziemlicher Gauner, ein Kleinganove, der immer knapp bei Kasse ist, aber er hat das Herz am rechten Fleck. Bitte, töte ihn nicht«, haucht sie eindringlich und voller Unsicherheit. Halb aus Scherz, aber aus bitterem Ernst. Es gibt noch gute Menschen auf diesem Planeten voller Egoisten und Gräueltäter.
»Werde ich nicht, versprochen. Ich bin suizidgefährdet, keine Mörderin.« Ein Moment der Überlegung verstreicht schweigend. »Na ja, noch nicht.«
»Okay«, sagt sie lang gezogen, wahrscheinlich mit der Vermutung, dass sie einen riesigen Fehler begangen hat.
Wer könnte es ihr verdenken.
Fayola drückt mir dreißig Euro und Pfefferspray in die Hände. »Ich werde allen sagen, dass du einfach so abgehauen bist. Kurz vor Ende meiner Schicht werde ich dein Fehlen melden.« Sie sieht sich um, als ob man uns beobachten würde. »Nimm den Hinterausgang, er steht derzeit offen, weil einige dort noch anstoßen und rauchen. Du kennst dich ja hier aus.«
Ich nicke gedankenverloren und stecke ihre Geschenke in die Taschen der Bomberjacke. »Erinnere mich nicht dran.« Mit der Gewissheit, dass ich verloren bin und keinen Plan habe, wie es weitergehen soll, sehe ich ihr in die Augen. »Ich mag deinen Stil. Die Glatze steht dir total.«
»Ich deinen auch.« Für den Bruchteil einer Sekunde ist es wirklich ein halbwegs normales Gespräch zwischen zwei jungen Frauen. »Deine langen Haare sind toll.«
»Ja«, murmle ich und zwinge mir ein Lächeln ab. »Das sahen leider eine ganze Menge Arschlöcher genauso. Besonders jene, die ihre Finger nicht bei sich lassen können.« Die Erinnerungen muss ich mit aller Macht verdrängen. Es ist nicht die Zeit für schwere Gedanken. Nun gilt es, mein Leben zu retten, das ich vor nicht allzu langer Zeit noch beenden wollte. Doch irgendetwas ist anders. Irgendetwas, das ich noch nicht zu greifen vermag.
Langsam schreite ich zur Tür. »Du solltest sie begutachten, wenn sie nicht aussehen wie ein Haufen Filz.« Kurz halte ich inne. »Ich danke dir, Fayola. Für alles, von Herzen.«
»Klar.« Sie wartet eine Sekunde, holt Luft. »Ich weiß, wie es ist, wenn die ganze Welt gegen einen scheint.« Plötzlich klingelt das Telefon, und wir zucken zusammen. Sie sieht auf das Display und drückt mich beinahe aus der Tür, in den hell erleuchteten Gang. Das Licht schmerzt in den Augen. Fayola sieht gestresst aus, schnallt mir den Rucksack auf den Rücken, und ich muss mich zusammenreißen, dass ich nicht vor Schmerzen aufschreie.
Anscheinend lässt die Wirkung der Drogen langsam nach, und die Vitamine wollen noch nicht ganz meinen Körper fluten.
»Da sind zwei Wasserflaschen drin und ein Baguette. Sollte eigentlich mein Mitternachtssnack sein, aber du brauchst es dringender als ich.« Sie sieht sich in alle Richtungen um und begleitet mich noch ein Stück. »Du weißt, wir befinden uns hier am Rande von Tannenwald, ein kleiner Bahnhof ist direkt vor dem Krankenhaus.«
»Danke, aber das ist noch nicht mein Ziel.«
»Was?« Wir bleiben stehen, während meine fast unbekannte Retterin mich ansieht, als hätte ich den Verstand verloren. »Wo willst du jetzt hin?«
Mein Blick geht in die Ferne, ein paar Augenblicke nur. »Ich muss noch einmal in die Stadt hinein, in das Epizentrum der Hölle, dort, wo die Gesetze der Menschlichkeit keine Gültigkeit haben.«
»Aha.« Plötzlich klingelt das Telefon in ihrer Hand. Angestrengt sieht sie sich um, ob die Türen zu den Krankenzimmern geschlossen bleiben. »Und was willst du dort?«
Ich zwinge mir ein letztes Lächeln ab, bevor ich mich umdrehe. »Einen Toten besuchen.«
3 – Vertrauen
4175 Tage vor dem Ende
Es ist wieder Sommer. Der erste, seitdem ich hier bin.
Im Büro des Kaplans ist es so heiß, dass ihm die Schweißperlen in Strömen herablaufen. Mit der roten Haut und der glühenden Nase sieht er aus wie ein Schweinchen. Ich trage nur eine dreckige Jeans und einen dünnen Pulli aus der Kleiderkammer, während er wieder diese ekelige schwarze Robe übergeworfen hat. Es muss fürchterlich warm sein dort drunter. Sogar der weiße Kragen ist durch den Schweiß gelb gefärbt.
In seinem Büro stinkt es nach Schnaps und Zigaretten. Ich will nicht hier sein. Es ist dunkel, voll mit langweiligen Büchern, und ich muss immer still sitzen und mit Kaplan Johan de Vries über alles Mögliche reden. Dabei will ich nichts sehnlicher, als mit den anderen Kindern in die Klassenräume gehen, lernen, spielen, weiter die Einrichtung St. Georgius erkunden. Wir bekommen Lehrer von außerhalb. Das ist schön, sie sind immer freundlich und geben sich viel Mühe.
Hier, in der muffigen Bude, muss ich ganz oft husten und bin immer froh, wenn ich wieder auf den kühlen Flur der alten Abtei treten kann. Ja, das habe ich schon gelernt. Das Gebäude auf dem Marktplatz in Tannenwald war früher einmal für Mönche gedacht.
Wieder huste ich und halte mir die Hand vor den Mund, wie es die Lehrer wollen. Sogar jetzt raucht der Kaplan und trinkt dabei aus einer großen, weißen Tasse. Er glaubt, ich weiß nicht, dass es gar kein Kaffee ist, den er da schlürft, aber den beißenden Gestank kenne ich nur zu gut. Er haftet ihm an wie Klebe und scheint in jeder seiner Roben zu hängen.
»Und hast du schon Freunde gefunden?«, will er wissen und lächelt mich mit gelblichen Zähnen an.
Die Frage stellte er immer wieder in den letzten Monaten. Meistens, wenn ihm die Gesprächspausen zu lange werden.
»Schon«, murmle ich und zupfe an Stoffel.
»Wen denn?«
Habe ich ihm schon mehrmals gesagt. Aus irgendeinem Grund will er die Antworten immer wieder hören. »Ich mag die Jessy ganz gerne und auch den Torky.«
Wenn er lächelt, sieht es aus, als würde ein Walross grinsen. Ein puterrotes, stinkendes Walross. »Du meinst Jessica Czerbi und Thomas Torkmann? Das ist gut, sie sind in deinem Alter und haben ungefähr dasselbe durchgemacht.«
»Wir nennen ihn nur Torky«, antworte ich, ohne auf den zweiten Teil seines Satzes einzugehen. Wie ich befürchte, lässt der Kaplan nicht locker.
»Weißt du denn, was ihr durchgemacht habt?«, will er wissen, lehnt weiter locker auf seinem Schreibtisch und drückt die Zigarette im überfüllten Aschenbecher aus.
Jetzt sehe ich wieder hoch. Ihm direkt in die Augen, damit ich den Blick des Kaplans erkennen kann, wenn die Worte meine Lippen verlassen. »Unsere Eltern sind alle gestorben.«
Er scheint schockiert. Der Mann schluckt, zündet sich noch eine Zigarette an und qualmt den Raum voll. »Weißt du, wie deine Eltern gestorben sind?«
»Es war ein Autounfall. Im letzten Winter. Deshalb habe ich die großen Brandnarben am Rücken.«
Ich spreche alles laut und deutlich aus, wie die Lehrer es uns beigebracht haben. Genau das scheint ihm nicht zu gefallen. Unruhig rutscht er auf der Tischkante herum.
»Und ...« Er räuspert sich, trinkt noch einen Schluck von dem ekligen Schnaps aus der Tasse. »... tut das dir nicht leid?«
»Nein.« Die Antwort rede ich einfach so dahin. Ohne Emotionen, wie einer der Lehrer manchmal sagt. Gefühlskalt und mit wenig Enepathie ... Emmapathie, oder wie das heißt. Die ganzen Worte finde ich doof und sind mir auch egal. Lieber sehe ich wieder zu Stoffel und streiche über sein kuscheliges Fell. Ach, was würde ich nur ohne ihn machen.
»Willst du mir verraten, warum?«
Ich antworte nicht, zupfe weiterhin an den Ohren.
»Mira? Möchtest du mir sagen, warum dir das nicht leidtut?«
Ich will nicht antworten. Eigentlich will ich gar nicht hier sein, sondern lieber mit Jessy und Torky die gruselige Abtei erkunden. Zu meinem großen Glück klopft es, und noch bevor der blöde Kaplan die Zigarette überhastet ausdrücken kann, schwingt die Tür auf, und ich sehe in das freundliche Gesicht von Diana Metternich.
»Störe ich etwa?«
»Nun, ich war gerade ...«
Ich bin so froh, sie zu sehen, dass ich sogar den Herrn Kaplan unterbreche. »Nein, gar nicht.« Sofort stehe ich auf, damit ich mir nicht so den Kopf verrenken muss. »Hallo, Frau Metternich«, piepse ich und presse Stoffel ganz fest an mich.
Sie sieht wieder toll aus. Die braunen Haare sind wie immer schön frisiert. Sie trägt einen der Anzüge für Frauen, die die erfolgreichen Damen auch im Fernsehen anhaben. Ab und zu dürfen wir Serien im Gemeinschaftsraum gucken, und manchmal habe ich das Gefühl, als könnte Frau Metternich da mitspielen. Sie wirkt wie ein richtiger Star. Locker lehnt sie am Rahmen und guckt auf mich herab.
»Sie sollten wirklich das Rauchen aufgeben.« Ihr Blick wandelt zwischen Enttäuschung und Wut. »Vor allem, wenn sie Seelsorge für die Kinder betreiben.« Für einen Lidschlag verrutscht das Lächeln, und sie sieht genervt aus. »Oder zumindest das, was Sie dafür halten. Nun, wie auch immer.«
Gut so, zeigen Sie es dem doofen Pfaffen!
Der Kaplan wird noch kleiner, als er ohnehin ist, und öffnet zwei der kleinen, bunten Fenster. »Natürlich, Frau Metternich. Darf ich fragen, warum Sie hier sind?«
»Nun, der Grund steht genau vor mir.« Sie kniet sich herab, schüttelt Stoffel eine Pfote, und ich habe sie sofort ins Herz geschlossen. »Seitdem Mira bei uns in der St.-Georgius-Einrichtung ein neues Zuhause gefunden hat, war sie kaum draußen. Ich wollte ihr mal etwas anderes zeigen.« Sie zwinkert mir verschwörerisch zu. Das mag ich. »So einfach, von Frau zu Frau.«
Der Kaplan räuspert sich. »Nun, ich halte das für keine gute Idee. Die Lehrer, Erzieher und Ärzte sind sich einig, dass die junge Mira erhebliche Defizite in ihrer empathischen Entwicklung aufweist. Es geht weit über die Verhaltensauffälligkeit hinaus.« Seine tiefe, rauchige Stimme wird leiser. »Einige reden sogar von soziopathischen Zügen.«
»Kein Wunder bei dem, was sie durchmachen musste.« Sie lässt Stoffels Pfote los und nimmt mit ihren perfekt lackierten, roten Fingernägeln meine Hand. Dabei fühlt sich ihre Haut ganz warm und weich an ... und sie duftet wie eine Blumenwiese an einem Frühlingsmorgen. »Es ist wichtig, dass sie auch mal rauskommt, ein wenig Kind sein darf und nicht nur analysiert wird von Kirche und Ärzten.« Sie richtet sich auf, hält dabei meine Hand fest, führt mich aus dem stickigen Raum hinaus, und ich bin ihr unendlich dankbar, endlich wieder frische Luft zu atmen. »Außerdem muss ich Sie nicht daran erinnern, wer der größte Gönner dieser Einrichtung ist.« Sie dreht sich um, wieder zwinkert sie. Anscheinend macht sie das gern. »Kleiner Tipp, es ist nicht die von Ihnen so verehrte Kirche.«
Gott, ist die Frau toll!
Die Worte verlassen ihre Lippen bereits, während wir schon durch den Flur gehen, der mit komischen, grauen Statuen vollgestellt ist, die uns ständig grimmig angucken. Aber mit Frau von Metternich ist selbst das gar nicht so schlimm.
»Bist du schon mal Cabriolet gefahren?«
Ein paar Sekunden weiß ich nicht, was sie meint, bis mir die Bilder aus den Fernsehwerbungen einfallen. »Die Autos ohne Dach?«
»Ganz genau.«
Zielsicher führt sie mich durch die dunklen Korridore und schwingt die Eingangspforte auf. Sofort brennt die Sonne auf meiner Haut, und ich kann frische Luft atmen.
Wundervoll.
»Is' schön hier draußen, oder?«, sagt sie, drückt auf einen Knopf, woraufhin das Auto neben uns blinkt. »Alles besser, als in dem sticken Büro vom Kaplan zu sitzen.«
»Auf jeden Fall.« Ich bin so dankbar, dass ich endlich etwas anderes sehe als die blöde, ehemalige Abtei und die Lehrer. Sicherlich sind sie nett, aber die ständigen Regeln sind schon doof.
Da gibt es Frau Birkhof, die kleine, pummelige Cheferzieherin mit kurzen Haaren, die alles zu ernst nimmt und uns immer auf den Gang der Mädchen schickt, wenn wir gerade mit Torky rumalbern. Und selbst dort müssen wir schnell in die Federn und das Licht löschen. Oder Herrn Mattes, den Azubi, der viel zu schnell redet und immer sagt, was wir tun müssen.
Aber das ist alles vergessen, als Frau Metternich zu dem roten Flitzer schreitet, der ganz vorne an der Abtei mitten auf dem Marktplatz parkt.
»Wow«, entfährt es mir, und ich trete näher.
Sie steigt ein und ich sehe, wie alle Männer auf dem Marktplatz sich nach ihr umdrehen. Selbst die in der Schlange bei der Eisdiele verrenken sich die Köpfe und achten darauf, dass ihre Frauen nicht zu viel merken.
»Das gute Stück ist gerade ein halbes Jahr alt. Der Fahrtwind im Haar ist einfach unglaublich.« Sie streicht mir über den Kopf. »Und du hast so schöne Haare und bist so ein hübsches Mädchen, bei dir wirbeln sie bestimmt ganz wundervoll. Sie sind so lang, fast wie bei Rapunzel.«
»Ich weiß«, sage ich atemlos und versuche, die Tür zu öffnen. »Das sagen die Erzieherinnen auch immer.«
»Der Name passt.« Frau Metternich muss mir helfen und streicht mir erneut über die Haare. »Die kleine, hübsche Rapunzel. Wenn du möchtest, lasse ich dich auch mal fahren.«
Ich mache große Augen, steige in das Auto, und mein Herz pocht wie verrückt. »Echt?«
»Nein«, scherzt sie und schnallt mich an. »Aber wer weiß, vielleicht irgendwann.«
Sie drückt auf einen Knopf, und plötzlich röhrt der Motor so laut, dass ich mir die Ohren zuhalten möchte. Laut schwingt klassische Musik aus den Lautsprechern, die sie schnell mit einigen Bewegungen zum Schweigen bringt.
Nachdem der erste Schreck verflogen ist, gibt sie Gas. Erst langsam, die neidischen Blicke genießend, doch auf der Straße drückt sie sich eine Sonnenbrille auf die Nase und schießt an den anderen Autos einfach vorbei.
»Es ist, als würden sie parken und wir in einer Rakete sitzen«, rufe ich und spüre, wie der Wind an meinen Ohren rauscht. Die Sonne ist heiß und die Luft so warm, dass ich die Arme austrecke, als ob ich wie ein Vogel dahingleiten würde.
»Na, dann pass mal auf, Rapunzel.«
Frau Metternich lacht laut auf und schießt über die Straße, die den Ort umschließt. Links rauschen Häuser an uns vorbei, rechts sehe ich nur dichten Wald. In der Abtei erklärte man uns, dass die Leute mitten im Wald siedelten, um die umliegenden Städte mit Holz zu versorgen. Die ganze Gemeinde ist aus dem Nichts und mitten in den Wald gebaut worden.
Daher kommt der Name Tannenwald.
Mir dringt der moosige Duft des Grüns in die Nase, und ich schließe für einen Moment die Augen.
»Es fühlt sich schön an, glücklich zu sein«, schreie ich dem Wind entgegen.