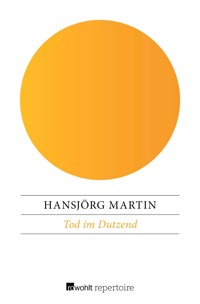9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rummelplatz. Karussells, Bratwurststände, Autoscooter, Glücksräder, Schießbuden und Achterbahnen bilden die unverwechselbare Kulisse aus glitzerndem Licht, Musikfetzen und Gerüchen, vor der nun plötzlich die tragische Aktion abläuft: In einem Wagen der Geisterbahn wird ein Toter gefunden. Und für Kommissar Leo Klipp von der Kriminalpolizei endet jäh, was als freier Abend begonnen hatte. Der Zufall will es, daß der Wagen mit dem Toten genau vor ihm zum Stehen kommt; er muß eingreifen. Ein Streifenwagen ist rasch zur Stelle. Die Mordkommission kommt gleich hinterher. Die Polizeimaschinerie beginnt zu arbeiten; mit gewohnter Präzision greifen die Zahnräder ineinander. Aber die Maschinerie läuft leer. Nichts wird zutage gefördert, nichts stimmt zusammen. Die junge Frau des Toten – er gehörte zu dem Geisterbahnunternehmen – benimmt sich nicht wie eine trauernde Witwe; der betrunkene Alte, der eine Aussage machen will, stirbt unter sonderbaren Umständen, ehe er vernommen werden kann, und der Mann, auf den sich der Verdacht schließlich richtet, hat plötzlich ein Alibi ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Hansjörg Martin
Rechts hinter dem Henker
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Rummelplatz. Karussells, Bratwurststände, Autoscooter, Glücksräder, Schießbuden und Achterbahnen bilden die unverwechselbare Kulisse aus glitzerndem Licht, Musikfetzen und Gerüchen, vor der nun plötzlich die tragische Aktion abläuft: In einem Wagen der Geisterbahn wird ein Toter gefunden. Und für Kommissar Leo Klipp von der Kriminalpolizei endet jäh, was als freier Abend begonnen hatte. Der Zufall will es, daß der Wagen mit dem Toten genau vor ihm zum Stehen kommt; er muß eingreifen.
Ein Streifenwagen ist rasch zur Stelle. Die Mordkommission kommt gleich hinterher. Die Polizeimaschinerie beginnt zu arbeiten; mit gewohnter Präzision greifen die Zahnräder ineinander. Aber die Maschinerie läuft leer. Nichts wird zutage gefördert, nichts stimmt zusammen. Die junge Frau des Toten – er gehörte zu dem Geisterbahnunternehmen – benimmt sich nicht wie eine trauernde Witwe; der betrunkene Alte, der eine Aussage machen will, stirbt unter sonderbaren Umständen, ehe er vernommen werden kann, und der Mann, auf den sich der Verdacht schließlich richtet, hat plötzlich ein Alibi ...
Über Hansjörg Martin
Hansjörg Martin (1920–1999) war ursprünglich Maler und Graphiker. Nach dem Krieg arbeitete er als Clown, war Bühnenbildner und Dramaturg, dann freier Schriftsteller. Er schrieb Kriminalromane und Kinder- und Jugendbücher.
Inhaltsübersicht
Die Hauptpersonen
Madame Sylvia
weiß alles und verrät es gegen Honorar.
Stanko Konyas
stirbt in der Geisterbahn.
Tony Konyas
trägt dies mit Fassung.
Paul Horn
murmelt Unverständliches, ehe er stirbt.
Herr Zink
sammelt teure Garderobe und Liliputaner.
Kriminalrat Spannagel
hat’s im Kreuz.
Kommissar Klipp
hat eine Idee, die sich als falsch erweist und zum Erfolg führt.
Wenn ich’s recht überlege, verdanke ich das alles Kurt Koschnieder, und ich darf eigentlich nicht mit der Geschichte beginnen, ohne auf ihn, auf seine Diebstähle und Kellereinbrüche gebührend hinzuweisen … Aber er hat nichts davon, weil er noch ungefähr vier Jahre absitzen muß. Und es ist unwahrscheinlich, daß ihm Danksagungen dieser Art im Zuchthaus zu Gesicht kommen.
Dennoch: Ohne Kurt Koschnieders Einbruchsserie in die Keller rund um den Pfaffendorfer Platz wäre ich sicher nicht mit dem «Fall Geisterbahn» in Berührung gekommen. Möglicherweise säße ich heute noch im Dezernat VI (Einbrüche) und langweilte mich.
Es ist nämlich ungewöhnlich, daß ein Kriminalbeamter unter 30 mit so einer Sache betraut wird – noch dazu, wenn er bis dahin nie mit Mordfällen zu tun gehabt hat, außer im theoretischen Unterricht auf der Polizeischule.
1
Es regnete nicht mehr. Obschon es später Nachmittag war und Dämmerungszeit, wurde es draußen heller, als es den ganzen Tag über gewesen war. Ich sah das silbergraue Rechteck Himmel vor meinem Bürofenster und hatte plötzlich von meinem Beruf die Nase so gestrichen voll, wie – aber das ist nur eine Vermutung von mir – ein Ballettmeister nach acht Stunden Probe von Mädchenbeinen die Nase voll hat.
Ich hatte es satt, diesen Mist zu lesen. Polizeiliches Protokoll über die Vernehmung der persönlich erschienenen Luise verwitwete Giebel, geborene Bauernfeind, die am 16. November abends, als sie von der Geburtstagsfeier ihrer Schwägerin kam, einen sehr verdächtig aussehenden Mann mit einem Handkoffer gesehen hatte.
Oder die unsachlichen Aussagen des Zuschneiders Anton Stoszinsky, aus dessen Keller sieben Büchsen Fleischkonserven, elf Gläser eingemachtes Obst, eine defekte Fahrradpumpe und ein Karton mit acht Dutzend Gummiabsätzen verschwunden waren … Was um Himmels willen macht ein kinderloses Ehepaar in den Sechzigern – wie die Stoszinskys – mit 96 Gummiabsätzen? Im übrigen fehlte bei den Gummiabsätzen die Größenangabe.
Stoszinsky bezichtigte nacheinander sieben Personen. Keine seiner Verdächtigungen hatte sich bei näherer Nachprüfung im mindesten als stichhaltig erwiesen.
Die Akte war fast drei Zentimeter dick. Ein drei Zentimeter hoher Stapel beschriebenes Papier, von mehreren fleißigen Beamten – wie heißt das – erstellt … wegen sieben Büchsen Fleischkonserven, elf Gläsern eingemachter Kirschen, einer Fahrradluftpumpe und – Himmel noch mal – 96 Gummiabsätzen.
Ich hatte es satt, satt, satt!
Ich klappte den graubraunen, filzigen Pappdeckel zu und knallte den Kram mit Schwung auf die acht ähnlichen Akten, die sich – mehr oder minder dick – auf meinem gelben Schreibtisch türmten und von weiteren Einbrüchen in Mietshauskellern berichteten, bei denen ein paar Flaschen Wein, ein paar Gläser Eingemachtes, ein Satz Werkzeuge, ein Vogelbauer, ein Radio und was weiß ich noch geklaut worden waren …
Das Ganze roch nach Halbstarken, die aus Jux und Dollerei Dummheiten machten, vielleicht auch ihr Taschengeld aufbessern wollten, oder nach einem kleinkarierten Einzelgänger, der so primitiv arbeitete, so ohne persönliche Note, daß es schwer war, ihn zu fassen.
Ich rätselte schon seit einigen Tagen an der Geschichte herum – aber nun hatte ich’s dick. Bis oben hin dick. Schluß für heute. Feierabend!
Ich packte das Aktenbündel in den wackligen Spind, der links von der Kunstdruck-Heidelandschaft (Staatseigentum) steht, angelte aus dem Wandschrank neben der Tür meinen Trenchcoat und warf noch einen müden Rundblick auf die Stätte meines Wirkens im Dienste der Gerechtigkeit; dann schloß ich die Tür von außen – aber leise, denn es war erst halb sechs. Bis zum offiziellen Dienstschluß fehlte noch eine halbe Stunde.
Der Pförtner im Hofausgang, der ein Zwölfender ist und entsprechend durchgeistigt, hob seinen Bullenbeißerblick vom Groschenblatt-Sportbericht: «Schon Feierabend, Herr Klipp?»
«Wie man’s nimmt», entgegnete ich mit jener betonten Fröhlichkeit, bei der die Augen nicht mitlachen. «In unserer Branche gibt’s nie Feierabend – das müßten Sie doch am besten wissen!»
Halb geschmeichelt, halb irritiert nickte er und schürzte die bläuliche Oberlippe, so daß sich sein Bart stachelig sträubte. Dann drückte er auf den Knopf, der die große Flügeltür entriegelt, und fuhr fort, den Essay über die gestrigen Gewichtheberkämpfe (Halb-Schwergewicht) zu genießen.
Die Luft schmeckte, trotz ihres hohen Benzingehalts, auch noch nach Frische, feuchter Erde und seltsamerweise nach Heu.
Ich ging durch die Reihen der geparkten Autos, meditierte zum hundertstenmal über die Beziehung zwischen Hubraum, Geltungsbedürfnis und Sozialprestige und amüsierte mich bei der Vorstellung, was wohl geschähe, wenn einer der kleinen Angestellten aus dem Archiv oder aus der Registratur eines Tages mit seinem Fiat 500 mit einem silbergrauen Cadillac zum Dienst käme – noch anderthalb Meter länger als der Mercedes des Chefs …
Meine Laune besserte sich.
Ich pfiff schon wieder irgendwas, ohne hinzuhören, als ich meinen standesgemäßen Volkswagen aufschloß, den 34 Pferden unter seiner Haube aufmunternd zuschnalzte und im vorschriftsmäßigen Zwanzig-Kilometer-Tempo den Hof des Polizeipräsidiums verließ.
Die erste Reaktion auf die Geräusch- und Geruchswolke, die mich umfing, als ich neben dem Rummelplatz aus dem Auto stieg, war Hunger. Richtiger, überfallartiger Heißhunger auf Bratwurst. Thüringer Bratwurst vom Rost – brutzelnd, fettspritzend, dunkelbraun knusprig und dick mit Senf beschmiert.
Ich drängelte mich schluckend quer durch die Menge auf die nächst gelegene Wurstbude zu und vertilgte dort im Stehen hintereinanderweg drei der daumendicken Dinger.
«Noch eine, der Herr?» fragte das blasse Mädchen hinter dem Rost mit abwesendem Lächeln. Die Blässe war gut abgestimmt auf die Farbe der noch nicht gebratenen Würste.
Ich dankte, zahlte, wischte mir den Mund und mischte mich unter die Menschen, die sich einzeln, zu zweien und in Gruppen langsam zwischen Bratwurst-, Schmalzgebäck- und Türkischem-Honig-Geruch, zwischen Drehorgelgeleier, Beatlärm und rauhem Anreißergeschrei die Budenstraßen entlangbewegten. Zweihundert Meter weiter – es wurde allmählich dunkel und überall flammten Leuchtröhren in allen möglichen Farben auf – zweihundert Meter weiter also, kurz vor dem großen Bayerischen Bierzelt, begannen die Bratwurstgewürze zu wirken.
Mein plötzlicher Durst bestätigte meinen alten Verdacht, daß die Bierzeltbesitzer den Bratwurstbudeninhabern Pfeffer und Salz kostenlos liefern. Ich unterwarf mich dieser indirekten Verbraucherbeeinflussung um so lieber, als ich das bayrische Bier (neben Ludwig Thoma und Karl Valentin) für einen der wesentlichen Beiträge des süddeutschen Raumes zur Kultur unseres Volkes halte.
Auf die Blasmusik, die mir im Zelt um die Ohren schlug, hätte ich zur Not verzichtet – aber sie ist nun mal inbegriffen. Und Bayrischzell kann nichts dafür, daß es in dem Tal liegt, dort wo die Glooo-cken klingen hell.
Ich schrie der Kellnerin über ihr freigebig enthülltes Busengebirge meinen Wunsch zu und hatte, noch ehe die Seppeln auf dem Podium die Spucke aus Posaunen und Trompeten schüttelten, einen Litersteinkrug vor mir, obwohl ich nur einen halben bestellt hatte.
Aber ich meuterte nicht, führte den Irrtum auf die Dienstwilligkeit sowie den Bizepsumfang der dekolletierten Dame zurück und hob das kühle Kilo mit dem festen Vorsatz, mich seiner unbedingt würdig zu erweisen.
Der erste Schluck war herrlich.
Die Seppeln hatten zu blasen aufgehört. Der Oberseppel sagte auf bayrisch etwas an, das durch die scheppernden Lautsprecher noch unverständlicher wurde. Darauf riefen alle Musikanten etwas im Sprechchor und hoben Krüge wie den, der vor mir stand. Und dann bliesen sie ein trauriges Stück. Es handelte von Edelweiß und Alpenglühen, von einem Bua in der Fe-helsenwand sowie einem Marterl am Wiesenrain … Ich weiß das, weil der Oberseppel leider auch sang … Der weibliche Teil des Liebespaares, das mir gegenübersaß, kriegte richtige Weh-Weh-Augen und lehnte sich trostsuchend an seinen Partner, der genierte Blicke in die Runde warf, ehe er den Arm schützend um seiner schönen Schulter schlang.
Aber das Bier war vorzüglich.
Als ich der geballten Folklore entrann, war es draußen schon ziemlich dunkel und zwischen den glitzernden Karussells und Buden noch voller geworden. Ich ließ mich wieder in der Menge treiben. Die Väter und Mütter mit ihren Kindern waren nun verschwunden. Jetzt bummelten miniberockte Teenager – poposchwenkend, kichernd und von schlaksigen Jünglingen verfolgt – durch das Geplärr und Gebimmel. Bürobelegschaften aller Branchen und Jahrgänge drehten noch eine Rummelplatzrunde, und vereinzelte Junggesellen, denen die Angst vor ihrem möblierten Dasein und der Hunger nach irgendeinem Abenteuer im Gesicht stand, flanierten an den geräuschvollen Attraktionen vorbei, ohne sie so recht wahrzunehmen. Die ersten Huren tauchten auf und sondierten das Gelände. Ein paar Strichjungen standen vor der Achterbahn und ließen die blonden Locken wehen.
Es fing an kühl zu werden.
An den Kinderkarussells wurden die Lichter gelöscht und geflickte Zeltplanen vor die Miniaturpracht aus Feuerwehrautos und Peterwagen gerollt und gebunden.
Auf den Stufen vor der und rund um die Raupenbahn hatte sich eine Horde langmähniger Knaben versammelt, die dem dröhnenden Getrommel und Gekreisch aus den überlauten Verstärkern mit zuckenden Gliedmaßen hingerissen lauschte. Gegen den irrsinnigen Krach hatte die wunderschöne alte Karussellorgel nebenan keine Chance; beziehungslos hob die dazugehörige hochbrüstige und knallbunt bemalte Holzdame im Rokokokostüm den Taktstock und drehte ruckartig den Kopf mit den gläsernen Kuhaugen.
Ich stand eine Weile unter dem Kettenkarussell und prämierte im Geiste die Kniekehlen der Mädchen, die gegen den Abendhimmel über mir schwebten. Dann sah ich, daß neben mir mehrere Männer standen und wie ich in die Luft guckten. Da trottete ich schnell davon, denn ich wollte meine reinen ästhetischen Freuden nicht in der Gesellschaft grober Sinneslust … und so weiter.
Aber hübsche Kniekehlen waren da zu sehen gewesen – und die Mädchen wußten das wohl.
Um mir selbst zu beweisen, daß ich nicht in die Kategorie vom Alkohol lüsterner Beingucker gehörte, steuerte ich einen Schießstand an.
Ich schoß stehend freihändig mit fünf Schuß fünf wundervolle Wachspapierblumen aus den weißen Tonröhrchen und wandte mich dann, nach größeren Gewinnen suchend, den Scheiben zu.
Der Schießbudenbesitzer machte ein ängstliches Gesicht, als ich gleich eine Zwölf schoß. Er tat mir beinahe leid. Es war kein faires Spiel. Wenn unsereiner, bei dem dauernden Schießdrill, den sie uns angedeihen lassen, keine Zwölf auf dem Rummelplatz schießen kann, dann ist entweder das Gewehr nicht in Ordnung oder er ist betrunken. Betrunken war ich nicht, ein gutes Gewehr hatte ich offenbar auch erwischt – ich hätte dem armen Mann die Bude ausräumen können. Drei Schuß eine Mark. Dreimal die Zwölf – freie Auswahl!
Die freie Auswahl bestand aus roten, blauen und grünen Riesenteddybären, Tischlampen in Gestalt von Hansekoggen, riesigen Blumenvasen mit Goldschnörkelgewürm darauf, Einmeter-Puppen, absolut unzerbrechlich, mit Schlafaugen, Mammastimme und in lila Organdy gehüllt, sowie aus echten Gemälden, in Essig und Öl gemalt und silbrigglitzernd gerahmt. Das schönste davon stellte eine liegende halbnackte Dame dar, die sehr rosa war, von sieben Elfen umschwebt und von Mondschein berieselt.
Aber ich brachte es nicht übers Herz, den Schießbudenbesitzer seiner Schätze zu berauben. Ich legte das Gewehr aus der Hand, kramte in meiner Tasche nach Geld und griff nach den Wachspapierblumen.
«Ach – wie schade!» sagte eine Mädchenstimme hinter mir. «Ich dachte, Sie schießen einen Hauptgewinn!»
Ich drehte mich um.
Zwei Teenager standen da. Sie hatten mir zugeschaut, hatten sich offensichtlich über meine Treffer gefreut und machten nun richtig enttäuschte Gesichter. Die eine, die gesprochen hatte, trug auf kurzgeschnittenem dunklen Pagenkopf eine lustige grüne Mütze, deren Farbe mit ihren ebenfalls grünen Augen so verblüffend harmonierte, daß ich erstaunt sagte: «Sie haben ja doll grüne Augen!»
Das Mädchen wurde rot und blickte zu Boden.
«Verzeihung!» sagte ich.
Die andere kicherte und schob ihren Arm unter den der Grünäugigen.
Aus dem Augenwinkel sah ich, daß der Schießbudenonkel – als ob er Böses ahne – das Gewehr, mit dem ich geschossen hatte, an die Seite legte und ein anderes an seine Stelle schob. Das ärgerte mich.
«Darf ich Ihnen irgendwas schießen, meine Damen?» fragte ich und machte eine leichte Verbeugung. «Ich bin ‹Null-Null-Fünf› – also noch zwei Nummern besser als der Berühmte. Soll ich’s Ihnen beweisen?»
Die Grünäugige fand ihre Fassung wieder und lachte. Die andere kicherte immer noch albern. Häßlich war sie auch. Zu komisch, daß besonders hübsche Mädchen immer und überall solche Schreckschrauben im Gefolge haben.
«Ja – wenn Sie wollen …» sagte die Grünäugige. «So einen Bären möchte ich schon …»
«Und ich so ’ne Lampe!» fiel die Kichergans schnell ein.
Natürlich.
«Ein Bär – eine Lampe. Bitte sehr – sofort!» tönte ich und griff nach dem Gewehr, das der Schießbudenbesitzer an die Seite gelegt hatte. «Noch fünf Schuß», sagte ich. «Eine Zwölf hatte ich ja schon.»
«Das gilt nicht», sagte der Mann giftig. «Sie hatten sechs Schuß, und da war nur eine Zwölf bei. Jetzt müssen Sie neu. Außerdem ist das Gewehr nicht in Ordnung.»
«Das macht nichts», sagte ich. «Ich schieße am liebsten mit kaputten Gewehren. Gehn Sie beiseite!»
Ich legte schon an, da griff der Kerl nach dem Lauf. «Erst zahlen!» knurrte er.
Na warte, du Gartenzwerg! Ich legte ein Fünf-Mark-Stück auf den Tresen, zielte und schoß.
«Zwölf», stellte der Kerl widerwillig fest.
Ich nickte. «Die erste, ja. Nun zählen Sie mal fleißig!»
Die Mädchen lachten.
Ich schoß noch fünfmal und hatte noch fünfmal die Zwölf.
«So, mein Bester», sagte ich, «drei Mark zurück und zweimal die freie Auswahl, ja?» Er war ganz blaß geworden, und er erinnerte mich an eine Ratte. Eine blasse Ratte.
Ich kümmerte mich nicht um ihn, wandte mich an die Mädchen und sagte mit großer Geste: «Bitte, meine Damen – wählen Sie: Alles steht zu Ihrer Verfügung – nur der Besitzer ist nicht zu haben. Aber der lohnt sich auch nicht.»
«Dürfen wir wirklich?» fragte die Kichernde und zeigte, als ich nickte, tatsächlich auf so eine Koggenlampe.
Der Mann reichte sie ihr mit verkniffenem Gesicht.
«Und Sie, mein Fräulein?» fragte ich die Hübsche.
Sie musterte mit vorgeschobener Unterlippe und schiefgelegtem Kopf aus großen Augen die Galerie Bären. «Den blauen in der zweiten Reihe», entschied sie. «Der hat das hübscheste Gesicht.»
Es hatten sich einige Zuschauer eingefunden. Ich verteilte meine Wachspapierblumen unter die anwesenden Damen, nickte dem Schießbudenonkel abschiednehmend zu und ging zwischen den beiden Mädchen davon.
Die Grünäugige drückte ihren blauen Bären an sich und sagte: «Schönen Dank!»
«Es war mir eine Ehre und ein Vergnügen!» sagte ich und überlegte, ob ich mich nun vorstellen müßte und wie das wohl weitergehen sollte. Schließlich konnte ich ja nicht gut mit zwei achtzehnjährigen Mädchen einen Rummelplatzbummel machen. Außerdem wollte ich das auch nicht. Jedenfalls bestimmt nicht mit zweien.
Mein Kopfzerbrechen war unnötig.
Eine Gruppe junger Burschen schob sich durchs Gewühl. Einer rief:
«Hallo, Gabi – da seid ihr ja!»
Die Grünäugige lachte, winkte und rief zurück: «Guck, was ich habe, Charly – ist er nicht schick?»
Ich verabschiedete mich mit einem Nicken und fürchte, daß mein Lächeln ausgesehen hat, als ob ich auf ein Pfefferkorn gebissen hätte.
Als ich mich zur anderen Seite wandte, fiel mein Blick auf ein blau angestrahltes Schild:
MADAME SYLVIA
SAGT IHNEN DIE WAHRHEIT!
Da ich schon immer mal die Wahrheit wissen wollte, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit, ging ich auf den Wohnwagen zu, über dem das Schild befestigt war.
Ein zierliches Fünf-Stufen-Treppchen führte zur Tür des holzverkleideten Wagens. Über dem Treppchen bauschte sich ein roter Baldachin, an gedrechselten Holzstäben befestigt. Neben der Tür hing ein Plakat, das verkündete, welche Künste Madame Sylvia beherrschte und feilbot.
Die Wahrheit über Ihren Charakter, las ich, erfahren Sie durch Madame Sylvias magnetisch-telepathische Handliniendeutung ebenso, wie Sie mittels streng wissenschaftlicher Deutung Ihres Horoskops einen Blick in die Zukunft tun können!
Die einfache Analyse kostete drei Mark, ein umfassendes Wesensbild mit Zukunftsdeutung Ihrer Chancen in Liebe, Gesundheit und Beruf zehn Mark. Wer es schwarz auf weiß haben wollte, mußte gar fünfundzwanzig Mark berappen.
Unter dem Plakat befand sich ein kleines Messingschild, auf dem Thea Riethmüller zu lesen war. Ich kombinierte, daß dies der bürgerliche Name der Rummelplatz-Pythia sei und machte mich auf einiges gefaßt.
Aber schon die Stimme, die auf mein Klopfen «Herein!» rief, klang nicht so, wie ich erwartet hatte, und als ich eintrat, war ich ehrlich überrascht von dem Raum und von der Frau, die daran stand.
Der Raum – etwa zweimal zweieinhalb Meter groß – duftete nach Kaffee und Eau de Cologne, eine Mischung, die ich immer schon geschätzt habe. Links neben der Tür war ein Bücherregal voll wissenschaftlich wirkender Wälzer, rechts – wo mehr Platz war – stand eine Eckbank mit buntbezogenen Kissen, davor ein runder Tisch und auf dessen anderer Seite ein sehr schöner, lederbezogener Ohrensessel. Über der Eckbank hing, um einen Druck von Degas’ ‹Tänzerinnen› gruppiert, ein oder anderthalb Dutzend Fotos mit und ohne Widmungen.
Das größte, in einem Silberrahmen, zeigte einen sehr männlichen Mann in einer schneeweißen Phantasieuniform. Quer stand in großen Schriftzügen: Der tüchtigsten Kartenhexe! Hans Albers.
Ich hab den Burschen immer gemocht und gut verstanden, daß Frauen weiche Knie kriegten, wenn er das vom Stapel ließ, was er unter Singen verstand. Daß ich seinem Konterfei hier begegnete, machte mir Madame Sylvia auf Anhieb sympathisch.
Sie stand vor dem dunkelblauen Samtvorhang, der wohl ihren Wohnwagen in Arbeitsraum und Privatgemächer teilte, und schaute mich an.
«Guten Abend», sagte ich. Fast hätte ich ‹gnädige Frau› hinzugefügt.
Der buntseidene Kimono, den sie halblang über einer engen schwarzen Hose trug, hatte zwar ein bißchen etwas Zigeunerisches – aber Gesicht, Blick, die einladende Handbewegung, die mich zum Setzen aufforderte – alles war große Dame.
Die große Dame war klein, zierlich, silberhaarig und etwa sechzig Jahre alt. Sie rauchte aus einer langen, elfenbeinernen Zigarettenspitze, was mir etwas zu sehr nach Schau schmeckte, und sagte mit einem fast unmerklichen Lächeln: «Bitte, nehmen Sie Platz, Herr …»
«Klipp!» sagte ich hastig.
«Bitte, nehmen Sie Platz, Herr Klipp», wiederholte sie und ließ sich, als ich nach kurzem Kampf mit meinem Trenchcoat endlich saß, mir gegenüber in dem rostroten Ledersessel nieder.
«Was kann ich für Sie tun?»
«Tja …» Ich wußte nicht so recht, was ich sagen sollte. Eigentlich war ich doch auf einen Jux eingestellt gewesen, auf eine dicke Tante, die mir mit dämonischem Gehabe Glück und langes Leben weissagen würde. Ich hatte mir ein paar flachsige Fragen ausgedacht, die ich stellen wollte: Ob die Millionenerbschaft, die ich erwartete, noch vor dem Winter käme – ob ich meinem unwiderstehlichen Drang zur Bühne folgen sollte – ob ich die Geliebte erobern würde, die sich jetzt in der Gewalt eines unmenschlichen Vaters befände, der sie mit einem hundertjährigen orientalischen Großkaufmann verheiraten wolle, und lauter solche Sachen.
Aber nun, da Madame Sylvia weder dick noch dämonisch war, da sie eine Dame war und sich mit allerlei kultivierten Dingen umgab – auf dem Bücherregal stand eine kleine schwarze Bronzefigur, die nach Maillol aussah, und von der Decke hing eine schöne alte Kupferlampe – nun also war mir sämtlicher Wind aus den Segeln meiner Spottlust genommen.
Ich stotterte: «Tja, also … Ich wollte … Ich möchte Sie bitten, mir – ehem …»
«Eine Beratung, ja?» fragte sie.
Ich nickte.
Sie erhob sich, nahm von einem Häkchen neben der Tür ein Holztäfelchen mit Öse, auf dem BITTE NICHT STÖREN stand, und hängte es an die Außenseite der Wohnwagentür. Dann kam sie auf mich zu, sah mich aus schmalen grauen Augen an, atmete nachdenklich den Zigarettenrauch aus und sagte: «Geben Sie mir Ihre linke Hand!»
Ich gehorchte.
Sie nahm meine Hand in ihre beiden Hände, behielt die Zigarettenspitze im Mund und bewegte meinen Daumen und meine Finger, wobei sie die Linien in meiner Handfläche betrachtete und wie im Selbstgespräch murmelte:
«So um die Dreißig … Einigermaßen gesund … Na ja, der Magen muckert zuweilen, aber eine starke Lebenslinie … Nur in der Liebe, da ist nicht viel los – noch nicht. Ziemlich dünn. Und der Beruf … hm … ein seltsamer Beruf. Kopfarbeit – und doch irgendwie … ja: gefährlich …»
Sie blinzelte, überlegte, ließ meine Hand los und sah mich wieder an.