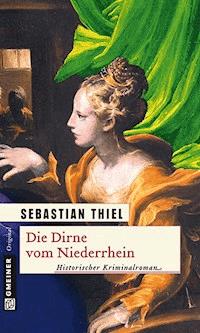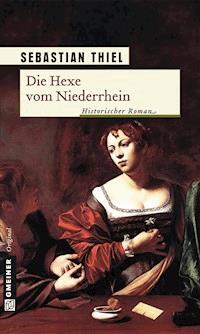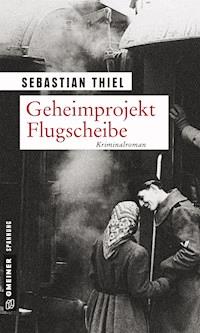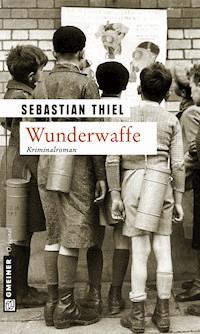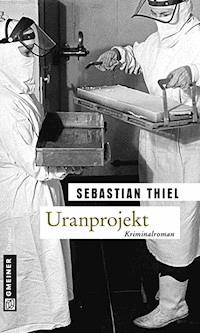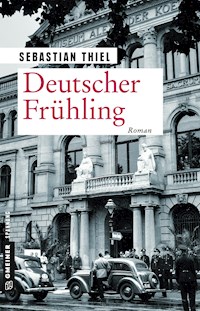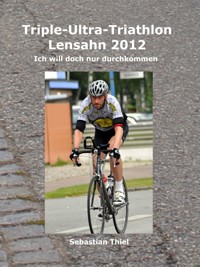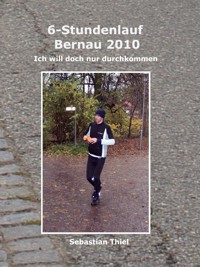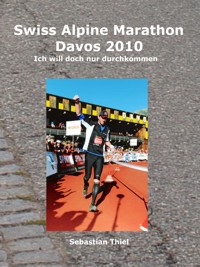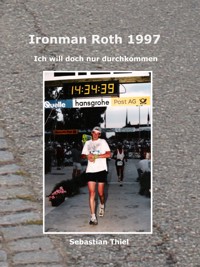Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Zeitgeschichtliche Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Wuppertal 1826. An einem Sommertag büxen die Industriellenkinder Marlene und Gotthard Marigold aus, um mit dem sechsjährigen Friedrich Engels die Dampfmaschine in der Textilfabrik seines Vaters zu erkunden. Neben dem lärmenden Ungetüm erblicken die drei auch Kinder bei der schweren Arbeit. Der Anblick verändert etwas in Friedrich. Fortan widmet er sein Leben dem Ende der Ausbeutung. Lene verliebt sich in ihn. In Erwachsenenjahren begleitet sie ihn bis nach Manchester, wo ihm sein Kampf mächtige Feinde einbringt, Feinde, die über Leichen gehen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sebastian Thiel
Revolution und Kaviar
Roman
Impressum
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Deutscher Frühling (2019), Das Adenauer-Komplott (2017), Geheimprojekt Flugscheibe (2015), Sei ganz still (2015), Uranprojekt (2014), Die Dirne vom Niederrhein (2013), Wunderwaffe (2012), Die Hexe vom Niederrhein (2010)
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2020
Lektorat: Daniel Abt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild
Deutsche Delegierte des Internationalen Arbeiterkongresses in Zürich, von links: Friedrich Simon, Frieda Simon geb. Bebel (Tochter von August Bebel), Clara Zetkin, Friedrich Engels, Julie Bebel (Ehefrau von A. Bebel), August Bebel, Ernst Schaffer, Regina Bernstein, Eduard Bernstein, im Gasthof zum Löwen in Bendlikon bei Zürich
ISBN 978-3-8392-6368-6
Haftungsausschluss
Personen und Handlungen sind frei erfunden, soweit sie nicht historisch verbürgt sind.
Diese Geschichte ist, wenn auch mit realen Elementen und Gegebenheiten hinterlegt, rein fiktiv und entstammt der Fantasie des Autors.
Kapitel 1 – Der Tod ist nicht wählerisch
Barmen, Sommer 1826
Lene wusste nicht, ob es Freude oder Angst war, die ihr Herz so schnell zum Klopfen brachte.
Hastig nahm sie die Hand ihres Bruders Gotthard und drückte sie fest, dass seine Knöchel weiß hervortraten. »Da ist er«, hauchte sie an ihn gerichtet, ohne den großgewachsenen Jungen und seine Brigade aus den Augen zu lassen, die von einem Hügel vor ihnen gelangweilt auf sie hinunterblickten. Ihre Worte waren nicht mehr als ein Flüstern. »Der Kapitän und seine Gesellen.«
»Ich habe dir gesagt, dass wir nicht so weit von zu Hause weglaufen sollten.« Gotthards Stimme war starr und fest wie sein Blick. »Unsere Gouvernante wird aus dem Schimpfen nicht mehr rauskommen. Rot wird Madame de Genlis werden und die Falten an ihrem Kinn werden zucken wie die Kehlen der Frösche beim Quaken. Aber du wolltest ja weit hinaus und dir diese blöde Dampfmaschine angucken.«
Kein Vorwurf lag in den Worten ihres Bruders. Es war lediglich eine Feststellung. Lene hatte ihm lange und hartnäckig in den Ohren gelegen.
Die Gerüchte über das Monstrum waren allzu verlockend. Angeblich setzte der Fabrikant Friedrich Engels senior in seiner Firma anstatt der Wassermühlen eine Maschine ein, die aus dem Nichts Kraft erzeugen konnte. Wenn man dem bierseligen Gebrabbel der Arbeiter ihres Vaters Glauben schenkte, nahm das Ungetüm eine halbe Halle ein, besaß die Kraft von zwanzig Kaltblütern und raubte mit höllischem Krach halb Barmen den Schlaf. Es musste pfeifen, röcheln, scheppern, und die Rauchsäule soll sich Tausende Ellen gen Himmel recken.
Nun, gesehen hatte sie noch nichts und schlafen konnte sie eigentlich ganz gut. Sei es drum! Lene konnte einfach nicht widerstehen. Obwohl sie erst sechs Jahre alt war, bescheinigte ihr Madame de Genlis einen wachen Geist … wenn nur dieser schrecklich männliche Drang zum Erforschen und Verstehen nicht wäre, wie sie nicht müde wurde zu betonen.
»Das ziemt sich nicht für eine Dame«, hatte sie gesagt und jeden Versuch, etwas über diese Maschine herauszufinden, im Keim erstickt. »Besonders nicht für die einzige Tochter eines Rüstungsindustriellen, der seine Kleine einmal gut verheiraten möchte. Mädchen müssen brav sein, schick und klug genug, keine dümmlichen Fragen zu stellen.«
Lene war den endlos langen Reden ihrer Gouvernante überdrüssig. Sie hatte ihren kaum älteren Bruder Gotthard so lange bearbeitet, bis er mit ihr ausgebüxt war, um die Maschine zu sehen. Doch bevor sie das Fabrikgelände der Familie Engels überhaupt erreichten, stellte sich ihnen der Sohn des Fabrikanten in den Weg.
Friedrich Engels, der »Kapitän«, wie ihn seine Soldaten und Spießgesellen nannten, war der unangefochtene Führer der Schüler. Selbst im Nachbarort hatten sie von ihm gehört. Weder scheute er davor zurück, sich mit Lehrern anzulegen, noch, den Erwachsenen Streiche zu spielen. Und nun stand er unweit vor ihnen, hob die Hand zum Gruß und blickte argwöhnisch auf sie herab, während Gotthard seinen Arm um Lenes Brust schwang und sie hinter sein Kreuz drückte.
»Kommt her!«, rief Friedrich ihnen entgegen. »Wollt ihr was Tolles sehen?«
»Sollen wir gehen?«, flüsterte Lene und trat vor.
Gotthard nickte unmerklich, dass nur sie seine Bewegungen vernehmen konnte. »Es könnte eine List sein. Vielleicht wittern sie Geld oder wollen uns prügeln. Wir sollten wieder nach Hause gehen.«
»Dann werden wir die Dampfmaschine nie zu Gesicht bekommen«, protestierte Lene, obwohl die Angst mit jeder Silbe mitschwang und ihr die Kehle beinahe zuschnürte. »Der Schornstein müsste bald zu sehen sein.«
»Man bekommt nicht immer, was man sich im Leben wünscht, Marlene.«
Die Lage war unbestreitbar ernst. Ansonsten hätte er sie nicht mit ihrem vollen Namen angesprochen und den Satz zitiert, den ihr Vater Adam Marigold nur allzu gerne von sich gab, wenn er mit seinen Bediensteten oder Arbeitern verhandelte.
»Aber manchmal.« Lene wagte es nicht, dem jungen Friedrich einen Hauch von Aufmerksamkeit zu schenken. Sie blickte abwechselnd zu Boden und in das versteinerte Gesicht ihres Bruders. »Sollen wir es wagen?«
Die Entscheidung wurde ihnen innerhalb der nächsten Herzschläge aus den Händen gerissen. Die Gruppe folgte ihrem Anführer, bis nur noch wenige Zoll zwischen ihnen lagen. Die kniehohen Gräser kitzelten in diesem besonders heißen Sommer Lenes Beine. Ein Windstoß blies ihre blonden Haare von den Schultern und ließ sie wie einen Schweif um sie wirbeln. Der Geruch von Chemikalien vermischte sich mit dem wohligen Duft von Wiesenblumen zu einer verführerischen Mischung. Die Firma Engels konnte nicht mehr weit sein, lag bestimmt hinter dem Hügel, den die Brigade so pflichtbewusst bewacht hatte. Lene war ihrem Ziel nahe.
Unmöglich konnte sie da aufgeben.
»Wie heißt ihr?«, fragte Friedrich, ohne sich mit Vorgeplänkel zu beschäftigen. »Aus der Schule kenne ich euch nicht.«
»Ich heiße Marlene Marigold«, druckste sie hinter ihrem Bruder hervor. Dabei war ihre Stimme wie junger Schneefall, dünn und so zerbrechlich, dass jeder Windhauch sie fortgetragen hätte. »Und das ist mein Bruder Gotthard. Wir kommen aus Langerfeld und wollten die Dampfmaschine sehen.« Manchmal musste man es mit entwaffnender Ehrlichkeit versuchen.
»Marigold«, wiederholte Friedrich mit zusammengekniffenen Augen und musterte die beiden scharf. »Ihr seid die Kinder von Adam Marigold, dem Rüstungsfabrikanten.«
Gotthard straffte sich. »Und wenn schon.« Er sagte es, als ob er sich entschuldigen müsste. »Deinem Vater gehören ein Textilunternehmen und die Dampfmaschine, über die alle reden.«
Einige Momente beherrschte Stille die Szenerie, nur das Rauschen des Windes im Blattwerk bezeugte, dass die Zeit nicht stehen geblieben war.
Die Sekunden schienen sich in die Unendlichkeit auszudehnen, bis Friedrich endlich sein Schweigen brach. »Ihr wollt die Maschine sehen? Dann kommt mit«, forderte er die beiden auf und verzog dabei keine Miene.
Lene beäugte ihn, dann seine Spießgesellen. Im Gegensatz zu Friedrich wirkten sie unsicher, Falten kräuselten sich auf ihren Stirnen. Sie tauschten ungläubige Blicke und einer stupste ihrem Anführer gegen die Schulter. »Meinst du das ernst?«
»Das ist unser Geheimnis!«, protestierte ein anderer. »Niemand außer unserer Bande darf sie sehen.«
Friedrich wischte all ihre Bedenken mit einem Kopfschütteln beiseite. »Sie sind so weit gekommen, dann sollen sie auch sehen, wofür sie den langen Weg auf sich genommen haben.« Kein Argwohn lag in der Stimme des Jungen oder gar Falschheit.
Wenn es eine List war, war er ein hervorragender Lügner, dachte Lene und wagte sich einige Zoll aus ihrer Deckung. »Gut«, sagte sie und zog ihren Bruder mit sich. »Das ist nett von euch. Geh voran, wir folgen.«
Friedrich nickte, drehte sich auf dem Absatz und schritt durch das dichte, von der Sonne ausgeblichene Gras, auf den Hügel. Als Gotthard zögerte, klammerten sich Lenes Finger um sein Handgelenk und zogen ihn weiter, bis sich vor ihnen das Firmengelände auftat.
Die Engelsmühle und die vielen Backsteinhäuser beeindruckten Lene nicht im Geringsten. Oft hatte sie ihre Mutter durch die Fabrikgebäude ihres Vaters begleitet, wenn sie eine Nachricht im Büro übermitteln musste. Sie kannte das Gefühl, wenn die Arbeiter innehielten und ihnen zunickten, nur um im nächsten Moment über sie zu tuscheln.
Was ihre Augen wirklich groß werden ließ, war der Schornstein, der eine dunkle Säule gen Sonne spuckte. Es sah aus, als würde sich der Qualm mit den Lichtstrahlen verbinden und irgendwo hoch oben am Himmel in den wenigen Wolken auflösen.
»Und wie kommen wir da rein?«, wollte Lene wissen. Sie hielt die Hand ihres Bruders fest umschlossen. Sie wusste nicht, ob sie dem berühmten und berüchtigten Tunichtgut Friedrich Engels trauen konnte. Immerhin waren seine Taten bis über die Dorfgrenze bekannt, und nicht alles, was über ihn an ihre Ohren gedrungen war, machte ihr Mut, dieses Abenteuer schadlos zu überstehen.
»Du gar nicht«, blaffte einer seiner Gesellen. Das Gesicht des Jungen erinnerte Lene an das einer Ratte. »Mädchen müssen draußen bleiben.«
»Wir nehmen sie mit.« Friedrichs Stimme ließ keine Widerrede zu. »Warum nicht? Es wäre schade, so etwas Tolles den Blicken der Menschen vorzuenthalten.« Unverhohlener Stolz lag in jedem Wort.
Vielleicht wollte er sich wichtigmachen oder angeben, aber das war Lene egal. Sie nickte kurz, rang sich ein Lächeln ab und ließ den Jungen mit den braunen Haaren und dem gut sitzenden Leinenhemd nicht aus den Augen.
Ihr Weg führte sie weiter am Firmengelände vorbei. Der Geruch der Chemikalien wurde stärker und drang nun unangenehm in ihre Nasen. Sie konnte erkennen, dass die Firma Unmengen an glitzernder Flüssigkeit in die Wupper leitete. Auch das war ein wohlbekanntes Bild, immerhin machte es ihr Vater genauso. Wie sollte man sonst den Unrat entsorgen?
Die letzten Ellen ging Friedrich geduckt am Zaun entlang und spähte oftmals in Richtung des Fabrikgeländes. Wahrscheinlich durfte er die Werkshallen nicht ohne Aufsicht betreten. Lenes Vater hatte es ihnen unzählige Male eingebläut. Sie schätzte, in der Familie Engels würde es nicht anders sein.
Als sie fast an der Wupper angelangt waren, räumte Friedrich Tannenäste und Stroh von einer Stelle, bis ein Loch im Zaun auszumachen war.
»Haben wir Anfang des Sommers entdeckt«, erklärte er im verschwörerischen Tonfall, während die Sonne auf seine braungebrannte Haut fiel und er dazu blinzelte. Er musste viele Stunden an der frischen Luft verbracht haben. »Wir müssen aufpassen, dass uns die Vorarbeiter nicht erwischen. Vater und Großvater Casper mögen es gar nicht, wenn Kinder auf dem Gelände tollen.«
»Das kennen wir«, antwortete Gotthard kameradschaftlich. In seinen Augen lag ein seltsamer Glanz. Offenbar hatte er seine anfängliche Vorsicht abgelegt.
Friedrich holte Luft, dann schlüpfte er als Erster durch das schmale Loch und achtete genau darauf, dass sein Hemd nicht durch Gras oder Erde beschmutzt wurde. Seine Familie war reich, doch auch Wohlhabende schmissen das Geld nicht zum Fenster hinaus, und seine Gouvernante würde wahrscheinlich ebenso laut werden wie Madame de Genlis, dachte Lene still und verkniff sich ein Lächeln. Angeschrien zu werden gefiel selbst dem wagemutigsten Bandenchef nicht.
Während die größeren Jungs sichtlich Probleme hatten, durch das Loch im Zaun zu schlüpfen, war es für Lene ein Leichtes, auf die andere Seite zu kommen, ohne dass ihre Kleidung überhaupt die Erde berührte.
Mit ein wenig Übermut in der Stimme stemmte sie die Hände in die Hüften und beobachtete, wie sich der Rest von Friedrichs Rotte unter dem Zaun durchdrückte. »Kommt ihr?«
Als endlich alle auf der anderen Seite angekommen waren, schritt Friedrich weiter voran, Lene und Gotthard folgten ihm auf dem Fuß. Die Spießgesellen trotteten laut rumorend und klopften den verräterischen Dreck von ihrer Kleidung. Gerade wollte Friedrich die Hand heben und zur Ruhe mahnen, doch es war bereits zu spät.
»Was macht ihr hier?«, schrie eine aufgebrachte tiefe Männerstimme über den halben Komplex. »Schleicht euch gefälligst!«
Aus dem Augenwinkel konnte Lene den Mann ausmachen. Seine blaue Uniform und die Kappe wiesen ihn als Vorarbeiter der Firma aus. Vielleicht musste er seine Notdurft verrichten oder er wollte hinter den Gebäuden eine Zigarette qualmen. Vielleicht war es der Lärm der Bande gewesen, der seine Aufmerksamkeit geweckt hatte. Auf jeden Fall waren sie irgendwie ins Visier des Alten geraten und nun stapfte er mit schweren Schritten und Schaum vor dem Mund auf sie zu.
Geistesgegenwärtig packte Friedrich ihren Bruder und sie am Schlafittchen und zog sie hinter die Ecke eines Schuppens. Die anderen Jungen aus seiner Bande suchten ihr Heil in der Flucht und schossen wie aufgeschreckte Karnickel auf das rettende Loch im Zaun zu. Jegliche Vorsicht wurde dabei über Bord geworfen und der Morast klebte wie ein verräterischer Zeuge an ihrer Kleidung.
Innerhalb weniger Lidschläge waren sie im dichten Wald des Wupperufers auf der anderen Seite verschwunden, während der Vorarbeiter ihnen weitere Flüche hinterherschmetterte. Lene hielt den Atem an. Sie saßen in der Falle. Links vor ihnen am Zaun grollte der Mann und sah sich in alle Richtungen um. Rechts von ihnen hinter dem Schuppen lag der Hauptplatz der Firma, wo reger Betrieb herrschte, und hinter ihnen das von Öl und Chemikalien glänzende Wasser des stetig rauschenden Flusses.
»Und jetzt?«, fragte Gotthard an Friedrich gewandt.
Der legte den Zeigefinger auf die Lippen und beobachtete ruhig den Weg des Aufsehers. Wenn sein alter Herr wüsste, was er hier trieb … Die Gerüchte über die Strenge von Friedrich Engels senior waren wohlbekannt und unter den Arbeitern gefürchtet.
»Los, weiter«, forderte er auf, seine wachen Pupillen suchten das Gelände ab und er marschierte in Richtung des Schornsteins.
»Zum Ausgang geht es da entlang.« Die Stimme ihres Bruders war der Hysterie nahe.
Lene konnte spüren, wie ihm die Angst den Atem raubte. Gotthard wollte Vater immer alles recht machen, und wenn Adam Marigold erfuhr, wo sie sich gerade befanden, würde er bestimmt drei Tage lang toben. Das Donnerwetter ihres Lebens wäre ihnen gewiss.
Sie nahm seine Hand und drückte sie fest an sich. »Aber dann sehen wir niemals die Maschine«, flüsterte sie halblaut und zog ihn weiter. »Sei nicht so ein Angsthase, Gotthard.«
Friedrich nickte zustimmend. »Hör auf deine Schwester.« Noch einmal sah er sich um, dann schoss er los. »Die Sonne neigt sich dem Horizont entgegen. Wir müssen uns eilen.«
Mit gehöriger Mühe und einem Ruck an seinem Arm löste Lene Gotthards Starre und flitzte ebenfalls über das dichte Gras, bis sie am Gebäude angekommen waren, das mit seinen Ausdünstungen die Sicht auf die Sonne verdeckte. Sie hatte das Gefühl, als würden sie unter einer Glocke laufen, deren Glas mit Ruß beschmiert war, während ein grauer Schleier ihren Blick trübte. Lene legte ungläubig ihre Hand an die Backsteinmauer des unscheinbaren Maschinenschuppens. »Das soll es sein?«, wollte sie mit piepsender Stimme wissen. In ihren Träumen war das fauchende Monstrum riesengroß, spuckte Feuer, und der Boden erzitterte. Es war enttäuschend, wie man so einem kleinen Ding eine ordinär große Beachtung schenken konnte.
»Das ist es«, erwiderte Friedrich mit glänzenden Augen, die den grauen Nebel um sie herum durchdrangen. Beißender Qualm suchte sich den Weg in die tiefsten Winkelungen ihrer Lungen, als er die Tür zu dem Gebäude öffnete. »Sie ist noch in der Probephase, soll bald die volle Kraft erreichen.« Er ließ die beiden herein und schloss die Tür. »Seht euch das Antriebsrad an, wie schnell es läuft und welche Kraft es entwickeln kann.«
Lene konnte ihren Blick nicht von dem Jungen reißen. Sie bewunderte sein Interesse für die kleinen Details und ließ außer Acht, wie enttäuscht sie war. Dieses … dieses Ding sollte die unglaubliche Kraft der Engelsmühle ersetzen? Der Kessel war nicht größer, als ein Mann hoch war, das Rad drehte sich fast gemächlich und nur ein leichtes Zischen verriet, dass das Stahlkonstrukt wirklich lebte. Nach wenigen Sekunden hatte sie sich an diesem Wunderwerk sattgesehen.
»Ich will nach Hause«, verkündete sie schmollend, drehte sich erst in Gotthards Richtung, dann in die von Friedrich. »Oder habt ihr etwas anderes zum Gucken?«
Eine Sekunde war der Junge in seinen Überlegungen gefangen, dann öffnete er die Tür. »Neben der Färberei wird bei uns Wolle gesponnen. Das ist ein Fest, wenn die Spindeln surren. Wollt ihr es sehen?«
»Kann eine Biene fliegen?«
»Wie bitte?«
»Natürlich will ich es sehen!« Zu gerne ließ sich Lene von seinem Enthusiasmus anstecken. Die Aussicht, heute noch etwas Besonderes zu erleben, war zu verlockend. Obwohl Gotthard erneut mit gehörigem Widerstand aufwartete, zog sie ihn aus dem Schuppen und war froh, endlich wieder frische Luft in ihre Brust ziehen zu können.
So interessant die Technik der Männer auch war, stets schien sie dreckig, laut und in Wahrheit oftmals eine gehörige Portion kleiner, als sich die Kerle beim Bier erzählten. Typisch Jungs, wie Madame de Genlis zu sagen pflegte.
Mehrmals musste Lene husten, zog ihren Bruder weiter und folgte Friedrich vom Mauerwerk zur Nebenhalle, bis sie schließlich hinter den bunten Bottichen der Färberei Schutz fanden. Mit schlafwandlerischer Sicherheit führte er sie eine Treppe hinauf, sodass sie in der einfallenden Dämmerung gut in ein Bogenfenster spähen konnten.
Die Scheiben waren voller Ruß und Schmutz, viel konnte man nicht erkennen. Friedrich zog einen Lappen aus der Hosentasche und reinigte behutsam die Scheiben.
»Die Baumwolle wird so schnell gesponnen, dass ihr nicht einmal …«
Als hätte ihn der Blitz getroffen, starrte er mit offenem Mund in die Halle.
»Was ist los?« Lene drängte neben Friedrich an das Fenster. Sie kniff mehrmals die Augen zusammen, um sicher zu sein, dass sie kein Trugbild vor sich hatte.
An vier langen Tischen konnte sie Kinder erkennen. Wie emsige kleine Ameisen arbeiteten sie die Watteberge ab, die vor ihnen in die Höhe ragten. Sie waren kaum älter als Lene selbst, doch während ihre eigenen Wangen rosig waren und ihr Kleidchen sauber glänzte, schienen die Kinder ausgemergelt und der Stoff ihrer Kleidung wirkte matt und zerschlissen. Immer wieder warfen Aufseher weitere Baumwolle auf die Tische, bis sie sich so hoch aufgetürmt hatte, dass die Kleinen einander kaum mehr sehen konnten.
»Was machen sie da?« Lena drückte ihre Nase fest an die Scheibe.
Gotthard riskierte einen kurzen Blick, nickte schnell und räusperte sich, wie er es immer tat, wenn er etwas verstand, wofür andere länger brauchten. »Kinderhände sind schnelle Hände«, sagte er im belehrenden Tonfall ihres Vaters. »Auch wir setzen Kinder zum Arbeiten ein.« Sein Blick fiel auf Friedrich. »Genau wie die Familie Engels.«
Lene sah ebenfalls zu dem Jungen herüber. Der Schock stand ihm ins Gesicht geschrieben. Waren es seine Spielkameraden, mit denen er vor Kurzem noch herumgealbert hatte? Der sonst selbstsichere Bursche wirkte plötzlich zerbrechlich und wortkarg.
»Friedrich?« Lene zupfte sanft an seinem Hemd. »Friedrich? Hörst du mich?«
»Wieso müssen sie arbeiten?« Friedrichs Frage war nicht an sie gerichtet. Sein Blick ging geradeaus durch das Fenster, doch er fixierte einen Punkt in weiter Ferne, den Lene nicht sehen konnte. Sie wollte weiter an ihm zerren, diese tiefgründigen dunklen Augen aus ihren Überlegungen reißen, doch die Stimme des Aufsehers grub sich unerbittlich durch Mark und Bein.
»Da seid ihr ja! Saubande!«
Offensichtlich wusste er nicht, dass er den Sohn des Chefs vor sich hatte. Nun rüttelte auch Gotthard mit aller Macht an Friedrich, und mit vereinten Kräften gelang es ihnen, den Jungen wieder ins Hier und Jetzt zu holen.
»Wir wurden entdeckt«, sagte Lene und sah mit Entsetzen, dass der Mann Richtung Färberei hastete und somit ihren Fluchtweg versperrte.
Friedrich schaltete blitzschnell. »Kommt mit mir!«
Er nahm Anlauf, sprang von einem Vorsprung zum nächsten, bis sie an den Bottichen herabsteigen konnten und wieder festen Boden unter den Füßen spürten. Der Vorarbeiter humpelte zwar, doch tat er dies mit einer Schnelligkeit, die Lene den Angstschweiß in den Nacken trieb. Sofort blickte sie zu Friedrich.
Der Junge spurtete voran, kroch unter einer Leiter hindurch, bis er den Rand der Wupper erreichte. Mehrere Meter ging es von dort nach unten. Lene und ihr Bruder folgten ihm blind. Sie sah, dass er wohlüberlegt am Rand der Uferböschung entlang balancierte, um dann hinter einer Fabrikmauer zu verschwinden. Offenbar war er schon öfter auf diesem Weg vom Gelände geflohen.
Lenes kurze Füße trugen sie, so schnell sie konnten. Ihre Brust begann zu brennen, die Strähnen hingen ihr nass im Gesicht. Alles gleichgültig, schließlich hatten sie ihr Ziel fast …
Mitten in der Bewegung stockte Friedrich. Etwas hatte ihn aus der Reserve gelockt und seine geschmeidigen Bewegungen ins Wanken gebracht.
»Friedrich!«, grollte es über die Flussböschung.
Im vollen Lauf konnte Lene den Mann gerade so erkennen, der Friedrichs Namen so aussprach, wie es nur einer tun konnte: sein Vater.
Friedrich versuchte zu bremsen, verlor das Gleichgewicht und stürzte in die glitzernde Wupper. Lene wollte ihn halten und auch Gerhard griff zu, doch Friedrichs Gewicht zog sie und ihren Bruder mit in die Tiefe. Ihr blieb ein Moment, um Luft zu holen, dann umschloss sie das kalte Nass, das von den Chemikalien in allen Farben des Regenbogens schimmerte. Es wurde ganz still.
Während sie gedämpfte Schreie hörte, wurde Lene von Panik ergriffen. Wo war die rettende Wasseroberfläche? Alles sah gleich aus, in Schwärze gehüllt, vereinzelte Sonnenstrahlen im schwarzen Wasser kündeten davon, dass sie noch nicht tot war. Der Drang zu atmen wurde übermächtig. Ihre Augen brannten wie ihre Lungenflügel. Das Gefühl wich aus ihren Gliedern und Lenes Bewegungen wurden mit jedem ihrer hastigen Herzschläge unkontrollierter.
Sie hatte die Hoffnung beinahe aufgegeben, da spürte sie einen festen Griff an ihren Haaren. Der Schmerz war unbeschreiblich, doch als sie endlich wieder frische Luft in ihren Brustkorb saugen konnte, war er vergessen.
Der Vorarbeiter packte sie grob und zog sie zu sich. »Ich hab die Kleine!«
Schnell atmend wurde sie auf das Gras am Ufer gebettet. Keuchend sah sie sich um. Friedrich lag zu ihrer linken, ihr Bruder Gotthard hustete an ihrer rechten Seite.
»Friedrich!« Erneut erklang die Stimme seines Vaters, diesmal jedoch ohne Groll, voller Angst. Der Mann im feinen Anzug kniete sich neben seinen Sohn und wischte ihm die nassen braunen Strähnen aus dem Gesicht. »Was hast du dir nur dabei gedacht?«, schalt er besorgt, vergewisserte sich kurz, dass Lene und Gotthard nichts passiert war, und klopfte mit seinen tellergroßen Händen mehrmals auf den Rücken des Jungen.
»Warum … warum müssen die Kinder unserer Arbeiter bei uns schuften?«, fragte er von Hustenkrämpfen geschüttelt.
Lene horchte auf. Sie waren knapp dem Tode entronnen, sie spürte weder Finger noch Füße, und Friedrich, dieser Tunichtgut, stellte als erstes die Frage, warum seine Spielkameraden arbeiten mussten. So etwas wäre ihr nie in den Sinn gekommen.
Auch Engels senior schien verdutzt, vergaß sogar, auf den Rücken seines Sohnes zu klopfen. Er räusperte sich, tauschte verlegene Blicke mit seinem Vorarbeiter und stellte Friedrich auf die Füße. »Weißt du, mein Sohn, wenn es viel Arbeit gibt, müssen die Kinder von ärmeren Familien manchmal aushelfen, um etwas zu Essen auf dem Tisch und ein Dach über dem Kopf zu haben.«
»Und ich?«, wollte er wissen. »Muss ich auch arbeiten?«
Mit einem Anflug von Amüsement schüttelte Engels senior den Kopf. »Nein, Friedrich. Wir hatten Glück.«
»Warum haben nicht alle Glück?«
Darauf hatte der Vater keine Antwort und sein Gemurmel verlor sich in Schweigen. Friedrich indes wartete ein paar Sekunden und half Lene und Gotthard hoch. »Danke schön«, hauchte er. »Dafür, dass du mich halten wolltest.«
Ein Lächeln stahl sich auf Lenes Mundwinkel. Die Taubheit verflüchtigte sich und schien ein paar Schmetterlinge hinterlassen zu haben, die in ihrem Bauch umherschwirrten.
Friedrich schüttelte das Wasser von sich wie ein nasser Hund. Der Vorarbeiter blickte mit besorgter Miene zu seinem Chef. »Herr Engels, Sie wissen doch, was im Umland grassiert …«
Die beiden Erwachsenen wurden kalkweiß. Der Tumult hatte unzählige Arbeiter aufgeschreckt. Stimmgewirr vermischte sich mit erschrockenem Wehklagen.
»Was denn?«, wollte Friedrich mit anwachsendem Zorn in der Stimme wissen. »Warum beäugt ihr uns, als wären wir Halunken?«
Engels senior lehnte sich herab und legte seine Pranke auf die Schulter seines Sohnes. »Es ist die Cholera, Friedrich.« Er atmete schwer und Schmerz lag auf seinen Zügen. »Diese heimtückische Krankheit breitet sich im ganzen Land aus. Kinder fallen ihr im Handumdrehen anheim, wenn sie dreckiges Wasser trinken und sich anstecken.« Sein Kopf drehte sich langsam zu seinem Vorarbeiter, als wollte er etwas verbergen, doch Lene konnte sehen, dass die Augen des großen und mächtigen Mannes feucht waren. »Wickel die beiden in dicke Wolldecken, bringe sie zu ihren Eltern und sag ihnen, was passiert ist.« Seine Wangenmuskeln arbeiteten unablässig. »Lass nichts aus und eile dich.«
Der Vorarbeiter verbeugte sich tief und trat näher. »Ja, Herr.«
»Ich werde nicht sterben, Vater«, spie Friedrich und stemmte entschlossen die Hände in die Hüften. »Du sagtest, unsere Familie hat Glück.«
»Das ist dem Sensenmann egal. Er nimmt reiche, arme, kluge und dumme Menschen gleichermaßen an sich.« Engels senior musste die Nase hochziehen. Der Mann lächelte tapfer. »Der Tod ist nicht wählerisch, mein Sohn.«
Kapitel 2 – Die weite Welt
Zwölf Jahre später
Lene schloss die Augen und fühlte selbst durch ihre Lider die Helligkeit der strahlenden Sonne. Bienen summten in der Luft und unterbrachen ihre emsige Arbeit an den Wildblumen nur, um Gotthard oder Friedrich zu ärgern. Eine leichte Brise spielte mit ihren blonden Strähnen und kitzelte sanft ihre Nase. Sie lag rücklings auf dem kleinen Hügel, der sich an das Wäldchen der Firma Engels schmiegte, und genoss die Ruhe des Augenblicks. Nach einigen Atemzügen sah sie zum Himmel auf und beobachtete den dunklen Qualm der Schornsteine, den der Wind in ferne Länder trug. Hier hatte sie Friedrich vor langer Zeit kennengelernt.
Achtzehn Jahre war sie nun alt. Was war das für ein wundervolles Alter. Das Leben lag vor ihnen, eine unendliche Breite an Möglichkeiten, doch im Moment konnte sie sich nichts Schöneres vorstellen, als mit Friedrich und Gotthard die Zeit totzuschlagen und den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen.
Sie balancierte geschickt auf der Zunge einen Grashalm, ließ diesen auf ihr Sommerkleid fallen und beobachtete Friedrich, der tief in eins seiner Bücher versunken war. Ohne zu überlegen, riss sie ein Büschel Gras aus der Erde und warf es ihm an die Schulter.
»Lene!« Er blickte sich so schnell um, dass ihm die Haare ins Gesicht und über den Flaum an seinen Wangen fielen. Seit Wochen versuchte er, sich einen Bart wachsen zu lassen. Mit überschaubarem Erfolg. Beinahe hatte Lene einen Anflug von Mitleid, aber die wenigen Härchen sahen einfach zu ulkig aus, als dass sie sich nicht darüber amüsieren konnte.
»Um was geht es diesmal?«, wollte sie wissen und legte ihren Kopf zurück ins weiche Gras.
»Bitte was?«
»Dein Buch.« Sie tippte mit ihrem nackten rechten Fuß gegen den Einband. »Du verschlingst sie ja förmlich. Welches Thema behandelt es? Den französischen Aufstand?«
»Zu langweilig«, gab er zu bedenken. »Eine Revolution, die nicht von allen mitgetragen wird, könnte schnell als Staatsstreich ausgelegt werden.«
»Die Völkerschlacht bei Leipzig?«
»Schon interessanter.« Friedrich hielt inne und blickte in die Ferne. »Besonders die Jahre danach, nachdem Studenten die Farben Schwarz-Rot-Gold des Lützowschen Freikorps übernommen hatten, um dem Vaterland die Treue zu schwören und nicht dem preußischen König Friedrich Wilhelm III. Geniale Idee, schlechte Ausführung.«
Lene liebte solche Gespräche. Sie konnte seinen Gedanken stundenlang zuhören, wie er sich in seinen Theorien verlor, neue aufstellte, um sie im nächsten Moment zu verwerfen oder selbst zu entkräften. Sie lachte leise auf, stupste ihn mit dem Zeh an. »Mir ist durchaus bewusst, wie sehr du die Preußen ins Herz geschlossen hast.«
»Exakt«, murmelte er und blickte wieder intensiv in das Buch auf seinen Knien. »Ungefähr wie Skorbut oder eine Pilzinfektion.«
»Lass gut sein, Lene«, rief Gotthard lachend, zog an seiner Pfeife und versuchte, Kringel zu rauchen. Sofort wurden sie vom warmen Sommerwind davongetragen. Übrig blieb nur eine leichte Tabaknote zwischen all dem Blumenduft. »Die Preußen bringen wenigstens Zucht und Ordnung in die ländlichen Gebiete und unseren Friedrich musst du in Ruhe lassen. Immerhin soll er für seinen alten Herrn büffeln.« Er warf Friedrich eine Zigarre zu, die er aus den Beständen ihres Vaters stibitzt hatte. »Habe ich nicht recht?«
Friedrich steckte die Zigarre dankend ein. Ein müdes Lächeln war auf seinen Lippen zu erkennen und das Gespräch stockte. »Möglich.«
Etliche Sekunden lag Lene im hohen Gras und ließ die Worte wieder und wieder durch ihren Verstand sausen. Als sie nicht auf eine zufriedenstellende Lösung kommen wollte, richtete sie sich auf. »Was soll das heißen? Du musst für deinen Vater lernen?«
Langsam, als würde er damit jemanden verletzen können, legte er einen Grashalm zwischen die Seiten und schloss das Buch. Er sah ihr nicht in die Augen, sondern starrte auf die Schornsteine und das emsige Gewusel der Firma Engels.
So wortkarg kannte sie ihn nicht. Lene erhaschte einen Blick auf den Titel des Wälzers. »Grundlagen und Verständnisse des internationalen Handels?« Sie glaubte nicht, was sie da las. Sie waren doch Freunde, erzählten sich alles. Zumindest meinte sie das.
Auch Gotthard war auf einmal still, paffte leicht vor sich hin und zog den Kopf ein, als wittere er Lenes Unbehagen.
»Was geht hier vor?«, verlangte sie zu wissen.
»Ich wollte es dir sagen, fand aber nicht das richtige Momentum.« Friedrich räusperte sich, drehte seinen Kopf leicht und strich über den kümmerlichen Bart. »Vater hat mich vom Gymnasium abgemeldet.«
»Wie ist das möglich?« Lene war völlig außer sich. Sie sprang auf ihre Füße und trat nah an ihn heran, sodass sie den herben Duft seiner Haut riechen konnte. »Schuldirektor Hantschke hält so große Stücke auf dich. Du willst Jura studieren, in den Staatsdienst wechseln oder gar Dichter werden. Alle Türen stehen dir offen, Friedrich.«