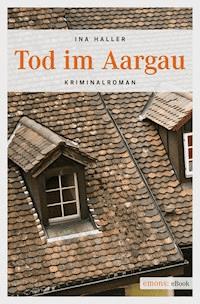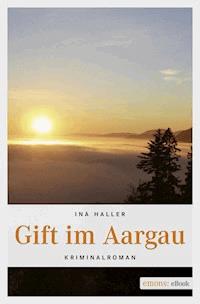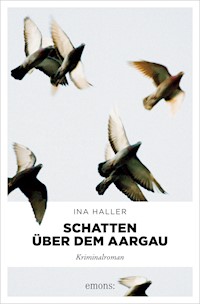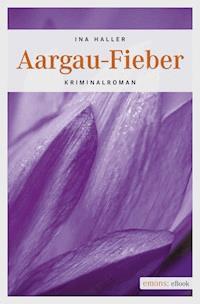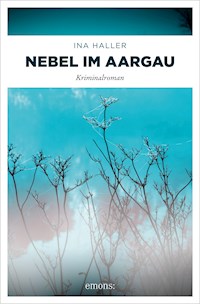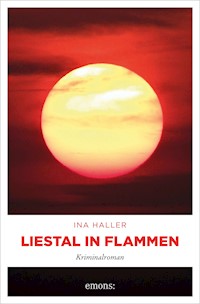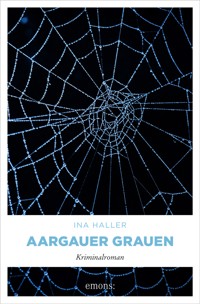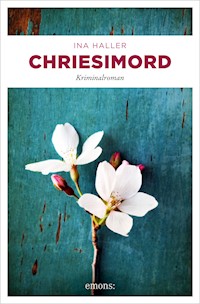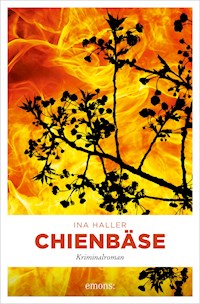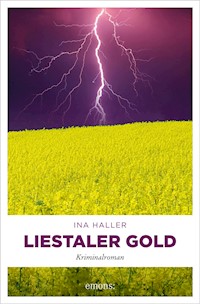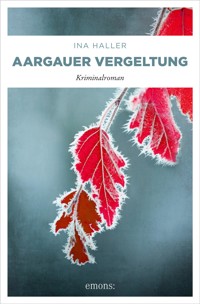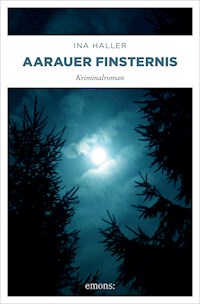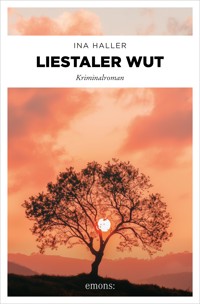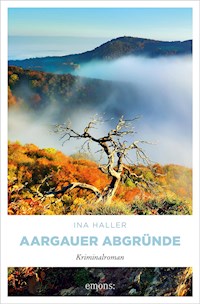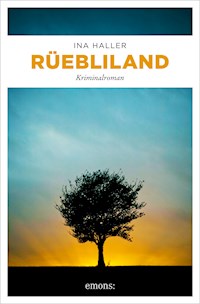
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Samantha-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein berührender Kriminalroman: authentisch, emotional, hochspannend. Samanthas Welt gerät ins Wanken, als sie nach Hause fährt und ihre Adoptiveltern ermordet auffindet. Kurz darauf wird sie von einer Inderin kontaktiert, die behauptet, ihre leibliche Schwester zu sein. Verzweifelt beginnt Samantha Nachforschungen anzustellen und entdeckt, dass die Unterlagen zu ihrer Adoption verschwunden sind. Ist der Grund für die Morde in ihrer Herkunft zu finden? Samantha begibt sich auf die Suche nach der Wahrheit und nach ihren Wurzeln – und gerät dabei in den Fokus des Mörders ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ina Haller lebt mit ihrer Familie im Kanton Aargau, Schweiz. Nach dem Abitur studierte sie Geologie. Seit der Geburt ihrer drei Kinder ist sie «Vollzeit-Familienmanagerin» und Autorin. Zu ihrem Repertoire gehören Kriminalromane sowie Kurz- und Kindergeschichten. Im Emons Verlag erschienen «Tod im Aargau», «Gift im Aargau», «Der Metzger von Aarau», «Schatten über dem Aargau», «Aargau-Fieber», «Der Fluch von Aarau» und «Aarauer Finsternis». www.inahaller.ch
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Am Ende findet sich ein Glossar.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2019 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: birdys/photocase.de
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-525-1
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmässig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Für
Urs – danke für deine Verbindungen nach IndienUmesh – thanks for your invitationand the time we spent together
Prolog
Das Klingeln des Telefons zerriss die Stille. Er fuhr herum und starrte Richtung Wohnzimmer. Das Telefon schrillte weiter. Nach dem siebten Klingelzeichen hörte es auf, als sich der Anrufbeantworter einschaltete.
Es wurde dringend Zeit zu verschwinden. Er bückte sich. Kaum hatte er die Flasche auf den Boden unter das Lavabo gestellt, durchfuhr ihn ein Schreck. Seine Fingerabdrücke! Er schnellte hoch und griff nach dem Handtuch. Konzentriert rubbelte er an der Stelle, die er meinte, angefasst zu haben, und passte auf, keine neuen Abdrücke zu hinterlassen. Dabei vermied er es, Richtung Leiche zu schauen.
Als er das Badezimmer verliess, überlegte er, was er sonst angefasst haben könnte. In Gedanken ging er den Weg durch, den er im Haus gemacht hatte. Er wandte sich zur Haustür. Mit dem Tuch um seine Hand öffnete er sie und zuckte zurück, als auf der Strasse zwei Jugendliche auf ihren Velos entlangfuhren.
Verhalte dich unauffällig, so wird sich keiner an dich erinnern. Betont lässig trat er nach draussen. Nachdem er die Tür hinter sich zugezogen hatte, stopfte er das Tuch in einen Plastiksack, den er aus der Küche mitgenommen hatte. Er brauchte alle Willensanstrengung, um nicht davonzurennen. Bei der Strasse angekommen, hielt er sich links. Er spazierte ihr kurz entlang und bog zweimal rechts ab. Als ihm eine Frau mit einem Kinderwagen entgegenkam, versteifte er sich. Sie nickte ihm kurz zu, und er zwang sich zurückzugrüssen. Zwei Buben rannten an ihm vorbei. Ihnen folgte eine ältere Frau mit einem Dackel. Sie beachtete ihn nicht, sondern hastete, den Hund hinter sich herziehend, den Kindern nach.
Als er bei seinem Auto angekommen war, konnte er sein Glück nicht fassen, dass ihm offenbar keiner Beachtung geschenkt hatte. Er stieg ein. Sein Blick huschte über die Strasse und zu den Häusern. Alles wirkte ruhig. Ein Mann und eine Frau joggten vorbei. Hoffentlich trog der Schein nicht. Und hoffentlich alarmierte gerade keiner die Polizei und gab seine Personenschreibung und das Kennzeichen seines Autos durch. Mit zitternder Hand schob er den Schlüssel in die Zündung und fuhr davon.
EINS
Samantha kam sich fehl am Platz vor und trat dichter an die Mauer unter der Kastanie. Sie ging nicht gerne zu Anlässen, bei denen sie keinen direkten Bezug zu den einladenden Personen hatte.
Eigentlich hatte sie nicht kommen wollen, aber es war beinahe Pflicht gewesen, Spalier zu stehen. Die meisten Mitarbeiter von AarePharm waren der Einladung gefolgt.
Sie beobachtete die Hochzeitsgäste, die auf dem Platz vor der Aarauer Stadtkirche den Apéro genossen. Die Trauung von André Villiger, dem Laborleiter des Egerkinger Pharmaunternehmens AarePharm, und seiner Frau Laura war stimmungsvoll gewesen. Laura stammte aus Aarau und hatte sich gewünscht, dass die Trauung in der Stadtkirche stattfand.
Die beiden standen umringt von Gratulanten mitten auf dem Platz vor dem Gerechtigkeitsbrunnen. Laura, die in dem weissen Brautkleid zu leuchten schien, schaute in ihre Richtung. Kurz trafen sich ihre Blicke, aber Samantha war überzeugt, Laura hatte sie nicht gesehen. Sie war eine von vielen. Ausserdem war Laura beschäftigt genug, alle Glückwünsche entgegenzunehmen.
Nach einigen kurzen Gesprächen hatte Samantha eine Pause gebraucht. Ein leichter Windstoss strich über ihr Gesicht. Ein einzelnes Blatt, das gelb-braun verfärbt war, schwebte zu Boden. Für Mitte Oktober war es erstaunlich warm. Überhaupt war das Wetter dieses Jahr seltsam. Auf einen heissen und trockenen Sommer folgte nun dieser milde Herbst mit Temperaturen von zwanzig bis fünfundzwanzig Grad. Weitere Zeichen für die Klimaerwärmung, hiess es.
Samantha drehte sich um und blickte in die andere Richtung. Von hier hatte man einen guten Blick nach Westen zum Jura. Die schöne Aussicht wurde durch die Wasserdampffahne des Kernkraftwerkes Gösgen beeinträchtigt. Beim Betrachten dieser Wolke machte sich Beklemmung in ihr breit. Schnell kehrte sie der Fahne den Rücken zu und beobachtete weiter das Treiben.
Keiner machte Anstalten zu gehen. Im Gegenteil. Die Gäste schienen sich gut zu amüsieren. Samantha entdeckte Erik und Bernd aus ihrem Team. Sie hatte keine Lust, sich zu ihnen zu gesellen, und schielte auf ihre Armbanduhr. Sie wollte nicht die Erste sein, die sich verabschiedete. Das war in ihren Augen unhöflich. Wohl oder übel würde sie eine Weile bleiben müssen.
Samantha lehnte sich gegen den Baum. Die Rinde kratzte über die nackte Haut ihrer Arme. Sie strich ihr dunkelgrünes Kleid glatt. Einen Vorteil hatte die Hochzeit.
«Endlich hast du Gelegenheit, dich hübsch zu machen», hatte ihre Mutter gewitzelt.
«Die beiden haben sich einen schönen Tag ausgesucht», sagte Joel Gyger. Samantha versteifte sich, als ihr Vorgesetzter sich zu ihr unter den Baum gesellte. Bei AarePharm gehörte er zur Geschäftsleitung und war mit zweiunddreissig das jüngste Mitglied. Er war für die Qualitätssicherung verantwortlich.
«Ja, sie haben richtiges Wetterglück», pflichtete Samantha ihm bei. Sie musterte seine hoch aufgeschossene, schlanke Gestalt und überlegte fieberhaft, wie sie am besten Small Talk machen sollte – etwas, das sie nicht gut konnte.
In dem halben Jahr, in dem sie bei AarePharm angestellt war, hatten sie privat kaum ein Wort gewechselt.
Joel Gyger wandte sich ihr zu. «Ich bin überrascht, Sie hier anzutreffen. Ich dachte, Sie wollten in die Ferien fahren.»
«Wir fahren am Abend ab.»
«Zum Wandern, richtig?»
«Ja, ins Wallis. Meine Eltern haben mich eingeladen. Sie haben die Gelegenheit, die Ferienwohnung von Freunden zu benutzen, und haben mich gefragt, ob ich Lust hätte mitzukommen.»
«Ich beneide Sie. Das ist das ideale Wanderwetter.» Joel Gyger lächelte, und seine braunen Augen blitzten. Er hob sein Champagnerglas und stiess damit gegen Samanthas. «Nun sind Sie über ein halbes Jahr bei uns. Da finde ich es längst überfällig. Ich bin Joel.»
Samantha war bereits aufgefallen, wie persönlich der Umgang bei AarePharm war. Die Mitarbeiter duzten sich untereinander und sogar mit ihren Vorgesetzten. Sie war die Einzige, bei der das bisher nicht zugetroffen hatte. Nun ergriff Joel offenbar die Gelegenheit, das zu ändern. Samantha dachte an ihre frühere Stelle. So ein lockerer Umgang hatte dort nicht geherrscht. Genau wurde darauf geachtet, wer welche Position in der Hierarchie innehatte.
«Total untypisch und veraltet», hatte ihre Freundin Lorena gesagt. «Die Firma muss den Stand von vor hundert Jahren beibehalten haben. Ich frage mich, wie du es da so lange ausgehalten hast.»
Samantha setzte ein Lächeln auf. «Samantha.»
«Freut mich.» Joel stiess ein zweites Mal mit seinem Glas gegen ihres und trank einen Schluck.
«Joel?» Ein Mann, den Samantha nicht kannte, kam auf sie zu. «Kannst du bitte kommen?»
«Natürlich.» Er reichte Samantha die Hand. «Ich wünsche dir schöne Ferien. Erhole dich in den Bergen. Es wird viel Arbeit geben, wenn du zurückkommst.» Er zwinkerte ihr zu. «Bis in zwei Wochen.»
Samantha blickte ihm nach. Seine vollen braunen Haare hatten im Sonnenlicht einen leichten Kastanienton, um den ihn vermutlich viele Frauen beneideten. Wie Samantha wusste, war er zum späteren Fest mit Freunden und Familie geladen.
Sie bemerkte, wie sich die ersten Gäste verabschiedeten. Erleichtert stiess sie sich vom Baum ab, stellte ihr halb ausgetrunkenes Glas auf einen der Tische und schloss sich denen an, die die Treppe nach unten Richtung Haldentor liefen.
Dreissig Minuten später parkte sie ihren Smart vor dem Reiheneckhaus ihrer Eltern, das sich unweit der Sekundarschule Brugg befand. Das Bezirksschulhaus war nur wenige hundert Meter weiter. Die Nähe zur Schule hatten sowohl Samantha als auch ihre Eltern geschätzt. Häufig war sie am Morgen knapp dran gewesen und hatte es in letzter Sekunde geschafft, unbemerkt ins Klassenzimmer zu schlüpfen.
Von ihrem Standort aus konnte Samantha die Aare zwar nicht erkennen, dafür hörte sie das Wasser rauschen. Der silbergraue Toyota stand vor der Garage. Samantha warf einen Blick ins Innere. Er war bereits halb mit Koffern und Taschen gepackt. Nur die Kisten mit dem Essen fehlten. Samantha musste lächeln, wenn sie sich vorstellte, wie ihr Vater versuchte, all das, was ihre Mutter unbedingt mitnehmen wollte, im Wagen zu verstauen. «Wir gehen nicht auf eine Weltreise», würde sein am meisten gesagter Satz heute sein.
Bevor Samantha ihren Koffer umladen würde, wollte sie sich umziehen.
Samantha betrat den Garten. Als sie gegen die Haustür drückte, öffnete sich diese zu ihrem Erstaunen nicht. Sie klingelte, da sie den Schlüssel im Smart gelassen hatte. Die Sekunden verstrichen. Verwundert trat Samantha einen Schritt nach hinten und blickte in den ersten Stock hoch. Bestimmt sind sie auf der Terrasse, dachte sie und umrundete das Haus. Die Terrassentür war offen. Daneben stand eine Giesskanne. Ihre Mutter war offenbar dabei gewesen, die Pflanzen zu giessen.
Samantha streckte den Kopf zur Terrassentür hinein. «Ich bin es», rief sie.
Keine Antwort.
Samantha betrat das Haus. «Mueti, Vati?»
Stille.
Sie streifte die Pumps von den Füssen und wackelte mit den Zehen. Absatzschuhe waren definitiv nichts für sie. Die Kühle der Plättli tat gut, als sie durch das Wohnzimmer lief und die Treppe nach oben eilte. Samantha klopfte an die Schlafzimmertür ihrer Eltern. Keine Antwort. Sie öffnete die Tür und fand das Zimmer leer vor. Sie ging zum Arbeitszimmer, das ebenfalls leer war.
Verwundert drehte sie sich um. Waren ihre Eltern zu den Nachbarn gegangen, um den Schlüssel abzugeben, und hatten dabei die Terrassentür offen gelassen?
Die Mosers wohnten zwei Häuser weiter. Sie würden den Briefkasten leeren und die Pflanzen giessen, solange sie in den Ferien waren.
Samantha kehrte ins Parterre zurück. In der Küche stand eine Kiste mit Vorräten, die ihre Mutter gepackt hatte. Samantha beschloss, auf der Terrasse zu warten.
Als sie durch das Wohnzimmer ging, bemerkte sie ein Bein, das hinter dem Sofa hervorschaute. Sie brauchte eine Weile, bis sie verstand, was das bedeuten konnte, und eilte um das Sofa.
Ihr blieb der Schrei im Hals stecken, als sie in die aufgerissenen Augen ihres Vaters blickte. Rund um seinen Kopf hatte sich eine Blutlache ausgebreitet. Die Kante des Glastischchens war ebenfalls rot gefärbt.
Samantha ging in die Hocke. Hektisch tastete sie nach dem Puls. Nichts. Sie schoss hoch.
«Mueti!»
Sie rannte in den Gang und bemerkte die offene Tür zum Gästebadezimmer. Samantha taumelte zurück, als sie neben dem Lavabo am Boden ihre Mutter erblickte. Ihre Augen starrten sie leblos an. Eine Blutlache umrahmte ihren Kopf. Unter dem Lavabo neben dem Schränkchen stand eine Weinflasche, an der Blut klebte.
Versteinert sass Samantha in der Küche ihrer Eltern. Die Sanitäterin stellte ein Glas Wasser vor sie und zog einen Stuhl heran. Sie griff nach Samanthas Hand, als sie sich neben sie setzte.
«Bitte trinken Sie einen Schluck.»
Samantha war unfähig, sich zu rühren. Sie starrte weiter auf die gepackte Kiste: Konfitüre, Honig, Brot, Teigwaren, Reis …
Hinter sich hörte sie Stimmengemurmel. Samantha versuchte die Stimmen so weit auszublenden, dass sie die Sätze nicht verstehen konnte. Sie wollte nicht wissen, worüber geredet wurde. Trotzdem konnte sie dem Drang nicht widerstehen und schaute sich um. Gerade gingen ein Mann in Polizeiuniform und einer in einem weissen Ganzkörperanzug, der ihn wie einen Astronauten erscheinen liess, an der Küchentür vorüber. Rasch senkte Samantha den Kopf und zupfte an einem Hautfetzen neben ihrem linken Daumennagel. Ein Schmerz zuckte durch die Haut, als sie ihn abriss. Blut sickerte aus der kleinen Wunde. Hypnotisiert starrte Samantha den Blutstropfen an.
«Ja, sie ist hier», sagte die Sanitäterin. «Sie steht unter Schock. Bis jetzt habe ich kein Wort aus ihr herausgebracht.»
Samantha hob den Kopf und schaute die Kiste an. Ihre Mutter hatte den Kaffee vergessen.
«Lassen Sie uns das übernehmen», sagte eine Männerstimme.
Die Frau brummte etwas, das wie «ungern» klang. Nachdem sie den Raum verlassen hatte, erschienen zwei Männer in Samanthas Blickfeld. Sie löste ihren Blick von der Kiste und starrte die Männer an. Der Blonde setzte sich ihr gegenüber und hielt dabei seine blauen Augen unverwandt auf sie gerichtet.
«Mein Name ist Christian Bachmann. Und das ist Fritz Landolt.» Bachmann wies auf den zweiten Mann mit krausem grauen Haar und Vollbart. Er stellte die Kiste vom dritten Stuhl auf den Boden und setzte sich neben Bachmann.
«Wir sind von der Kantonspolizei, Abteilung Leib und Leben.»
Polizei. Natürlich. Samantha nickte. Zu mehr war sie nicht fähig.
«Sie haben Herrn und Frau Kälin gefunden?»
Erneut nickte Samantha.
«Ich weiss, wie schrecklich das für Sie sein muss, Herrn und Frau Kälin so aufgefunden zu haben. Aber es ist für uns wichtig, so schnell wie möglich Fragen zu stellen. Ist das für Sie in Ordnung?»
Samantha nickte.
Landolt holte ein Notizbuch hervor und schlug es auf. «Darf ich zuerst nach Ihrem Namen fragen?»
«Samantha Kälin», brachte sie mühsam hervor. Ihre Stimme klang fremd in ihren Ohren.
«Kälin?» Landolt wechselte mit Bachmann einen Blick.
Bachmann machte eine vage Bewegung mit der Hand Richtung Gang. «Sind Sie mit den beiden verwandt?»
«Das sind meine Eltern», sagte Samantha und war sich bewusst, was als Nächstes kommen musste.
Bachmann neigte den Kopf, was einer Aufforderung weiterzusprechen gleichkam.
Samantha holte zitternd Luft. «Ich wurde adoptiert. Ursprünglich stamme ich aus Indien.»
«Indien?», wiederholte Landolt.
Diese Reaktion war Samantha gewohnt. Jeder nahm an, Inder müssten eine dunkle Haut haben. Obwohl sie einen dunkleren Teint als Mitteleuropäer hatte, war ihre Haut für eine Inderin hell. Helles Latte-macchiato-Braun nannte ihre Freundin Lorena es. Genauso passten ihre grünen Augen nicht zu dem allgemeinen Bild, das die Leute von einer Inderin hatten. Das Einzige, das passte, waren ihre dichten, langen schwarzen Haare, die ihr fast bis zur Taille reichten.
Als sie nicht antwortete, sah Landolt Bachmann an, der übernahm. «Da Sie perfekt Schweizerdeutsch sprechen, nehme ich an, Sie kamen bereits als Kind in die Schweiz.»
«So ist es.»
«Wohnen Sie im selben Haus?», fragte Bachmann weiter.
«Nein. Ich habe eine Wohnung in der Altstadt in Lenzburg.» Sie nannte die Adresse, die Landolt notierte.
«Haben Ihre Eltern – Adoptiveltern – weitere Kinder?», fuhr Bachmann fort.
Samantha schüttelte den Kopf.
«Gibt es andere Verwandte?»
«Valentin Kälin.»
In der Pause, die sich einstellte, konnte Samantha erkennen, wie es in Bachmanns Kopf arbeitete.
«Meinen Sie damit Nationalrat Valentin Kälin?», fragte er nach einer Weile.
«Ja. Er ist der Bruder meines Vaters.»
«Können Sie mir bitte seine Kontaktdaten geben?»
Sie nannte die Adresse und Telefonnummer, die Landolt ebenfalls notierte. Will er mich testen, ob ich die Wahrheit sage, fragte sie sich. Bachmann konnte diese Angaben bestimmt anderswo entnehmen.
«Gibt es einen Grund für Ihre Anwesenheit?», fuhr Bachmann fort.
«Wir waren verabredet und wollten zusammen in die Ferien fahren.» Die Worte fühlten sich wie ein Messerstich direkt in den Magen an. Würden ihre Eltern noch leben, wenn sie früher gekommen wäre?
«Darf ich fragen, wann Sie hier ankamen und wie Sie Ihre Eltern vorgefunden haben?»
Zitternd holte sie Luft. Reiss dich zusammen, dachte sie. Die beiden machen nur ihre Arbeit und brauchen die Information, damit sie den finden können, der Mueti und Vati getötet hat.
Sie räusperte sich und begann so genau wie möglich zu berichten. Landolt machte die ganze Zeit Notizen, was sie verunsicherte.
«Für eine Reise in die Berge haben Sie sich erstaunlich in Schale geworfen», sagte Bachmann, nachdem sie geendet hatte. Er musterte Samantha, und sie wurde sich bewusst, dass sie nach wie vor das elegante Kleid trug.
«Ich war auf einem Fest», sagte sie. «Ich wollte mich hier umziehen, bevor wir abfahren.»
«Fest? Darf ich wissen, wo?», hakte Bachmann nach.
«Auf der Hochzeit des Laborleiters der Firma, in der ich angestellt bin.» Himmel, klingt das kompliziert, dachte sie. «Auf der Hochzeit von André Villiger, der wie ich bei AarePharm arbeitet», präzisierte sie.
Bachmann und Landolt schauten einander an. Bachmann machte einige Gesten mit der Hand, was Samantha erneut irritierte. «Die Mitarbeiter waren zum Apéro geladen», fühlte sie sich genötigt zu sagen.
«Können Sie mir jemanden nennen, mit dem Sie gesprochen haben?», fragte Bachmann.
«Joel Gyger, mein Chef», war der Erste, der Samantha in den Sinn kam. Kaum hatte sie seinen Namen ausgesprochen, wünschte sie, es nicht getan zu haben. Angestrengt überlegte sie, wen sie Bachmann ausserdem nennen konnte. Ihr kamen sechs weitere Mitarbeiter in den Sinn, mit denen sie kurz gesprochen hatte, bevor sie sich unter den Baum auf dem Platz vor der Kirche verzogen hatte.
***
Samantha sass an dem kleinen Esstisch in ihrer Zweizimmer-Dachwohnung. Sie hatte den Kopf auf die Arme gelegt und wartete, ob endlich Tränen kamen. Lorena setzte sich neben sie. Samantha hob den Kopf und blickte in das sommersprossige Gesicht, das von einem roten Lockenkopf umrahmt war. Nachdem Bachmann und Landolt ihre Fragen beendet hatten, hatte ein Polizeibeamter sie nach Hause gebracht, da sie psychologische Betreuung abgelehnt hatte. Samantha hatte alleine sein wollen. Erst zu Hause realisierte sie, dass das keine gute Idee gewesen war. Sie hatte Lorena angerufen. Ihre Freundin, die sie bereits seit dem Kindergarten kannte, war sofort gekommen.
«Trink einen Schluck», sagte Lorena.
Samantha nippte an dem Glas. «Ich wünschte, ich könnte weinen oder schreien. Ich spüre, wie es in mir brodelt und ich am liebsten alles gegen die Wand schmeissen würde, was ich in die Finger bekomme, aber ich kann nicht. Ich bin wie gelähmt.»
«In dem Fall ist es besser, wenn du gelähmt bist. Zerstörungswut hilft im ersten Augenblick, aber später wirst du dich nicht befreit fühlen.»
«Warum kann ich nicht weinen? Das soll helfen, habe ich gehört.» Sie stand auf und wechselte zum Sofa.
«Das ist der Schock, denke ich. Wenn der weg ist, wirst du es können.» Lorena strich über ihren Arm. «Hast du deinem Onkel Bescheid gesagt?»
Erschrocken hob Samantha den Kopf. «Nein.»
«Du solltest es tun, wenn es die Polizei nicht bereits getan hat. Du solltest ihn anrufen.»
Ihr Blick huschte zur Uhr. Fast Mitternacht. «Das kann ich nicht. Nicht heute. Morgen.»
«Es wäre gut. Ihr braucht euch.»
«Ich kann nicht», wiederholte Samantha und begann am ganzen Körper zu zittern. «Was soll ich ihm sagen?» Lorena strich weiter über ihren Arm, aber dieses Mal verfehlte diese Geste die beruhigende Wirkung.
Es klingelte an der Tür, und Samantha und Lorena zuckten gleichzeitig zusammen. Lorena stand auf, während Samantha weiter vor sich hin starrte und das Stimmengemurmel, das von der Tür kam, ausblendete.
«Sammy!»
Sie erschrak, als sich Valentins Frau Sonja neben sie setzte und sie umarmte. Steif lehnte Samantha sich gegen sie. Sonja strich über ihren Rücken.
«Das ist furchtbar», flüsterte sie.
Auf der anderen Seite quetschte sich noch jemand auf das Zweiersofa. Samantha roch das Aftershave ihres Onkels. Lorena schloss die Wohnungstür und blieb unschlüssig dort stehen.
«Kind», sagte er und drückte ihren Arm.
«Der Polizist sagte, du hättest sie gefunden. Stimmt das wirklich?», fragte Sonja.
Samantha löste sich aus ihrer Umarmung und stand auf. Auf einmal konnte sie keine Person zu dicht bei sich ertragen. Am liebsten hätte sie alle gebeten zu gehen. Samantha setzte sich auf den Sessel, der gegenüber dem Sofa stand.
Sonjas Augen waren gerötet. Ihre kurz geschnittenen, blond gefärbten Haare standen vom Kopf ab. Obwohl sie pummelig war, wirkte sie auf einmal ausgezehrt. Auch Valentin schien gealtert. Normalerweise wirkte er nicht wie vierundfünfzig, sondern mindestens zehn Jahre jünger. Die Augen hinter der Brille hatten den Glanz und das schelmische Glitzern, das sie mehr oder weniger immer hatten, verloren. Seine Wangen waren eingefallen und das Gesicht grau. Das war nicht mehr der überragende Politiker, der bei den letzten Wahlen mit einem Glanzresultat in den Nationalrat gewählt worden war.
«Als der Polizist … wie heisst er – irgendwas mit einem Gewässer?», fragte Valentin.
«Bachmann», sagte Sonja leise.
«Als Herr Bachmann sagte, Doris und Peter seien tot, hielt ich das für unmöglich. Am Mittag waren sie bei uns zum Essen und haben die Wanderstöcke geholt. Ihre Vorfreude auf eure Wanderferien war riesig – die ersten gemeinsamen Ferien seit wie lange? Sie wussten nicht, wohin mit ihrer Energie, und schmiedeten die ganze Zeit Pläne. Sie können nicht einfach tot sein!»
Samanthas Hals wurde trocken, und sie war unfähig zu sprechen. Um diese Zeit sollte sie nach einem reichhaltigen Essen in der Ferienwohnung im Bett liegen. Morgen hatten sie die erste Wanderung vorgehabt.
«Erschlagen, hat der Beamte gesagt. Das kann nicht sein.» Über Sonjas Wangen strömten Tränen, und Samantha beneidete sie darum, weinen zu können.
Das Schweigen, das nur von Sonjas Schluchzern unterbrochen wurde, dehnte sich aus. Valentin legte den Arm um seine Frau, und Sonja presste ihr Gesicht gegen seine Schulter. Valentins Augen schienen ins Leere zu blicken.
«Möchtest du darüber reden?», fragte er unvermittelt.
Samantha zuckte zusammen.
«Ich meine, wie du sie gefunden hast.»
Nein, hätte sie am liebsten geschrien. «Ich kann nicht.»
«Es wäre gut.»
«Nicht jetzt.»
«Möchtest du mit zu uns kommen?», fragte Sonja, die sich inzwischen beruhigt hatte.
«Nein.» Geht endlich, dachte sie. Ich weiss, ihr meint es gut, aber ich muss alleine sein.
«Du kannst nicht alleine bleiben», sagte Sonja, als habe sie ihre Gedanken erraten.
«Lorena ist bei mir», brachte sie nach einigen Sekunden heraus.
«Wir sind deine Familie. Du kannst in Adriennes Zimmer schlafen.»
Samantha schüttelte den Kopf. Enttäuschung blitzte in Sonjas Augen auf, und Samantha verspürte ein schlechtes Gewissen. Sie war erleichtert, als ihr Onkel aufstand. «Wenn du uns brauchst, sind wir jederzeit für dich da», sagte er kurz angebunden.
Am liebsten hätte Samantha gesagt: «Das Gleiche gilt andersherum», aber sie brachte den Satz nicht über die Lippen und schämte sich dafür. Immerhin hatte Valentin gerade seinen Bruder auf brutale Art verloren.
«Bitte geh auch», sagte sie zu Lorena, nachdem Sonja und Valentin die Wohnung verlassen hatten.
ZWEI
Samantha war hundemüde. Nachdem Lorena gegangen war, hatte sie sich hingelegt, aber sie hatte das Gefühl, in der Nacht keine Sekunde geschlafen zu haben. Kaum hatte sie die Augen geschlossen, hatte sie ihre blutüberströmten Eltern vor sich gesehen.
Als sie die Nachttischlampe eingeschaltet hatte, war es nicht besser gewesen. Augen zu und schlafen bedeutete Dunkelheit, die Platz für den Schrecken liess.
Gegen sechs Uhr am Morgen hatte sie sich aus dem Bett gequält und Frühstück gemacht. Das hatte sie nicht herunterbekommen. Nur einen Cappuccino hatte sie trinken können. Langsam war es draussen hell geworden, und das Licht der aufgehenden Sonne hatte den Tod ihrer Eltern unrealistisch erscheinen lassen.
Realität wurde er wieder, als es an der Tür geklingelt hatte und Bachmann und Landolt davorstanden. Die Beamten wirkten genauso übernächtigt.
Für die beiden musste der Tod ihrer Eltern lästig sein, weil er ihnen das Wochenende verdarb. Allerdings konnte Samantha keinen Groll bei ihnen ausmachen. Im Gegenteil, sie behandelten sie professionell und freundlich.
Samantha wäre es lieber gewesen, sie hätten mit den weiteren Befragungen bis Montag gewartet. Allerdings war ihr klar, dass sie so schnell wie möglich Informationen zusammentragen mussten.
Samantha bat die beiden herein und fragte sie, ob sie etwas trinken wollten. Bachmann wirkte, als wolle er zunächst ablehnen, schien jedoch ihren Wunsch, aktiv etwas machen zu können, zu erraten.
«Für mich gerne einen Espresso», sagte er und schaute Landolt an.
«Für mich auch. Vielen Dank.»
Die beiden setzten sich an den Tisch und warteten, bis Samantha sich mit den beiden Tassen zu ihnen gesellte.
«Wir würden Ihnen gerne weitere Fragen stellen», sagte Bachmann ohne grosse Einleitung.
Samantha brachte nur ein Nicken zustande.
Bachmann holte seine Notizen hervor und ging Samanthas Aussage vom Vorabend durch. «Haben Sie Ergänzungen?»
«Nein.»
«Ist Ihnen aufgefallen, ob Dinge fehlen?», fragte er weiter.
«Dinge?»
«Wertgegenstände, Geld.»
Hilflos sah Samantha ihn an. «Sie meinen, jemand habe meine Eltern getötet, weil er sie berauben wollte?»
«So in der Art», sagte Bachmann.
«Bei meinen Eltern gab es nichts zu holen. Das einzige Wertvolle, wenn man das so nennen will, sind der Fernseher und der Computer. Schmuck hatten sie keinen.»
«Fernseher und Computer waren da», sagte Landolt. «Fühlten sich Ihre Eltern bedroht?»
«Warum sollten sie?»
«Gab es keine Probleme mit Freunden?»
«Meine Eltern haben nie über Streitigkeiten gesprochen.»
«Mit Nachbarn?», fragte Bachmann.
«In dem Quartier, in dem meine Eltern wohnen, wird viel Wert auf gute Nachbarschaft gelegt. Alle unterstützen sich gegenseitig.»
«Gab es wirklich keinen Streit?», hakte Bachmann nach.
Samantha schüttelte den Kopf.
Bachmann musterte sie einen Augenblick schweigend. «Die nächste Frage wird persönlich sein, ist aber leider notwendig. Ist das in Ordnung?»
Samantha nickte.
«Doris und Peter Kälin haben Sie adoptiert. Sie sind keine gebürtige Schweizerin. Hatten Ihre Eltern deswegen Probleme?»
«Probleme?», wiederholte Samantha.
«Damit meine ich zum Beispiel, ob sie fremdenfeindlichen Äusserungen ausgesetzt waren. Oder wurden Sie direkt mit Fremdenfeindlichkeit konfrontiert?»
Samantha starrte erst Bachmann und danach Landolt an. «Ich fühlte mich nie als Ausländerin und tue es heute genauso wenig.»
«Das meine ich nicht. Sie haben einen Namen, der nichts in diese Richtung vermuten lässt, und Sie sprechen Aargauer Dialekt. Wenn man Sie nicht sieht, gehen Sie für jeden als Schweizerin durch.»
«Ich bin Schweizerin!», rief sie heftig. Samantha atmete einmal durch. «Entschuldigung.»
«Sie müssen sich nicht entschuldigen», sagte Bachmann.
«Hin und wieder kommen, wie soll ich sagen, verletzende Äusserungen vor, aber das ist zum Glück selten. Ich habe weder im Beruf noch privat Probleme und habe mich nie bedroht gefühlt, wenn Sie das meinen.»
«Wie war es bei Ihren Eltern? Hatten sie mit Fremdenfeindlichkeit zu kämpfen, als sie Sie adoptierten?», fragte Bachmann weiter.
«Mein Vater und sein Bruder waren als Expats für ein Chemieunternehmen in Indien tätig, um dort einen Produktionsstandort aufzubauen. Mein Onkel als Produktionsleiter und mein Vater als Automationsspezialist.» Samantha machte eine kurze Pause, um sich zu sammeln. «Da meine Mutter keine eigenen Kinder bekommen konnte, haben sie sich entschlossen, eins zu adoptieren. Weil sie zu diesem Zeitpunkt in Delhi wohnten, war es für sie naheliegend, ein indisches Kind zu adoptieren. Kurz darauf erkrankte mein Vater an Tuberkulose. Meine Eltern kehrten vorzeitig in die Schweiz zurück und nahmen mich mit. Zum Glück konnte mein Vater geheilt werden. Als wir in die Schweiz kamen, war ich bereits Teil der Familie.»
«Wie reagierten die Nachbarn, als Ihre Eltern mit einem Ausländerkind einzogen?», fragte Bachmann.
«Es war von Anfang an klar, dass ich nicht ihr leibliches Kind war. Meine Eltern waren blond und ich schwarzhaarig. Hinzu kommt mein dunklerer Teint. Von Anfang an gingen meine Eltern offen mit der Adoption um. Alle, denen sie es erzählten, reagierten tolerant. Vorurteile oder ausländerfeindliche Äusserungen gab es zwar, gehörten aber zur Seltenheit. Von den meisten wurden meine Eltern unterstützt, da die erste Zeit, insbesondere die Krankheit meines Vaters, meinen Eltern viel abverlangte. Meine Mutter hat einmal gesagt, es sei ihnen manchmal ein wenig zu viel des Guten gewesen, wie sich die Leute um sie gekümmert haben.»
«Wie sah es innerhalb der Familie aus?», fragte Bachmann weiter.
«Mein Onkel und seine Frau waren gemäss meiner Mutter am Anfang skeptisch. Das lag nicht an der Adoption, bei der sie ihnen mit den ganzen Formularen geholfen haben, oder an meiner Herkunft. Ihre Befürchtungen gingen eher in die Richtung, man wisse nicht, ob ich eventuell krank sei oder in der Art.»
«Wurden diesbezüglich keine Abklärungen getroffen?», mischte sich Landolt ins Gespräch ein.
«Im Waisenhaus wurde ich genau untersucht. Es ging ihnen eher um, wie soll ich es nennen – Spätfolgen.»
«Das heisst, Sie waren krank?»
«Meine Eltern sind hier nicht ins Detail gegangen. Wie gesagt, mein Onkel und meine Tante unterstützten meine Eltern, wo es ging. Zusammengefasst: Ich bin von meinen Eltern und ihren Familien behütet aufgewachsen.»
«Valentin Kälin ist der Bruder Ihres Vaters. Von Verwandten Ihrer Mutter haben Sie uns gestern nichts gesagt.»
«Die Schwester meiner Mutter und ihr Mann sind beim Skitouren im Engadin von einer Lawine erfasst und getötet worden, als ich achtzehn war. Sie hatten keine Kinder.»
«Was ist mit Ihren Grosseltern?», fragte Bachmann.
«Mueti hat mir erzählt, sie seien anfangs befremdet gewesen, aber sie haben die Entscheidung respektiert. Meine Grossväter und die Mutter meines Vaters leben nicht mehr. Mein Grosi lebt in einem Heim. Sie ist dement, und es ist von der Tagesform abhängig, ob sie uns erkennt oder nicht. Ich bitte Sie, meine Grossmutter nicht zu befragen und ihr nichts vom Tod meiner Eltern zu sagen.»
«Das Heim ist informiert?», hakte Bachmann nach.
«Ja.» Samantha hatte dort angerufen, kurz bevor die Beamten gekommen waren. «Grosi wird Ihnen nicht weiterhelfen können, da sie in ihrer eigenen Welt lebt. Die Augenblicke, in denen sie in unserer Zeit weilt, sind kurz. Die Heimleiterin meinte, es sei besser für sie, wenn sie nichts vom Tod meiner Eltern erfährt.»
Bachmann machte eine Notiz. «Ich stelle mir diesen Zustand besonders für Sie als Angehörige schwer vor.»
«Das ist es. Man gewöhnt sich nie daran.»
«Zurück zu Ihnen. Wie alt waren Sie, als Sie in die Schweiz kamen?», fragte er.
«Ungefähr zweieinhalb Jahre. Bevor Sie fragen, an die Zeit in Indien habe ich keine Erinnerung.»
«Was verständlich ist. Das heisst, Sie sind seit ungefähr sechsundzwanzig Jahren in der Schweiz?»
Samantha nickte und fragte sich, warum das für die Ermittlungen wichtig sein sollte.
«Konnten Ihre Eltern Sie einfach so mit in die Schweiz nehmen?»
«Soviel ich weiss, mussten sie die Adoptionsunterlagen übersetzen und beglaubigen lassen und an die Schweizer Vertretung schicken, die alles an den Heimatkanton weiterleitete. Dort wurde es an das Zivilstandsamt oder so weitergegeben. Nachdem meine Adoption in der Schweiz anerkannt war, erhielt ich das Schweizer Bürgerrecht. Da meine Eltern das gleich nach meiner Adoption in die Wege geleitet haben, war meine Einreise kein Problem.»
«Wie alt waren Sie bei der Adoption?»
«Knapp drei Monate.»
«Haben Ihre Eltern mit Ihnen über Ihre Herkunft gesprochen?», fragte Landolt.
«Viel gab es nicht, was sie berichten konnten. Man hat mich in ein Waisenhaus gebracht, nachdem meine leiblichen Eltern gestorben waren. Soviel ich weiss, gab es einen grossen Brand im Slum, dem unter anderem ihre Hütte zum Opfer gefallen war. Ich habe als Einzige überlebt.»
«In welchem Slum? In Delhi?», fragte Bachmann.
«Ja», antwortete Samantha.
«Das heisst, Sie haben keine lebenden Verwandten. Ich meine damit entferntere Verwandte wie Tanten oder Onkel, Cousinen oder Cousins?»
«Dazu gab es keine Angaben, als ich adoptiert wurde. Ich vermute, es wurde gar nicht nach Verwandten gesucht. Meine Mutter hat gesagt, ich soll froh sein, ins Waisenhaus gekommen zu sein.»
«Warum?», fragte Landolt.
«Grosse Perspektiven hatte ich im Slum nicht. Die Schweiz sei die bessere Alternative für mich gewesen.»
«Das klingt nachvollziehbar», sagte Bachmann und machte eine weitere Notiz. Samantha hätte zu gerne gewusst, was er schrieb und inwiefern die Antworten auf diese Fragen relevant für den Tod ihrer Eltern sein sollten.
«Sind Ihre Eltern später nach Indien zurückgekehrt?», fragte Landolt.
«Sie meinen, nachdem mein Vater genesen war?»
Bachmann nickte.
«Nein. Meinen Vater haben keine zehn Pferde zurückgebracht. Einmal Tuberkulose hat gereicht, hat er gesagt. Er wollte das Risiko kein zweites Mal eingehen. Er hat folglich gekündigt und eine neue Stelle als Wartungsspezialist für Chemieanlagen mit weniger Reisetätigkeit und nur innerhalb Europas angenommen. Ein weiterer Grund war, meine Eltern wollten mich hier einschulen. Die Tuberkulosebehandlung zog sich über ein Jahr hin. Als er für gesund erklärt wurde, waren es nur wenige Monate, bis ich in den Kindergarten kam.»
«Was ist mit Ihrem Onkel?», fragte Bachmann.
«Er blieb in Indien und kehrte zurück, als meine Cousine und mein Cousin eingeschult wurden.»
«Hatten Ihre Eltern viele Kontakte in Indien?»
«Natürlich hatten sie das. Von der Arbeit, mit Nachbarn und mit anderen Expatfamilien. Die Kontakte zu den Einheimischen beschränkten sich eher auf die Arbeit. Nachdem sie zurückgekehrt waren, standen sie weiterhin in Kontakt, der allerdings nach und nach weniger wurde. Irgendwann gab es nur noch sporadisch eine Karte zu Diwali, dem indischen Neujahr.»
Erneut wunderte Samantha sich, wozu das alles wichtig sein sollte. Bachmanns Stift huschte über die Seiten des Notizbuches. Als er den Kopf hob, begegneten sich ihre Augen. Seine Miene war nichtssagend, aber er schien in ihrer zu forschen.
«Das heisst, heute hatten sie keinen Kontakt mehr?», hakte Bachmann nach.
«Soviel ich weiss, nicht.»
Bachmann klappte sein Buch zu. «Würden Sie mit uns zum Haus Ihrer Eltern fahren und schauen, ob nichts fehlt?»
Samantha konnte nichts sagen und ihn nur anstarren.
«Ich weiss, was ich von Ihnen verlange. Dennoch möchte ich sichergehen, dass nichts fehlt. Ich kann es nicht beurteilen, Sie schon.»
***
Samantha hatte die Hände zu Fäusten geballt. Die Fingernägel gruben sich schmerzhaft in die Haut ihrer Handinnenflächen. Starr stand sie neben Bachmann im Gang im Haus ihrer Eltern. Es war ruhig.
«Wo haben Ihre Eltern Wertgegenstände aufbewahrt?»
«Sie besassen nichts, das einen grossen Wert hat», wiederholte Samantha ihre Aussage von vorhin. Ihre Stimme klang unnatürlich schrill. Warum stellte er diese Frage nochmals?
«Schauen Sie bitte nach.» Bachmann dirigierte Samantha zum Wohnzimmer. Sie vermied es, auf die Stelle zu schauen, an der ihr Vater gelegen hatte. Aus den Augenwinkeln erkannte sie eine Linie am Boden – die Markierung, wo der Körper sich befunden hatte. Rasch wandte sie sich ab und öffnete einzelne Schubladen. Die Portemonnaies lagen darin. In ihnen befanden sich neben Münzen und einer Fünfzigernote die Postcheck- und die Kreditkarte ihres Vaters. In dem Glasschrank, in dem einzelne Mitbringsel von den wenigen Reisen, die sie gemacht hatten, standen, schien nichts zu fehlen. Samanthas Blick fiel auf die Ganesh-Figur. Der vergoldete indische Elefantengott war das Wertvollste, das sich in den Wohnzimmerschränken befand. Samantha verliess das Wohnzimmer und ging gefolgt von Bachmann in den ersten Stock. An der Schlafzimmertür zögerte sie. Es schien ihr nicht richtig, mit einem Fremden diesen Raum zu betreten. Nach einigen Sekunden öffnete sie die Tür. Darum herum würde sie nicht kommen. Einen Moment blieb sie mit geschlossenen Augen stehen und atmete die Mischung des Parfüms ihrer Mutter und des Aftershaves ihres Vaters ein. Bald würde sich dieser Geruch verflüchtigt haben. Zitternd holte Samantha Luft und spürte im gleichen Augenblick eine Hand auf ihrer Schulter. Sie trat von Bachmann weg und schaute im Schrank nach. Die Kleider hingen auf den Bügeln beziehungsweise lagen ordentlich zusammengefaltet auf den Tablaren. Im Nachttisch ihrer Mutter fand sie das kleine Schmuckkästchen. Als sie es öffnete, spürte sie Bachmanns Anspannung.
«Es fehlt nichts», sagte sie heiser. «Wie gesagt, die Ohrringe und Ketten haben eher einen ideellen Wert.»
Samantha stellte das Kästchen zurück und erhob sich. Ihr Blick begegnete Bachmanns, und sie meinte, Enttäuschung darin zu erkennen. Bisher musste er davon ausgegangen sein, ihre Eltern könnten Opfer eines Raubmordes gewesen sein.
Sie gingen ins Arbeitszimmer. Samantha schaute in den Schreibtischfächern nach, ohne zu wissen, was ihr Vater genau dort aufbewahrt hatte. Ratlosigkeit machte sich breit, als sie die obere Schublade schloss. Wieder traf ihr Blick den von Bachmann.
«Es fehlt nichts», sagte sie. «Ich wiederhole es gerne. Meine Eltern hatten keine Reichtümer. Das, was sie besassen, reichte zum Leben, aber nicht zum Anhäufen von Schätzen.»
DREI
Bachmann und Landolt nahmen Samantha gegenüber am Tisch Platz. Möglichst unauffällig schaute Samantha sich um. Bisher war sie nie auf einem Polizeiposten gewesen. Es hatte sie eingeschüchtert, als Bachmann sie gestern gebeten hatte, am Montagvormittag ins Polizeikommando nach Aarau zu kommen. Bachmann schlug sein Notizbuch auf und überflog die Seiten.
«Nachdem im Haus Ihrer Eltern definitiv nichts zu fehlen scheint, möchte ich nochmals auf Freunde und Nachbarn zu sprechen kommen. Sie können sich wirklich keinen vorstellen, der ein Interesse oder einen Grund gehabt haben könnte, Ihre Eltern zu töten?»
«Nein», antwortete Samantha.
«Besteht die Möglichkeit, der Überfall könne nicht Ihren Eltern, sondern jemand anderem gegolten haben?»
«Wie meinen Sie das?»
«Ihre Eltern haben auf Sie gewartet, damit Sie gemeinsam in die Ferien fahren konnten.»
«Wollen Sie damit andeuten, jemand hat mich töten wollen?»
Bachmann neigte den Kopf auf die Seite und schwieg.
«Wieso das?», rief Samantha.
«Das frage ich Sie.»
«Wenn Sie auf meine Herkunft anspielen, kann ich nur das Gleiche sagen wie gestern. Ich werde kaum ausländerfeindlich angegangen. In der Regel sind es verbale Attacken, und die sind selten, wie ich gestern mehrfach betont habe.»
«Es gab keine Anfeindungen in der letzten Zeit?», hakte Bachmann nach.
«Nein.»
«Gab es irgendetwas in der letzten Zeit, das Ihnen seltsam erschien?»
«Was meinen Sie damit?»
«Hatten Sie zum Beispiel das Gefühl, es folge Ihnen jemand, oder gab es Anrufe, bei denen keiner antwortete, wenn Sie das Gespräch entgegengenommen haben?»
«Nein.»
«Haben Ihre Eltern etwas in dieser Richtung erwähnt?»
«Ob es bei ihnen anonyme Anrufe gab? Nein.»
«Wie ist es mit Ihrem Onkel?»
«Das müssen Sie ihn selbst fragen. Allerdings weiss ich nicht, was Valentin mit dem Tod meiner Eltern zu tun haben soll.»
«Er ist eine Person des öffentlichen Lebens. Könnte der Mordanschlag Ihrem Onkel und nicht Ihren Eltern gegolten haben?»
«Wieso sollte es das? Mein Onkel wohnt in Gränichen und meine Eltern in Brugg. Ausserdem war nur wenigen bekannt, dass Valentin der Bruder meines Vaters war.»
Die Art und Weise, wie Bachmann sie anschaute, verunsicherte Samantha. Sie wartete auf eine neue Frage, die aber ausblieb. Das Schweigen zog sich in die Länge.
«Mein Vater hat nie damit angegeben, der Bruder eines Politikers zu sein», sagte sie, als ihr die Stille zu unerträglich wurde.
«Sie glauben also an keine Verwechslung?»
Beinahe hätte Samantha aufgelacht. «Unterschiedlicher als Valentin und mein Vater können Brüder nicht sein.»
Bachmann sagte nichts, und wieder stellte sich dieses Schweigen ein, das Samantha als unangenehm empfand.
«Sie haben Valentin gesehen. Er ist gross, und kaum ist er da, drängt seine Präsenz alles andere auf die Seite. Mein Vater, der drei Jahre älter war als er, war eher unscheinbar und hasste es, in irgendeiner Form im Rampenlicht zu stehen.» Hinzu kam das Aussehen. Valentin war massig, ohne dass man ihn deshalb als dick bezeichnet hätte, und hatte volle Haare. Der Bart war gepflegt und zurechtgestutzt. Ihr Vater dagegen war mindestens zehn Zentimeter kleiner, untersetzt, und nur ein schmaler Haarkranz umgab seine Glatze. Zudem hatte er keinen Bart. «Wenn man es nicht wusste, kam man nicht auf die Idee, sie seien Brüder. Mein Vater hatte Valentin gebeten, ihn und seine Familie, also uns, so weit wie möglich aus seiner Karriere und allem, was damit verbunden ist, herauszuhalten. Dem Wunsch hat er entsprochen. Wenn beispielsweise die Medien über Valentins Privatleben berichtet haben, war von uns nie die Rede.»
«Darin muss ich Ihnen recht geben. Bis gestern habe ich nicht gewusst, dass Nationalrat Kälin einen Bruder hat. Haben Sie lange in Brugg gelebt?»
Der abrupte Themenwechsel überraschte Samantha, und sie brauchte einige Sekunden, bis sie sich darauf eingestellt hatte. «Ich bin in Brugg aufgewachsen.»
«Das heisst, Sie leben seit Ihrer Kindheit im Aargau?»
«Nein. Nach der Matura habe ich während eines Zwischenjahres gejobbt, um zusätzlich Geld für das Studium zu verdienen. In dieser Zeit habe ich bei meinen Eltern in Brugg gewohnt. Als ich mit der Ausbildung anfing, bin ich ausgezogen und habe in Zürich Biologie mit Schwerpunkt Biochemie studiert. Nach dem Ende des Studiums ging ich in die Westschweiz. Vor einem halben Jahr bin ich in den Aargau zurückgekehrt.»
«Von wo?»
«Ich habe in der Nähe von Lausanne bei einem Pharmakonzern gearbeitet. Die Stelle war auf zwei Jahre beschränkt. Im Rahmen dieses zweijährigen Projektes habe ich an der Entwicklung neuer Medikamente bei der Herstellung mitgearbeitet.»
«Warum sind Sie ausgerechnet nach Lausanne gegangen?»
«Es hat sich so ergeben. Ausserdem habe ich die Gelegenheit genutzt, um mein Französisch aufzupolieren.»
«Wieso wurde Ihr Vertrag nach den zwei Jahren nicht verlängert?», fragte Bachmann.
«Ich hätte länger bleiben können, aber ich wollte zurück in die Deutschschweiz. So kam ich zu AarePharm.»
«Warum sind Sie nicht nach Egerkingen oder nach Brugg gezogen?»
«Ich fand in Lenzburg die passendere Wohnung, und mit dem Auto sind es nur fünfundzwanzig Minuten zu AarePharm. Von Brugg her hätte ich den längeren Arbeitsweg. Daher habe ich Lenzburg bevorzugt.»
«War die berufliche Entscheidung rückblickend die richtige?»
Erneut wunderte Samantha sich, wozu das alles wichtig sein sollte. «Bisher ja.»
«Zurück zu Ihren Eltern.»
Samantha begann sich zu fragen, ob das Hin- und Herspringen zwischen den einzelnen Themen zu der Befragungstaktik gehörte und was Bachmann damit bezwecken wollte.
«Ist Ihnen an Ihren Eltern in der letzten Zeit etwas aufgefallen?», fragte Bachmann.
«Wie meinen Sie das?»
«Haben sie sich verändert? Wirkten sie beispielsweise nervöser als sonst, oder waren sie aufbrausend? Hatten Sie das Gefühl, Ihre Eltern würden Ihnen etwas verheimlichen?»
«Nein. Sie waren wie immer.»
Bachmann und Landolt wechselten einen Blick.
«Unser Rechtsmediziner meint, Ihre Eltern seien nicht lange tot gewesen, als Sie sie fanden», sagte Landolt.
«Was heisst das?» Samantha bekam einen schalen Geschmack im Mund.
«Eine halbe Stunde oder weniger», sagte Bachmann.
«Das heisst, ich bin beinahe dem Täter begegnet?», rief Samantha. Sie verschränkte die Finger ineinander, als ihre Hände zu zittern anfingen.
Bachmann antwortete nicht, sondern schaute ihr einfach in die Augen. Ein neues, langes, unangenehmes Schweigen stellte sich ein, das Samantha dieses Mal nicht brach. Ihre Gedanken machten sich selbstständig. War der Täter noch im Haus gewesen, als sie eingetroffen war? Hatte er sich versteckt? Eine neue Möglichkeit nahm Gestalt an. Hielten die beiden es für möglich, sie könnte die Tat begangen haben?
Bachmanns Blick war nach wie vor auf sie gerichtet. Sein Gesicht war nichtssagend, aber er beobachtete genau ihre Reaktion. Er musste merken, wie sich ihr Herzschlag beschleunigte und sich Schweiss auf der Stirn sammelte. «Sind Sie Rechts- oder Linkshänderin?»
«Linkshänderin», krächzte Samantha.
Ein neuer Blickwechsel der beiden Männer. Sie nickten einander zu.
«Darf ich Sie bitten, uns noch einmal detailliert zu schildern, wie Sie bei Ihren Eltern vorfuhren und anschliessend das Haus betreten haben?»
Samantha benötigte einige Sekunden, bis sie mit der Wiederholung ihres Berichtes beginnen konnte. Die Befragung zermürbte sie mehr und mehr. Das ist das, was sie erreichen wollen, dachte sie. Bleib ruhig. Du hast nichts getan.
Samantha konzentrierte sich auf ihren Bericht und bemühte sich, nichts auszulassen und jede kleine Abweichung zu vermeiden. Sie holte aus und begann beim Apéro, beschrieb den Weg, den sie genommen hatte. Sie war an dem Tag nicht über die Autobahn gefahren, weil es wieder einmal Stau gehabt hatte, und war stattdessen über Wildegg und Holderbank nach Brugg gefahren. Samantha berichtete, wie sie beim Haus ihrer Eltern angekommen war. Sie schilderte, wie sie ausgestiegen war und das Haus betreten hatte.
Die beiden Beamten nickten einander ein weiteres Mal zu, nachdem sie geendet hatte. Als Bachmann sie anschaute, meinte sie, ein leichtes Lächeln in seinem Gesicht zu erkennen. Es wirkte freundlich. Erleichterung machte sich breit. Dennoch war sie weiterhin auf der Hut.
Sie wusste nicht, wie sie es durchstehen sollte, falls die Beamten sie als Tatverdächtige ins Auge fassten. Ihr Herzschlag beschleunigte sich von Neuem, als ihr bewusst wurde, dass dieser Verdacht in den Augen der Polizisten durchaus Sinn machte. Nach wie vor herrschte Schweigen, das Samantha so schnell wie möglich loswerden wollte.
«Wollen Sie sagen, wenn ich früher nach Hause gekommen wäre, hätte ich den Täter überrascht?» Oder ihre Eltern würden noch leben, oder Samantha wäre wie sie tot? Schuldgefühle und Angst wechselten sich ab und drohten sie zu ersticken. Warum hatte sie sich überreden lassen, bei dieser Hochzeit Spalier zu stehen? Wären sie bereits nach dem Mittag abgefahren, würden sie noch leben. In diesem Punkt war sich Samantha sicher.
***
«Was sollen diese ganzen Fragen?», ereiferte sich Valentin. «Ich habe das Gefühl, sie stochern im Nebel und kommen keinen Schritt weiter. Stattdessen müssen wir die ganze Zeit unsere Aussage wiederholen. Sie sollten aufhören, ihre Zeit zu verplempern, und endlich den Mörder finden.»
Als sie am Vormittag im Polizeikommando gewesen war, hatte Samantha nach den neuen Befragungen ihre Aussage unterschrieben. Auf ihre Frage, wann sie ihre Eltern beerdigen dürfe, hatte Bachmann ihr erklärt, zuerst müsse die Obduktion fertig sein. Wie es aussah, war ihre Mutter durch einen Schlag mit der Weinflasche auf den Hinterkopf gestorben. Die Flasche musste der Täter in der Küche gefunden haben, denn dort hatte eine weitere mit der gleichen Etikette gestanden. Vermutlich hatten sie den Wein in die Ferien mitnehmen wollen.