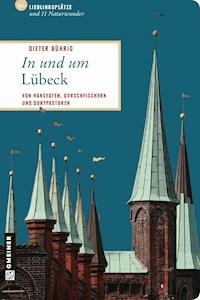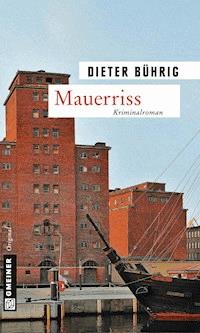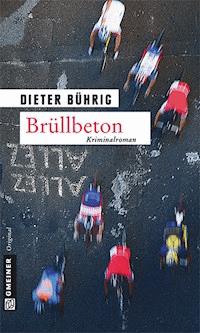Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2010 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 07575/2095-0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2010
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/Korrekturen: Daniela Hönig / Doreen Fröhlich, Katja Ernst
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung des Fotos »Die Gasse« von: © Kay Horn / fotolia.de
ISBN 978-3-8392-3538-6
Vorwort
Und das alles geschah vor nicht allzu langer Zeit in Lübeck.
Sie kennen Lübeck nicht, die alte Hansestadt Lübeck? – Dabei liegt sie doch ganz in Ihrer Nähe. Mitunter spielen sich dort schon recht merkwürdige Geschichten ab – und von einer möchte ich Ihnen erzählen. Sie ist so fantastisch, dass sogar manche Lübecker an ihrer Echtheit zweifeln.
Aber davon später. Vorher lade ich Sie zu einem kleinen Rundgang durch die Handlungsorte meiner Geschichte ein. Am besten, Sie setzen sich gleich in Ihr Auto und geben ›Lübeck‹ in Ihr Navigationsgerät ein. Eine freundliche, ausgeglichene Automatenstimme weist Ihnen, ohne auf Ihre Widerrede zu achten, sogleich den richtigen Weg. Während Sie den Anweisungen folgen, können Sie und Ihre Begleitung entspannt den Blick über die Umgebung schweifen lassen.
Denn der Weg nach Lübeck führt in der Tat durch eine wunderschöne Landschaft. Sie kommen durch gepflegte Dörfer mit Reetdachkaten, die von fruchtbaren Wiesen und goldgelben Rapsfeldern umgeben sind. Hin und wieder lädt ein gemütliches und kaum teures Gasthaus den Reisenden aus der Ferne zu ›Sauerfleisch mit Bratkartoffeln‹ ein, einem regionaltypischen Mittagessen. Ein paar alte Wehrkirchen mit Fundamenten aus Findlingen, schmiedeeiserne Wegekreuze und holzgeschnitzte Gedenktafeln erinnern an ferne Tage. Überhaupt ist hier alles sehr friedlich und überschaubar, so, als wäre die Zeit stehen geblieben.
Bald haben Sie das Meer erreicht. Viel ist da um diese Jahreszeit nicht zu sehen. Die wegen der gefürchteten Sturmfluten hochgezogenen Deiche geben nur selten den Blick auf ein paar gelangweilt schlendernde Spaziergänger frei. Hin und wieder taucht einer der leeren Strandkörbe im Sichtfeld auf. Die wenigen Segelboote am Horizont scheinen ihren Weg zum Heimathafen zu suchen. Genau wie Sie Ihren nur noch kurzen Weg nach Lübeck.
Gleich hinter Neustadt, wenn Sie von Norden kommen, nur wenige Kilometer unterhalb der Meeresküste, tauchen das erste Mal die Kirchturmspitzen von Lübeck auf. Von Weitem sieht die Stadt noch immer so mittelalterlich aus wie vor Hunderten von Jahren, als man sie das Kronjuwel der über die Ost- und Nordsee herrschenden Kaufmannshanse nannte.
Nicht alle Lübecker wissen, woher der Name ihrer Heimatstadt stammt. Viele glauben, er leite sich von dem ›Lübecker Marzipan‹ ab, dabei verhält es sich natürlich umgekehrt. Aber das Marzipan ist nun einmal weltweit bekannter als die Stadt selbst. Andere meinen, ›Lübeck‹ gehe aus der Bezeichnung ›lütte Bäke‹, also ›kleiner Bach‹, hervor. Auch das stimmt nicht, obwohl die Trave, die Lübeck früher von fast allen Seiten umspülte, kein wirklich großer Fluss ist. Das dem Namen zugrunde liegende Wort ›Liubice‹ kommt vielmehr aus dem Slawischen und bedeutet – je nach Auslegung – ›Siedlung der L’ub‹ oder ›die Liebliche‹.
Eine kleine Gruppe von Lehrern des Katharineums, der altsprachlichen Oberschule, von der in meiner Geschichte noch die Rede sein wird, findet ihre Stadt nicht besonders lieblich. Vor Kurzem, während einer ihrer Stammtischrunden in der benachbarten Kneipe ›Buthmanns‹, beschloss sie, Lübeck in Anlehnung an das griechische Wort ›chronos‹, die Zeit, umzutaufen in ›Chronaborg‹: Hort der Zeit – Stadt, in der die Zeit stehen geblieben ist.
Ausgangspunkt ihrer Überlegung war die Tatsache, dass die berühmte große Astronomische Uhr, die die Marienkirche am Marktplatz ziert, nicht zwischen Sommer- und Winterzeit unterscheiden kann. Aber das diente ihnen nur als Vorwand. In Wahrheit hatten sie es satt, sich ständig über eine Kulturpolitik aufzuregen, der es ihrer Meinung nach völlig an Aufgeschlossenheit gegenüber dem zeitgemäßen Wandel fehlte. Für sie handelte der Senat der Stadt nach dem Prinzip: Meide alles, was neu und was fremd ist.
Ein entsprechender Antrag in der Bürgerschaft sorgte für heftige Aufregung. Dazu muss man wissen, dass die alteingesessenen Hanseaten in jeder Beziehung äußerst konservativ mit ihrer Zeit umgehen. Und daher verwundert es nicht, dass der Antrag der Studienräte nach längerer heftiger Debatte abgelehnt wurde.
In ihrer Blütezeit war die Stadt von einem riesigen Ringwall umgeben, der zum Schutze vor Eindringlingen außerdem noch mit einem raffinierten Wassergrabensystem verbunden wurde. Inzwischen hat der Wall seine militärische Funktion eingebüßt und wurde größtenteils geschliffen, um friedlichen Parkanlagen und heiß umkämpften Parkplätzen zu weichen. Die Stadtväter meinten auf diese Weise, ›mit der Zeit zu gehen‹.
Viele Touristen besuchen die Stadt eigentlich nur wegen des weithin bekannten Marzipans oder um die Wirkungsstätten einiger berühmter Dichter zu bewundern. Dabei wurde das Marzipan hier gar nicht erfunden, und mit den Dichtern stand die Stadt zu deren Lebzeiten nicht immer auf bestem Fuß. Nun, in Lübeck schmückt man sich gelegentlich gern mit fremden Federn. Dabei ist die Altstadt als solche schon einen Besuch wert – auch wenn der Neuzeitmensch in seinem Zerstörungswahn mit Kriegsbomben so manche Lücke in das historische Erbe riss.
Aber das Lückenreißen kann er auch ganz gut in Friedenszeiten. Fast alle alten Stadttore fielen den angeblichen Bedürfnissen des modernen Verkehrslebens zum Opfer. Nur einem Zufall ist es zu verdanken, dass das Holstentor, heute eindrucksvolles Wahrzeichen der Stadt, nicht mit eingerissen wurde.
Das alles wäre nicht notwendig gewesen. Heute ist der Verkehr längst wieder aus der Innenstadt verbannt, um einer bis in die Nacht shoppenden Menschenmenge Platz zu machen. Die Stadtplaner setzen auf Fußgängerzonen – globalisierte Flaniermeilen, die sich mit ihren Modeboutiquen, Fast-Food-Ketten und Medienmärkten in nichts von den Hauptstraßen anderer gesichtsloser Großstädte unterscheiden.
Wo beispielsweise früher ein traditionsreiches Musikalienhaus das kulturelle Leben der Stadt befruchtete, haust jetzt ein Billigmodeladen, aus dem monoton hämmernde Popmusik dröhnt. Wohl in der Absicht, unter den Kunden gleich von vornherein die Spreu vom Weizen zu trennen. Lübeck kann eben international mithalten.
Sie sind also herzlich in unserer Stadt willkommen. Wenn Sie von der Westseite anreisen, werden Ihnen die prachtvollen Barockfassaden mit den schwungvoll gestalteten Giebelvoluten auffallen. Durch die mit verzweigten Ornamenten geschmückten Haustüren schritten einst die vornehmen Kaufleute, durch deren Handel die Stadt aufblühte.
Einige der schönsten dieser Häuser dienen heute als Kitsch-Andenkenläden und der touristischen Gastronomie. Italienisch, griechisch, türkisch – nicht gerade hanseatisch. Wie gesagt, ganz international.
Kommen Sie jedoch von der Ostseite, bietet sich Ihnen ein anderes Bild. Zunächst passieren Sie enge, kopfsteingepflasterte Gassen, in denen es gelegentlich nach feuchter Wäsche und Kohleintopf riecht und in denen Kinder unbesorgt Fußball kicken, ohne sich um die fahlen Scheiben der butzigen Kleinkrämerläden oder die Häuflein von Hundekot, die ab und an den Rinnstein säumen, zu kümmern.
Wechseln Sie in einem solchen Fall besser die Straßenseite. Von dort aus können Sie die gotischen Backsteintreppengiebel mit den fensterlosen Blenden bewundern, die sich die Handwerker und Krämer teuer ausbauen ließen. Dadurch erschien ihr Haus größer und wichtiger. Hinter der leeren Fassade versteckt sich allenfalls ein steiles, unbewohnbares Dachgeschoss. Auch in diesen Vierteln lebt man seit jeher nach dem Motto: ›Der äußere Schein ist alles‹.
Auf der Spitze des kleinen Hügels, den die Altstadt von Natur aus bildet, steht das ehrwürdige Rathaus mit dem berühmten Ratsweinkeller, in dem schon viel Geschichte und so manche Geschichten geschrieben wurden. Unübersehbar riesige Wappen an der Fassade zeugen von der seefahrerischen Tradition der Stadt. Auch die mittelalterlichen Ratsherren liebten den Schein: Zum Markt hin ließen sie eine hochragende Wand bauen, um die markttreibenden Bürger mit ihrem Reichtum und ihrer Macht zu beeindrucken. Damit die Scheinfassade schweren Stürmen trotzen konnte, wurden Windlöcher in den gotischen Backsteinbau eingefügt.
Eine, in niederländischer Renaissance gehaltene Prachttreppe, führt auf die Hauptstraße, als wolle Lübeck beweisen, es sei weltoffen und wohlhabend. Aber auch dieser Schein trügt in beiderlei Hinsicht. Vielleicht war das früher einmal so. Heute kommen die Ratsherren nur noch selten vor die Tore ihrer Stadt. Das brauchen sie auch nicht, denn die wichtigen Probleme werden gern im Ratsweinkeller bei einem Krug selbst gebrautem Braunbier gelöst.
Und von Wohlhabenheit kann man heute nicht mehr sprechen. Lübeck ist eine der am meisten verschuldeten Städte im Land. Da helfen auch nicht die reichlich fließenden Einnahmen durch die Touristen. – Wo wohl das viele Geld bleibt?
Gegenüber dem Rathaus steht die Marienkirche. Sie ist nicht nur das geistliche Zentrum der Stadt, sondern auch das kulturelle. In Trost spendender Regelmäßigkeit wird hier zu Ostern die Matthäuspassion, am Totensonntag die h-Moll-Messe und zur Weihnachtszeit passend das gleichnamige Oratorium aufgeführt. Und am Abend des Jahreswechsels strömt ganz Lübeck in die Kirche, um sich den Messias anzuhören. Viele Zuhörer singen selbst mit.
Nur ein paar kulturell interessierte Bürger beklagen, dass sich das Musikleben der Stadt wenig weiterentwickelt. Neuere Klänge hört man lediglich aus den engen Fenstern der Übungsräume der nahe gelegenen Musikhochschule herausschallen.
Bevor wir diese erreichen, machen wir noch einen kleinen Abstecher zum Stadttheater und zur Oberschule. Das Theater ist in einem ehemaligen Handelsherrenpalast untergebracht. Es diente zunächst mehr oder weniger als Tummelplatz für durchreisende Theatergruppen. Als aber im Jahre 1794 die ›Zauberflöte‹ auf den Spielplan gesetzt wurde, waren auch die vornehmeren Bürger von Lübeck gewonnen – auch wenn sie nur wenig von dem verwirrenden Märchen verstanden. Spötter behaupten, die ›Zauberflöte‹ erklinge dort noch heute 365 Mal im Jahr.
Gleich in der Nähe befindet sich ein Theater anderer Art: die Oberschule. Ein achtlos Vorübergehender wird in den alten Gemäuern zunächst ein Kloster vermuten. Was auch gar nicht so abwegig ist, da das Gebäude vor der Säkularisation im 16. Jahrhundert schweigenden Mönchen als Katharinenkloster der inneren Einkehr diente.
Zwar sind die alten Sprachen, die Naturwissenschaften und die Musik Schwerpunkte des Instituts, wichtiger für unsere Geschichte sind jedoch die hartnäckigen Gerüchte, nach denen geheime unterirdische Gänge, von den ehemaligen Klostergemäuern aus, sowohl westwärts zum Stadttheater als auch südwärts zu den Bürgerhäusern rund um die Musikhochschule bis hin zu den Kanälen am Stadtwall führen sollen. – Aber das basiert wahrscheinlich nur auf den üblichen Schülerfantastereien.
Doch schreiten wir weiter. Der nächste Tempel der schönsten Muse der Stadt, die Musikhochschule, liegt, der allgemeinen Hierarchie folgend, weiter südlicher, etwas mehr den Hang hinab. Für einen Fremden ist er leicht zu übersehen, vermittelt er auf den ersten Blick nicht unbedingt den Eindruck einer akademischen Einrichtung.
Im Gegenteil. Die Musikhochschule besteht aus einer Anhäufung von alten Bürgerhäusern, die sich um ein paar enge Gassen gruppieren. Da das Gelände in Richtung Stadtgraben abfällt, scheint es, als müssten sich die rötlichen Backsteinhäuser gegenseitig stützen, wie es die Rentnerehepaare tun, wenn sie einander untergehakt gemächlich durch die Wallanlagen spazieren.
Beim Ausbau des Konzertsaals der Hochschule fand ein Baggerführer einen mittelalterlichen Geldschatz mit Münzen aus den Jahren um 1533. Jemand hatte ihn aus mysteriösen Gründen unter den Fußbodendielen eines Altstadthauses vergraben. Den Gegenwert schätzte man auf den eines ausgewachsenen Privathauses. Kein schlechter Fund also. Der Bauarbeiter erhielt einen sechsstelligen Finderlohn, der Schatz wurde später dem Land zugeschrieben. Man munkelt, dass irgendwo dort ein weiterer Goldschatz in einer Holzkiste zu entdecken sei.
Nicht weit vom Haupteingang der Musikhochschule befindet sich ein Marionettenmuseum. Skurrile Puppen, Ritterrüstungen und Holzmarionetten werben im Eingang und im Schaufenster des hübschen und gepflegten Altstadthauses um Besucher. Eine wirklich sehenswerte Sammlung.
Unter den Lübeckern gibt es allerdings zu wenig Träumer, als dass das kleine Museum ein Publikumsmagnet wäre. Manchmal kommen ein paar Kinder, die versuchen, sich an dem hohen Fenstersims heraufzuziehen, um einen Blick in die geheimnisvolle Welt der mechanischen Fabelwesen werfen zu können. Für einen echten Hanseaten ist das Museum zu kindisch. Der weiß seine Zeit besser zu nutzen, als Spielzeug anzuschauen.
Nur ein paar Touristen, die von dem Zeitgefühl der Lübecker nichts ahnen, lassen sich gelegentlich von den technischen Wunderwerken anlocken. Gern bestaunen sie die mechanische Präzisionsarbeit und manche von ihnen, die es mit der elterlichen Pädagogik ein wenig übertreiben, rauben anschließend ihren Töchtern und Söhnen jegliche Fantasie, indem sie ihnen jedes Rädchen, jedes Gelenk, jeden Hebel und jedes Gewinde physikalisch genauestens erklären.
*
Auf der Rückseite dieses Hauses, in der Parallelstraße, stoßen Sie auf die merkwürdigste Erscheinung im Stadtbild von Lübeck. An der hinteren Brandmauer des Marionettenmuseums klebt eine bizarre, bis auf einige Mauerreste ausgebrannte Ruine, die eine Tragödie erahnen lässt. Zwischen den verrotteten Ziegeln und verkohlten Holzbalken versteckt sich ein Gewirr unbestimmbarer Zahnräder, Stahlfedern, Eisengerüste, Kabel und Metallbehälter. Trotzdem deuten die Trümmerreste darauf hin, dass hier einmal ein hochherrschaftliches Haus gestanden haben muss. Am verfallenen ehemaligen Eingangsportal erkennt man unter einer festen Ruß- und Dreckschicht noch ein paar Schriftzüge: ›Adrian Ampoinimera, Goldschmied und Uhrmacher‹.
Eigentlich passt die Ruine überhaupt nicht in das Stadtbild. Doch eigenartigerweise ist dieser Schandfleck bis heute nicht beseitigt worden. Die offiziellen Stadtführer schweigen dazu. Es wird Ihnen schwerfallen, Näheres über die Ruine und die Brandursache zu erfahren. Weder das Internet noch Ihr Navigationsgerät geben Auskunft.
Eine menschliche Tragödie, ein bedauernswerter Unfall, ein abstoßendes Kriminaldelikt? Oder lastet ein alter Fluch auf dem Gelände? Die Bewohner meiden den Ort. Die Leute haben eine alte Sage nicht vergessen. Ich möchte sie Ihnen nicht vorenthalten, bevor ich zu meiner eigentlichen Erzählung komme, der Geschichte dieser Ruine.
Und da Sie, lieber Leser, sicherlich wissen, dass Raum und Zeit nie getrennt voneinander existieren können, ist es auch eine Geschichte über die Zeit, eine Geschichte über Vergangenes und über Vergängliches. Die Vergangenheit ist physikalisch gesehen nichts als der negative Teil der Zeitachse. Die Vergänglichkeit jedoch, das ist der Schatten, den die Zeit schon heute auf unsere Lebenswelt wirft.
*
Im Jahr 1493 starb auf dem Anwesen, auf dem jetzt die Brandruine steht, ein reicher und vornehmer Kaufmann, der wegen seines Geizes und seiner gotteslästerlichen Ansichten gefürchtet war. Er hatte sein Leben damit verbracht, religiösen Silberschmuck, vergoldete Reliquien, heilige Amulette und wertvolle Perlenketten aus aller Welt zu sammeln. Da er seinen Schatz liebte und niemand ihn erben sollte, verfügte er, dass alles zusammen mit ihm begraben wird. Erst nach 50 Jahren durfte das Grab geöffnet werden, und der Reichtum sollte dem Katharinenkloster gestiftet werden.
Seine letzten Worte waren: »Hole euch alle der Teufel!«
Als die Frist vergangen war, konnten es die Mönche kaum abwarten und öffneten den Sarg. Und siehe da: Der Schatz war verschwunden, der Leichnam lag jedoch frisch und unverwest darin, als ob die Reliquien seinen Körper am Leben gehalten hätten.
Die Mönche, um ihren Gewinn gebracht, beschlossen, den Toten öffentlich auszustellen und gegen einen nicht unbeträchtlichen Obolus besichtigen zu lassen. Wer das Rätsel der Unvergänglichkeit löse, dem wollten sie täglich eine kostenfreie Messe lesen.
Eines Tages kam ein Fremder, stieg in dem besagten Haus ab, das inzwischen eine Gastwirtschaft beherbergte, und wollte das Wunder sehen. Der Klostervorsteher beauftragte die Hausmagd, den Leichnam aus dem Keller des Klosters zu holen und ihn auf den Schanktisch zu legen.
Die gute Frau zierte sich sehr und ging erst, als der Fremde ihr einen Beutel Dukaten anbot. Sie holte den unverwesten Körper und legte ihn wie befohlen auf den Tisch.
»Da lieg in Gott!«
Kaum hatte sie das ausgesprochen, erhob sich der Tote und sprach: »Ich danke dir. Jetzt bitte den lieben Gott auch noch, dass ich verwesen möge!«
Zweimal bat er die Magd. Jedes Mal antwortete eine ferne Stimme, die vom Dachboden herzukommen schien: »Nein, Gotteslästerer, nein!«
Erst beim dritten Mal erschütterte ein lautes Krachen das Haus und man hörte die geheimnisvolle Stimme rufen: »Wohlan, um der guten Magd willen sei er verwest.«
Ein scharfer Windstoß durchfuhr die Schenke. Dann war der Leichnam verschwunden.
Als die Mönche am nächsten Tag die Gruft aufräumen wollten, fanden sie die Körperreste des Leichnams darin. Er war über Nacht zu Staub und Asche geworden.
Die Ordensbrüder betteten ihn zur letzten Ruhe und ließen sich von dem Fremden einen gehörigen Batzen ausbezahlen.
Die Magd lebte von ihren Dukaten glücklich bis an das Ende ihrer Tage und bekam dazu noch jeden Tag eine Messe für ihr Seelenheil gelesen.
Der heilige Schatz – im Volksmund zu Unrecht ›Wikingerschatz‹ genannt – jedoch blieb für immer verschwunden.