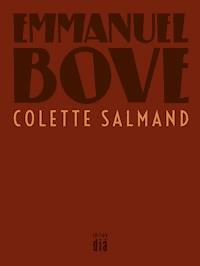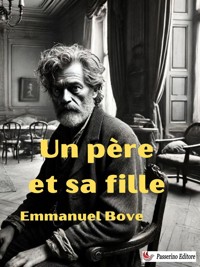Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition diá
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Werkausgabe Emmanuel Bove
- Sprache: Deutsch
Sie sind ein junges, gewiss auch seltsames Paar, Pierre Changarnier und seine Freundin Violette. Changarnier lebt in einem schäbigen Hotelzimmer und ist arm, doch weiß er auch, dass in seinen vier Wänden nichts passieren wird, was seine Situation verändern könnte. Also macht er sich zusammen mit Violette auf, "dem Glück entgegenzugehen, da es nun mal nicht zu uns kommt". Ihr Streifzug durchs nächtliche verschneite Paris verläuft aber anders als gedacht. Als sich ein kleiner Mann an ihre Fersen heftet und Changarnier ihn nicht abschütteln kann, kommt es zu einem Gewaltausbruch. Der Mann fällt zu Boden, und Changarnier glaubt, ihn umgebracht zu haben … Die neun bisher unbekannten Erzählungen schildern dagegen den braven Irrsinn der Normalbürger in Friedens- und Kriegszeiten. Aber ob es um die noch einzutreibenden Schulden eines Toten, peinlich gewordene Eltern oder einen zudringlichen Witwentröster geht – auch diese erstmals übersetzten Geschichten sind Bove in kühl-ironischer Bestform. Zum Weiterlesen: "Emmanuel Bove. Eine Biographie" von Raymond Cousse und Jean-Luc Bitton ISBN 9783860347096
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 161
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch
Sie sind ein junges, gewiss auch seltsames Paar, Pierre Changarnier und seine Freundin Violette. Changarnier lebt in einem schäbigen Hotelzimmer und ist arm, doch weiß er auch, dass in seinen vier Wänden nichts passieren wird, was seine Situation verändern könnte. Also macht er sich zusammen mit Violette auf, »dem Glück entgegenzugehen, da es nun mal nicht zu uns kommt«. Ihr Streifzug durchs nächtliche verschneite Paris verläuft aber anders als gedacht. Als sich ein kleiner Mann an ihre Fersen heftet und Changarnier ihn nicht abschütteln kann, kommt es zu einem Gewaltausbruch. Der Mann fällt zu Boden, und Changarnier glaubt, ihn umgebracht zu haben …
Die neun bisher unbekannten Erzählungen schildern dagegen den braven Irrsinn der Normalbürger in Friedens- und Kriegszeiten. Aber ob es um die noch einzutreibenden Schulden eines Toten, peinlich gewordene Eltern oder einen zudringlichen Witwentröster geht – auch diese erstmals übersetzten Geschichten sind Bove in kühl-ironischer Bestform.
»Gewohnt souverän hat Laux auch diesen Bove verdeutscht. ›Schuld‹ ist fast ein Bove-Konzentrat, geeignet für Bove-Anfänger, obligatorisch für Bove-Liebhaber.« (Steffen Richter in Neue Zürcher Zeitung vom 26. August 2010)
Mehr zum Autor und seinem Werk unter www.emmanuelbove.de
Der Autor
1898 als Sohn eines russischen Lebemanns und eines Luxemburger Dienstmädchens in Paris geboren, schlug sich Emmanuel Bove mit verschiedenen Arbeiten durch, bevor er als Journalist und Schriftsteller sein Auskommen fand. Mit seinem Erstling »Meine Freunde« hatte er einen überwältigenden Erfolg, dem innerhalb von zwei Jahrzehnten 23 Romane und über 30 Erzählungen folgten.
Nach seinem Tod 1945 gerieten der Autor und sein gewaltiges Œuvre in Vergessenheit, bis er in den siebziger Jahren in Frankreich und in den achtziger Jahren durch Peter Handke für den deutschsprachigen Raum wiederentdeckt wurde. Heute gilt Emmanuel Bove als Klassiker der Moderne.
Der Übersetzer
Thomas Laux ist Literaturkritiker und Übersetzer aus dem Französischen. Er lebt in Düsseldorf.
Schuld und Gewissensbiss
Ein Roman und neun Erzählungen
Aus dem Französischenund mit einem Nachwortvon Thomas Laux
Edition diá
Inhalt
Schuld
Erzählungen:
Der Retter
Eine diskrete Untersuchung
Ein Verwirrter
Die dreitausend Franc
Der Gewissensbiss
Eine offene Rechnung
Bomben auf die Verrückten
Das Testament
Fehlstart
Nachwort
Impressum
Schuld
Changarnier setzte sich in den einzigen Sessel seines elenden Zimmers. Seit dem Vortag schneite es, und die Schneeflocken setzten sich auf die Fensterscheiben wie Insekten auf eine Wand.
Changarnier blickte auf seine abgenutzten Schuhe. »Ich werde nasse Füße bekommen, wenn ich auf die Straße gehe«, dachte er, »aber wenn ich hierbleibe, was soll ich dann machen?« Er stand auf, zündete sich eine Zigarette an. Er hatte keinen Durst und wollte dennoch trinken. Er hatte keinen Hunger und wollte dennoch essen. Er warf die Zigarette fort, denn er hatte keine Lust zu rauchen. In der kalten Luft seines geschlossenen Zimmers machte sich ein abgestandener Geruch breit. »Ich bin ja schließlich keine Null«, murmelte er. Er ging zu einem Spiegel. »Du! Eine Null!« Unerwartet schroff, so als hätte er unhöflich sein wollen, wandte er seinem Spiegelbild den Rücken zu und zögerte dann ein paar Sekunden lang. Er wusste nicht, was er tun sollte. Sich wieder hinsetzen? Er hob die fortgeworfene Zigarette auf, zündete sie erneut an. »Wo bin ich?«, fragte er sich, lächelnd. Schließlich ließ er sich in den Sessel fallen.
Ein paar Minuten döste er vor sich hin, als jemand an die Tür klopfte.
»Was gibt’s denn?«, fragte er wie mechanisch.
»Ich bin’s«, antwortete eine Frauenstimme.
Er ging die Tür öffnen und stand einer kränklich wirkenden jungen Frau gegenüber, die sich ihres heruntergekommenen Zustands anscheinend noch nicht klar geworden war. Abermals zündete Changarnier seine Zigarette an und musterte die soeben Gekommene mit spöttischem Blick.
»Schämst du dich eigentlich nicht, so heruntergekommen zu sein?«, fragte er. »Schämst du dich nicht, bei allen Leuten, die dich kennen, Mitleid zu erregen? Besitzt du denn kein bisschen Würde? Lebst du denn wie ein Tier? Wenn ein Mann dir etwas zu trinken spendieren würde, würdest du mitgehen. Er könnte dich in ein Dreckszimmer wie dieses hier führen und du würdest ihm immer noch folgen. Du willst von ihm nichts im Voraus, aber dann, hinterher, versuchst du, diesem satten Glückspilz ein paar Scheine aus der Tasche zu ziehen. Und trotzdem lebst du, und du hast den perfekten Körper eines Menschen, fünf Finger an jeder Hand, fünf Zehen an jedem Fuß. Du armseliges Ding! Begreifst du nicht, dass es auf dieser Welt noch etwas anderes gibt als diese Erbärmlichkeit, in der du vegetierst? Begreifst du nicht, dass es ein höheres Sein gibt?«
Die gerade erst Eingetroffene hörte dieser Tirade unbeeindruckt und ohne zu unterbrechen zu. Sie trug einen gefärbten, billigen Kaninchenmantel, an dem die Knopflöcher eingerissen waren. Ihr Kopf war von einer Mütze bedeckt. Diese schlichte Aufmachung gab dieser mit Sarkasmus überschütteten Frau eine noch dramatischere Note. Changarnier indes schien für dieses Drama unempfänglich zu sein, er folgte einer fixen Idee. Sein Elend, seine Untätigkeit, sein Desinteresse an allem machten ihn unempfindlich für das Leiden anderer.
»Du bist ein armes Wrack«, fuhr er fort. »Du hast nicht einmal Respekt vor dir selbst. Richtig?«
Zustimmend nickte sie leicht mit dem Kopf.
»Du könntest arbeiten wie jeder andere. Warum tust du es nicht? Lieber bettelst du, nimmst Drohungen und Schläge in Kauf, gibst dich für jeden dreckigen Mistkerl her.«
Violette fing an zu weinen. Das Bild, das der junge Mann von ihr zeichnete, überraschte sie nicht. Wenn sie sich Mühe gab nachzudenken, dann war das, was er soeben gesagt hatte, genau das, was sie selbst von sich dachte. Doch in der Regel zog sie es vor, gar nicht zu denken.
»Du hast recht«, erwiderte sie nur.
Da geschah etwas Seltsames. Changarnier, der bis jetzt arrogant gegenüber Violette gewesen war, lächelte plötzlich traurig. Dann sagte er:
»In Wahrheit bist du ein Engel, du erfährst Leid und Gemeinheiten, aber dein Herz bleibt rein. Das ist mit das Schönste auf der Welt, und sollten Leute dir etwas vorwerfen, dann schick sie zu mir; ich werde ihnen sagen, wer du bist. Und wenn sie mir nicht glauben wollen, dann prügele ich mich mit ihnen, bis ich nicht mehr kann.«
Bei diesen Worten hatte sich Changarniers Gesicht verklärt. Er sah sich bereits als Verteidiger menschlicher Schwächen. Nervösen Schritts, einer starken Erregung ausgeliefert, ging er in seinem kleinen Zimmer auf und ab. Abrupt blieb er stehen und beobachtete intensiv die Besucherin, die ihre Tränen fortwischte.
»Liebst du mich?«, fragte er sie.
»Ja«, erwiderte sie nur.
Er ging zu der jungen Frau, nahm ihre Hände und schaute sie dankbar an.
»Habe Vertrauen zu mir«, sagte er, »verliere niemals dieses Vertrauen, und du wirst sehen, eines Tages sind wir glücklich. Im Moment kommt es darauf an, dass wir auf uns selbst zählen können, dass wir immer zusammen sind. Komm, lass uns rausgehen …«
Mit diesem Vorschlag fand Violette ihr Lächeln wieder. Sie glaubte an den positiven Einfluss des freien Raums. Aus dem Haus zu gehen bedeutete für sie stets Hoffnung, Vergnügen, unbekannte Dinge. Im Treppenhaus aber wurde sie von einem Schwindel erfasst und wäre beinahe gestürzt. Changarnier konnte sie gerade noch festhalten.
»Was ist mit dir?«, fragte er.
»Ach, nichts, nichts«, stammelte sie, als ob sie durch eigene Schuld um das schönste Vergnügen beraubt werden könnte.
»Sollen wir wieder nach oben?«
»Oh, nein, nein, lass uns rausgehen.«
Es war sechs Uhr abends. Noch immer fiel der Schnee. Die Passanten beeilten sich, nach Hause zu kommen, wo, zumindest in Changarniers Vorstellung, ein gutes Feuer und eine liebe Familie auf sie warteten. Sie spazierten einige Minuten durch ihr belebtes Viertel. Rote, gelbe und grüne Leuchtreklamen schienen den Schnee, der um sie herum lag, wegzuschmelzen.
»Sollen wir dort reingehen?«, fragte Changarnier, wobei er auf ein kleines Café wies, das zwar ärmlich, aber geheizt schien. »Oder sollen wir zu Lavignol gehen?«
»Gehen wir hier rein«, erwiderte Violette, die nicht mehr weiterkonnte.
Eine sanfte Hitze empfing sie, erfüllt vom Geruch eines Abendessens, das in einer nahen Küche vorbereitet wurde. Womöglich zum tausendsten Mal in seinem Leben bedauerte es Changarnier, dass die Cafébesitzer nie, auch nicht gegen Geld, ihre Mahlzeiten mit den Gästen teilten. Sie setzten sich abseits an einen Tisch. Einige Minuten lang wechselten sie kein Wort. Als der Kellner schließlich zu ihnen kam, musste Changarnier allerdings den Mund aufmachen. Den Ton seiner eigenen Stimme zu hören bewirkte, dass er weitersprach, als der Kellner gegangen war.
»Violette«, sagte er, »eines ist sicher, dieses Leben kann so nicht weitergehen. Jeder Mensch auf der Welt hat Geld, Liebe, Vergnügen, bloß wir nicht. Jeder Mensch kommt, geht, lebt, bloß wir nicht.«
Changarnier schlug mit der Faust auf den Tisch.
»So kann das nicht weitergehen.«
Violette sah ihn erschrocken an. Protest war ihrer einfachen Seele fremd. Sie ertrug ihr Schicksal, und statt zu versuchen, aus ihrem Elend herauszukommen, hatte sie nach und nach nur immer verbitterter dreingeschaut. Ihre Ohnmacht war derart, dass jede Reaktion ihr sinnlos erschien. Plötzlich richtete sie sich auf, scheinbar ihre Starre ablegend. Changarnier, der Mann an ihrer Seite, weinte. Und da wurde diese Frau, die offenbar kein Recht zu leben hatte, die die Dummheit selbst verkörperte, der niemals in den Sinn gekommen wäre, unglücklich zu sein, die niemals auf irgendjemanden neidisch gewesen war, unversehens zu einer anderen. Sie neigte sich ihrem Gegenüber zu, nahm vorsichtig seine Hand und fragte, ohne weitere Zärtlichkeiten zu wagen aus Angst, böse angefahren zu werden, mit größtem Mitgefühl:
»Aber was hast du denn?«
Er antwortete nicht. Ermutigt von diesem verzweifelten Anblick, rückte sie noch etwas näher an ihn heran.
»Sagst du mir, was du hast?«
Er stammelte einige unverständliche Worte. Dann, sich halb aufrichtend, fragte er:
»Wer auf der Erde soll mich verstehen, wer soll Mitleid mit mir haben? Ich bin allein, habe nichts, was soll aus mir werden?«
Violette kam nicht auf den Gedanken zu sagen, dass er doch sie habe – so bescheiden hatte ihr armseliges Leben sie gemacht. Sie sah ihn mit ohnmächtigem Mitleid an. Alle beide waren, obwohl durch dieselben Bande wie alle Paare dieser Welt vereint, hoffnungslos voneinander entfernt. Wenn man sie so eng beieinandersitzen sah, schien es, als ob die Liebe etwas Unbedeutendes war, solange glückliche Umstände sie nicht zur Entfaltung bringen konnten. Sie saßen zusammen wie alle Verliebten und waren dennoch einander fremd. Plötzlich stand Changarnier auf, so als wollte er aufbrechen – und setzte sich ebenso plötzlich wieder hin. Sein Zorn auf die Welt war dermaßen geballt, dass er nicht wusste, was tun, dass er nicht mehr wusste, was denken, dass er zu allem und zu nichts bereit war.
»Lass uns gehen«, sagte er unvermittelt.
Wie zuvor im Zimmer begrüßte Violette diesen Vorschlag.
Unter den weiter herabfallenden Schneeflocken gingen sie etwa hundert Meter, ohne ein Wort zu sagen. Trotz vorgerückter Stunde war die Menschenmenge nochmals angewachsen, und die Autos, die aneinanderstießen, weil es so viele waren, waren ins Stocken geraten. Lautes Geschrei erhob sich von der Straße. Es war, als würde das Leben selbst nach Changarnier rufen, als wäre dieser Krach der spürbare Beweis dafür, dass es auf dieser Welt noch etwas anderes gab als seinen eigenen elenden Horizont.
Etwa zehn Minuten lang versanken sie so in immer mehr Menschen und Lärm, in Schnee und Lichtern. Violette folgte ihm mit kleinen, ängstlichen Schritten. Plötzlich wandte er sich um. Sie hatte ihn gerade gefragt:
»Willst du, dass ich dir Geld gebe?«
Er sah sie einen Moment lang an, ohne ein Wort.
»Ja, du, oder eine andere oder sonst wer. Egal, woher es kommt, wenn es nur kommt. Geld, Geld, das mir erlaubt, alles zu machen, das ist es, was ich will, das ist mein Traum, das ist das Ziel meines Lebens.«
»Aber ich kann dir keins geben«, fuhr das arme Mädchen jammernd fort.
»Das weiß ich doch. Weder du noch die anderen, niemand.«
Er hielt erneut inne, vom schnellen Reden erschöpft. Feiner Schweiß perlte auf seiner Stirn. Mit seiner schneenassen Hand wischte er ihn fort. Dann schaute er zum Himmel empor. Er war rosafarben von den Lichtern der Stadt unter den dicken Schneewolken. Und diese Unendlichkeit oberhalb der Stadt, jenseits aller Ordnung und menschlicher Bauten, war etwas Ergreifendes für ihn, ein Anblick, der zu seiner eigenen Welt im Kontrast stand. Er begriff, dass es eine Unermesslichkeit gab, der er nicht angehörte, der kein Mensch angehörte, und da dies so war, glaubte er zu verstehen, dass es unter diesem grandiosen Himmel, auf dieser überbevölkerten Erde darauf ankam, sich am besten durchzuschlagen. Einen Augenblick lang sah er sich auf einer Stufe mit den Glücklichen, den Unglücklichen, den Reichen, den Gebrechlichen. Er war so wie alle Menschen, und dieses Gefühl ließ ihn freudig erschauern. Doch zugleich schien es ihm, als hätten jene vor ihm schon den gleichen Schluss gezogen und es aus diesem Grund auch so gut verstanden, sich ein Stück vom irdischen Glück zu sichern, während er dazu nicht in der Lage gewesen war.
»Leg einen Schritt zu«, sagte er zu Violette, die allmählich zurückblieb.
»Aber wohin gehen wir überhaupt?«, wollte sie von ihm wissen, denn zum ersten Mal hatte sie genug davon, draußen unterwegs zu sein.
»Weiß ich nicht. Wir gehen einfach vor uns hin und hoffen, dass uns etwas widerfährt. Da das Glück nun mal nicht zu uns kommt, müssen wir ihm entgegengehen. Was bleibt Unglücklichen wie uns anderes übrig, als voranzugehen in der Hoffnung, dass uns etwas Neues passiert? Wir gehen, solange die Kräfte reichen, bis wir nicht mehr können, und dann wird man weitersehen, uns kann ja nichts Schlimmeres mehr passieren. Sind wir denn nicht das Mittelmäßige, das Kranke, das Schwache dieser Welt? Wir müssen gehen, Violette.«
Sie sah ihn mit verweinten Augen an. Ihre Beine wollten sie nicht mehr tragen. Das Wasser lief ihr über das Gesicht, und ihr ärmlicher Pelz, den sie auf den nächtlichen Tanzfesten des Viertels trug, sah aus wie der letzte Lumpen. Changarnier blieb stehen, um seine Gefährtin in Augenschein zu nehmen. Seit dem Morgen hatte er nichts mehr gegessen, seine Migräne schmerzte ihn im Nacken und in den Schläfen und ließ ihn alles durch einen verschwommenen Lichthof des Ekels und des Albtraums sehen.
»Geh trotzdem«, sagte er, ohne einen Schritt zu tun, so erschöpft war er selbst. Er kam nicht mehr voran. Seine Füße waren nass. Da er nicht von vornherein den Kragen seines dünnen Mantels hochgestellt hatte, wollte er es jetzt auch nicht tun, weil er fürchtete, einen nassen Nacken zu bekommen. Ein Zittern erfasste ihn, um ein Haar wäre er hingefallen. Ein Passant hielt ihn fest, stellte ihn gerade und verschwand.
»Lass uns weitergehen«, wiederholte er nachtwandlerisch. »Wir können hier nicht stehen bleiben. Wir müssen irgendwo hingehen. Wir müssen irgendwas tun, und weiterzugehen ist unsere einzige Möglichkeit.«
Violette erwiderte nichts. Sie gehorchte und tat einige Schritte, doch Changarnier war zu schwach, ihr zu folgen. Trotzdem rief er ihr aus der Entfernung zu:
»Richtig so, gehe! Man muss gehen, man muss dem Schicksal und dem Glück entgegengehen, da beides nun mal nicht zu uns kommt.«
Violette marschierte weiter. Schon verdeckten Passanten sie zeitweise vor dem Blick des jungen Mannes. Jäh aufgeschreckt reckte er sich hoch, stürzte ihr hinterher, so als ob sie durch bloßes Weggehen auf das Glück gestoßen wäre und ihn seinem erbärmlichen Schicksal überlassen hätte. Wie ein in der Wüste verlorener Reisender die Kraft findet, seinen Gefährten zur nächsten Oase zu folgen, so schaffte er es, ihr zu folgen. Allerdings gab es da keine Oase. Als er zu ihr aufgeschlossen hatte, redete er ihr weiter gut zu. Doch diese Unternehmung überstieg seine Kräfte. Er erblickte ein Café, blieb wieder stehen und sagte zu Violette in verändertem Tonfall:
»Lass uns dort einen Moment lang ausruhen. Ich kann nicht mehr. Im Übrigen, was soll das Gehen, wenn es doch immer das Gleiche ist? Wozu laufen, wenn wir doch niemals das finden werden, was uns glücklich macht?«
»Denkst du jetzt wieder anders?«, fragte sie.
»Nein, tue ich nicht, aber ich bin erschöpft.«
Unverändert schnell huschten die Lichter der Straße über ihre Gesichter. Und noch immer fiel der Schnee, schmolz, sowie er den Boden berührte, und verwandelte die Straßen in Matsch. Sie betraten ein Café, in dem trockene Menschen Karten spielten, wo auch die Sitzbänke trocken waren und wo milde Wärme und Heiterkeit herrschten. Wie vorhin setzten sie sich etwas abseits an einen Tisch. Ein sanftes Wohlgefühl durchströmte sie. Für unglückliche Menschen gibt es Momente, die von ihnen ganz besonders geschätzt werden: Übergangsmomente. Für sie stellen sie einen Luxus dar, und so darf man in der Angewohnheit einiger Menschen, immer wieder neue Lokale zu betreten, nicht nur ein Bedürfnis nach Rausch erkennen, sondern auch den Wunsch nach Veränderung des eigenen Zustands. Sie kommen rein, sie gehen wieder los. Erst wollen sie weg, dann wollen sie wieder zurück. Changarnier holte eine Zigarette aus einer seiner Taschen.
»Willst du sie haben?«, fragte er Violette. »Es ist die letzte«, fügte er hinzu, damit sie ablehnte.
Aber weder wollte sie, noch wollte sie nicht. Ihr war alles egal. Er zündete sich seine Zigarette mit einem Zündholz aus dem Café an, ein Zündholz, das nicht ihm gehörte, und in seinem Elend war er sich bewusst, dass das ein Geschenk war.
»Violette, was wollen wir trinken?«
»Was du willst.«
Er rief nach dem Kellner und bestellte zwei Rumgrog. Dann atmete er tief zufrieden den Rauch seiner Zigarette ein. »Ich rauche in diesem Moment mit größerem Vergnügen als irgendein glücklicher Mensch«, dachte er. »Es gibt nichts Besseres, als eine Sache zu entbehren, um ihren Wert zu schätzen.« Und so trank er mit gleicher Befriedigung auch seinen Rum.
»Was will ich mehr? Mehr als satt sein? Schließlich sind wir so vielleicht glücklicher, nicht wahr, Violette?«
Erschrocken sah sie ihn an. Sie war eine Frau; sie verstand derartige Glücksmomente nicht. Alles, was sie wusste, war, dass sie der letzte Dreck war, und nie, hätte sie auch die größte Befriedigung aufleben lassen, wäre sie auf die Idee gekommen, glücklich zu sein. Wie auch – nach dem, was er, Changarnier, ihr vor dem Ausgehen gesagt hatte?
Nachdem er etwa zehn Minuten ruhig dagesessen hatte, stand Changarnier abrupt auf.
»Komm«, sagte er, »wir müssen gehen, wir können hier nicht bleiben. Wir essen irgendwo ein Sandwich und gehen dann ins Kino. Und morgen, tja, morgen ist nichts mehr übrig, nichts zum Mittagessen, nichts für das Hotel, gar nichts.«
»Das ist vielleicht nicht sehr klug, besser wäre es, wir würden auf die paar uns verbleibenden Francs aufpassen.«
»Und was, wenn ich mich bei der Fremdenlegion bewerben würde und wenn ich ums Leben käme und wenn ich arbeiten würde und wenn du auch arbeiten würdest, zum Beispiel als Kinoangestellte, und ich als der Mann am Projektor, vielleicht freitags, wenn es ein neues Programm gibt, alle beide im selben Kino und mit festem Gehalt? Und jeden Tag im Restaurant, jede Nacht auf dem Zimmer, jeden Morgen im Bett, dazu die Tageszeitung und das sichere Päckchen Maryland – was würdest du davon halten?«
»Ich habe mir immer gedacht, dass es so enden sollte.«
»Ja, aber danach? Wir können dann nicht mehr aufhören. Sowie man aufhört, ist es genauso wie heute.«
»Wir könnten sparen.«
»Dann lieber nicht arbeiten, weil wir ja keinen Spaß mehr hätten.«
»Und später?«
»Aber später wird es dasselbe sein, du glaubst doch nicht, dass wir so viel ansparen könnten, um von unserem Vermögen zu leben. Also muss man arbeiten, um zu leben. Aber da nicht zu arbeiten uns das Leben nicht abnimmt, können wir ebenso gut auch gar nichts machen, weil wir ja so leben, als würden wir arbeiten.«
Grinsend hielt er inne.
»Die alle da brauchten bloß aufhören, sie sind wie wir.«
Aber sie hörten nicht auf.
»Klar, die sind letztlich wie wir, hä, hä …«