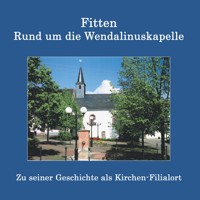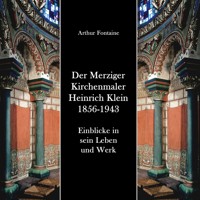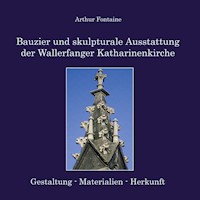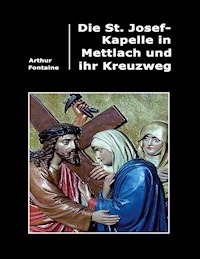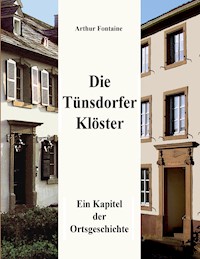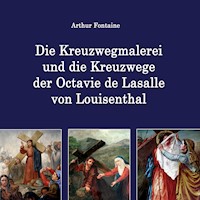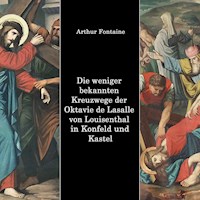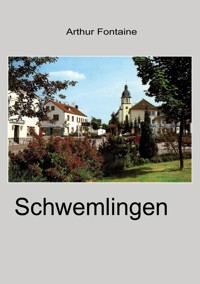
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Heimatbuch Schwemlingen von 1985 ist seit langem nicht mehr zu erwerben. Vielfache Nachfrage haben nun zu einem inhaltlich unveränderten Nachdruck des Werkes veranlasst. Zudem ist der Nachdruck sowohl als Druckwerk als auch als e-Buch erhältlich. Die Publikation stellt alle wesentlichen Strukturen des Ortes Schwemlingen dar, zeigt auf, wie sie entstanden sind und schreibt sie bis auf das Jahr 1985 fort.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anschriften:
Autor: Arthur Fontaine, Fasanenweg 3, 6640 Merzig-Schwemlingen
Autoren der Einzelbeiträge:Hans Leisten, Luxemburger Straße 73, 6640 Merzig-Schwemlingen Wolfgang Orth, Stefansbergstraße 54, 6640 Merzig
Cornelia Vales, St. Stephan-Straße 20, 8262 Altötting
Prof. Dr. Wolfgang Dachroth, Geologisches Institut Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 234, 6900 Heidelberg
E. Kohlmeier, cand. geol., Geologisches Institut Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 234, 6900 Heidelberg
Dr. h.c. Paul Haffner, Merchinger Straße 81, 6640 Merzig
Dieter Heinrich, Haardter Weg 14, 6640 Merzig-Schwemlingen
Hans-Günther Decker, Königsberger Straße 1, 6640 Merzig-Hilbringen
Originalausgabe:
Redaktion und Layout: Arthur Fontaine
Herstellung: PROVESA — Brigitte Fontaine, Fasanenweg 3, 6640 Merzig-Schwemlingen
Druck: Merziger Druckerei und Verlag GmbH, Gutenbergstraße 1, 6640 Merzig, 1985
Vertrieb: Heimatverein Schwemlingen e.V.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Schwemlingen — auf den ersten Blick
2 Grundzüge der Entwicklung des Ortes
2.1 Frühe Spuren
Übersicht
Bodenfunde (von Hans Leisten)
2.2 Ortsgründung und erste Erwähnung in fränkischer Zeit
Schwemlingen — ein „ingen-Ort“
Erste urkundliche Erwähnung
Bodenfunde (von Hans Leisten)
2.3 Schwerpunkte der Ortsgeschichte bis zum Ende des 19. Jahrhunderts
Die Entwicklung des Ortsgefüges
Die politisch-staatliche Zugehörigkeit
Aus der Zeit der Hexenprozesse
Die Zeit des Dreißigjährigen Krieges
2.4 Die Ortsentwicklung in unserem Jahrhundert
Die Bereiche Politik und Verwaltung
Versorgung und öffentliche Einrichtungen
2.5 Schwemlingen in siedlungsgeschichtlicher Betrachtung (von Wolfgang Orth)
Einleitung
Frühe Siedlungszeugnisse
Mittelalterliche Besiedlung
Die Haus- und Dorfformen vor dem Dreißigjährigen Krieg
Die Siedlungsentwicklung nach dem Dreißigjährigen Krieg
Das Einhaus
Lothringer Einhaus und breitgegliedertes Quereinhaus
Anwesen „Im Ecken“ Nr. 22
Anwesen „Im Urth“ Nr. 1
Die Ortsform Schwemlingens zu Beginn des 19. Jahrhunderts
Ausblick in die Zukunft
2.6 Elemente des Schwemlinger Ortsbildes — vormals und heute
Brunnen
Straßen
Plätze
Alte Ortsansichten
3 Religiöses und kirchliches Leben — aus Vergangenheit und Gegenwart
3.1 Anfänge
3.2 Frühe Pfarrzugehörigkeit
3.3 Die Schwemlinger Kapelle
3.4 Der lange Weg zur pfarrlichen Selbständigkeit
Der Kirchweg nach St. Gangolf — eine große Beschwernis
Erster Vorstoß zur Eigenständigkeit
Es wird schlechter statt besser
Versuche und Proteste
Jetzt oder nie!
Der Schritt zur Selbständigkeit
3.5 Der Pfarrhaus- und Kirchenbau
3.6 Die Entwicklung der Pfarrgemeinde und des kirchlichen Lebens vom Beginn bis heute
3.7 Die bisherigen Schwemlinger Seelsorger
3.8 Schwemlinger in geistlichen Berufen
3.9 Aus dem Pfarrleben
3.10 Zum Stil von Bauwerk und Ausstattung der Schwemlinger Pfarrkirche St. Laurentius (von Cornelia Vales)
3.11 Die Mariensäule
3.12 Die Schwemlinger Weg- und Friedhofskreuze
3.13 Interessantes und Kurioses aus acht Jahrzehnten Pfarrgeschichte
(
90 Kappes-Häupter für den Pfarrer
Die Glocke mit dem Riß
Der „von Hammer’sche Fond“: Ein Geschenk für Schwemlingen zum Besseringer Nutzen
Das Vermächtnis des Dr. Matthias Hüllen
Die Beziehungen Schwemlingens zu den Klöstern Mettlach und St. Gangolf
Das Stelleneinkommen des Pfarrvikars um 1915
Dienstpflichten und Einkommen des Küsters bzw. Organisten um 1915
Die Meßgebühren 1915
Diebstahl der Monstranz 1920
Alte Gottesdienstordnungen
Das St. Laurentius-Lied
„Der Aufstand der Schwemlinger“
3.14 Das Kloster Marienau
Vorgeschichte
Klostergründung und Einzug der Schwestern
Die Schwestern nehmen ihre Tätigkeit auf
Umbau und Ausbau des Hauses
Der Kapellenneubau
Die Missionsschule
Wandel der Aufgaben
3.15 Die evangelischen Christen in Schwemlingen
4 Erziehung und Bildung in Kindergarten und Schule — von den Anfängen bis heute
4.1 Fünfzig Jahre Kindergarten in Schwemlingen
Gründung und Entwicklung bis 1944
Neubeginn nach dem zweiten Weltkrieg
Der Kindergarten von 1954 bis heute
4.2 Aus der Schwemlinger Schulgeschichte
Im Winter zur Pfarrschule nach St. Gangolf
Die erste Schule im Ort
Ein eigenes Schulhaus
Mehr Klassen, mehr Schulraum
Die schulische Situation zwischen den beiden Weltkriegen
Neubeginn und Entwicklung nach dem zweiten Weltkrieg
Die heutige Grund- und Hauptschule Schwemlingen
Die Schwemlinger Lehrpersonen und Schulleiter
5 Der Ort in seinem natürlichen Umfeld
5.1 Geographische Lage, Landschaft, Klima
5.2 Die Gemarkung Schwemlingen
Größe und Grenzen der Gemarkung
Die Fluren
Die Gewanne
5.3 Die Steine und ihre Entstehung im Raum Schwemlingen im Überblick
(von W. Dachroth und E. Kohlmeier)
5.4 Die Bodennutzung
Übersicht
Der Wald
Die Flur
Die Gewässer
Die Steinbrüche, Sand- und Kiesgruben
5.5 Botanische Streifzüge in die Umgebung von Schwemlingen
(von Paul Haffner)
5.6 Zur Fauna der Gemarkung Schwemlingen und ihres Umfeldes
(von Dieter Heinrich)
5.7 Schutz und Pflege der Landschaft
Landschaftsschutz
Landschaftspflege
Natur- und Umweltschutz
Naturdenkmäler, Gedenkbäume
6 Sozialpflegerische Einrichtungen
6.1 Das psychiatrische Pflegeheim „Helfende Tat“
6.2 Das Altenheim des Klosters „Marienau“
7 Die Wirtschafts- und Sozialstruktur des Ortes — Entwicklung und Stand
7.1 Die Zeit des bäuerlichen Gepräges
7.2 Die „Cahier de doléances“ — ein Dokument der wirtschaftlichsozialen Verhältnisse vor Beginn der französischen Revolution
7.3 Die Auswanderungen im 19. Jahrhundert
7.4 Die Entwicklung Schwemlingens vom Bauerndorf zur Arbeitergemeinde
7.5 Die Entwicklung der einzelnen Wirtschaftszweige
Die Landwirtschaft in Schwemlingen
Handel und Gewerbe im Ort
Entwicklung und Stand des Dienstleistungsbereiches in Schwemlingen
8 Vereinsleben — gestern und heute
8.1 Schwemlinger Vereine vormals
8.2 Unsere heutigen Vereine
8.3 Der Dachverband der Schwemlinger Vereine
9 Spiel-, Sport-, Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten
9.1 Spielplätze
9.2 Der Sportplatz
9.3 Die Tennisanlage
9.4 Das „Päppelder Wäldchen“
9.5 Die Saargauhalle
9.6 Wandermöglichkeiten
10 Aus dem Volksleben
10.1 Mundartliches
10.2 Anekdoten
10.3 Alte Bekannte
10.4 Bräuche, Feste, Feiern
(
Kaisers Geburtstag
Erntefeste
Mädchenlehen
Kirmes
Fastnacht
Der Maibaum
Martinszug, Sternsinger, „Kläppern“
Der Altentag
Das „Deppengießerfeschd“
Der Volkstrauertag
10.5 Sagen
(
Kathrein auf Roden
Der Meier von Schwemlingen
Der Bausmärten
Das Irrlicht in der Grät
Die Sage von Müller’s Kreuz
Der büßende Ritter wird Klausner am Johannisbrunnen
Anhang 1: Verzeichnis der verwendeten Fachbegriffe
Anhang 2: Liste der Schwemlinger Auswanderer im 19. Jahrhundert
Anhang 3: Die Schwemlinger Lehrpersonen
Anhang 4: Die Schwemlinger Ortsvorsteher
Quellen- und Literaturverzeichnis
Bildquellenverzeichnis
Spenderliste
Vorwort
Das vorliegende Buch ist für den an seinem Gemeinwesen und dessen historischer Entwicklung interessierten Schwemlinger Bürger entstanden und ihm gewidmet.
Es stellt im wesentlichen die Strukturen des heutigen Zustandes im Ort dar und zeigt auf, wie sie entstanden sind. Soweit möglich, sind diese Strukturen der verschiedenen Lebensbereiche inhaltlich ausgestaltet und lebendig gemacht. Hierbei setzten vor allem drei Umstände oft unliebsame Grenzen: Zum einen gibt es nur spärliches Quellenmaterial und wenige heimatkundliche Veröffentlichungen über Schwemlingen, zum anderen ist die Zahl der „alten“ Schwemlinger, die als Träger der mündlichen Überlieferung befragt werden konnten, klein geworden. In anderen Fällen zwang der als sinnvoll erkannte Umfang des Buches zur Begrenzung, um alle Bereiche ausgewogen berücksichtigen zu können.
Das Buch trägt die wichtigsten derzeit bekannten Ergebnisse der heimatkundlichen Forschung über Schwemlingen zusammen, ergänzt sie und erweitert sie bis zum heutigen Tage. Erstmals wird eine umfassende Wirtschafts-, Sozial- und Vereinsgeschichte unseres Ortes vorgelegt.
Auf Einzelquellennachweise wurde zum Zweck der Leichtlesbarkeit in der Regel verzichtet; ein allgemeines Quellenverzeichnis ist vorhanden. Sollte sich Interesse am Nachweis einer Quelle im Einzelfalle zeigen, so steht der Autor für Auskünfte zur Verfügung. Fachbegriffe sind mit dem folgenden Zeichen* versehen. Diese Begriffe sind im alphabetischen „Verzeichnis der verwendeten Fachbegriffe“ erklärt. Es ist versucht worden, das Buch durch eine reiche Bebilderung interessanter und informativer zu machen. Was die historischen Abbildungen betrifft, so wurde allein ihre Aussage, nicht ihre fototechnische Qualität bei der Auswahl berücksichtigt. Die meisten Fotovorlagen dieser Art sind Amateuraufnahmen und weisen Altersschäden auf. Dies schien mir jedoch kein Grund, auf besonders interessante Exemplare zu verzichten.
Eine wichtige Quelle für dieses Buch war die mündliche Überlieferung. Durch vergleichende Auswertung mündlicher Parallelberichte ist mit Sicherheit ein hohes Maß an historischer Richtigkeit für die Ergebnisse dieser Quelle erreicht worden. Hier sei allen gedankt, die durch Gesprächsbereitschaft ihren Beitrag zu diesem Buch geleistet haben. Darüber hinaus ist allen Dank zu sagen, die durch Informationen, Hinweise sowie Bereitstellen von Quellenmaterial und Fotos behilflich waren. In diesen Dank einzuschließen sind die genannten Mitautoren für die honorarfreie Bearbeitung einzelner Themen.
Schließlich muß im Zusammenhang mit einem solchen Projekt auch von Geld die Rede sein. Hier gilt herzlicher Dank meiner Frau, die mit ihrer Firma PROVESA-Schulbuchvertrieb die kostenlose Vorfinanzierung des Buches übernommen hat. Als Autor habe ich meiner Frau auch zu danken für die Übernahme aller schreibmaschinenschriftlichen Arbeiten im Zusammenhang mit der umfangreichen Korrespondenz bei der Materialsammlung sowie für das Schreiben des Manuskriptes. Zur finanziellen Absicherung des Buches und zu seinem günstigen Kaufpreis haben auch die Stadt Merzig und das saarländische Kultusministerium durch großzügige Zuschüsse beigetragen, ebenso zahlreiche Privat- und Firmenspender; auch ihnen allen ist Dank zu sagen.
Diese zahlreichen Dankadressen machen deutlich, daß sich hier viele zu einer uneigennützigen Gemeinschaftsleistung zusammengefunden haben.
Es bleibt zu hoffen, daß das Buch sein zweifaches Ziel erreicht, den „Altbürgern“ Schwemlingens ihre Verwurzelung in der dörflichen Tradition neu aufzuzeigen und den „Neubürgern“ das Wurzelschlagen zu erleichtern. Hieraus mögen Ansätze zu einem neuen Gemeinschafts- und Selbstbewußtsein für ein Leben in dörflichen Strukturen unter den Bedingungen unserer Zeit erwachsen.
Merzig-Schwemlingen, im Mai 1985
Der Autor und Vorsitzende des Heimatvereins Schwemlingen e. V.
1 Schwemlingen — auf den ersten Blick
Schwemlingen liegt am nordwestlichen Rand der Merziger Talweitung auf den Schwemmlandterrassen eiszeitlicher Herkunft.
Begrenzt wird der Ort im Osten von der Au, dem Wiesenland der Talweitung, im Süden setzen sich die Schwemmlandterrassen fort, in westlicher Richtung steigt die Ortslage bis zu den restlichen Teilen des Haardtwaldes an und erstreckt sich in das Weiler Tal, nördlich bildet der Federfelsberg eine natürliche Grenze. Landschaft und Bild des Ortes werden auch stark von der reizvollen Tallandschaft des Kohlenbrucherbaches geprägt, der von Südwest nach Nordost einen tiefen Einschnitt zwischen Scheidwald sowie Federfelsberg nördlich und Haardtwald südlich geschaffen hat. Bedingt durch diese geographische Situation und seiner Lage um 170 m über dem Meeresspiegel, hat der Ort Teil am milden Klima des Merziger Beckens.
Schwemlingen ist großräumig durch die Bundesautobahn 8 (Europastraße 42) und die Bundesstraße 406, im Nahbereich ebenfalls durch die B 406 sowie durch die Landstraßen II 38 und I 175 verkehrsmäßig angebunden. Die A 8 hat seit dem 15. November 1984 im Süden des Ortes eine Ab- und Auffahrt „Merzig-Schwemlingen“ in beiden Autobahnrichtungen. Damit ist der Ort in südliche Richtung unmittelbar an die Straßenverbindung in das saarländische Industriegebiet und darüber hinaus in den süddeutschen Raum, in nördliche Richtung (vorerst über die B 406) in den Trierer Raum und den Benelux-Bereich angeschlossen. Die B 406 führt, von Süden kommend, durch den Ort und verläßt ihn in westlicher Richtung. Neben ihrer oben beschriebenen großräumigen Bedeutung bindet die B 406 Schwemlingen vor allem an das etwa 5 km entfernte Stadtzentrum Merzig und den Merziger Raum, die Hochwaldregion und die Nachbarorte im Süden und im Westen an. Die L II 38 verbindet Schwemlingen mit dem nordwestlich gelegenen Nachbarort Dreisbach und dem Ausflugsziel Steinbach/Saarschleife. Die L I 175 führt von Schwemlingen durch die Au zum nordöstlichen Nachbarort Besseringen und zur rechten Saarseite. Geplant ist eine Querverbindung von der A 8 durch die Au mit Anschluß an die Bundesstraße 51 auf der rechten Saarseite.
Omnibuslinien verbinden Schwemlingen direkt mit den Städten Merzig und Dillingen sowie dem Fabrikort Mettlach. Die gleichen Linien fahren auch die Orte in der näheren und weiteren Umgebung Schwemlingens an. Diese guten öffentlichen Nahverkehrsmöglichkeiten sind vor allem im Hinblick auf den Berufs- und Schülerverkehr des Auspendlerortes Schwemlingen zu würdigen.
Nächstgelegene Eisenbahnstationen sind der Hauptbahnhof Merzig (etwa 5 km) und der Bahnhof Besseringen (etwa 2,3 km) an der Eisenbahnlinie Saarbrücken-Trier.
Schwemlingen war vor der saarländischen Gebiets- und Verwaltungsreform bis zum 1. Januar 1974 selbständige Gemeinde im Amtsbezirk Hilbringen und ist seither Stadtteil der Kreisstadt Merzig. Der Ort zählte Ende 1984 2229 Einwohner. Nach dem zweiten Weltkrieg setzte ab Mitte der 50er Jahre in Schwemlingen eine lebhafte Aufwärtsentwicklung ein, die zu einer starken Zunahme der Bevölkerungszahl führte, aber auch eine erhebliche Verbesserung der „Lebensbedingungen“ erbrachte.
Die überwiegend katholische Bevölkerung bildet eine selbständige Kirchengemeinde mit eigenem Gotteshaus. Die Ordensgemeinschaft der Steyler Missionsschwestern unterhält in Schwemlingen das Kloster „Marienau“ mit Altenheim. Seit dem 17. September 1975 besteht in Schwemlingen ein psychiatrisches Pflegeheim. Der Ort hat einen Kindergarten sowie eine Grund- und Hauptschule. Das Vereinsleben in kultureller, sportlicher und musischer Hinsicht ist sehr rege. Unterstützt werden diese Aktivitäten durch das Vorhandensein der „Saargauhalle“, der einzigen Mehrzweckhalle der Stadt Merzig. Auch das „Päppelder Wäldchen“ bietet nicht nur als Naherholungsgelände, sondern auch für Veranstaltungen Schwemlinger Vereine ausgezeichnete Möglichkeiten.
Dem Erholungssuchenden und Wanderfreund hat die Gemarkung Schwemlingen und deren Umgebung viel zu bieten: Vor allem der Scheidwald ist eines der schönsten Waldgebiete unseres Raumes mit ausgedehntem, gut ausgebautem Wegenetz.
Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung Schwemlingens ist außerhalb des Ortes in den Gewerbe-, Handels- und Verwaltungszentren der näheren und weiteren Umgebung beschäftigt. Allerdings sind auch im Ort Landwirtschafts-, Handwerks- und Handelsbetriebe ansässig. Der Dienstleistungsbereich bietet hier wichtige Möglichkeiten an: z. B. eine Arztpraxis, eine Apotheke, ein Massageinstitut, ein Kosmetik-Studio, zwei Bankfilialen, drei Hotels, eine Pension, drei Restaurants, ein Kaffee, mehrere Gaststätten, zwei Tankstellen u. a. Daher hat Schwemlingen im Rahmen der Entwicklungsplanung der Stadt Merzig die Funktion eines Nebenzentrums mit Versorgungsaufgaben sowohl für den eigenen Stadtteil als auch für die Stadtteile Weiler, Büdingen und Wellingen mit Dienstleistungen (in den Bereichen Grundversorgung, Gesundheit, Bildung, Freizeit, Wohnen u. a.).
Durch eine ausgesprochene Nutzungsmischung im Ortskern ist Schwemlingen ein sehr „lebendiger“ Ort. All dies wäre Ansatz für eine mögliche wirtschaftliche Entwicklung als Fremdenverkehrsort. Unsere schöne Landschaft, das milde Klima, Schwemlingen als „Tor zur Saarschleife“, die sehr gute Nah- und Fernverbindung und nicht zuletzt die offene Grundeinstellung unserer Menschen sind weitere Argumente für Schwemlingen als künftigen Erholungsort. Hinzu kommt die geplante Nutzbarmachung der Saar für die Personenschiffahrt mit einer Anlegestelle im nahe gelegenen Besseringen.
Zwar ist die Entwicklung eines Stadtteiles stets an den Rahmen des gesamtstädtischen Entwicklungskonzeptes gebunden. Dies schließt jedoch sicher nicht aus, daß Initiativen, Anregungen und Aktivitäten aus dem Kreis der unmittelbar Betroffenen kommen, insbesondere wenn es um die Nutzung und Entwicklung spezieller örtlicher Möglichkeiten geht. Dies wäre auch im Sinne der Erhaltung einer eigenen Identität, Stärkung der örtlichen Selbstgestaltung und der Entwicklung eines neuen Gemeinschafts- und Selbstbewußtseins im Ort.
Nach diesem, zugegebenen provozierenden Blick in die Zukunft, wenden wir uns nun den verschiedenen Lebensbereichen im einzelnen zu, spüren den Anfängen und Entwicklungen im Laufe der Geschichte nach und stellen fest, wie sie sich heute darbieten.
2 Grundzüge der Entwicklung des Ortes
Die heutige Bedeutung Schwemlingens als erklärtes Nebenzentrum der Kreisstadt Merzig hat sich erst in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg durch eine gezielte Entwicklung eingestellt. Daß Schwemlingen durch die Jahrhunderte hin nur selten besondere, über den Ort hinausragende Bedeutung erlangte, liegt an verschiedenen Umständen: Der Ort war nie Herrschaftssitz, hatte kein Kloster, war bis in unser Jahrhundert keine eigenständige Pfarrei, hatte keine besonderen wirtschaftlichen Anreize zu bieten. Damit sind nur wenige wesentliche Gründe genannt.
Bei näherem Hinsehen stellt man allerdings fest, daß Zeiträume größerer oder geringerer Bedeutung und Ausstrahlung wechselten. Für die Menschen jedoch ist ihr Wohnort zu allen Zeiten ihre Heimat gewesen, mit der sie oft schicksalhaft verbunden waren.
Die folgenden Darstellungen konzentrieren sich, soweit möglich, auf diejenigen historischen Tatsachen und Beziehungen, die Schwemlingen unmittelbar betreffen. Das ausführliche Quellen- und Literaturverzeichnis dieses Buches gibt die nötigen Hinweise auf Materialien, die in die allgemeinen politischen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklungen und Zusammenhänge einführen.
2.1 Frühe Spuren
Übersicht
Aus den Anfängen menschlicher Besiedlung sind nur einzelne, verlorene Spuren hauptsächlich in Form von Bodenfunden auszumachen.
Aus der älteren Steinzeit (bis 3000 v. Chr.) gibt es einzelne Funde in der Umgebung unseres Ortes.
Bodenfunde aus der jüngeren Steinzeit (3000 - 2000 v. Chr.) auf Schwemlinger Gebiet lassen erkennen, daß unser Ort wahrscheinlich bereits zu dieser Zeit besiedelt war. Ausgedehnte, wildreiche Wälder, der Fischreichtum von Saar und Kohlenbrucherbach sowie der fruchtbare Boden der Schwemmlandterrassen boten den Menschen dieser vorgeschichtlichen Zeit sicher eine Lebensgrundlage in unserem Raume.
Auch während der Kupfer- und Bronzezeit (2000 - 750 v. Chr.), die durch Hügelgrab- und Urnenfeldfriedhof gekennzeichnet ist, dürfte unsere Gemarkung besiedelt gewesen sein. Diese Annahme wird durch Funde in der Umgebung Schwemlingens belegt.
Für die Eisenzeit (750 v. Chr. - 0) weisen zahlreiche Funde auf Schwemligner Gebiet die Besiedlung nach. Die Funde stammen sowohl aus der älteren Eisenzeit (Hallstattzeit*; etwa 750 - 450 v. Chr.) als auch aus der jüngeren Eisenzeit (Latènezeit* 450 v. Chr. - 0). Die Latènezeit ist die Zeit der Kelten. Unser Ortsgebiet lag wahrscheinlich im Bereich des keltischen Stammes der Treverer.
Für eine fortgesetzte Besiedlung des Schwemlinger Gebietes zeugen auch die bedeutenden Funde aus der anschließenden Römerzeit (0 - 400). Nachdem die Römer Gallien um 50 v. Chr. erobert und die keltischen Stämme unterworfen hatten, bauten sie Heeres- und Handelsstraßen sowie zahlreiche Befestigungsanlagen. Landwirtschaft, Handwerk und Handel kamen zur Blüte, römische Verwaltungs- und Regierungsformen wurden eingeführt. Die römische Kultur verband sich mit der einheimischen keltischen zur gallorömischen Mischkultur.
Bodenfunde(von Hans Leisten)
Ob aus der Altsteinzeit von Menschenhand hergestellte Geräte auf dem Bann Schwemlingen gefunden wurden, ist ungewiß, obwohl in manchen Veröffentlichungen davon die Rede ist. Es gibt einige atypische Feuersteinfunde, die der Altsteinzeit zugeschrieben werden, die aber wohl späteren Ursprungs sind. Aus der Spätphase der Altsteinzeit (von manchen Forschern auch als Mittelsteinzeit bezeichnet) sind zahlreiche Mikrolithe* aus Schwemlingen vorhanden, die im Kreisheimatmuseum zu Merzig ausgestellt sind.
Feuersteinmesser (Klinge, 18 cm lang) in verschiedenen Ansichten aus der Jungsteinzeit
Die Funde aus der Jungsteinzeit sind vielfältig. Das schönste Stück ist eine Steinklinge, die aus einem bergfrischen Feuersteinknollen abgespalten wurde. Durch Feinretusche wurde die als Bohrer geeignete Spitze herausgearbeitet. So entstand ein zum Schneiden und Bohren geeignetes Arbeitsgerät. Der Bestand an Feilspitzen ist groß. Wir unterscheiden zwei Typen. Die meisten Spitzen haben einen Stiel, wodurch sie leichter an einem Schaft befestigt werden konnten. Eine Feilspitze ist herzförmig. Dadurch ließ sich am Ende ein gespaltener Schaft besser befestigen.
Geschliffene Steilbeile wurden viele gefunden. Im Heimatmuseum zu Merzig ist ein faustgroßer Stein, an dem eine Vollbohrung angefangen wurde. Diese Bohrungen waren mühsam, weil mit scharfem Sand und einem harten Holzstab von Hand gebohrt wurde. Es wurde meist von zwei Seiten gearbeitet, wodurch zwei konische Bohrlochteile entstanden. Später wurden hohle Knochen oder Holunderholz zum Bohren benutzt. Weil dabei ein Bohrkern entstand und man schon mit einer Bogensehne den Bohrer in schnelle Bewegung versetzte, war es nach Erfindung der steinzeitlichen Bohrmaschine bedeutend leichter, Löcher in Steingeräte zu bohren, die einen Stiel erhalten sollten.
Steinwerkzeuge aus der Jungsteinzeit
Die Kupferzeit, die bei uns nur zweihundert Jahre dauerte, hat uns noch keine Spuren hinterlassen. Es ist sicher, daß damals weiterhin Feuersteingeräte benutzt wurden, weil sie den Wettbewerb gegen das weiche Kupferbeil nicht zu fürchten brauchten.
Aus der Bronzezeit sind keine Funde auf Schwemlinger Gebiet bekannt geworden, wie sie etwa die Verwahrfunde von Trassem und Tünsdorf zeigen.
Aus der Urnenfelderbronzezeit sind wohl deshalb keine Bodenfunde gemacht worden, weil die damaligen Einwohner auf dem heutigen Bann Schwemlingen wohl auf dem großen urnenfelderzeitlichen Gräberfeld zu Rech bestattet wurden. Die Gräber dieses Friedhofes wurden nur beim Kiesabbau planmäßig erfaßt. Das Grabgelände setzte sich aber auch westlich der Straße fort, wie später dort beim Bau von Häusern festgestellt wurde.
Der Kiesabbau in den Kiesgruben auf Krewels brachte Bronzeschmuck aus der Hallstatt- und der La-Tène-Zeit. Gräber sind ein sicheres Zeichen dafür, daß auf der fruchtbaren Ackerterrasse Kelten wohnten.
Bronzeringe aus der Hallstattzeit
Bronzeringe aus der Hallstattzeit
Beim Bau einer Garage am Anwesen Luxemburger Straße 73 wurden von mir Reste einer latènezeitlichen Siedlung festgestellt. Es wurde Siedlungskeramik aus verschiedenen Latènestufen sichergestellt. Daß an dieser Stelle längere Zeit gewohnt wurde, zeigte sich, weil drei Stampflehm-Fußböden in geringem Abstand übereinander angeschnitten wurden.
Die Römerzeit hat viele Spuren auf Schwemlinger Gebiet hinterlassen. Auf dem jetzigen Friedhofsgelände stand ein achteckiger Tempel, wie sie in der damaligen Zeit vielerorts bezeugt sind. Auf Roden deuten Flach- und Rundziegel, große römische Backsteinplatten und Mauerwerk wohl auf eine Villa Rustica hin. Im anschließenden Waldrandgebiet wurde römische Keramik gefunden, die den dazugehörigen Bestattungsplatz vermuten läßt. Auf Federfels wurden während des zweiten Weltkrieges beim Pflügen zwei römische Brandgräber gefunden. In der Baugrube Trierweiler-Grau, Luxemburger Straße 86, wurden römische Leistenziegel mit den dazugehörigen Rundziegeln geborgen. Das Stück eines Faltenbechers läßt eine Zeitbestimmung zu. In „Stöd“ sollen unweit des Steilhanges der Hochterrasse die Fundamente eines langen römerzeitlichen Bauwerkes in der Mitte des letzten Jahrhunderts ausgegraben worden sein.
Auf dem Altenberg, nördlich der Straße von Fitten nach Büdingen, westlich der Einmündung des von Schwemlingen kommenden Feldwirtschaftsweges, wurden römische Ziegel, Keramik und mancherlei Eisengeräte gefunden. Darunter waren Zangen, kleine Hufeisen und Nägel. Hier könnte eine mansio, also eine Straßenstation, gewesen sein.
Als das Siedlungsgelände auf „Baus“ erschlossen wurde, stieß man auf römerzeitliches Mauerwerk. Römische Keramik konnte vielfach dort beobachtet werden.
Der damalige Schüler Peter Pinter fand beim Wühlen im römischen Bauschutt sechs spätrömische Münzen, einen Anhänger, Teile vom Bügel zweier kaiserzeitlicher Fibeln und Teile eines Glasgefäßes mit Fadenglasverzierung. Dort wurde auch ein grauer Spinnwirtel aus gebranntem Ton mit einem eingeritzten Kreuz gefunden.
Römische Funde (Münzen u. a.)
2.2 Ortsgründung und erste Erwähnung in fränkischer Zeit
Schwemlingen — ein „ingen-Ort“
Die Völkerwanderungszeit (400 - 500) brachte das Ende der Römerherrschaft in unserem Raum. Der germanische Stamm der Franken ließ sich hier nieder und gründete zahlreiche Siedlungen, vor allem an Fluß- und Bachläufen sowie in anderen ackerbaugünstigen Gebieten. Es ist dies die Zeit der fränkischen Landnahme. Ortsnamen auf ,,-ingen“ gehen überwiegend in die Frühzeit der Landnahme zurück. Die Namensbildung der Orte auf ,,-ingen“ erfolgte meist in Verbindung mit einem althochdeutschen Personennamen, der die Sippe kennzeichnete. Die Franken bestatteten ihre Toten auf Reihengräberfriedhöfen (so genannt wegen der einheitlichen Ausrichtung der Gräber). Teile eines solchen fränkischen Friedhofs sind auf dem Gelände des heutigen Schwemlinger Friedshofs freigelegt worden.
Erste urkundliche Erwähnung
Wenn sowohl Bodenfunde als auch die Namensforschung die Anfänge unseres Ortes belegen, so weist die Namensgebung darüber hinaus in die Frühzeit der Frankenherrschaft. Wir können demnach die Siedlungsgründung zwischen 500 und 600 annehmen. Es ist natürlich kaum zu erwarten, daß die Gründung schriftlich belegt ist. Die erste Erwähnung unseres Ortes finden wir in einer Pergament-Güterrolle des Klosters Mettlach aus der Zeit um 1150. Diese Rolle stammt in ihren ältesten Teilen aus dem Jahre 930, weshalb man das Datum der Ersterwähnung Schwemlingens ursprünglich diesem früheren Zeitpunkt zuordnete. Die Rolle wurde jedoch später weiter benutzt; die Eintragungen, die unseren Ort betreffen, stammen aus der angegebenen späteren Zeit. In der Güterrolle heißt es:
„Heimo de Svaemedinga fradidi super altare S. Liutwini II iugera pro salute anime filie sue Gerburge qui sind inter wiehs et Budingam in loco qui dicitur hundesdale.“
Heimo von Svaemedinga schenkte auf dem Altare des hl. Lutwinus 2 Joch (Land) für das Seelenheil seiner Tochter Gerburga, die zwischen (Wald-) Wieß und Büdingen liegen, in einem Gelände, das Hundesdale heißt.
Erste urkundliche Erwähnung Schwemlingens
Die älteste überlieferte Namensform Schwemlingens ist also Svaemedinga. Die Namensforschung zeigt auf, daß in diesem Ortsnamen der germanische Personennamen Sividmot verwendet worden ist. Die Siedlungsgründer dürften demnach die Mitglieder der Sippe des Dividmot, die Sividmotinger (vgl. Svaemedinga) gewesen sein.
Bodenfunde
(von Hans Leisten)
Wie weit die gallo-römische Bevölkerung die Stürme der Völkerwanderung überlebte, ist umstritten. Die Sprachwissenschaftler sind heute der Meinung, daß Teile der früheren Einwohner überlebt haben müssen, weil die alten Fluß- und auch Bachnamen nur so auf uns gekommen sein können.
Es ist erwiesen, daß im Hauptweinbaugebiet der Mosel bis ins 12. Jahrhundert moselromanisch gesprochen wurde. Es gibt auch Orte, wo man zwei Friedhöfe feststellte. Das eine Gräberfeld war seit der Römerzeit belegt und zeigte auch in späterer Zeit Gräber mit einfachen Grabbeigaben oder, wohl unter christlichem Einfluß, beigabenleere Gräber. Daneben bestand ein Friedhof am gleichen Ort, der die für germanische Männer- und Frauengräber typischen Grabbeigaben hatte.
In Schwemlingen kann es ähnlich gewesen sein. Seit langem sind die 13 Steinsärge bekannt, die nach 1830 bei der Anlage des Friedhofes beim Erdaushub von Gräbern gefunden wurden. Sie hatten, wenn sie nicht ausgeraubt waren, die für die merowingische Zeit typischen Grabbeigaben.
Funde aus fränkischer Zeit (Schwerter aus Eisen — 1 und 2, Scheidenzwinge aus Bronze — 2a, und Lanzenspitze aus Eisen — 3)
Es ist noch wenig bekannt, daß wohl noch ein zweiter Friedhof im Bereich der Sebastianstraße bestand. Beim Aushub der Baugrube für das Haus Peter Canaris-Hammes wurden im Kies Verfärbungen mit Keramikteilen und dem Teil einer Gürtelschnalle gefunden. Als man nach dem Bau des Hauses im Garten Kies grub, wurden dort dieselben Beobachtungen gemacht. Herr Canaris sagte mir, daß die Nachbarn beim Hausbau ähnliches feststellten.
Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß ein die Völkerwanderung überlebender Einwohnerteil hier seinen Begräbnisplatz hatte, während die als Sieger und Herren gekommene Sippe des Sividmot sich auf „Krewels“ einen eigenen Friedhof mit viel aufwendigeren Gräbern in Steinsärgen anlegte.
Es ist für Nennig, Pachten, Wehingen und manche andere Orte erwiesen, daß die Franken, als das neue Herrenvolk, sich gern auf den zerstörten Resten der Römerzeit ihre Grablegen schufen. Für Schwemlingen trifft dies auch zu, weil, wie oben erwähnt, auf dem fränkischen Totenacker ein römerzeitlicher Achtecktempel stand.
Es wurden nach der Frankenzeit keine Bodenfunde mehr bekannt, bis Herr Roman Thielen, Im Ecken 16a, beim Aushub seiner Baugrube Teile eines mittelalterlichen Tongefäßes aus dem 12. Jahrhundert fand.
Bodenfundkarte der Gemarkung Schwemlingen
2.3 Schwerpunkte der Ortsgeschichte bis zum Ende des 19. Jahrhunderts
Die Entwicklung des Ortsgefüges
Das heutige Schwemlingen ist aus vier Siedlungsteilen entstanden: Staad, Svaemedinga, Vederfels und Schank.
Staad (auch Stad, Stade, Stadt, Staadt, Statt, Stöd, Staud) lag zwischen der Au, der alten Saar und der heutigen Luxemburger Straße; es war ursprünglich räumlich vom späteren Ortskern getrennt. Der Name leitet sich vom althochdeutschen „Stad“ ab, was Gestade, Ufer bedeutet.
Ursprünglich ein Dorf, ging Staad schon vor 1500 in seiner Größe und Bedeutung zurück, übrig blieb ein Hof, der im Dreißigjährigen Krieg völlig verwüstet wurde. Danach wurde Staad von zugewanderten Lothringern wieder aufgebaut. Im Urkataster sind 1830 „Zu Staad“ etwa zwölf Gebäude erfaßt. Das Kloster Mettlach hatte in Staad ein Hofgut, und zwar an der Stelle der ehemaligen Häuser Marion und Streit (heute Luxemburger Straße 17 und 15).
Haus und Familie Marion haben noch heute den Dorfnamen „Huaf“. Jakob Weiten, geboren am 20. August 1747, war der letzte Pächter des Mettlacher Hofes.
Erwähnungen:
Untertanenliste des Herzogtums Lothringen von 1519 unter Schwemlingen: Gerhart of dem Stad; Bericht von einem Haus zu Staad (dem Grafen von Sayn gehörig); Schöffenweistümer von Merzig und dem Saargau 1529 und 1561: Haus zu Stade; 1582 verleiht das Kloster Mettlach den kleinen Zehnten unter anderem an den Theisen zu Stadt; 1621 wird Staadt als Ort des Kondominiums* Merzig-Saargau genannt; auf der Karte „Mosellae et Sarae Fluvii“ ist Statt um 1740 als Ort eingetragen (nicht aber Schwemlingen).
Svaemedinga (auch Sivimedinga, Swaemedinga, Schwemedingen, Suamedinga, Sweymlingen, Schwemblingen, Schwembling, Schwemling) lag auf beiden Seiten des Kohlenbrucherbachtales, rechts oberhalb des Tales der Teil „Urth“ (Ort), links oberhalb der Teil „Mühlenbach“. „Em Urth“ (der Name ist urkundlich nicht nachzuweisen) ist der Kern des gesamten Siedlungsbereiches, das ursprüngliche Schwemlingen, zu sehen. Sein Umfeld hat sich in dieser Kernfunktion wegen der zentralen Lage für alle Ortsteile bis heute erhalten. Im Urth befand sich ein Hofgut des Kurfürsten von Trier, und zwar auf dem Gelände des heutigen Anwesens Adam. In der Nähe des „Hoffs“ lassen sich heute noch an der Bausubstanz Teile des alten Kernbereiches erkennen.
Der Teil „Mühlenbach“ gruppierte sich an der Mühle des Kurfürsten von Trier auf dem „Hiwwel“.
Alte Bausubstanz im Siedlungskern Schwemlingen (Im Urth)
Erwähnungen (Auswahl):
Güterrolle der Abtei Mettlach um 1150: Heimo von Svaemedinga; Jakob von Montclair überläßt dem Kloster von Wadgassen 1324 eine Kornernte aus der Mühlenbacher Mühle (in Mulenbach apud Swemedingen); Montclair gibt 1438 Gerhard Kerne von Siersburg Renten in Schwemlingen zum Lehen; Gerhart Kerne und seine Familie veräußern 1446 ihren Besitz in Schwemlingen; der Gerichtsbezirk Sweymlingen wird 1446 an den Pfarrer Johann, genannt Seylner, von Hylbryngen verkauft; das Kloster Mettlach besitzt 1498 in Schwemlingen (und Vederfels) den großen und kleinen Zehnten aufgrund der Zugehörigkeit zur Pfarrei St. Gangolf; das Kloster Mettlach vergibt 1582 den kleinen Zehnten an den Theisen zu Stadt und Johann Muelner zu Schwemlingen; das Kloster zu Mettlach gibt 1589 dem Seiler Classen aus Schwemlingen eine Behausung zu Bisserdorf; 1623 wird wegen der Mühle zu Schwemling ein Prozeß geführt; von 1655 gibt es eine Einwohnerliste vom Schwembling; 1789 wird auch in Schwemling ein Beschwerdeheft (Cahier de doléances) verfaßt.
Vederfels (auch Vederfelts, Federfels, Veddervels, Vedderfels, Wederfelts, Federveils, Federfeltz, Federfilz) war ein bedeutender Ort nordwestlich des Siedlungskerns Schwemlingen auf der Höhe des Federfelsberges, einem steil abfallenden Felsmassiv. Heute noch heißt der Flurteil „Am Federfels“. Die Siedlung hatte einen eigenen Bann. Während des 13. und 14. Jahrhunderts muß hier ein Rittersitz bestanden haben, wie zahlreiche urkundliche Erwähnungen belegen. Im Dreißigjährigen Krieg wurde Vederfels völlig zerstört und nicht wieder aufgebaut.
Erwähnungen (Auswahl):
In einem Kaufvertrag von 1288 wird ein Edelgeschlecht von Vederfels genannt; 1290 ist ein Berthold von Federfels zu finden; 1375 verzichtet Johann von Büdingen auf einen Teil seines Gutes in Federfels; der Abt von Mettlach vergibt 1420 das Lehen Federfels an Claudius von Lellig; eine Abgabenliste von Montclair aus dem Jahre 1554 nennt einen Zins, den ein Hirt von Federfels schuldet; in einem Vertrag von 1621 zwischen Kurtrier und Lothringen wird der Ort Federfels namentlich genannt.
Schank war ein weitab gelegenes Dorf in den Schanker Wiesen am Rande der Straße Schwemlingen-Dreisbach. Im heutigen Altschank ist der ursprüngliche Dorfkern noch an der vorhandenen Bausubstanz zu erkennen.
Der Name ist von einer Schänke hergeleitet; sie befand sich bis vor 1900 in „Hentersch-Haus“ (später Haus Nikolaus Bies, heute In der Schank 36).
Schank wurde im Dreißigjährigen Krieg weitgehend zerstört, wurde danach aber wieder besiedelt. Im Urkataster sind 1830 zwei Gebäude verzeichnet.
Erwähnungen: Das Kloster Mettlach besitzt 1498 ein Hofgut zu Schank; ein Verzeichnis der Kellerei Saarburg nennt 1587 einen Reinharden zu Schank bei Schwemlingen. Samson von Warsberg verkauft 1606 Renten und Einkünfte aus Schank. 1621 wird Schank bei der Aufzählung der Saargauorte genannt.
An dieser Stelle muß auf eine weitere Ansiedlung eingegangen werden, den Hof „Roden“ (auch Rode), auf dem Gebiet der heutigen Flur „Roden“ am Rande des Schwemlinger Waldes. Der Hof wurde im Dreißigjährigen Krieg zerstört. An diese Zeit erinnern die Sagen um „Kathrein von Roden“, die an anderer Stelle wiedergegeben werden.
Erwähnungen: Ein Dokument nach 995 aus Mettlach wird auf das Schwemlinger Roden bezogen. Um 1300 wird ein Heinrich Rode erwähnt, der Vater eines Edelknechtes auf Montclair; im Güterbuch der Abtei Mettlach wird 1498 die Vollemohle in Rode genannt.
Die Ortsteile Schwemlingen, Staadt und Schank, nach dem Dreißigjährigen Krieg wieder aufgebaut, sind aus dem Siedlungsbereich Schwemlingen nach und nach zur Gemeinde Schwemlingen zusammengewachsen. Die Namen Staadt, Schank, Urth, Roden und Federfels sind nur noch in Straßenbzw. Flurnamen erhalten.
Die politisch-staatliche Zugehörigkeit
Vor- und frühgeschichtliche Zeit
Für die politische Ordnung in vorgeschichtlicher Zeit waren die Gruppen Familie, Sippe und Stamm zuständig.
Zu einer gewissen staatlichen Ordnung gelangten bereits die Kelten (in unserem Gebiet 600 v. Chr. - 0). Ihre Stämme wurden von Häuptlingen (Königen) angeführt, Adel und Druiden* bildeten Stände mit besonderen Rechten. Unser Ort lag wahrscheinlich im Bereich des keltischen Stammes der Treverer.
Erst die Römer (0 - 400) schufen eine umfassende staatliche Ordnung und Verwaltung nach eigenem Recht. Unser Gebiet gehörte zur Provinz Belgica des Römischen Reiches mit der Hauptstadt Trier.
Die zwischen 500 und 600 gegründete Siedlung Svaemedinga gehörte politisch zum fränkischen Königreich. Die regoinale Verwaltung lag in den Händen von Grafen. Die gebietsmäßige Einteilung des Frankenreiches erfolgte in „Gaue“*. Unser Ort gehörte zum unteren Saargau, der ursprünglich die Ufergebiete zu beiden Seiten der Saar zwischen Biest und Saarschleife umfaßte.
Mittelalter
Zu Ende des Frühmittelalters (um 900) begann eine Entwicklung, die auch für unser Gebiet für viele Jahrhunderte von wesentlicher politischer Bedeutung war: die Zersplitterung des fränkischen Reiches in Territorialherrschaften*. Hierdurch wurden die alten fränkischen Gaue aufgelöst und den verschiedenen neuen Herrschaftsbereichen eingegliedert.
In unserem Raume waren ursprünglich das Herzogtum Lothringen, das Erzstift (später Kurfürstentum) Trier und die Grafschaft Luxemburg mit territorialen Rechten vertreten, durch Verkauf schließlich nur noch Lothringen und Trier. Da im Gebiet Merzig-Montclair-Mettlach die gegenseitigen Grenzen und Rechte zwischen Lothringen und Trier nicht klar abgegrenzt waren und ihre Besitzungen beiderseits der Saar bunt durcheinander lagen, kam es zu ständigen Auseinandersetzungen über Grenzverläufe, Hoheitsrechte und Einkünfte.
Im Jahre 1368 schloß man daher einen Vertrag, der die gemeinschaftliche Oberhoheit und Verwaltung im strittigen Gebiet vorsah; es entstand das Kondominium (oder die Gemeinherrschaft)* Merzig-Saargau.
Die Gemeinherrschaft war in drei Verwaltungseinheiten, Meiereien genannt, gegliedert. Schwemlingen war der Hauptort der Untermeierei Saargau (auch Schwarzmeierei genannt) mit den weiteren Orten Weiler, Büdingen, Wellingen, Büschdorf, Wehingen und Bethingen.
Die Vereinbarungen zur gemeinsamen Verwaltung von Merzig-Saargau verhinderten in der Folge nicht, daß immer wieder Streitfälle auftraten, unter denen besonders die Bevölkerung zu leiden hatte.
Neuzeit
Als 1654 Lothringen von Frankreich besetzt wurde, hatten die Franzosen in der Gemeinherrschaft Merzig-Saargau Mitspracherecht. Dieser Zustand wurde wieder rückgängig gemacht, als Lothringen 1659 von Frankreich dem Herzog zurückgegeben werden mußte.
1670 brachte sich Frankreich unter Ludwig XIV. erneut in den Besitz Lothringens und sicherte sich damit wiederum die Mitherrschaft in der Gemeinherrschaft Merzig-Saargau. Ab 1680 setzt sich Frankreich durch Reunion* in den alleinigen Besitz der Herrschaft in Merzig und im Saargau. Nach einem verlorenen Krieg, der auch unserer Gegend wieder drückende Lasten auferlegt hatte, mußte Ludwig XIV. 1697 die meisten der reunierten Gebiete abtreten; der Herzog von Lothringen wurde wieder in seine Rechte eingesetzt.
Der spanische Erbfolgekrieg brachte 1704 erneut die Besetzung Triers und des Saargaues durch Frankreich, die bis 1714 andauerte. Damit hatte der lothringisch-trierische Raum in den einhundert zurückliegenden Jahren (seit 1618 — Beginn des 30jährigen Krieges) nur ingesamt zehn Friedensjahre erlebt. 1766 wurde Lothringen französische Provinz.
In der immer noch bestehenden Gemeinherrschaft Merzig-Saargau trat Frankreich folglich in die alten lothringischen Rechte ein. Um klare Verhältnisse im Kondominium zu schaffen, wurde es durch einen Vertrag vom 1. Juli 1778 zwischen Frankreich und Kurtrier geteilt. Die Saar bildete die Grenze: Die Orte links der Saar, damit auch Schwemlingen, erhielt Frankreich, die Gemeinden rechts der Saar fielen an Trier. 1779 wurde unsere Bevölkerung in der Pfarrkirche St. Gangolf feierlich aus ihrer doppelten Untertanenschaft entlassen. Die nun französischen Orte, mit ihnen Schwemlingen, wurden von dem Baillage (Amtsbezirk) Busendorf aus verwaltet.
Die französische Revolution (Beginn 14. Juli 1789) beseitigte nicht nur den Feudalismus* auch in unserem Raum, sie brachte ebenfalls eine Neueinteilung der Verwaltung. Unser Ort gehörte danach zum Kanton Sierck im Arrondissement Thionville des Moseldepartements mit der Hauptstadt Metz. Schwemlingen war für die Regelung der örtlichen und überörtlichen Verwaltungsangelegenheiten eine eigenständige Mairie (Bürgermeisterei), die von einem Maire (Bürgermeister) verwaltet wurde. Zur Mairie Schwemlingen gehörten alle Gemeinden, die auch zur Untermeierei Saargau gehört hatten.
Nach der Niederwerfung Napoleons durch Preußen und seine Verbündeten kam die Saargegend 1814/15 zu Preußen. Die Neuorganisation der Verwaltung hatte für Schwemlingen folgendes Ergebnis: Zuordnung zur neugeschaffenen Bürgermeisterei Hilbringen und zum Kreis Merzig im Regierungsbezirk Trier. Diese Ordnung blieb mehr als hundert Jahre gültig, in der Zuordnung zum Kreis Merzig/Wadern bis zum heutigen Tag.
Die folgende Übersicht macht das ganze Ausmaß des wechselhaften politischen Schicksals unseres Ortes im Laufe seiner Geschichte bis ins 19. Jahrhundert deutlich:
Keltisch
600 v. Chr.
— 0
Römisch
0
— 400
Fränkisch
400
— 1368
Gemeinherrschaft:
a) lothringisch-trierisch
1368
— 1654
b) französisch-trierisch
1654
— 1659
c) lothringisch-trierisch
1659
— 1670
d) französisch-trierisch
1670
— 1680
Französisch
1680
— 1697
Gemeinherrschaft:
a) lothringisch-trierisch
1697
— 1704
b) französisch-trierisch
1704
— 1714
c) lothringisch-trierisch
1714
— 1766
d) französisch-trierisch
1766
— 1778
Französisch
1778
— 1815
Preußisch
ab 1815
Aus der Zeit der Hexenprozesse
Die Hexenverfolgungen erlebten gegen Ende des 16. Jahrhunderts in unserem Raume einen Höhepunkt; die meisten bisher urkundlich belegten Hexenprozesse fanden zwischen 1588 und 1603 statt, einzelne bis 1634. Über eine Schwemlinger Hexe finden sich keine Berichte. Jedoch treten Schwemlinger Zeugen in einem der ersten bekannten Hexenprozesse unserer Gegend gegen Meiers Kathrin aus Wellingen (Käthchen von Wellingen genannt) im Jahre 1588 auf. Es waren dies: Schultheißen Jakob, Stader Lena und Stader Els.
Die Zeit des Dreißigjährigen Krieges
Die Kriegshandlungen des Dreißigjährigen Krieges griffen erst 1632 auf unseren Raum über, und dies in einer derart tiefgreifenden Einwirkung, wie sie seit der Völkerwanderung nicht mehr eingetreten war. Zunächst diente unser Gebiet hauptsächlich als Aufmarsch- und Durchmarschgebiet lothringischer, französischer, schwedischer, kaiserlicher und spanischer Truppen mit allen Folgen (Heerlager, Einquartierungen, Beschlagnahmungen, Kriegskosteneintreibung).
1635 fluteten die Reste des geschlagenen französisch-schwedischen Heeres durch unseren Raum zurück, verfolgt von kaiserlichen und lothringischen Truppen. Die Kaiserlichen besetzten unser Land und verwüsteten es. Ihre Soldaten waren überwiegend ungarische, kroatische und polnische Söldner. Vor allen die Kroaten taten sich durch eine besondere Lust am Brennen und Morden hervor. Nachdem die kaiserliche Armee abgezogen war, blieben Reste dieser Söldnerarmee im Lande und zogen als räuberische Banden plündernd und zerstörend umher. Dies wurde auch durch den Friedensschluß von 1648 nicht anders. Bandentum und Kleinkrieg gingen in unserer Gegend weiter. Erst 1659 kam es zu einem Friedensvertrag, der den Dreißigjährigen Krieg auch bei uns beendete.
Die Folgen der Kriegszeit waren verheerend. Der Krieg hatte, unterstützt durch Hunger und Krankheit (vor allem die Pest), das Land verwüstet und fast menschenleer gemacht. Der Siedlungsbereich Schwemlingen war überwiegend zerstört, Staad, Federfels und der Hof Roden völlig. Auch die in der Anfangszeit der kriegerischen Ereignisse in Schwemlingen erbaute St. Sebastianus-Kapelle war in Schutt und Asche gefallen. Den wenigen Übriggebliebenen fehlte Vieh, Saatgut und Gerät. Eine weitere große Schwierigkeit ergab sich aus der eingetretenen Unsicherheit über die Besitzverhältnisse. Tod und Wegzug hatten herrenlose Güter entstehen lassen, die häufig von Ortsfremden in Besitz genommen wurden. Die vereinzelt verbliebenen Bauern bewirtschafteten verständlicherweise nur den besten Boden. So mußten allenthalben die Besitzverhältnisse neu geregelt werden. Aus dieser Zeit könnte die Erzählung „Die Schwemlinger überlisten die Büdinger“ stammen, die an anderer Stelle wiedergegeben wird.
Die Neuordnung geschah vor allem aufgrund von Begehungen der Gemarkung. Als man auf diese Weise 1656 auch den Schwemlinger Bann neu ordnete, wurden nur neun Bauernfamilien gezählt, von denen zwei zudem nicht im Ort ansässig waren.
(Schwembling: Adam Wagner, Fichter Matthes Erb, Nonner Mattheß, Matthes Seiler, Scholtzen Peter, Schwartzmeyer Matthes, Hein Peter Engel zu Bessering, Austgen Johannes zu Brotdorf, Kieffers Laudtwein).
In einem anderen Bericht aus dem Jahre 1663 heißt es gar, daß die Untermeierei Saargau (7 Dörfer mit Schwemlingen als Hauptort) insgesamt nur fünf Einwohner (Haushaltungen) gehabt habe. Dies beweist die tragische Wirkung des Dreißigjährigen Krieges auch im Schwemlinger Siedlungsgebiet.
1667 wird die Zahl der Feuerstellen (Haushaltungen) in der Untermeierei Saargau mit insgesamt acht angegeben (1624, vor dem Dreißigjährigen Krieg, waren es noch 80, davon 18 in Schwemlingen).
Schwemlingen hatte 1667 keinen Einwohner mehr, der steuerzahlungsfähig gewesen wäre.
2.4 Die Ortsentwicklung in unserem Jahrhundert
Die Bereiche Politik und Verwaltung
In den großen Zügen der politischen Entwicklung teilte Schwemlingen das Schicksal des Landes an der unteren Saar. Für den Bereich der Kommunalpolitik waren die Selbständigkeit Schwemlingens als Gemeinde und seine Zuordnung zur 1814 geschaffenen Bürgermeisterei Hilbringen bestimmende Faktoren.
Von der Amtsgemeinde zum Stadtteil
Bereits 1811, zur Zeit französischer Herrschaft, war durch ein Dekret die Mairie Schwemlingen aufgelöst und die nach wie vor selbständige Gemeinde Schwemlingen der Mairie Hilbringen eingegliedert worden. Ab 1935 wurde aus der Bürgermeisterei Hilbringen das Amt Hilbringen. Die Zugehörigkeit zu diesem Amt (wie vorher zur Bürgermeisterei) bedeutete die Verlagerung eines Teiles der Verwaltung der angeschlossenen Gemeinden auf die zentrale Behörde, für die Bürger den Weg zum Amtssitz in Hilbringen.
Als zu Beginn der 70er Jahre die Gebiets- und Verwaltungsreform im Saarland anstand, wurde von der Mehrheit der Schwemlinger Gemeindevertreter der Plan zur Bildung einer Großgemeinde aus den 13 Hilbringer Amtsbezirksgemeinden unterstützt. Das „Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden und Landkreise des Saarlandes“ vom 19. 12. 1973 brachte jedoch eine andere Lösung: Die Gemeinde Schwemlingen wurde mit 16 anderen Gemeinden und der alten Stadt Merzig zur neuen Stadt Merzig zusammengefaßt. Diese Reform trat am 1. Januar 1974 in Kraft. Schwemlingen ist nach der derzeitigen Gesetzeslage ein Gemeindebezirk (Stadtteil) mit eigenem Namen und Wappen. Der gewählte Ortsrat mit dem Ortsvorsteher an der Spitze hat im gesetzlichen Rahmen bestimmte Rechte und vertritt die Interessen des Bezirkes der Gesamtgemeinde (Stadt) gegenüber.
Der Ortsrat hat zu allen Angelegenheiten des Ortes Vorschlagsrecht, er ist in Angelegenheiten, die den Ort betreffen, zu hören und hat Stellung zu nehmen. Entscheidungsbefugnisse kommen dem Ortsrat in folgenden Punkten zu: Unterhaltung, Ausstattung und Nutzung der im Ort gelegenen öffentlichen Einrichtungen (z. B. Kindergarten, Sportanlagen, Friedhof, Halle), Festlegen der Reihenfolge von Straßenbaumaßnahmen, Pflege des Ortsbildes, Förderung von Vereinen, Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen u.a. Der Ortsvorsteher ist Ehrenbeamter. Zu seinen Aufgaben und Rechten gehört u. a. die Ausstellung von Lebensbescheinigungen und amtlichen Beglaubigungen, Entgegennahme von Anträgen und die Repräsentation des Ortes.
Das politische Schicksal zwischen den beiden Weltkriegen
Der erste Weltkrieg brachte in Schwemlingen an kriegerischen Handlungen einen Bombenabwurf: Etwa sieben Bomben fielen auf das Gelände am „Brückenberger Bur“ und am Sportplatz, ohne großen Schaden anzurichten. Der Grund für den Bombenabwurf wird in dem Umstand vermutet, daß an diesem Abend im Saale Wilhelm eine Filmvorführung stattgefunden hat und daß die hell erleuchteten Fenster den Abwurf provoziert haben. Mit der Besetzung des Saarraumes durch Frankreich und der Begründung des „Saargebietes“ als Folge des ersten Weltkrieges wurde Schwemlingen Grenzort, die Gemarkungsgrenze im nördlichen Scheidwaldgebiet Landesgrenze. Französische Zollbeamte wurden im Ort stationiert. Sie wohnten anfangs bei Schwemlinger Bürgern, zu denen sich ein gutes Verhältnis entwickelte. In den 20er Jahren wurden für die Zöllner und ihre Familien gegenüber der ehemaligen Gastwirtschaft Leick am Ortsausgang in Richtung Weiler Wohnhäuser, die sogenannten „Zollhäuser“, gebaut. Die wirtschaftlichen Verhältnisse besserten sich nach dem Weltkrieg im Saargebiet rascher als im übrigen Deutschland durch die ungehinderte Einfuhr französischer Waren. Preisvorteile auf der einen oder anderen Seite der Zollgrenze versuchten manche durch Schmuggel zu nutzen.
Die Saarabstimmung 1935 hinterließ mit ihren Begleiterscheinungen auch in unserem Ort ihre Spuren: Gründung einer Ortsgruppe der Deutschen Front, der die meisten Einwohner beitraten, Fahrten von Gruppen und Vereinen nach Deutschland zu Feiern und politischen Veranstaltungen, Rückgliederungsparolen an den Hauswänden usw. Auf die Rolle des ehemaligen Pfarrers Arenz im Abstimmungskampf wird später eingegangen.
Die Schwemlinger mußten zur Abstimmung nach Hilbringen; wer krank und bettlägerig war, wurde mit dem Krankenwagen dorthin gebracht. Der Jubel über das bekannte Abstimmungsergebnis war auch in Schwemlingen sehr groß. Eine lebensgroße Puppe als Symbol des unterlegenen „Status-quo“ (Beibehaltung des Sonderstatus des Saargebietes) wurde auf dem Kapellenplatz aufgehängt. Der Tag der Rückgliederung, der 1. März 1935, wurde auch in Schwemlingen ausgiebig gefeiert. In der Folge trat an die Stelle der Deutschen Front die NSDAP. Nachdem Schwemlingen zunächst der Ortsgruppe Hilbringen der Partei unterstanden hatte, wurde nach starkem Mitgliederzustrom eine eigene Ortsgruppe gebildet, zu der auch die Mitglieder aus den Orten Weiler, Büdingen und Wehingen gehörten. Die Hakenkreuzfahne beherrschte bei Feierlichkeiten das Ortsbild, Transparente und Wandschriften verkündeten u.a.: „Ein Volk, ein Reich, ein Führer“. In Schwemlingen war ein Parteibüro mit zwei Räumen eingerichtet, dem auch eine Dienststelle des „Amtes für Volkswohlfahrt“ zugeordnet war. Der SA-Reiter-Sturm, Standort Merzig, zählte in Schwemlingen 10 Aktive. Die Parteimitglieder und ihre Familienangehörigen waren in ihren jeweiligen Organisationen erfaßt: die Schulkinder im „Jungvolk“, die Jugendlichen in der „Hitlerjugend“ (HJ) und im „Bund deutscher Mädchen“ (BDM), die Erwachsenen in der NSDAP und der SA, die Frauen in der NS-Frauenschaft usw.
Am 1. Juli 1937 wurde in Schwemlingen ein Lager des weiblichen „Reichsarbeitsdienstes“ (RAD) eingerichtet. Zu diesem Zweck war das Haus Lessel umgebaut worden. Etwa 20 — 30 „Arbeitsmaiden“ leisteten hier in militärähnlich organisiertem Lebensablauf eine halbjährige Ausbildungs- und Dienstzeit pflichtmäßig ab; wie wurden während dieser Zeit in Schwemlingen und Umgebung auch als Hilfen in der Landwirtschaft, im Haushalt, zur Kinderbetreuung, im Kindergarten usw. eingesetzt.
Die Zeit des zweiten Weltkrieges
Einer der Vorboten des zweiten Weltkrieges war der Westwall, ein System von Bunkern und Panzersperren, das in unserem Raum rechts der Saar und als „Orscholzer Riegel“ von 1938 an errichtet wurde. Auch in Schwemlingen waren über 200 Westwallarbeiter aus allen Gegenden Deutschlands über ein Jahr lang einquartiert, und zwar überwiegend in den Gasthäusern, deren Säle zu Schlafstätten hergerichtet waren und die auch die Beköstigung zu übernehmen hatten.
Am 3. September 1939 erfolgte der Befehl zur Räumung der „Roten Zone“, einem etwa 10 km breiten Grenzstreifen, in dem auch unser Ort lag. In aller Eile wurde gepackt. Mit Pferde- oder Kuhwagen, mit dem Fahrrad oder zu Fuß suchten die Menschen die rechte Saarseite zu erreichen. Von hier aus ging es dann per Eisenbahn ins „Bergungsgebiet“ nach Thüringen, Hessen, Sachsen, Franken usw.
Schwemlinger auf dem Weg ins „Bergungsgebiet“ am 7. September 1939 in St. Goar
Im Sommer 1940 konnten die „Rückgeführten“ wieder in ihre Heimat, die praktisch ohne Kriegsschäden geblieben war. Unterdessen hatten die „Frontbauern“ (in Schwemlingen Nikolaus Weber, Jakob Adam, Alfons Streit, Josef Leick, Matthias Streit, Nikolaus Adam) die Felder gemeinschaftlich und mit Unterstützung des Militärs bestellt. Wenn auch die Rückkehr der Bevölkerung eine gewisse Erleichterung schaffte, so wurden die Zeiten doch immer härter. Zu äußerem Mangel kamen vermehrt persönliche Einsätze der Daheimgebliebenen: Die Frauen arbeiteten bei Behörden, in Fabriken und wurden neben Jugendlichen ab Herbst 1944 zu Schanzarbeiten an Lauf- und Panzergräben eingesetzt. In der Nähe der Zollhäuser wurde eine „Panzersperre“ aus Baumstämmen errichtet. Im Saale Wilhelm und in anderen Häusern waren in dieser Zeit etwa 40 „Schanzerjungen“, 14- bis 15jährige Hitlerjungen, einquartiert. Ab Mai 1944 gab es ständig Fliegeralarm, bei Tag und Nacht. Die Schwemlinger flüchteten in Keller oder aufs freie Feld. Im November/Dezember 1944 folgte die zweite Evakuierung. Nicht alle verließen den Ort, sie wollten hier das Kriegsende erwarten. Die einrückenden Amerikaner führten die Verbliebenen aus dem hiesigen Kampfgebiet nach Hemmersdorf zurück. Da die Amerikaner an der Saarfront einen Angriff erwarteten, verbrannten sie in Schwemlingen viele Häuser, 32 insgesamt; das waren etwa 30 Prozent des Wohnraumes im Ort.
Im März 1935 überquerten die Amerikaner die Saar und drangen in breiter Front ostwärts vor. Viele der Evakuierten wurden so von der Front überrollt und waren bestrebt, so rasch wie möglich nach Hause zu kommen.
Neubeginn nach dem zweiten Weltkrieg und Entwicklung bis heute
Langsam kehrten die Menschen in den trostlos anmutenden, stark beschädigten Ort zurück und richteten sich notdürftig ein. Allenthalben herrschte Mangel, die Lebensmittel waren rationiert. Landprodukte, Obst, Buchecker und Altmetall mußten in den ersten Jahren abgeliefert werden.
Die Amerikaner hatten ein Ausgehverbot ab 21.00 Uhr erlassen und setzten ihnen vertrauenswürdige Einwohner als Bürgermeister ein. In Schwemlingen war dies Philipp Leinen, der sich bei den nach Hemmersdorf gebrachten Einwohnern befunden hatte. Mitte Juli 1945 lösten französische Truppen die amerikanischen ab. Zum Ortsbürgermeister wurde Robert Gunkel ernannt. Bis zum Herbst 1945 waren die meisten Schwemlinger zurückgekehrt. Im MRS (Bewegung zum Anschluß der Saar an Frankreich) fanden auch in Schwemlingen ehemalige Funktionsträger der nationalsozialistischen Zeit eine Rückversicherung gegen Beschlagnahmungen und andere unangenehmen Maßnahmen der Besatzung. Als im Dezember 1945 wieder demokratische Parteien zugelassen wurden, entstanden in Schwemlingen die CVP (Christliche Volkspartei des Saargebietes) und die SPS (Sozialdemokratische Partei, Bezirk Saar). Am 15. September 1946 fanden die ersten Gemeinderatswahlen statt. Sie hatte in Schwemlingen folgendes Ergebnis:
wahlberechtigt:
551
abgegebene Stimmen:
506
gültige Stimmen:
433
CVP:
216
SPS:
217
Erster gewählter Nachkriegsbürgermeister wurde der Landwirt Nikolaus Adam (CVP). Er hatte dieses Amt bis 1956 inne. 1954 wurde in Schwemlingen eine Ortsgruppe der DPS (Demokratische Partei des Saarlandes) gegründet.
Der Abstimmungskampf über ein europäisches Saarstatut brachte 1954/55 nicht weniger politischen Zündstoff in unseren Ort als der von 1934/35. Das Ergebnis der Abstimmung am 25. Oktober 1955 in Schwemlingen lautete (in Klammern die Vergleichszahlen für das Saarland):
für das Saarstatut:
173
gegen das Saarstatut:
527
Am 1. Januar 1957, dem Tag des politischen Anschluses an die Bundesrepublik Deutschland, wurde in Schwemlingen ein Fackelzug veranstaltet, der durch die Straßen zum Schulhof führte, wo ein großes Feuer entzündet war. Hier fand eine Feier der Gemeinde unter Mitwirkung von Schwemlinger Vereinen statt.
Die Gemeinderatswahl am 15. Mai 1956 hatte bereits unter den Bedingungen der neuen „Parteienlandschaft“ stattgefunden. Hier ihr Ergebnis:
wahlberechtigt:
739
abgegebene Stimmen:
651
gültige Stimmen:
541
CDU
216
SPD
177
DPS
148
Der neue Gemeinderat wählte den Landwirt Peter Streit (CDU) zum Bürgermeister. Er blieb bis 1960 im Amt. Nach der Gemeinderatswahl vom 15. Mai 1960 wurde der Schlosser Oskar Bungert (SPD) zum Bürgermeister gewählt. Er war jedoch nur wenige Monate im Amt, denn am 4. Dezember wurden die Gemeindeparlamente erneut gewählt, nachdem die Wahlen vom 15. Mai für ungültig erklärt worden waren. Das Ergebnis dieser Wahl vom 4. 12. 1960 lautete:
wahlberechtigt:
827
abgegebene Stimmen:
709
gültige Stimmen:
668
CDU
254
SPD
225
DPS
99
Christliche Wählergemeinschaft
90
Der neue Gemeinderat wählte den Finanzangestellten Fritz Kuhn (CDU) zum Bürgermeister. Die folgenden Gemeinderatswahlen brachten bis heute stets Mehrheiten, die eine Wiederwahl von Fritz Kuhn sicherstellten. Im Ortsrat Schwemlingen sind derzeit CDU (7 Sitze) und SPD (4 Sitze) vertreten. Gegenwärtig bestehen eigene Ortsverbände der CDU und der SPD in Schwemlingen. Auch die Junge Union (JU), die Jugendorganisation der CDU, besteht als selbständige Gruppe im Ort.
Der Anhang 4 enthält eine Auflistung der bisherigen Schwemlinger Ortsvorsteher, soweit sie festgestellt werden konnten.
Im folgenden sind die aufgrund demokratischer Wahl ins Amt gekommenen Nachkriegsbürgermeister Schwemlingens abgebildet.
Bürgermeister Nikolaus Adam (1946 - 1956)
Bürgermeister Peter Streit (1956 - 1960)
Bürgermeister Oskar Bungert (1960)
Bürgermeister Fritz Kuhn (1960 - 1974); seit 1974 bis heute Ortsvorsteher
Am 12. Juni 1962 wurde der Gemeinde Schwemlingen ein Wappen verliehen. Man hatte als Anlaß das 80jährige Stiftungsfest des Männergesangvereins „Sängerbund 1882“ Schwemlingen und den Rahmen eines Heimatabends gewählt. Der Entwurf des Wappens stammt von Kurt Hoppstädter.
Das Schwemlinger Wappen: In Blau (hier die linierten Felder) befindet sich ein silberner Wellenschrägbalken (die Saar symbolisierend), begleitet oben von zwei gekreuzten silbernen Löffeln (Löffelgießertradition), unten von vier silbernen Kreuzen (die vier ehemaligen Schwemlinger Siedlungsteile)
Versorgung und öffentliche Einrichtungen
Für die Bewohner eines Gemeinwesens ist neben dessen politisch-verwaltungsmäßiger Entwicklung die Ausgestaltung seiner Lebens- und Versorgungsbedingungen von mindest gleichgroßer Bedeutung.
Die Wasserversorgung in Schwemlingen wurde ursprünglich durch die öffentlichen und privaten Brunnen sichergestellt. 1905 erhielt Schwemlingen ein Wasserleitungsnetz. Bis nach dem zweiten Weltkrieg wurde das Wasser von den Abnehmern pauschal bezahlt. Wasseruhren erhielten die Haushalte erst im Jahre 1956. Nikolaus Kruppert, dann Schmiedemeister Jakob Adam waren Rohrmeister der Gemeinde; ihnen oblagen die Aufsicht und Reparatur des Leitungsnetzes.
Schwemlingen versorgte sich ursprünglich aus einer gemeindeeigenen Quelle bei Weiler. Von dort wurde das Wasser in einen Hochbehälter am Nordhang des Waldgebietes „Auf Amerika“ geleitet. 1951 wurde diese inzwischen zu enge und störungsanfällige Zuleitung durch eine Leitung mit größerem Durchmesser ersetzt. Dadurch wurde ein allmählich entstandener Engpaß in der Wasserversorgung behoben. 1954 wurde die Fall-Wasserleitung vom Hochbehälter in den Ort erneuert. 1956 schloß sich die Gemeinde dem Wasserleitungszweckverband Hilbringen an, um eine Erneuerung des gesamten schadhaften Rohrnetzes in der alten Ortslage zu beschleunigen. Dies geschah in den folgenden Jahren nach und nach.
Im Zuge des weiteren Ausbaues der Wasserversorgung wurde ein neuer Hochbehälter am Altenberg gebaut, der aus der Tiefenbohrung bei Weiler gespeist wird. Von hier aus wird unser Ort derzeit mit Wasser versorgt. Es handelt sich um recht hartes Wasser des Härtebereiches 3 (allerdings mit einem sehr niedrigen Nitratgehalt). Eine Reserveleitung von Fitten zum Hochbehälter am Altenberg stünde bei Ausfall der Zuleitung von Weiler zur Verfügung. Es ist geplant, eine neue Verbindungsleitung zwischen den Hochbehältern Hilbringen und Altenberg zu bauen. Dies hätte für Schwemlingen zwei Vorteile: Einmal wäre die Wasserversorung des Ortes auf ein zweites Standbein gestellt, zum anderen könnte ein weicheres Mischwasser ins Schwemlinger Netz gegeben werden (Härtebereich 2 — 3 als Mittelwert).
Die Versorgung mit elektrischer Energie begann in Schwemlingen im Jahre 1914, als ein entsprechendes Leitungsnetz verlegt wurde. Wir lesen hierzu in der Schulchronik folgenden zeitgenössischen Bericht: „Eine sehr wichtige und praktische Einrichtung wurde im Sommer 1914 getroffen. Schwemlingen bekam nämlich Anschluß an die Überlandzentrale. Jetzt erstrahlte es in „neuem Lichte“ und wurde dieserhalben oft von Besseringen beneidet, das das Licht erst später bekam.“