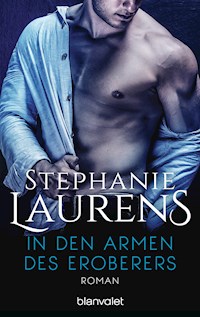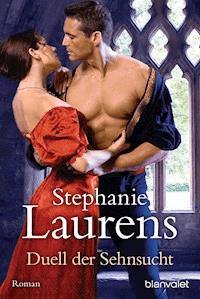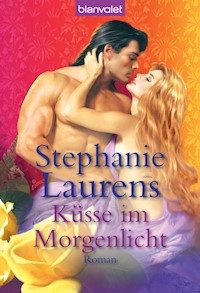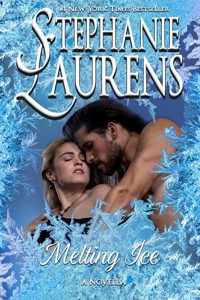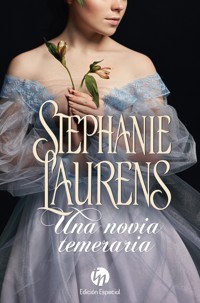5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MIRA Taschenbuch
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Cynster Sisters
- Sprache: Deutsch
Gibt es in London keine wahren Männer mehr? Die blassen Jünglinge, die sich in den eleganten Ballsälen tummeln, interessieren Heather Cynster nicht. Sie will im Sturm erobert werden, von einem Gentleman, für den Leidenschaft kein Fremdwort ist. Nur ein solch verwegener Held kommt für sie als Ehemann infrage. Um endlich dem Richtigen zu begegnen, besucht die junge Lady eine verruchte Soiree. Doch der Abend verläuft geradezu desaströs: Nicht nur, dass ein gewisser Viscount Breckenridge sich als Tugendwächter aufspielt und Heather somit sämtliche Chancen ruiniert. Nein, zu guter Letzt wird sie vor seinen Augen auch noch entführt! Ausgerechnet Breckenridge ist nun ihre letzte Hoffnung. Wird er sich als der furchtlose Held erweisen, den sie jetzt braucht?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 696
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Stephanie Laurens
Sehnsucht nach verruchten Küssen
Roman
Aus dem Amerikanischen von Nina Hawranke
MIRA® TASCHENBUCH
MIRA® TASCHENBÜCHER erscheinen in der HarperCollins Germany GmbH, Valentinskamp 24, 20354 Hamburg Geschäftsführer: Thomas Beckmann
Copyright © 2016 by MIRA Taschenbuch in der HarperCollins Germany GmbH
Titel der nordamerikanischen Originalausgabe: Viscount Breckenridge To The Rescue Copyright © 2011 by Savdek Management Proprietary Ltd. erschienen bei: Avon Books, an imprint of HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Konzeption/Reihengestaltung: fredebold&partner GmbH, Köln Umschlaggestaltung: pecher und soiron, Köln Redaktion: Bettina Lahrs Titelabbildung: Thinkstock; Romancenovelcovers.com
ISBN 978-3-95649-523-6
www.mira-taschenbuch.de
Werden Sie Fan von MIRA Taschenbuch auf Facebook!
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind Vorbehalten.
Der Preis dieses Bandes versteht sich einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Alle handelnden Personen in dieser Ausgabe sind frei erfunden.
PROLOG
Februar 1829
Im Schloss herrschte Stille, nichts regte sich. Draußen lag hoch Schnee, eine weiße Decke, unter der Hügel und Tal, loch und Wald begraben waren.
Er saß in der Waffenkammer, einem seiner Zufluchtsorte. Den Kopf gesenkt, war er in das Reinigen der Waffen vertieft, die vorhin benutzt worden waren. Als es kurz aufgeklart hatte, war er mit einigen Männern auf die Jagd gegangen. Mit dem erlegten Wild würden sie das Schloss eine Woche lang, wenn nicht länger, versorgen können. Eine kleine Befriedigung, aber immerhin.
Fleisch – wenigstens das konnte er beschaffen.
Jemand näherte sich entschlossenen Schrittes. Das vage Gefühl der Zufriedenheit schwand. Stattdessen befiel ihn ... Er fand kein treffendes Wort für den Aufruhr in sich, in dem Wut, Verzweiflung und Furcht dominierten.
Seine Mutter betrat die Kammer.
Er hob nicht einmal den Kopf.
Der Tisch, an dem er saß, nahm die Mitte des Raumes ein. Seine Mutter blieb an einem Ende des Möbels stehen.
Obwohl er ihren durchdringenden Blick auf sich spürte, fuhr er stoisch damit fort, das Gewehr zusammenzusetzen, das er gesäubert hatte.
Sie brach das Schweigen als Erste. Mit der flachen Hand schlug sie auf den Tisch, beugte sich vor und zischte: „Schwöre es! Schwöre, dass du es tun wirst – dass du nach Süden gehen, dir eine der Cynster-Schwestern packen und sie herbringen wirst, auf dass ich Rache üben kann.“
Er ließ sich Zeit mit einer Erwiderung, tat schwerfällig, wie stets. Das hatte er sich angewöhnt, um sein wahres Wesen zu verbergen und andere besser manipulieren zu können. In diesem Fall allerdings war seine Mutter so gewieft vorgegangen, dass sie nunmehr ihn am Haken hatte.
Das nagte an ihm.
Nach wie vor fragte er sich, was gewesen wäre, hätten sich die Dinge anders entwickelt. Wäre ihm früher aufgefallen, dass sie etwas im Schilde führte, wenn er ihrem Geschwafel aufmerksamer gelauscht hätte? Früh genug, um eingreifen und sie aufhalten zu können? Andererseits war sie so, seit er denken konnte: voller schwarzer Gedanken, den glühenden Wunsch nach Vergeltung im Herzen.
Sein Vater hatte nie erkannt, wie sie wirklich war. Ihm gegenüber hatte sie eine liebenswürdige Maske zur Schau getragen, mit der sie erfolgreich die Bitterkeit in ihrem Innern kaschiert hatte. Er hatte gehofft, dass mit seines Vaters Tod die schwarze Galle aus ihrem Herzen schwinden würde. Stattdessen quoll das Gift umso zersetzender hervor.
Zu sehr war er ihr Gezeter gewohnt; er schenkte ihm schon lange kein Gehör mehr.
Wie es aussah, mussten er und andere nun die Zeche dafür zahlen.
Für Reue und erst recht für Selbstvorwürfe war es zu spät.
Er schaute gerade so weit auf, dass er sie ansehen konnte, sorgsam darauf bedacht, seine Gefühle nicht preiszugeben. Einen Moment lang hielt er ihrem Blick stand, ehe er knapp nickte. „Aye, das werde ich.“ Er zwang sich auszusprechen, was sie hören wollte. „Ich werde eine der Cynster-Schwestern herbringen, damit Sie Rache üben können.“
1. KAPITEL
März 1829Wadham Gardens, London
Kaum hatte Heather Cynster einen Fuß in Lady Herfords Salon gesetzt, als ihr auch schon klar wurde, dass ihr Plan, sich einen geeigneten Gatten zu angeln, zum Scheitern verurteilt war.
In einem entlegenen Winkel des Salons wurde ein Kopf gehoben, dessen dunkler Schopf so perfekt wie fesch frisiert war, ganz der neuesten Mode entsprechend. Der stechende Blick zweier haselnussbrauner Augen wurde auf sie gerichtet und schien sie zu durchbohren.
„Verflixt!“ Unwillkürlich biss sie die Zähne zusammen, ohne ihr Lächeln verblassen zu lassen. Als wäre ihr nicht aufgefallen, dass der spektakulärste Mann im Raum sie anstarrte, ließ sie den Blick schweifen.
Breckenridge, zu dem der dunkle Schopf gehörte, wurde nicht nur von einer, sondern gleich von drei atemberaubend schönen Damen belagert, die unverhohlen um seine Gunst buhlten. Heather wünschte ihnen aufrichtig Glück und betete, er möge vernünftig sein und so tun, als hätte er sie nicht entdeckt.
Sie jedenfalls würde vorgeben, ihn nicht bemerkt zu haben.
Entschlossen verbannte sie Breckenridge aus ihren Gedanken und betrachtete die erstaunlich umfangreiche Gästeschar, die Lady Herford zu ihrer Soiree geladen hatte.
Die meisten Gäste waren älter als sie – zumindest die Damen. Einige kannte sie, andere nicht; jedenfalls hätte es sie verwundert, wenn auch nur eine der hier versammelten Frauen unverheiratet gewesen wäre. Oder verwitwet. Oder gar wie Heather zur Kategorie „alte Jungfer“ gehört hätte. Auf Soireen, wie Lady Herford sie gab, fanden sich vorrangig kultivierte, aber gelangweilte Matronen ein. Diejenigen also, denen nach amüsanterer Gesellschaft war, als sie der jeweilige, meist um einiges ältere und gesetztere Gatte zu bieten hatte. Solche Damen mochten nicht im eigentlichen Sinne frivol sein, doch Unschuldslämmer waren sie auch nicht. Da besagte Damen ihren Gatten zumeist einen, wenn nicht zwei Erben geschenkt hatten, waren die meisten weit älter als Heather mit ihren fünfundzwanzig Jahren.
Ihre erste flüchtige Prüfung der Anwesenden ergab, dass der Großteil der Herren ebenfalls älter war als sie. Das war vielversprechend. Die meisten waren in den Dreißigern und modisch, elegant, kostspielig und äußerst raffiniert gewandet. Sie hatte gut daran getan, Lady Herfords Soiree als erste Anlaufstelle zu wählen im Rahmen ihres Vorstoßes in die Gefilde jenseits der Grenzen jener exklusiven Welt, die aus den Ballsälen, Salons und Speisezimmern der höchsten Ränge des ton bestand.
Jahrelang hatte sie sich in den Empfangszimmern der gehobenen Gesellschaft nach ihrem Helden umgeschaut – nach dem Mann, der ihr Herz im Sturm erobern und sie ins Eheglück entführen würde. Schließlich war sie zu dem Schluss gelangt, dass dieser Mann sich nicht in ihren Kreisen bewegte. Viele Gentlemen des ton mochten zwar sämtliche an einen Ehegatten gestellte Anforderungen zur vollen Zufriedenheit erfüllen, machten aber einen weiten Bogen um die liebreizenden jungen Geschöpfe, die sich auf dem Heiratsmarkt präsentierten. Stattdessen verbrachten sie die Abende auf Veranstaltungen wie der von Lady Herford, um sich des Nachts in diversen Vergnügungen zu ergehen – in Glücksspiel und Tändeleien, um nur zwei zu nennen.
Ihr Held – irgendwo musste es ihn geben – gehörte vermutlich der Gruppe jener Männer an, die sich rarmachten. Demnach würde er kaum zu ihr kommen. Sie hatte das Thema ausgiebig und lebhaft mit ihren Schwestern Elizabeth und Angelica erörtert und schließlich erkannt, dass ihr nichts anderes übrig blieb, als sich zu ihm zu begeben.
Um ihn aufzuspüren und, falls nötig, eigenmächtig zur Strecke zu bringen.
Lächelnd nahm sie die flachen Stufen hinab zum Salon. Lady Herfords Villa war ein recht neues, luxuriöses Domizil im Norden des Londoners Viertels Primrose Hill – von Mayfair aus bequem mit der Kutsche zu erreichen. Das war vorteilhaft, bedachte man, dass Heather allein hatte herkommen müssen. Sie hätte es vorgezogen, mit Begleitung zu erscheinen. Aber als Mitverschwörerin hätte sich am ehesten ihre ein Jahr jüngere Schwester Eliza angeboten, die nicht minder angewidert von dem Mangel an Helden innerhalb ihres engen Zirkels war. Und sie konnten schlecht beide am selben Abend Kopfschmerzen vorschützen; diese List hätte ihre Mutter durchschaut. Daher beehrte Eliza derzeit Lady Montagues Ballsaal mit ihrer Anwesenheit, während Heather vermeintlich in ihrem warmen, behaglichen Bett in der Dover Street ruhte.
Nach außen hin gelassen und selbstsicher, glitt sie durch die Menge. Ihre Ankunft hatte in beträchtlichem Maße für Aufregung gesorgt. Obgleich sie vorgab, dies nicht zu bemerken, spürte sie förmlich die taxierenden Blicke auf ihrem sanft schimmernden bernsteinfarbenen Seidenkleid, einer extravaganten, ihren Körper umschmeichelnden Kreation mit Herzausschnitt und zierlichen Puffärmeln. Da der Abend ungewöhnlich mild war und ihre Kutsche gleich draußen wartete, hatte sie sich nur ein Schultertuch aus feiner topasblauer und orangegelber Norwich-Seide umgelegt, dessen Fransen ihr über die bloßen Arme und die Seide des Kleides strichen. Da sie kein Backfisch mehr war, durfte sie Kleider tragen, die zwar nicht so freizügig wie einige andere hier waren, aber dennoch männliche Blicke auf sich zogen.
Ein Herr, offenbar kühner als seine Genossen, löste sich aus einer Gruppe mehrerer Gäste und schlenderte zu ihr herüber.
Heather blieb stehen und hob hochmütig eine Braue.
Er lächelte und verbeugte sich geschmeidig. „Miss Cynster, nehme ich an?“
„Ganz recht, Sir. Und Sie sind ...?“
„Miles Furlough, Teuerste.“ Im Aufrichten sah er ihr in die Augen. „Sind Sie zum ersten Mal hier?“
„Ja.“ Heather schaute sich um, fest entschlossen, Souveränität und Selbstvertrauen auszustrahlen. Sie hatte die Absicht, sich ihren Helden selbst auszusuchen, statt die Wahl ihm oder irgendwem sonst zu überlassen. „Die Gäste wirken recht ausgelassen.“ Die Lautstärke des Stimmengewirrs nahm stetig zu. Sie erwiderte den Blick von Miles Furlough. „Geht es auf den Gesellschaften Ihrer Ladyschaft immer so fröhlich zu?“
Furlough verzog die Lippen zu einem Lächeln, das Heather nicht unbedingt gefiel.
„Ich denke, Sie werden noch herausfinden ...“ Furlough verstummte und sah an ihr vorbei.
Kaum hatte ihr Bauchgefühl sie gewarnt und ihr einen Schauer über den Nacken gejagt, als sich auch schon lange Finger stählern um ihren Ellbogen schlossen.
Die Berührung ließ ihr Hitze durch den Leib strömen, gefolgt von einem Schwindelgefühl, das ihr die Orientierung raubte und den Atem stocken ließ. Sie brauchte sich nicht umzudrehen, um zu wissen, dass Timothy Danvers, Viscount Breckenridge – der Fluch ihres Daseins –, sich gegen die Vernunft entschieden hatte.
„Furlough.“ Die tiefe Stimme, die schräg oberhalb ihres Kopfes ertönte, hatte, wie üblich, eine beunruhigende Wirkung auf Heather.
Abermals erschauerte sie – wie scheußlich, dass sie derart empfindsam war. Sie rang die Anwandlung nieder und wandte langsam den Kopf, um den Urheber des Schauers mit einem so kühlen wie ungnädigen Blick zu bedenken. „Breckenridge.“ Nichts in ihrem Ton wies darauf hin, dass sie seine Anwesenheit begrüßte – ganz im Gegenteil.
Er ignorierte ihre Bemühung, sich seines anmaßenden Gehabes zu erwehren; womöglich nahm er diese nicht einmal wahr. Eindringlich fixierte er Furlough.
„Wenn Sie so gut sein wollen, uns zu entschuldigen, alter Knabe. Es gibt da etwas, das ich gern mit Miss Cynster bereden würde.“ Breckenridge hielt Furloughs Blick stand. „Ich hoffe auf Ihr Verständnis.“
Furloughs Miene besagte, dass er sehr wohl verstand, jedoch wünschte, sich nicht zur Kapitulation verpflichtet zu sehen. Doch in diesem Umfeld durfte es so gut wie niemand wagen, Breckenridge – dem Liebling sowohl der Gastgeberin als auch der weiblichen Gäste – zu widersprechen. Unwillig neigte er den Kopf. „Selbstverständlich.“
An Heather gewandt, lächelte Furlough – aufrichtiger nun und eine Spur bedauernd. „Miss Cynster, ich wünschte, wir wären uns in einer vertraulicheren Runde begegnet. Vielleicht beim nächsten Mal.“ Er nickte zum Abschied und verschwand in der Menge.
Heather schnaubte verärgert. Ehe sie sich Einwände zurechtlegen und auf Breckenridge abfeuern konnte, verstärkte er den Griff um ihren Ellbogen und zog sie mit sich durch die Schar der Anwesenden.
Verblüfft versuchte sie, sich seinem Griff zu entwinden. Allerdings ohne Erfolg. „Was ...?“
„Wenn dir auch nur etwas an deinem Wohlergehen liegt, begleitest du mich brav zum Portal.“
Verstohlen schob er sie zum nicht weit entfernten Ausgang. „Lass. Mich. Los.“ Sie presste den Befehl leise zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor und würzte ihn mit einer guten Portion Empörung.
Er drängte sie die Salontreppe hinauf und nutzte den Augenblick, in dem sie sich eine Stufe oberhalb von ihm befand, um ihr zuzuraunen: „Was zum Teufel hast du hier zu suchen?“
Sein Tonfall übertrumpfte den ihren in puncto Vehemenz. Die Worte drangen tief und weckten – wie zweifellos beabsichtigt – eine vage, primitive Angst.
Bis sie diese Angst abgeschüttelt hatte, lotste Breckenridge sie bereits lässigen Schrittes und scheinbar ohne Eile durch die Gäste, die das Vestibül bevölkerten.
„Nein – du brauchst dich nicht erst an einer Antwort zu versuchen.“ Er schaute sie nicht an, sondern hatte das offene Portal im Auge. „Es interessiert mich nicht, welch törichte Flausen du dir in den Kopf gesetzt hast. Du gehst. Sofort.“
Unberührt, unschuldig, Jungfrau. Es fehlte nicht viel, und er hätte ihr die Worte um die Ohren gehauen.
„Es besteht kein Anlass für deine Einmischung.“ Ihre Stimme bebte vor kaum unterdrücktem Zorn.
Er erkannte, in welcher Stimmung sie war – in derselben wie stets, wenn er in der Nähe war. Gemeinhin hätte er darauf reagiert, indem er das Weite suchte, aber hier und jetzt blieb ihm nichts anderes übrig, als zu bleiben. „Ahnst du auch nur im Entferntesten, was deine Cousins – ganz zu schweigen von deinen Brüdern – mit mir anstellen würden, wenn sie herausfänden, dass ich dich in diesem Sündenpfuhl erspäht und einfach weggeschaut hätte?“ Abermals schnaubte sie und versuchte wiederholt, aber erfolglos, sich loszureißen. „Du bist ein ebenso ungehobelter Hornochse wie sie – und nachweislich ein ebensolcher Rüpel. Es wäre ein Leichtes für dich, ihnen Beine zu machen.“
„Einem vielleicht, aber allen sechs? Schwerlich. Ganz zu schweigen von Luc und Martin und Gyles Chillingworth – und was ist mit Michael? Nein, warte – was ist mit Caro und deinen Tanten und ...? Die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Da würde ich mich lieber bei lebendigem Leib häuten lassen – das wäre schmerzloser.“
„Du übertreibst. Lady Herfords Haus lässt sich kaum als Sündenpfuhl bezeichnen.“ Sie schaute zurück. „Nichts, was ich in diesem Salon gesehen habe, ist im Mindesten anstößig.“
„Im Salon vielleicht nicht – jedenfalls noch nicht. Aber weiter bist du nicht vorgedrungen. Vertrau mir, es handelt sich definitiv um einen Sündenpfuhl.“
„Aber ...“
„Nein.“ Sie hatten die vordere Veranda erreicht – die glücklicherweise menschenleer war. Er blieb stehen, ließ Heather los und gestattete sich endlich, sie anzusehen. Er betrachtete ihr Gesicht, ein makelloses Oval mit fein geschnittenen Zügen. Ihre Augen waren von einem Graublau wie die stürmische See und umgeben von dichten, langen dunkelbraunen Wimpern. Obwohl es in diesen Augen derzeit abweisend funkelte und die vollen Lippen zu einem schmalen Strich zusammengepresst waren, zählte ihr Antlitz zu jener Sorte, wie sie seit Urzeiten Kriegsflotten auf den Plan ruft und Kriege entfesselt. Es war ein Antlitz voller Leben, voller sinnlicher Verheißungen und schier übersprudelnder Lebensfreude.
Hinzu kam der Zauber, den ihre schlanke Gestalt ausübte. Diese war eher geschmeidig denn kurvenreich, aber von solch graziöser Anmut, dass jede ihrer Bewegungen Fantasien hervorrief, denen man – zumindest in seinem Fall – besser nicht allzu eingehend nachhing.
Heather war im Salon allein deshalb nicht bedrängt worden, weil Furlough den anderen zuvorgekommen war und sich als Erster aus der Erstarrung gerissen hatte, die unweigerlich jeden Mann befiel, der ihrer zum ersten Mal ansichtig wurde.
Breckenridge spürte, wie sich seine Züge verspannten, und kämpfte gegen den Drang an, die Hände zu Fäusten zu ballen und sich vor ihr aufzubauen in dem zweifellos vergeblichen Bemühen, sie einzuschüchtern. „Du fährst nach Hause, Ende der Diskussion.“
Ihre Augen wurden schmal. „Wenn du mich zu zwingen versuchst, schreie ich.“
Er verlor den Kampf und ballte die Hände zu Fäusten. Er und Heather maßen einander mit Blicken. „Wenn du das tust“, erwiderte er ruhig, „verpasse ich dir einen Klaps unters Kinn, schlage dich besinnungslos, erzähle jedem, du seiest ohnmächtig geworden, werfe dich in eine Kutsche und lasse dich heimbringen.“ Sie riss die Augen auf, sah ihn jedoch stur an, ohne klein beizugeben. „Das wagst du nicht.“
Er blieb ungerührt. „Willst du es riskieren?“
Heather zauderte. Das war das Dilemma im Hinblick auf Breckenridge – man wusste nie, was in ihm vorging. Sein Gesicht war das eines griechischen Gottes. Die markanten Konturen wirkten wie gemeißelt, und die schmalen Wangen unter den hohen Wangenknochen liefen zu einer kräftigen, kantigen Kieferpartie aus. Stets trug dieses Gesicht aristokratischen Gleichmut zur Schau und blieb unbewegt, ganz gleich, was Breckenridge gerade dachte. Nicht einmal die haselnussbraunen Augen unter den schweren Lidern verrieten irgendetwas; seine Miene war undurchdringlich die eines leichtlebigen Gentlemans, dem die Welt, mit Ausnahme seines unmittelbaren Vergnügens, einerlei war.
Alles an seiner Erscheinung förderte dieses Bild – von seiner dezenten, aber exquisiten und streng geschnittenen Kleidung, die seinen sehnigen, kräftigen Körper betonte, bis hin zu der gedehnten Sprechweise, derer er sich gemeinhin bediente. Allerdings kam Heather nicht umhin zu argwöhnen, dass dieses Bild nichts als Blendwerk war.
Sie musterte ihn – nichts deutete darauf hin, dass er nicht gewillt wäre, wie angedroht zu verfahren. Das wäre schlicht zu peinlich.
„Wie bist du hergekommen?“
Widerstrebend wies sie auf die Kutschen, die sich, so weit das Auge reichte, entlang des geschwungenen Trottoirs von Wadham Gardens reihten. „Mit der Kutsche meiner Eltern. Und ehe du mir eine Predigt darüber hältst, wie unschicklich es ist, nachts allein quer durch London zu fahren – sowohl der Kutscher als auch der Reitknecht stehen seit Jahrzehnten im Dienst meiner Familie.“
Er nickte. „Ich werde dich zur Kutsche geleiten.“
Wieder wollte er sie am Ellbogen fassen.
Sie wich zurück. „Spar dir die Mühe.“ Ihre Enttäuschung brach sich Bahn; gewiss würde er ihren Brüdern berichten, dass er sie bei Lady Herford ertappt hatte. Damit wäre ihr Plan durchkreuzt – ein Plan, der sich vielversprechend angelassen hatte, bis Breckenridge aufgetaucht war. Sie machte ihrem Ärger mit einem wütenden Blick Luft. „Die zwanzig Schritte kann ich gerade noch allein bewältigen.“
Selbst in ihren Ohren klang sie trotzig. „Lass mich einfach in Frieden!“, fügte sie hinzu, um ihre Würde zumindest halbwegs zu bewahren.
Das Kinn gereckt, machte sie schwungvoll kehrt und schritt die Stufen hinab. Auf dem Gehsteig wandte sie sich nach rechts und begab sich hoch erhobenen Hauptes zur Stadtkutsche ihrer Eltern, die sich unter den wartenden Gefährten befand.
Innerlich zitterte sie. Sie kam sich kindisch vor und kochte vor Zorn – und sie fühlte sich ihm ausgeliefert. So war es immer, wenn sie und Breckenridge die Klingen kreuzten.
Die unterdrückte Wut trieb ihr Tränen in die Augen. Sie blinzelte dagegen an, wohl wissend, dass er sie beobachtete. Daher straffte sie die Schultern und marschierte resolut weiter.
Vom Schatten der vorderen Veranda aus sah Breckenridge zu, wie sich die Frau, die er als Fluch seines Daseins betrachtete, auf den Weg zurück in ihr sicheres Heim machte. Warum von allen Damen des ton ausgerechnet Heather Cynster ihn derart aus der Fassung brachte, war ihm ein Rätsel; er wusste nur, dass er dagegen machtlos war. Sie war fünfundzwanzig und er zehn Jahre und Millionen Nächte älter. Gewiss war er für sie eine Art lästiger älterer Cousin – bestenfalls. Schlimmstenfalls sah sie ihn wie einen Onkel, der sich in alles einmischte.
„Wunderbar“, murmelte er, während er sie furchtlos davonschreiten sah. Sobald sie in Sicherheit wäre ... würde er zu Fuß nach Hause gehen. Vielleicht vertrieb die Nachtluft die Rastlosigkeit, die sich in ihm breitmachte, wann immer er mit Heather aneinandergeriet – eine Art Verlorenheit, ein Gefühl der Leere und das Empfinden, als liefe ihm die Zeit davon.
Stets blieb der Eindruck zurück, das Leben – sein Leben – wäre belanglos oder zumindest belangloser, als es sein sollte.
Er bemühte sich aufrichtig, sie aus seinen Gedanken zu verbannen. Unter den Gästen im Haus waren Damen, die alles gäben, um ihm Zerstreuung zu verschaffen. Aber er hatte vor langer Zeit gelernt, wie viel ihr Lächeln und ihre lustvollen Seufzer wert waren.
Flüchtige, banale, illusorische Intermezzos.
Zunehmend fühlte er sich hinterher herabgewürdigt, benutzt. Unbefriedigt.
Er sah, wie sich das Mondlicht in Heathers weizenblondem Haar fing und es gleißen ließ. Kennengelernt hatte er sie vor vier Jahren auf der Hochzeit seiner Quasi-Stiefmutter Caroline mit Michael Anstruther-Wetherby, dem Bruder von Honoria, der Duchess of St. Ives und Königin des Cynster-Clans. Honorias Gatte Devil Cynster war Heathers ältester Cousin.
An jenem sonnigen Tag in Hampshire war er Heather zum ersten Mal begegnet, wohingegen er ihre Cousins seit über einem Jahrzehnt kannte – sie bewegten sich in denselben Kreisen wie er, und bevor sie geheiratet hatten, waren ihnen weitgehend dieselben Interessen zu eigen gewesen.
Links vom Haus löste sich ein Gefährt aus der Reihe. Breckenridge schaute kurz hin, sah, dass der Kutscher seine Pferde antraben ließ, und blickte erneut nach rechts, wo Heather nach wie vor den Gehsteig entlangging.
„Zwanzig Schritte, von wegen.“ Das waren eher fünfzig. „Wo zur Hölle steht ihre Kutsche?“
Kaum hatte er die Worte ausgesprochen, als das andere Gefährt, eine Reisekutsche, auch schon auf gleicher Höhe mit Heather war.
Die Kutsche wurde langsamer.
Der Schlag wurde geöffnet, und ein Mann stürzte heraus. Ein weiterer, der neben dem Kutscher gesessen hatte, sprang vom Bock.
Ehe Breckenridge Luft holen konnte, waren die zwei durch die Wagenreihe geschlüpft und hatten sich Heather gepackt. Sie hielten ihr den Mund zu, erstickten so ihren Schrei, hoben sie hoch, schleppten sie zur Kutsche und stießen sie hinein.
„Heda!“ Breckenridges Ruf wurde von einem Kutscher weiter vorn aufgegriffen.
Aber die Kerle schoben sich bereits ins Wageninnere, während der Kutscher den Pferden die Peitsche gab.
Breckenridge rannte bereits die Treppe hinab und das Trottoir entlang, bevor er den bewussten Entschluss gefasst hatte, die Verfolgung aufzunehmen.
Die Reisekutsche verschwand hinter der Kurve, welche die Straße namens Wadham Gardens beschrieb. Aus dem Rattern der Räder schloss er, dass das Gefährt in die erstbeste abzweigende Straße eingebogen war.
Er erreichte den Kutscher der Cynsters, der gerade geschrien hatte und nun wie gelähmt dahockte und den Entführern nachgaffte. Breckenridge schwang sich zu ihm auf den Kutschbock und griff nach den Leinen. „Lassen Sie mich fahren. Ich bin ein Freund der Familie. Wir setzen ihnen nach.“
Der Kutscher schüttelte seine Betäubung ab und ließ die Leinen los.
Breckenridge scherte flugs aus, über die Enge der Lücke fluchend. Sobald er das Gefährt auf der Straße hatte, trieb er die Pferde an. „Halten Sie die Augen offen – ich habe keine Ahnung, wohin sie fahren könnten.“
„Aye, Sir – Mylord ...“
Flüchtig warf er dem Kutscher einen Seitenblick zu. „Viscount Breckenridge. Ich kenne Devil und Gabriel.“ Und all die anderen, aber die beiden Namen würden genügen.
Der Kutscher nickte. „Aye, Mylord.“ Er drehte sich zum Reitknecht um, der sich an seinem Platz festklammerte. „James, du hältst links Ausschau und ich rechts. Wenn wir sie aus den Augen verlieren, springst du an der nächsten Ecke ab und suchst sie.“
Breckenridge konzentrierte sich auf die Pferde. Zum Glück herrschte wenig Verkehr. Er bog in dieselbe Straße ein, welche die Reisekutsche genommen haben musste, und spähte gemeinsam mit den anderen beiden nach vorn. Mehrere Gaslaternen tauchten eine seltsam verwinkelte Kreuzung voraus in grelles Licht.
„Da vorn!“, erschallte ein Ruf von hinten. „Dort sind sie – sie biegen nach links in die breitere Straße ab.“
Breckenridge dankte dem Himmel für James’ scharfe Augen; er selbst hatte die Rückseite der Reisekutsche knapp nach James entdeckt. Er ließ die Pferde laufen, so schnell er es wagte, und folgte der Reisekutsche in die breitere Straße – gerade rechtzeitig, um zu sehen, dass sie an der nächsten Kreuzung nach rechts abschwenkte.
„Oh“, machte der Kutscher.
Breckenridge warf ihm einen Seitenblick zu. „Was ist?“
„Sie sind auf der Avenue Road, die weiter oben in die Finchley Road übergeht.“
Und die Finchley Road wurde zur Great North Road. Die Kutsche war auf dem Weg nach Norden. „Vielleicht wollen sie zu einer Adresse außerhalb Londons.“ Breckenridge sagte sich, dass dies durchaus denkbar sei – schließlich handelte es sich um eine Reisekutsche und nicht um ein Stadtvehikel.
Er lenkte die zwei Rappen ebenfalls auf die Avenue Road, während der Kutscher und James angestrengt nach vorn schauten.
„Jawoll, da sind sie“, meinte der Kutscher. „Aber sie haben einigen Vorsprung.“
Da es sich bei den Rappen um Cynster-Pferde handelte, scherte sich Breckenridge nicht um den Vorsprung ihrer Beute. „Hauptsache, wir verlieren sie nicht aus den Augen.“
Das war, wie sich herausstellte, leichter gesagt als getan. Es lag nicht an den Rappen, sondern an den träge dahintrottenden Zugtieren der sieben Gefährte, die zwischen sie und die Reisekutsche gerieten. Auf ihrem Weg durch die schmalen Gassen der Außenbezirke der weitläufigen Metropole, vorbei an Cricklewood und durch Golders Green, bot sich keine Gelegenheit zum Überholen. Es gelang ihnen, die Reisekutsche lange genug im Blick zu behalten, um sicherzustellen, dass sie tatsächlich die Great North Road nahm. Aber als sie High Barnet und das sich dahinter erstreckende Gebiet um den Barnet Hill erreichten, war die Kutsche verschwunden.
Innerlich fluchend, hielt Breckenridge in dem Hof des „Barnet Arms“, einer größeren Poststation mit angeschlossenem Gasthaus, in dem er wohlbekannt war. „Gehen Sie die Straße ab und versuchen Sie, jemanden aufzutreiben, der die Kutsche gesehen hat“, sagte er, an den Kutscher und James gerichtet. „Finden Sie heraus, was immer Sie herausfinden können – ob die Kerle die Pferde gewechselt haben und so weiter.“
Beide Männer kletterten von der Kutsche und machten sich auf den Weg. Breckenridge wandte sich den Stallburschen zu, die herbeigeeilt waren, um sich um die Pferde zu kümmern. „Ich brauche einen Wagen und euer bestes Paar Pferde. Wo ist der Stallmeister?“
Eine halbe Stunde darauf schied er von dem Kutscher und James. Sie hatten mehrere Leute aufgespürt, die die Reisekutsche gesichtet hatten. Diese hatte kurz am „Scepter and Crown“ pausiert, um die Pferde zu wechseln, ehe sie auf der Landstraße weiter gen Norden gefahren war.
„Hier.“ Breckenridge reichte dem Kutscher eine Notiz, die er niedergekritzelt hatte, während er auf die Rückkehr der beiden gewartet hatte. „Übergeben Sie dies Lord Martin, so rasch Sie können.“ Lord Martin Cynster war Heathers Vater. „Falls er, aus welchem Grund auch immer, nicht da sein sollte, geben Sie die Nachricht einem von Miss Cynsters Brüdern oder, sollten auch diese nicht zur Stelle sein, St. Ives.“ Dass Devil in London weilte, wusste er; was die anderen anging, war er nicht sicher.
„Aye, Mylord.“ Der Kutscher nahm die Nachricht an sich und hob eine Hand zum Gruß. „Und Ihnen viel Glück, Sir. Hoffe, Sie kriegen die Schurken recht bald zu fassen.“
Das hoffte Breckenridge auch. Er schaute zu, wie die beiden auf den Bock der Stadtkutsche stiegen. Sobald sie aus dem Hof waren und zurück nach London rollten, eilte er zu dem schnittigen Phaeton, der an einer Seite des Hofes wartete. Angespannt waren zwei Grauschimmel, die der Wirt nur selten verlieh. Sie tänzelten links und rechts der Deichsel und wurden von zwei nicht minder aufgeregten Stallburschen festgehalten.
„Sind recht munter, M’lord.“ Der Stallmeister war zu ihm getreten. „Waren seit Ewigkeiten nicht mehr draußen. Liege dem Wirt ständig in den Ohren damit, dass es besser wäre, sie dann und wann mal ordentlich rennen zu lassen.“
„Ich werde zurechtkommen.“ Breckenridge schwang sich auf den hohen Bock. Geschwindigkeit war, was zählte, und der leichte Phaeton in Verbindung mit den rassigen Pferden war wie geschaffen dafür. Er ergriff die Leinen, straffte sie, erspürte, wie weich die Schimmel im Maul waren, und nickte den Stallburschen zu. „Ihr könnt sie loslassen.“
Die Burschen taten wie geheißen und sprangen zurück, als die Pferde vorwärtsschossen.
Breckenridge zügelte sie gerade so weit, dass er die Kurve vom Hof auf die Straße nehmen konnte, und ließ sie laufen, den Barnet Hill hinauf und die Great North Road entlang.
Eine Weile war er vollauf damit beschäftigt, die Pferde zu lenken. Als diese sich beruhigten und die Meilen unter dem steten Rhythmus des Hufschlages dahinflogen, hatte er Muße zum Nachdenken. Außer ihm war kaum jemand auf der Straße.
Er fand Zeit, ein Dankgebet gen Himmel zu schicken für den Umstand, dass die Nacht lau war, denn er trug noch seine Abendgarderobe.
Und er fand Zeit, sich mit der Erkenntnis herumzuschlagen, dass Heather all dies nicht widerfahren wäre, wenn er nicht darauf bestanden hätte, dass sie Lady Herfords Villa verlasse. Hätte er ihr verboten, die zwanzig oder vielmehr fünfzig Schritte bis zu ihrer Kutsche ohne Begleitung zurückzulegen, befände sie sich nun nicht in den Händen unbekannter Missetäter, um zu erdulden, was immer diese ihr an Demütigungen antun würden.
Sie würden büßen; dafür würde er sorgen. Das allerdings milderte weder den Schreck noch die erdrückenden Schuldgefühle, bedingt durch das Wissen, dass sie seinetwegen in Gefahr schwebte.
Er hatte sie beschützen wollen. Stattdessen ...
Den Blick auf die Straße geheftet, jagte er dahin.
Die Häscher hielten Heather gefesselt und geknebelt, bis sie sich ein gutes Stück hinter Barnet befanden und die Straße verlassen dalag.
Kaum hatten die Männer sie vor Lady Herfords Haus in die Kutsche gestoßen, als sie Heather auch schon mit einem Leinenstreifen geknebelt und ihr flink die Hände und – da sie nach den Kerlen trat – auch die Füße gebunden hatten.
Es waren nicht nur zwei Männer. In der Kutsche hatte eine große, kräftige Frau gewartet, den Knebel in der Hand. Nachdem Heather mundtot gemacht und verschnürt worden war, hatte man sie neben die Frau gesetzt, sodass sie in Fahrtrichtung schaute, während die zwei Männer sich ihnen gegenüber niedergelassen hatten. Der eine hatte ihr beschieden, sie solle sich still verhalten, dann werde sich alles bald aufklären.
Dieses Versprechen und die Tatsache, dass ihr keiner dieser Leute bislang etwas getan hatte – sie hatten ihr nicht einmal gedroht –, beruhigten sie. So weit jedenfalls, um sie erkennen zu lassen, dass sie keine andere Wahl hatte, als der Aufforderung nachzukommen.
Das hatte sie nicht davon abgehalten, nachzudenken und sich mögliche Szenarien auszumalen. Beides hatte sie nicht weit gebracht. Sie wusste zu wenig, wusste nur, dass ihre Entführer zu dritt waren, den Kutscher auf dem Bock nicht mitgerechnet, und dass sie von London aus nach Norden fuhren. Sie hatte im Laufe der Fahrt genügend Orientierungspunkte erspäht und hinreichend viel gesehen, um sicher zu sein, dass sie Richtung Norden fuhren.
Sie befanden sich auf der Great North Road, als der Dünnere der beiden Männer das Wort ergriff. Er war drahtig und von mittlerer Statur, eher groß als klein. Sein Haar war gelockt und mausbraun, und seine Züge waren scharf geschnitten. „Wenn Sie vernünftig sind und sich benehmen, binden wir Sie los. Auf dieser Straße werden wir lange Zeit niemandem begegnen, und das Tempo behalten wir noch eine Weile bei. Schreien wäre daher zwecklos, niemand würde Sie hören. Wenn es Ihnen gelänge, sich aus der Kutsche zu werfen, würden Sie sich nur ein Bein brechen, wenn nicht das Genick. Sofern Sie versprechen, den Mund zu halten, still sitzen zu bleiben und zuzuhören, werden wir Ihnen die Fesseln abnehmen und Ihnen erklären, was es mit dem Ganzen auf sich hat – wie die Dinge stehen und was Sie erwartet. Also.“ Fragend hob er die Brauen. „Wie sollen wir es handhaben?“
Im spärlichen Licht im Innern der Kutsche konnte sie seine Augen kaum ausmachen, aber sie blickte in die ungefähre Richtung und nickte.
„Kluges Mädchen“, meinte der Drahtige ohne Sarkasmus. „Er hat gesagt, dass Sie Köpfchen hätten.“
Wer – er? Sie sah zu, wie der Drahtige, der ihr gegenübersaß, Anstalten machte, sich nach ihren Füßen zu bücken, jedoch innehielt.
Er warf der Frau neben ihr einen Blick zu. „Besser, du bindest ihr die Füße los.“ Er richtete sich auf und löste die Fesseln um Heathers Handgelenke.
Verwirrt schaute Heather die Frau an, die einen verärgerten Laut von sich gab und sich schwerfällig von ihrem Platz hochstemmte, um sich zwischen die Sitzbänke zu kauern. Unter Heathers Seidenröcken tastete sie nach dem Leinenstreifen, der als Fußfessel diente.
Sie sind darauf bedacht, mich nicht unsittlich zu berühren, ging Heather auf, während die beiden sie losbanden. Zumindest nahmen sie so weit Rücksicht, wie die Umstände es zuließen. Sie hätte nicht gedacht, dass Entführer sich derart ... ritterlich geben konnten.
Sobald ihre Füße von den Fesseln befreit waren, setzte die Frau sich wieder auf die Bank. „Den Knebel auch?“, fragte sie den Drahtigen.
Den Blick auf Heather gerichtet, nickte er. „Man hat uns angewiesen, ihr die Sache so angenehm wie möglich zu machen. Wenn sie also nicht närrischer ist, als wir glauben, können wir auf den Knebel verzichten.“
Heather drehte der Frau den Hinterkopf zu, damit sie den Knoten lösen konnte. Sobald der Leinenstreifen fort war, fuhr sie sich mit der Zunge über die Lippen und bewegte den Kiefer. Das war schon viel besser.
Sie sah den Drahtigen an. „Wer sind Sie? Und wer hat Sie geschickt?“
Er grinste – weiße Zähne blitzten im Halbdunkel auf. „Ah, nicht so schnell, Miss. Zunächst einmal: Wir haben den Auftrag, eine der Cynster-Schwestern zu ergreifen – ob Sie oder eine andere, ist egal. Wir haben Sie und Ihre Schwestern über eine Woche lang beobachtet, aber keine von Ihnen ist je ohne Begleitung ausgegangen. Das heißt, bis heute Abend.“ Der Drahtige – Heather beschloss, ihn so zu nennen – deutete eine Verbeugung an. „Dafür danken wir Ihnen. Wir hatten schon mit dem Gedanken gespielt, drastischere Maßnahmen zu ergreifen, um eine von Ihnen allein zu erwischen. Wie auch immer, nun da wir Sie haben, sollten Sie sich damit abfinden, dass es keine Sinn haben würde, uns entkommen zu wollen – niemand würde Ihnen helfen, denn wir haben eine Geschichte parat, mit der wir unser Tun rechtfertigen können. Was immer Sie unternehmen oder erzählen, was immer Sie einwenden, würde unsere Geschichte in den Augen anderer umso glaubhafter machen.“
„Was für eine Geschichte?“, hakte sie nach. Der Drahtige strahlte etwas Überlegenes aus; er machte nicht den Eindruck, als schwätzte er dummes Zeug.
Wie typisch für sie, ausgerechnet an intelligente Entführer zu geraten.
Als wollte er ihren Argwohn bestätigen, grinste er. Hörbar selbstzufrieden, erwiderte er: „Die Geschichte ist denkbar simpel. Wir sind von Ihrem Vormund beauftragt worden, Sie zurückzuholen. Sie sind ins sündige London entfleucht, ausgebüxt aus dem sittenstrengen Haushalt Ihres Vormundes. Wir sollen Sie zurückholen, und ...“, er legte eine dramatische Pause ein, zog ein zusammengefaltetes Blatt Papier aus der Tasche und winkte damit, „... dies bevollmächtigt uns, alles zu tun, was nötig ist, um Sie festzuhalten und zu ihm zurückzubringen.“
Stirnrunzelnd betrachtete sie das Papier. „Mein Vater ist mein Vormund, und er hat Ihnen gewiss keine solche Vollmacht ausgestellt.“
„Tja, nun, Sie sind aber gar nicht Miss Cynster, nicht wahr? Sie sind Miss Wallace, und Ihr Vormund Sir Humphrey ist höchst erpicht darauf, Sie nach Hause zu holen, wo Sie hingehören.“
„Und wo bin ich zu Hause?“ Sie hoffte, er würde ihr verraten, wohin sie fuhren, aber er lächelte nur.
„Das wissen Sie genau – das müssen wir Ihnen nicht sagen.“
Sie schwieg, bemüht, den Plan dieser Leute zu ergründen und auf eine Möglichkeit zu sinnen, ihn zu durchkreuzen. Aber sie trug nichts bei sich, womit sie hätte beweisen können, wer sie in Wirklichkeit war. Ihre einzige Hoffnung – die sie nicht aussprechen würde – bestand darin, zufällig jemandem zu begegnen, der sie vom Sehen her kannte. Leider war es unwahrscheinlich, dass sich eine solche Begegnung Ende März, da in London die Saison in Fahrt kam, auf dem Land ergeben würde.
Sie warf der Frau neben sich einen Seitenblick zu.
Als spürte er die Frage, die ihr auf der Zunge lag, erklärte der Drahtige: „Martha hier ...“, mit dem Kopf wies er auf die Frau, „... ist natürlich Ihre Zofe. Sir Humphrey hat sie uns an die Seite gestellt, um dem Anstand Genüge zu tun.“ Er lächelte grimmig. „Martha wird Sie nicht aus den Augen lassen, vor allem nicht in Situationen, in denen unsere – Cobbins’ und meine – Anwesenheit ungehörig wäre.“
Heather entschied, dass es vorerst das Beste wäre, sich – wie der Drahtige es ausgedrückt hatte – zu benehmen. Sie nickte der Frau zu. „Martha.“ Danach wiederholte sie die Geste gegenüber dem vierschrötigen Mann, der kleiner war als der Drahtige, dafür stämmiger. Er saß ihr schräg gegenüber und schwieg. „Cobbins.“
Anschließend richtete sie den Blick wieder auf den Drahtigen. „Und wer sind Sie?“
„Nennen Sie mich Fletcher, Miss Wallace“, erwiderte er lächelnd.
Ihr fielen noch ein paar andere passende Namen für ihn ein, doch abermals nickte sie nur, ehe sie sich auf ihrem Platz zurechtrückte und den Kopf gegen das Polster sinken ließ. Von weiteren Erkundigungen sah sie ab. Sie spürte, dass Fletcher von ihr erwartete zu protestieren, vielleicht gar um Gnade zu winseln oder ihn und die anderen von ihrer Mission abzubringen. Aber sie sah keinerlei Nutzen darin, sich derart zu erniedrigen.
Nicht den geringsten.
Je länger sie über das nachgrübelte, was Fletcher ihr eröffnet hatte, desto überzeugter war sie von der Aussichtslosigkeit etwaiger Aktionen ihrerseits. Dies war die sonderbarste Entführung, von der sie je gehört hatte ... Nun, im Grunde hatte sie noch nie von irgendeiner Entführung gehört, aber es kam ihr ausgesprochen merkwürdig vor, dass man sie zuvorkommend und mit solcher ... Umsicht behandelte; dass die Entführer so ungemein besonnen und souverän vorgingen.
Fletcher, Cobbins und Martha passten nicht in das Schema des gemeinen Entführers. Sie mochten nicht vornehm sein, doch Gesindel waren sie auch nicht. Sie waren ordentlich und unauffällig gekleidet. Wenngleich Martha groß und ungeschlacht war, konnte sie durchaus als Zofe durchgehen, vor allem als Zofe einer Dame, die sich vorwiegend auf dem Land aufhielt. Cobbins wirkte zurückhaltend und schien in seiner schlichten Gewandung mit dem Hintergrund zu verschmelzen. Aber auch er machte nicht den Eindruck, als gehörte er zu dem Menschenschlag, den man in zwielichtigen Kaschemmen antraf. Sowohl er als auch Fletcher sahen genauso aus wie die Sorte Männer, der sie angeblich angehörten – wie die Sorte, deren Dienste ein wohlhabender Landjunker in Anspruch nehmen mochte.
Wer immer die drei nach London geschickt hatte, er hatte sie gut vorbereitet. Ihr Plan war einfach und – von Heathers gegenwärtiger Lage aus betrachtet – so gut wie unmöglich zu vereiteln. Das hieß nicht, dass sie nicht entkommen würde – das würde sie irgendwie. Aber bevor sie die Flucht wagte, musste sie Näheres über den rätselhaftesten Aspekt dieser ominösen Entführung erfahren.
Die drei waren entsandt worden, um nicht sie im Besonderen zu entführen, sondern eine beliebige Cynster-Schwester – sie, Eliza, Angelica oder vielleicht auch ihre Cousinen Henrietta und Mary, die sich ebenfalls zu den Cynster-Schwestern zählen ließen.
Ihr fiel kein anderes Motiv ein als schlicht die Gier nach einem Lösegeld. Doch wenn das der Fall war – wieso sie dann aus London fortbringen? Wieso sie zu irgendeinem Mann schaffen? In Gedanken ging sie das Geschehene noch einmal durch und überdachte es, kam jedoch zu dem Schluss, dass Fletcher die Wahrheit gesagt hatte – die drei entführten sie im Namen eines Auftraggebers.
Drei Leute anzuwerben und obendrein eine Kutsche mitsamt Kutscher und Vierergespann, um sie und ihre Schwestern mehr als eine Woche lang zu beobachten – das klang nicht nach einer simplen Entführung, weil die Gelegenheit günstig gewesen war und jemand ein Lösegeld einstreichen wollte.
Wenn aber kein Lösegeld der Grund war, was dann? Und wenn sie entkäme, ohne die Antwort zu erfahren, wären sie und ihre Schwestern weiterhin in Gefahr?
In High Barnet hatten sie frische Pferde anspannen lassen, sodass sie weder in Welham Green noch in Welwyn haltmachen mussten.
Schließlich wurde die Kutsche langsamer. Sie kamen durch eine kleine Stadt. Fletcher beugte sich vor und schaute aus dem Fenster. „Knebworth.“ Er lehnte sich zurück und musterte Heather. „Hier werden wir die Nacht verbringen. Werden Sie vernünftig sein und den Mund halten? Oder müssen wir Sie fesseln und dem Wirt unsere Geschichte auftischen?“
Wenn sie das täten und Heathers Angehörige auf der Suche nach ihr hier vorbeikämen – und das würden sie, denn Henry, der alte Kutscher, dürfte längst Alarm geschlagen haben –, würde der Wirt eine Miss Wallace womöglich nicht erwähnen.
Den Blick auf Fletcher gerichtet, reckte sie das Kinn. „Ich werde mich benehmen.“
Er lächelte, nicht triumphierend, sondern wohlwollend. „So ist es recht.“
Sie seufzte innerlich. Dass Fletcher jedwede Selbstgefälligkeit abging, zeugte davon, dass er in der Tat nicht auf den Kopf gefallen war. Trotz seiner Alibi-Geschichte könnte sie noch immer Zeter und Mordio schreien, um den örtlichen Polizisten zu alarmieren. Möglicherweise würde der sie in Gewahrsam nehmen, solange er ihre Version der Ereignisse und die der Entführer überprüfte. In den Händen von Entführern aufgegriffen zu werden, würde allerdings ihrer Reputation einigen Schaden zufügen, Martha hin oder her. Vor allem, da Heather den unausgesprochenen Mutmaßungen, die unweigerlich die Runde machen würden, an diesem Abend Nahrung gegeben hatte, indem sie in die lasterhafte Welt von Lady Herfords Salon eingedrungen war.
Ausschlaggebend für ihre Gefügigkeit war jedoch, dass sie ihrer Einschätzung nach nicht in unmittelbarer Gefahr schwebte, solange sie Stillschweigen bewahrte und die Rolle spielte, die man ihr zugedacht hatte. Zumindest sah sie sich nicht gefährdet, bis sie den Auftraggeber der drei erreichten. Bis dahin würde sie sich darauf konzentrieren herauszufinden, was es mit dieser höchst befremdlichen Entführung auf sich hatte.
Und dann erst würde sie sich etwas einfallen lassen und fliehen.
2. KAPITEL
Drei Stunden später lag Heather auf einem nicht allzu bequemen Bett in einem Zimmer im Obergeschoss des „Red Garter Inn“ in Knebworth. Sie lag auf dem Rücken und starrte an die Decke. Draußen hatte sich der Mond hinter den Wolken hervorgekämpft; im silbrigen Licht, das durch das vorhanglose Fenster hereinfiel, war die Zimmerdecke deutlich zu erkennen, wenngleich Heather sie kaum wahrnahm.
„Was um alles in der Welt soll ich nur tun?“ Sie sandte die geflüsterte Frage hinauf zur Decke, ohne eine Antwort zu erhalten.
Sie hatte gut daran getan, keine Szene zu machen und zu versuchen, Wirt und Gäste auf ihre Seite zu ziehen. Sobald sie ihre Häscher im Lampenschein hatte mustern können, war ihr klar gewesen, dass ihre erste Vermutung den tatsächlichen Fähigkeiten der drei nicht gerecht wurde. Vor allem Fletcher wirkte einnehmend genug, um die Stichhaltigkeit seiner Version der Geschichte zu untermauern. Ein Blick in seine Augen bei Lichte hatte ihr bestätigt, dass er nicht nur intelligent, sondern auch schlagfertig und gerissen war. Wenn sie versuchte, andere dazu zu bringen, ihr zu helfen, würde er jedes nur erdenkliche Argument gegen sie auffahren. Und er würde wissen, was genau sich unter „jedes nur erdenkliche Argument“ fassen ließ. Wenn sie ihn provozierte, wäre ihr Ruf dahin, ohne dass sie dadurch ihre Freiheit wiedererlangt hätte.
Es wäre durchaus vernünftig gewesen zu fliehen, solange sie sich noch in der Nähe von London und ihrer Familie befunden hatte, auch wenn sie bislang nichts über das Motiv hinter der Entführung erfahren hatte. Leider war jeder Gedanke an Flucht im Keim erstickt worden.
Man hatte ihr die Kleider genommen.
Lange bevor sie in der Kutsche losgebunden worden war, hatte Martha einen dunklen Wollumhang hervorgeholt und Heather fürsorglich um die Schultern gelegt. Es war das erste Zeichen dafür gewesen, dass ihnen Heathers Wohl am Herzen lag. Mit Fortschreiten der Nacht war sie dankbar für den wärmenden Umhang gewesen. Auf Fletchers Anweisung hin hatte sie den Stoff beim Betreten des Inns fest um sich geschlungen. In ihrem gemeinsamen Zimmer schließlich hatte Martha den Mantel zurückgefordert und Heather angewiesen, das Kleid auszuziehen, ehe sie sich hinlegte. Heather hatte gehorcht, ohne nachzudenken – sie pflegte nicht im Abendkleid zu Bett zu gehen.
Allerdings war sie es gewohnt, in etwas mehr als nur ihrer seidenen Chemise zu schlafen, die – abgesehen von den noch transparenteren Seidenstrümpfen – derzeit alles war, was sie am Leib trug.
An andere Kleidung kam sie nicht heran, weder an ihre eigene noch an Marthas. Zudem hatte Martha den Türschlüssel in dem voluminösen Unterkleid verborgen, in dem sie sich hingelegt hatte. Sollte Heather es sich in den Kopf setzen, das Schloss zu knacken und sich nach unten zu schleichen, um Alarm zu schlagen, würde sie dies in Chemise und Seidenstrümpfen tun müssen. Würde sie das? Sie verwarf die Vorstellung und schaute abermals zu Marthas Bett auf der anderen Seite des Zimmers hinüber. Martha schnarchte.
Lautstark.
Sämtliche Kleider lagen unter Marthas massiger Gestalt – die, die Martha angehabt hatte, ebenso wie die, die sie in einer großen Tasche bei sich trug, und auch Heathers Abendkleid und Schultertuch sowie ein schlichtes Kleid mit geschlossenem Rock, das Martha ihr für den morgigen Tag mitgebracht hatte. Die „Zofe“ hatte alle Kleidungsstücke ordentlich unter dem Bettlaken drapiert und sich kurzerhand daraufgelegt.
Heute Nacht blieb Heather nichts anderes übrig, als bei ihren Entführern zu bleiben.
Ein Teil von ihr war von Angst erfüllt, nicht zuletzt, weil besagte Entführer das Geschick bewiesen hatten, einen jeden ihrer Schritte vorauszuahnen und zu vereiteln. Ein kühnerer Teil ihrer selbst hielt dagegen, dass ihre gegenwärtige missliche Lage womöglich ein Wink des Schicksals sei. Vielleicht sollte sie lange genug bei ihren Entführern bleiben, um in Erfahrung zu bringen, warum sie und ihre Schwestern bedroht wurden.
In ihr rangen die widersprüchlichsten Gefühle miteinander, als ein Kratzen an der Fensterscheibe ihr einen Schauer über den Rücken jagte.
Stirnrunzelnd schaute sie zum Fenster – und sah einen Schatten davor aufragen.
Sie schlüpfte aus dem Bett, wickelte sich in die Überdecke und hastete über den blanken Fußboden. Als sie das Fenster erreichte, lugte sie hinaus und ...
... blickte geradewegs in Breckenridges Gesicht.
Kurz war sie vor Schreck wie gelähmt. Er war der letzte Mensch, den zu sehen sie erwartet hätte. Allerdings ...
Seine verzweifelte Miene und die brüske Geste, mit der er sie aufforderte, das Schiebefenster zu öffnen, rissen sie aus ihrer Starre. Immerhin befand sich das Zimmer im Obergeschoss. Wie es aussah, klammerte sich Breckenridge an einem Fallrohr der Regenrinne fest.
Sie reckte sich nach dem Fensterriegel und nestelte daran. Womöglich hätte sie mit Breckenridges Erscheinen rechnen sollen. Immerhin hatte er ihr nachgeschaut, als sie zur elterlichen Kutsche gegangen war. Er musste mit angesehen haben, wie man sie gepackt und in die Kutsche geworfen hatte. Endlich gewann sie den Kampf gegen den Riegel und schob behutsam das Fenster hoch. Holz scharrte über Holz. Sie warf einen Blick über die Schulter auf Marthas reglose Gestalt.
Das Schnarchen setzte sich unvermindert und gleichmäßig fort.
Breckenridge hatte ihren Blick bemerkt. „Ist jemand bei dir?“
Die Frage war ein kaum vernehmbares Flüstern. Heather nickte und beugte sich über die Fensterbank, damit sie auf gleicher Augenhöhe mit Breckenridge war. „Ja, eine große, starke Zofe, aber sie schlummert tief und fest. Das Schnarchen stammt von ihr.“
Er lauschte, ehe er nickte. „Gut.“ Stirnrunzelnd fügte er hinzu: „Woher hast du sie? Die Zofe, meine ich?“
„Meine Entführer – Fletcher und Cobbins – handeln im Auftrag eines Mannes. Sie sollen mich zu ihm bringen, aber der Mann hat sie angewiesen, es mir während der Reise an nichts mangeln zu lassen. Daher Martha. Sie saß in der Kutsche, als ich ergriffen wurde.“
Was immer man Breckenridge vorwerfen mochte, er war weder dumm noch begriffsstutzig.
„Deine Entführer haben dir also eine Zofe an die Seite gestellt.“
Sie nickte. „Sie soll sich um mich kümmern und dafür sorgen, dass der Anstand gewahrt wird. Fletcher – er ist der Dünne, Drahtige und offenbar der Rädelsführer – hat dies offen ausgesprochen, als er Martha und mich dem Gastwirt vorgestellt hat. Sie nennen mich Miss Wallace.“
Nach kurzem Überlegen fragte er: „Gibt es einen Grund dafür, dass du dem Wirt nicht deinen richtigen Namen genannt und ihn aufgefordert hast, dir zu helfen, den Fängen von diesem Fletcher und seinen Kumpanen zu entkommen?“
Sie lächelte verkrampft. „Durchaus.“ Sie berichtete ihm von Fletchers Geschichte über ihren angeblichen Vormund Sir Humphrey, ihre vermeintliche Flucht ins verruchte London und die offenkundig gefälschte Vollmacht.
Als sie geendet hatte, schwieg Breckenridge eine Weile.
Heather lehnte sich über den Sims und stellte fest, dass er sich tatsächlich an einem der Fallrohre festhielt, einen Stiefel auf eine der Schellen gestützt, mit denen das Rohr im Mauerwerk befestigt war. Bedachte man, dass er nicht gerade klein war und einiges wog, stellte diese Pose ein beachtliches Kunststück dar.
In jeder anderen Situation wäre sie vermutlich beeindruckt gewesen.
In der gegebenen Situation überraschte es sie umso mehr, dass ihre anfängliche Angst wie ausgelöscht war. Sie hob den Blick und begegnete seinem – sah, dass er sie eingehend musterte. Tief schaute er ihr in die Augen, ehe er blinzelte, leicht den Kopf schüttelte, vorsichtig eine Hand vom Fallrohr löste und eine auffordernde Geste machte. „Komm, Zeit zu gehen.“
Sie starrte ihn an und schaute abermals über den Sims – der Erdboden befand sich tief unter ihnen. „Du machst wohl Witze.“
„Ich halte dich fest und stütze dich, während wir hinunterklettern.“
Sie sah ihn an. Er wollte sie an sich pressen, sodass sie zwischen ihm und dem Rohr gefangen wäre? Die Vorstellung ... ließ sie innerlich erschauern. „Ich habe keine Kleider – Martha liegt darauf.“
Er ließ den Blick von ihrem nackten Hals abwärts über die Decke wandern, die sie sich umgeschlungen hatte. „Hast du darunter nichts an?“
Klang er verärgert? Oder fassungslos?
„Nur meine Chemise, die – wie du dir unschwer wirst vorstellen können – ein besseres Nichts ist.“
Kurz schloss er die Augen und schlug sie wieder auf. Seine Miene wirkte eine Spur grimmiger. „Also schön. Wenn das so ist, geh durch die Tür, und wir treffen uns unten ...“
„Die Tür ist abgeschlossen. Martha schläft mit dem Schlüssel in der Tasche. Zwar könnte ich das Schloss auch ohne Schlüssel öffnen, aber ich fürchte, davon würde sogar sie aufwachen. Und selbst wenn nicht – glaubst du allen Ernstes, dass ich es riskieren sollte, in diesem Aufzug in irgendeinen Tölpel hineinzustolpern, der schlaflos umherirrt?“
Sie sah, dass er dies tatsächlich in Erwägung zog. „Außerdem habe ich dir noch nicht alles erzählt.“
Er verengte die Augen, als argwöhnte er, sie treibe irgendein Spiel mit ihm. „Was hast du mir verschwiegen?“
Sie ignorierte seinen Blick und gab wieder, was Fletcher aufgetragen worden war. „Es hätte eine jede von uns dreien oder auch fünfen treffen können.“
Er schaute sie verständnislos an. „Und? Im Hinblick auf ein Lösegeld ist es belanglos, wen es trifft.“
„Schon, aber wenn dieser Auftraggeber lediglich auf ein Lösegeld aus ist, wieso lässt er mich dann aus London herausschaffen? Warum dieses immense Maß an Aufwand und Kosten? Weshalb mir eine Zofe zur Verfügung stellen? Das alles ergibt keinen Sinn.“
Breckenridge zögerte. „Die Zofe ergäbe Sinn, wenn dieser Auftraggeber dich zwingen wollte, ihn zu heiraten, um an deine Mitgift zu gelangen.“
„Wohl wahr. Aber wenn das seine Absicht wäre, ergäben wiederum seine Anweisungen keinen Sinn. Jeder, der auch nur oberflächlich Erkundigungen einholt, würde rasch erfahren, dass Angelica im Gegensatz zu Eliza und mir kein beträchtliches Vermögen geerbt hat. Sie war noch nicht auf der Welt, als unsere Großtanten gestorben sind, und daher wurde ihr nichts vermacht.“ In ihrem Eifer beugte sie sich weiter aus dem Fenster.
Breckenridge – von dem Gedanken gepeinigt, dass sie so gut wie hüllenlos war – wäre gern zurückgewichen, doch hinter ihm befand sich nichts als Luft. Also blieb ihm nur, ihre hüllenlose Präsenz zu ertragen, indem er, bildlich gesprochen, die Zähne zusammenbiss und sich wappnete.
„Deshalb“, fuhr der Fluch seines Daseins ahnungslos fort, „kann auch das nicht der Grund für diese Entführung sein.“ Sie schaute ihn an. „Was immer dahintersteckt – sofern ich die Wahrheit ergründen und herausfinden will, ob Eliza, Angelica, ich und vielleicht auch Henrietta und Mary weiterhin bedroht sind, muss ich bei Fletcher und den anderen bleiben. Zumindest solange ich nicht in unmittelbarer Gefahr schwebe.“
Von ihm drohte ihr momentan weit mehr Gefahr als vonseiten ihrer Entführer. Die Erkenntnis ließ ihn eine Grimasse schneiden, was sie offenbar als Zustimmung deutete.
Sie zog einen ihrer schlanken Arme unter der Decke hervor und berührte flüchtig die Hand, mit der Breckenridge sich am Fenstersims festhielt. „Würdest du meiner Familie eine Botschaft überbringen? Sie wissen lassen, dass es mir gut geht und ich sie benachrichtigen werde, sobald ich wieder frei bin?“
Ungläubig schüttelte er den Kopf. Sie glaubte tatsächlich ... „Sei nicht töricht.“ Er bedachte sie mit einem finsteren Blick. „Ich kann dich nicht in den Händen deiner Häscher zurücklassen und davonfahren.“
Während er sie musterte, überlegte er, wie viel sie wiegen mochte und ob er es wagen durfte ...
Sein prüfender Blick war ihr anscheinend nicht entgangen. Sie richtete sich auf, trat einen Schritt zurück und hielt ihm warnend einen Zeigefinger vor die Nase. „Denk nicht einmal daran, mich mitzunehmen – weder jetzt noch künftig. Ich schreie das ganze Wirtshaus zusammen, wenn du mich auch nur anrührst.“ Wunderbar. Aus schmalen Augen betrachtete er sie. Er kannte sie gut genug, um zu wissen, dass dies keine leere Drohung war.
Offenbar sah sie ihm an, dass er einlenken würde, denn sie entspannte sich. „Wenn du also so gut sein willst, eine Botschaft zu übermitteln ...“
„Ich habe euren Kutscher bereits mit einer Nachricht zu deinem Vater geschickt. Ich habe ihm ausrichten lassen, dass man dich in einer Kutsche über die Great North Road nach Norden entführt und ich dir auf den Fersen bin. Ich nehme an, wenn deine Angehörigen binnen eines Tages nichts von uns hören, werden deine Cousins sich auf unsere Spur setzen.“
Sie verschränkte die Arme vor der Brust und betrachtete ihn missbilligend. „Soll das heißen, dass du vorhast, mir zu folgen?“, hakte sie nach.
„Ja.“ Er sprach – flüsterte. „Selbstverständlich. Ich kann schlecht zulassen, dass man dich Gott weiß wohin verschleppt.“
„Hm.“ Nachdenklich sah sie ihn an. „Also schön, Folgendes werde ich tun: Ich werde Fletcher, Cobbins und Martha so viel wie möglich über ihren Auftraggeber sowie dessen Anweisungen und Beweggründe entlocken. Genug zumindest, um bestimmen zu können, ob meine Schwestern und Cousinen ebenfalls in Gefahr sind. Danach werde ich entkommen. Falls du dann noch in der Nähe bist, kannst du mir helfen.“
Sie verstummte und schaute ihn erwartungsvoll an.
Ihm lag eine gepfefferte Antwort auf der Zunge, aber ... Heather musste freiwillig mit ihm kommen, und „stur“ war ihr zweiter Vorname. „Na gut.“ Es kostete ihn Überwindung, die Worte auszusprechen. Nach kurzem Überlegen fügte er hinzu: „Ich werde eine Nachricht nach London schicken. Morgen folge ich eurer Kutsche und bleibe immer dicht hinter euch.“ Seine Miene wurde hart. „Eine Bedingung habe ich: Wir treffen uns jede Nacht.“ Er sah zu der im Bett schnarchenden Zofe hinüber. „Das sollte nicht allzu schwierig sein, selbst wenn jedes Treffen so ablaufen muss wie dieses. Sobald du in Erfahrung gebracht hast, was du wissen willst, wirst du mit mir nach London zurückkehren, und zwar umgehend. Wenn es so weit ist, werde ich eine Zofe anstellen, sodass alles seine Richtigkeit hat.“
Sie überdachte den Vorschlag kurz. „Das klingt nach einem hervorragenden Plan“, sagte sie schließlich.
Er verkniff sich eine sarkastische Bemerkung; Sarkasmus nahm sie nie gut auf. Stattdessen nickte er. „Schließ das Fenster und geh wieder ins Bett. Wir sehen uns morgen.“
Sie trat vor und ließ vorsichtig das Schiebefenster hinunter. Anschließend blieb sie einen Moment lang hinter der Scheibe stehen, ehe sie sich abwandte und verschwand.
Er blickte nach unten – widerstand mannhaft der Versuchung, heimlich zu beobachten, wie sie die Überdecke ablegte und ins Bett schlüpfte – und machte sich daran hinabzuklettern. Wie die Dinge sich entwickelt hatten, ärgerte ihn mehr oder minder; verdrießlich stimmte es ihn allemal. Während er sich am Fallrohr nach unten hangelte, musste er sich jedoch eingestehen, dass er ihre Standhaftigkeit unterschwellig, aber unleugbar bewunderte.
Die Familie war wichtig.
Das wusste kaum jemand besser als er. Sein leiblicher Vater, der verblichene Camden Sutcliffe, war ein herausragender Diplomat gewesen – und ein herausragender Frauenheld. Breckenridges Mutter war die Countess of Brunswick gewesen, die ihrem Gatten zwei Töchter, jedoch keinen Sohn geschenkt hatte. Breckenridge war von Brunswick ohne Umschweife als Sohn anerkannt worden – anfangs aus Erleichterung darüber, endlich den verzweifelt ersehnten Erben zu haben, und später aus echter Zuneigung.
Brunswick war es auch gewesen, der Breckenridge die Bedeutung von Familie vermittelt hatte. Seinen Vornamen Timothy verwendete Breckenridge selten; von Geburt an war er Breckenridge gewesen und identifizierte sich mit diesem Namen, der dem ältesten Sohn des Earl of Brunswick zustand. Als den nämlich hatte er sich immer betrachtet – als Brunswicks Sohn.
Daher verstand er voll und ganz, dass Heather das Bedürfnis verspürte zu ergründen, welches Motiv dieser skurrilen Entführung zugrunde lag. Immerhin tangierte dies nicht allein sie; es hätte auch ihre Schwestern und möglicherweise ihre Cousinen treffen können.
Er hatte selbst zwei ältere Schwestern, Lady Constance Rafferty und Lady Cordelia Marchmain. Häufig bezeichnete er sie als seine scheußlichen Schwestern, doch er hätte Drachen für sie getötet. Und obwohl sie ihm ständig Predigten hielten und ihn piesackten, liebten sie ihn. Vermutlich predigten und piesackten sie ihn deshalb; an den Ergebnissen ihrer Mühen konnte es weiß Gott nicht liegen.
Als er den Boden fast erreicht hatte, stieß er sich mit den Füßen von der Mauer ab, ließ das Rohr los und landete im Kies neben dem Inn. Er hatte den Wirt bestochen, ihm zu verraten, in welchem Zimmer die hübsche Dame untergebracht war. Da er seine Abendgarderobe trug, war es nicht schwer gewesen, in die Rolle des verwegenen Herzensbrechers zu schlüpfen.
Er richtete sich auf und blieb einen Augenblick lang in der kühlen Nachtluft stehen, um im Geiste durchzugehen, was er zu erledigen hatte. Den Phaeton würde er gegen ein unauffälligeres Gefährt tauschen müssen, aber die beiden Grauschimmel würde er behalten, wenigstens vorläufig. Er blickte an sich hinab und verzog das Gesicht. Auch an seiner Kleidung würde er Änderungen vornehmen müssen.
Seufzend machte er sich auf den kurzen Weg zu dem kleinen Gasthaus ein Stück die Straße hinunter, in dem er sich einquartiert hatte.
Hoch über ihm stand Heather am Fenster und beobachtete erleichtert seufzend, wie er davonschritt. Sie hatte ihn erst sehen können, nachdem er sich von der Wand gelöst hatte. Von der Sorge befallen, er könnte den Halt verlieren und stürzen, hatte sie gewartet und Ausschau gehalten.
Sie konnte ihn nicht ausstehen – kein bisschen. Seine herablassende Art war ihr zuwider. Dennoch wollte sie nicht, dass er zu Schaden kam, schon gar nicht, wenn er eigens gekommen war, sie zu retten. Dass sie sich gegen eine Rettung zum jetzigen Zeitpunkt entschlossen hatte, bedeutete nicht, dass sie so närrisch war, seine Hilfe auszuschlagen. Oder seine Rückendeckung. Oder gar, sollte es sich als notwendig erweisen, seinen Schutz – natürlich nur, soweit vertretbar.
Seine diesbezüglichen Fertigkeiten dürften nicht zu verachten sein.
Wie seltsam, dass sie von Selbstvertrauen und Zuversicht erfüllt worden war, kaum dass sie ihn vor dem Fenster erblickt hatte. In diesem Moment hatten sich alle zuvor gehegten Ängste verflüchtigt.
Sie wischte den Gedanken beiseite und wandte sich vom Fenster ab. Beruhigt, selbstsicher und um einiges überzeugter davon, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, tappte sie barfüßig zurück zum Bett, breitete die Tagesdecke darüber aus, schlüpfte darunter und legte den Kopf aufs Kissen.
Im Geiste sah sie Breckenridges Miene vor sich, als er sie gestikulierend aufgefordert hatte, das Fenster zu öffnen. Sie lächelte. Er, der sich gern so lässig gab, war plötzlich gar nicht mehr gelassen gewesen. Belustigt und leichteren Herzens zugleich, schloss sie die Augen und schlief ein.
3. KAPITEL
Am folgenden Morgen saß Heather relativ früh wieder in der Kutsche auf dem Weg gen Norden. Martha war eine Stunde nach Tagesanbruch aufgewacht und hatte Heather das Kleid aus schlichtem grünen Batist ausgehändigt, das sie für sie im Gepäck gehabt hatte. Heather hatte auch ihr Schultertuch mit der Fransenbordüre ergattern können, doch ihr Abendkleid aus bernsteinfarbener Seide sowie ihr kleines Abend-Retikül waren in Marthas ausladender Tasche verschwunden. Anderes Schuhwerk für sie hatte Martha nicht dabei. In den wollenen Umhang gehüllt und mit ihren leichten Ballschühchen an den Füßen, war Heather nach unten in eine separate Stube eskortiert worden.
Das Frühstück hatte sie gemeinsam mit Fletcher, Cobbins und der raubvogelgesichtigen Martha eingenommen. Es hatte sich ihr keine Gelegenheit geboten, auch nur den Blick eines der Mädchen einzufangen, die an den Tischen bedienten. Falls irgendwer sich nach ihr erkundigen sollte, würden sich die überarbeiteten Mädchen gewiss nicht an sie erinnern.
Während sie aß, rief sie sich ins Gedächtnis, wie sie sich gestern Abend in der Kutsche verhalten hatte. Sie hatte Fragen gestellt, ihren Entführern jedoch keinen Anlass gegeben zu glauben, dass sie ihnen ernstlich Schwierigkeiten bereiten oder ihre Befehle missachten könnte. Zugegeben, sie war nicht in Tränen ausgebrochen und hatte auch nicht, herzerweichend schluchzend, die Hände gerungen. Aber die drei waren vorab davon in Kenntnis gesetzt worden, dass sie Köpfchen hatte, und daher dürften sie ein solches Gebaren kaum erwartet haben.
Als man sie vorhin in die wartende Kutsche verfrachtet hatte, war sie zu einem Entschluss gelangt. Obwohl es ihr gewaltig gegen den Strich ging, würde sie weiter die junge Dame spielen, welche die drei vermutlich in ihr sahen: gefügig und trotz ihrer angeblichen Intelligenz verhältnismäßig harmlos. Während sie erneut in Fahrtrichtung Platz genommen hatte, hatte sie sich folgenden Plan zurechtgelegt: Sie würde die drei dazu bringen, in ihr ein schulmädchenhaftes Ding zu sehen, das sie nach Hause begleiteten.