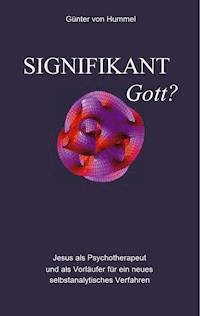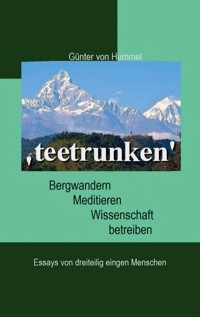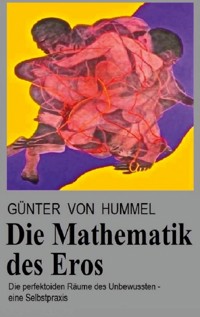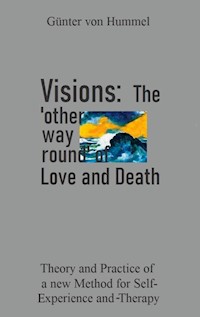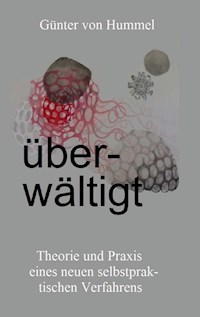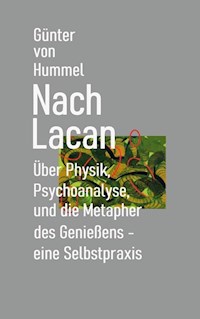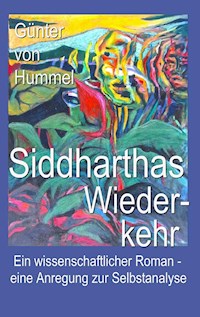
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der junge Inder Shayan Amand begibt sich beim Autor in psychoanalytische Behandlung. Schon bald wird sichtbar, dass seine früheren Meditationen an den Ufern des Ganges und andere Begebenheiten an Hermann Hesses Buch 'Siddhartha' erinnern. Aber auch Hesses Leben selbst, der mehrmals in Psychoanalyse war, zeigt Parallelen zu Shayans Entwicklung. Denn so wie für Hesse die Psychoanalyse nicht ausreichte, sondern zudem 'spirituelle' Aspekte notwendig waren, um seinem Leben und Schreiben deutlich Gestalt zu geben, so auch bei Shayan. Seine Therapie deckte viele seiner seelisch unbewussten Erinnerungen und Probleme auf, musste aber um ein meditatives Verfahren ergänzt werden, das der Autor schon vor vielen Jahren modernen wissenschaftlichen Kriterien entsprechend erarbeitet hat. Bei dieser Methode werden formelhafte Worte, die mehrere Bedeutungen in sich enthalten, dazu genutzt, das Unbewusste zu spontan auftretenden Gedanken anzuregen, die leicht zu entschlüsseln sind. Erst damit gelingt es einen ganz tief in Shayans Seele verborgenen Konflikt aufzudecken und ihm so ein reifes Leben zu ermöglichen. Somit halten sich romanhafte Erzählung und Wissenschaft die Waage und führen zu einem narrativ-essayistischem Ergebnis, das dem Leser Einsicht in die Tiefenpsychologie vermitteln, ihm aber auch helfen kann seine Selbstanalyse voranzutreiben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Umschlagsbild des Autors soll den indischen Dschungel zeigen, wie er vielleicht in Siddharthas letztem Aufenthalt vorgekommen ist. Bekanntlich zeigt Hesses Siddhartha dort seinem Freund Govinda, wie ihn viele Gesichter und Gestalten aus dem Pflanzengewirr anschauen und ihm so Entstehen und Vergänglichkeit allen Seins demonstrieren. Doch ist dies für heute nicht mehr der Weisheit letzter Schluss. Wir brauchen nicht nur für das Kaleidoskop des Bildes, sondern auch für das Durcheinander der Worte eine verbesserte Kombination beider, um die Weisheit neu zu ordnen.
Inhaltsverzeichnis
Das Niedrigste des Allerhöchsten
Kinderheirat und der Taumel des Sakralen
Shayan und Siddhartha
Psychoanalytische Therapie
Mutters Doppelblick und Gurus Echo-Diskurs
Literarisches und Wirkliches
Faszination und Sublimierung
Hesse und die Psychoanalyse
ARE – VID - EOR
Die doppelte Verneinung
Indischer Ausklang
Anhang zum Verständnis der praktischen Übungen der
Analytischen Psychokatharsis
Bibliographie
1. Die niedrigste Stufe des Allerhöchsten
Ganz zu Anfang dieses Jahrhunderts kam ein junger Inder, Shayan Amand,1 zu mir in analytische Psychotherapie, dessen Geschichte sowie auch der Verlauf der Behandlung mich stark an Hermann Hesse und sein Buch ‚Siddhartha‘ erinnerten. Shayan war zum zweiten Mal für längere Zeit in Deutschland und beherrschte die deutsche Sprache daher gut. Doch bevor ich die Schilderung der Therapie aufnehme und auf die Parallelität zu Hesses Buch eingehe, schicke ich ein paar vorgezogene Erzählungen voraus. Vorgezogen deswegen, weil alles, was ich nun schon anfangs erwähnen möchte, aus der eigentlichen späteren Behandlung stammt, deren konkreten Verlauf ich ab dem vierten Kapitel schildern werde. Ich will mich im Grunde genommen an dem Fortgang dieser Therapie orientieren, fange jedoch jetzt nicht gleich mit einer detaillierten Schilderung derselben an, weil sonst schon die ersten Zeilen mit etlichen wissenschaftlichen und theoretischen, das Verständnis nur erschwerenden Bemerkungen angefüllt sein würden.2 Nur über das Wesen des seelisch Unbewussten will ich jetzt gleich eine kurze Bemerkung machen.
Das menschliche Seelenleben verläuft nämlich größtenteils nicht bewusst, nicht in den Gedanken und Gefühlen, die uns zu beherrschen scheinen. Es ist vielmehr unbewusst, indem dort zwei grundlegende Strebungen, Triebe wirken; der französische Psychoanalytiker J. Lacan nannte sie die ‚imaginäre Ordnung‘ bzw. den Schautrieb, und die ‚symbolische Ordnung‘ bzw. den Sprechtrieb.3 An diesen beiden Grundkräften oder Ordnungen kann man nichts ändern, sie sind „konstante Kräfte“ wie sie schon S. Freud definierte, doch wie sie miteinander kombiniert sind, daran kann man verändernd mitwirken. Wenn der kleine Shayan Amand in Nordindien schon als Junge oft am Ufer des Ganges saß und meditierte, bewegte sich sein Seelenleben mehr aus der ersten dieser Strebungen heraus, dem der Schaulust, des Visuellen, des sich in sich selbst Spiegelnden, Imaginären. Der damals Elfjährige identifizierte sich mit Teilen der malerischen Umwelt des Flusses, mit dem fließenden Wasser, den Zier-und Chinagräsern des Ufers, den aufflatternden Brillenvögeln und vielem anderen um ihn herum. Ein Kind in diesem Alter verwächst noch oft mit den charakteristischen Zügen, den mehr optischen, imaginären Signifikanten all dieser Objekte und lässt daher die zweite Strebung, die sprachlich-symbolischer Zusammenhänge, noch weitgehend außer Acht.4 Shayans Seele war also noch sehr bildhaft und von der ‚imaginären Ordnung‘ beeinflusst, aber schon von einigen Wortbedeutungen und Symbolen mitgeprägt.
Der damals also Elfjährige hatte von seinem Großvater, der regelmäßig Yoga praktizierte, gelernt, wie man den frühen Morgen an den kühlen Wassern des Flusses dazu nutzen konnte, in jene leicht gehobene und wie mit der Umgebung verschmolzene Stimmung zu gelangen, die man in Indien Moksha nennt, Befreiung, Erlösung. Auch wenn dies für Shayan, den noch kindlichen Yogi, vielleicht kein altersentsprechender Begriff ist, denn er entstammt dem Vokabular komplex ausgearbeiteter Yoga- und Meditationsformen, so träumte der Junge manchmal doch davon wie sein Großvater, sein Babu zu werden, der in seinem Leben viel meditiert hatte. Babu war ein großer Mann, der reichlich sonnengegerbte Falten im Gesicht, einen grauweißen Bart und einen ähnlich farbigen kunstvoll geschlungenen Turban trug wie es bei den Sikhs, jener neben den Hindus und Moslems dritten Religionsgruppe in Indien üblich ist. Wie der Fluss hatte also auch Babu etwas Ikonisches an sich. Er war eine ‚Erscheinung mit Bedeutung‘ wie es der Philosoph W. Seitter nannte,5 oder der Archetyp des väterlich-gutmütigen alten Mannes wie es der Freud-Schüler C. G. Jung beschrieb.
Aber vielleicht hing Shayans Träumen nur damit zusammen, dass alte Menschen in Indien immer noch besondere Achtung und Ehrerbietung genießen, und sein Babu somit eine Art Gott-Mensch war, den man geradezu inständig verehren musste. Indien ist voll mit Bildern von alten runzligen und bärtigen Heiligen, und fast jeder alte normale Mensch zehrt dort ebenso von diesem Nimbus. In den modernen westlichen Gesellschaften kennt man kaum noch solch eine Berücksichtigung und Achtung des höheren Alters. Wer steht in unseren westlich-modernen Zivilisationen noch im Bus auf, um einem Älteren Platz zu machen oder lässt ihm beim Einsteigen den Vortritt? Schließlich glauben heutzutage die jungen Menschen bei uns, dass Altwerden keine besondere Leistung ist. Man wird automatisch alt, man muss nichts dazu tun, es ist eher hässlich und funktioniert von selbst, warum also sollte man dem Alter besondere Achtung zollen!?
Der Fluss, an dessen Ufern Shayan damals saß, strömte mit der ungeheuren Gelassenheit plastischer und abgekühlter Lava dahin. Ab und zu flog ein Reiher oder ein Schwarm Nektarvögel mit lebhaftem Gezwitscher auf. Es war einfach wundervoll das Erwachen der Natur zu beobachten und gleichzeitig denselben Ton, dieselbe Gestimmtheit und malerische Muße in der Seele aufzuspüren. Obwohl Shayan keine besondere Ahnung davon hatte, was Meditieren alles bedeuten konnte und was damit zu erreichen wäre, er wollte einfach – zumindest noch in diesem Alter – ein großer Magier, Zauberer oder Guru werden. Oder irgendetwas von dem, was auch in seinem Babu steckte, der selbst nie davon sprach oder etwas von seinem Lebensweg erzählte. Er wollte dieser geheimnisvolle Potentat werden, denn sein Schweigen hatte Babu vielleicht noch mehr interessant gemacht, als wenn er von den Ergebnissen seiner Meditationen und Erfahrungen dauernd gesprochen hätte. Babu war eine lebende Statue, ein indischer Weiser.
Später – mit etwa sechzehn oder siebzehn Jahren – wandelten sich Shayans Wünsche nach Größe und Ruhm, und er träumte davon Schiffskapitän oder gar Computerwissenschaftler zu werden. Auch Pilot und Raumfahrer waren Vorstellungen, die er sich später machte und die soweit gingen, dass er als einziger von einer anstrengenden und gefährlichen Marsmission zurückkehren und von allen umjubelt werden würde. Nach jahrzehntelanger Reise sah er sich von einem riesengroßen Spaceshuttle heruntersteigen und – allseits geehrt – seine Familie in den Arm nehmen. Er hatte noch keine Ahnung, dass man von einer Mission zum Mars wegen der schwierigen Ressourcen- und Rückstartprobleme nicht in einer Lebensspanne wieder zur Erde zurückkommen könnte. Vorerst jedenfalls muss man dort bis zum Tod bleiben, wenn man überhaupt lebend dahin kam.
Dagegen waren die Voraussetzungen für den Computerwissenschaftler, der er später dann tatsächlich geworden ist, in Indien nicht schlecht. Aber auch der Gedanke ein Guru wie sein Babu zu werden war für den Jungen nicht unrealistisch. Schließlich wuchs Shayan in der Nähe von Haridwar auf, wo es alle zwölf Jahre eine Kumbh Mela gibt, ein Treffen von Millionen gläubiger Hindus. In Indien gibt es hunderte von Namen für die Menschen, die sich den höheren Weihen des Yoga oder irgendeiner Art von ‚Spiritualität’ und Meditationsmethoden zugehörig fühlen. Man konnte Sadhu, Sannyasin, Paramahansa, Sant, Yogeshwar, Satsangi, Pandit, Sat-Guru oder gar Param Sant Satguru heißen, um nur ein paar der Titel zu nennen, deren Verwirklichung große Anerkennung versprach. In Indien befindet sich jeder Mensch schon von vornherein ein ganz klein wenig ins sogenannte ‚Spirituelle’ emporgehoben, was – fast muss man es so sagen – dort auch notwendig ist.
Denn nur diese leichte Anhebung führt dazu, dass die Menschen in dem ständigen engen Gewurrle, in demHautan-Haut-Gedränge, in dem zu einer scheinbaren Einheit gewordenen Masse-Mensch-Gefüge und -Gerumple überhaupt überleben zu können. Von einer gewissen auch noch so geringen Höhe aus, selbst wenn sie nur gefühlt ist, überblickt man nämlich alles und bemerkt, dass die Menschen alle in der gleichen Situation sind. Sie kommen mit ihren Rikschas, Fahrrädern, Ochsenkarren, TukTuks, Taxis, Last-und Personenwagen, als Fußgänger, Dabbawallas, Eremiten und als hundert andere Gestalten gleichermaßen gut vorwärts, wenn auch oft seitlich ausweichend oder durcheinandergekreuzt weiter. Alles funktioniert im hastig-gelassenem Tempo, und getreu nach Heraklits These vom ‚Panta Rhei‘ fließt alles zügig und doch auch sanft und gleichmütig auf einer sehr niedrigen Stufe des Daseins dahin.
Doch über all dies brauchte sich Shayan Amand keine komplexen Gedanken zu machen. Er war noch in die ländliche Dorfgemeinschaft, in der er, seine Familie, etliche Verwandte und Bekannte lebten, vollkommen eingeschlossen. Es gab dort – etwa Ende der siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts – kein Fernsehen und schon gar kein Gerät dieser heutzutage wichtigen digitalen Elektronik. Selbst ein Telefon besaßen nur wenige. Und nicht nur dem Alter musste man Achtung zollen, es galt – und gilt sicher auch heute noch – in Indien als normal, Ungemütliches, Schmerzhaftes, Eintöniges etc., auszuhalten, zu ertragen und zu erdulden. Ich hatte einmal einen jungen Psychologiestudenten in Therapie, der mir erzählte, welche Strategien, neue Methoden, Gruppen-Theorien und andere psychologische Verfahren in seinem Studium diskutiert würden, um das Leben angemessen gut und mit entsprechendem Spaßfaktor ausgestattet gestalten zu können. Für alles sollte es positive Bewältigungsformen und Bequemlichkeitsstrategien geben, um den doch so unsinnigen Stress zu vermeiden.
Doch jetzt, nach einigen Semestern des Studiums sagte der Student, dass er erkannt habe, manchmal auch etwas aushalten und ertragen können zu müssen. Er war selbst richtig erstaunt darüber. Denn aushalten war ein absolutes Negativwort. Es erinnerte an Durchhalteparolen der Kriegsjahre, und so etwas war verpönt. Etwas auszuhalten und nicht gleich nach psychologischen Tricks zur Vermeidung jeglicher Unannehmlichkeit zu rufen, erschien dem jungen Psychologiestudenten jetzt plötzlich wie eine Erleuchtung. Mal einfach warten, bis etwas Unangenehmes wieder vorbei ist, war Shayan, dem indischen Jungen dagegen von Natur aus vertraut. So etwas kommt immer wieder mal vor, dass es wochenlang zu heiß ist oder dass es im Monsun zu viel regnet. Dass es manchmal nicht viel zu essen gab oder einfach nichts los war und man so gezwungen war, etwas aushalten zu müssen ohne wie die heutigen Kinder westlicher Länder ständig zu sagen: „mir ist langweilig, was soll ich tun“.
Ich glaube also, dass es gut ist, schon ein paar wichtige Bilder aus Indien und Shayans Kindheit und Jugend zu vermitteln – auch einschließlich der Hintergründe, die in einer analytischen Psychotherapie erst nach vielen Sitzungen zur Sprache kommen. Ich will ja alles ein wenig so schildern, dass es nicht nur die Kasuistik eines Falles im Fachjargon wird. Es soll ein Gemisch aus meinen und Shayans eigenen Worten sein, eine Erzählung, ein essayistischer Roman, in den ich auch wissenschaftliche Thesen zu Wort kommen lasse, wenn ich einen Kommentar dazu mache, wie er versuchte, die Traumen seiner nicht gerade leicht verlaufenden Kindheit zu verdrängen.
Denn ein Kindheitstrauma hat – mehr oder weniger – jeder Mensch. Die erste Kombination der oben genannten imaginär-symbolischen Triebkräfte geht fast immer auch irgendwie schief. Das ganz kleine Kind ist damit überfordert, es kann nur einen Teil zu seiner Ich-Bildung integrieren und muss somit seine Seele spalten. Es kann in seiner Schaulust, in der neugierigen Strebung der Aufmerksamkeit, in diesen Spiegel- und Strahlungen, von denen ich eingangs schrieb, nicht alles klar und distinkt genug festhalten und die Mutter sowie die ersten Bezugsobjekte können nur eine gute Begleitung bieten.6 Dazu kommt, dass wir von Anfang an von der Sprachwelt, dem erwähnten Sprechtrieb, den ich gerne auch ein ‚Es Spricht‘ nenne, geprägt werden, was ebenso zur Verdrängung und Spaltung beiträgt. Denn der Mensch hat weder die Ordnung der Dinge noch die der Sprache erfunden, sondern ist von daher unbewusst bestimmt, wenn er auch ihre Kombinationen mitformen kann. Eine der ersten, wenn auch nicht die allererste Kombination ist das imaginäre ‚Objekt‘ seines Ich. Sein Spiegel und sein Echo.
Das Ausharren in der Stille und Einsamkeit mag also etwas Besonderes für Shayan gewesen sein, ohne dass er seine seelischen Vorgänge dabei genau hätte beschreiben können. Man muss sich sogar fragen, ob er sie wirklich voll empfunden hat. Moderne Psychologen stellen die kindliche Psyche oft als wildes, chaotisches Geschehen dar, doch Kinder können vieles schnell verdrängen oder – wie erwähnt – abspalten, solange es sich nicht um gravierend vitale Beschädigungen handelt. Diese Einsamkeit des Blicklichen, der Schau, des ‚Strahlt‘ am ruhig dahingleitenden Fluss deutete zwar an, dass die Fülle des Lebens nur vorläufig um den Preis einer Stille, Leere und Isoliertheit, zu haben ist. Auch solche Ausdrücke und Begriffe waren für Shayan dennoch gar nicht denkbar. Da existierte einfach nichts und niemand um ihn, nur ein paar vertrocknete Akazien fanden sich und ein paar Ring- und Silberdisteln sowie graugrünes Schilfgras und die besagten Reiher oder Vögel. Trotzdem macht die Dürftigkeit es aus, dass in der Meditation der schillerndste Überfluss auch schon in der Seele eines kleinen Jungen entstehen kann.
Je ärmer die Höhle des Eremiten, desto größer sein Reichtum an Ansehen und Geltung. Je schlichter sein Gehabe, desto üppiger fällt der Eindruck aus, den er auf andere macht. Dieses gegensätzlich Paradoxe ist in Indien auch heute noch überall zu erleben. Man denke nur an die Yogis, die jahrelang auf nur einem Bein stehen und dafür grenzenlos bewundert werden. Vielleicht war irgend so ein Bewusstsein für eine indische Besonderheit bei Shayan schon unterschwellig da. Seine Mutter ging fast jeden Tag mit ein paar Blumen aus dem Haus, um sie unter einen als heilig geltenden Baum zu legen. Im Wohnzimmer gab es einen kleinen Altar mit dem Elefantengott Ganesha und zudem wusste Shayan auch, dass er in einem der größten Länder der Erde lebte, was ihm eine wie ferngesteuerte Beruhigung verschaffte.
Indien war immer schon ein in nationale Größe und in spirituelle Vereinzelung geteiltes Land. Zweigeteilt also nicht nur wegen seiner enormen Differenzen zwischen arm und reich oder seiner ebenso enormen religiösen Spannungen, sondern auch wegen seiner Psychologie, indisch gesagt: der Vielschichtigkeit seiner Seele. Man findet da auf der einen Seite jene intellektuelle Oberflächlichkeit, von der manche sagen, es sei Fatalismus (was nur zum Teil stimmt), aber auch die Art von Kindlichkeit, wie sie in indischen Filmen zum Ausdruck kommt: dem Bösen sieht man seine Verderbtheit schon an der Visage an, während der Gute ein kitschiger jugendlicher Schönling ist, ein affektierter Held. Schließlich gewinnt er auch immer die Schnulzenaktrice, die theatralisch seufzende vollbusige Schickse, die immer von vielen mitfühlenden Mädchen umtanzt und umsungen wird.
Andererseits aber zeigt sich in Indien gerade bei den einfachsten Menschen oft jenes so echte, milde und aus tiefster Tiefe kommende indische Lächeln, dieses wortlose Du-zu-Du, das eine Übereinkunft gegenseitiger Freude und Zärtlichkeit, ja einfach einer universalen Gegenseitigkeit des von mir gerade erwähnten Masse-Mensch-Gefüges ausdrückt. Es handelt sich um das Lächeln einer Simplizität, die aus allen libidinösen Quellen des Körpers zusammenströmt, fast ohne selbst noch libidinös zu sein, indem es sich auf den Lippen ausbreitet, klanglos, klaglos, im Vorübergehen: Ich bin wie Du, auf der niedrigsten Stufe von etwas sehr, sehr Hohem, dem Höchsten. Diese niedrigste Stufe von etwas Allerhöchstem hatte schon Freud das Lust- oder Unlustprinzip genannt. Das Homöostase-Prinzip.
Die Seele, das Psychische, das Unbewusste, haben beim Menschen eine nie dagewesene Höhe erreicht, aber nichts ist unangenehmer, als wenn diese Höhe zu stark, zu spannungsgeladen, zu lustvoll (oder unlustvoll) und zu vielschichtig wird, weil es voll von Spiegelbildern, von Träumen und unklaren oder zu bedeutsamen Blicken ist. Diese erste Ausdehnung des Psychischen ist also vom imaginären Signifikanten her bestimmt, und während man so narzisstisch die niedrigste Stufe des Höchsten anpeilend recht aufwendig mit sich beschäftigt ist, kommt man nicht zum wahren Genießen.
Denn dies ist etwas anderes, wenn auch vielleicht Ähnliches wie der ‚sakrale Taumel‘, von dem mir Shayan gegen Ende unserer Therapie bei dem Ethnologen M. Leiris gelesen zu haben, erzählte. Die Kindheitserfahrungen am Gangesufer bei der Kumbh Mela in Haridwar (1986) hätten für ihn etwas von diesem Numinosen an sich gehabt, das das Schreckliche (das Unterste) mit dem Erhabenen (dem Obersten) verbindet. Ich komme darauf noch zurück. M. Leiris war von diesem Taumel, dem ‚Sacré‘, dem mehr geheimnisvollen, ja verbotenen Heiligen fasziniert gewesen. Ihm sei zuzuschreiben – wie H. J. Heinrichs erwähnt – dass z. B. ‚die gesamte Aktivität des Torero, des Dichters oder des Liebhabers „auf den winzigen, aber tragischen Spalt, der das preisgibt, was in unserer Conditio unvollendet ist“, gründet‘.7 Alle kreisen sie um dieses gefährlichreizvolle Niedrig-Höchste, das eine Kluft ist, eine Nervenspannung, eine unbewusste Dramatisierung.
Zu diesem Niedrig-Höchsten des ‚Sacré‘ passt eben auch, was man also in Indien ‚Spiritualität’ nennt. Darunter ist am wenigsten eine nur orthodox, nur operationalisierende religiöse Verfasstheit zu nennen, ein ‚sacré droit‘ (ein geregeltes Sacré) wie Leiris auch sagte. Ich selbst kann mit dem Begriff des ‚Spirituellen‘ nicht allzu viel anfangen, weshalb ich ihn auch in Anführungszeichen setze und auch eher Leiris zustimme, der es das ‚sacré gauche‘ nennt, das linke, linkische, wilde Heilige. Aber wenn ‚Spiritualität’ bei jenem milden Lächeln anfängt, das nicht viel Kraft kostet, aber die Reibungen des Alltags so erträglich macht, wenn es um etwas geht, das das Gefühl einer Ohnmacht, einer Schwäche aus Kopf und Bauch in den Lippen zusammenströmen lässt und so mit der erotischen Kraft aus den Körper-Chakras in einen flüchtigen Sieg verwandelt, muss es auch in ethnologischen oder psychoanalytischen Begriffen ausdrückbar sein.
Ich denke, es steht dem primärsten Mischen von imaginärer und symbolischer Ordnung nahe, es ist eine – wie Freud sagte – Ur-Verdrängung. Denn wie gesagt, das wahre Genießen kommt durch das droit/gauche, niedrig/höchste oder seelisch/körperliche Drama noch nicht ganz zustande, und das ist auch in der Psychoanalyse ein Problem. Es heißt allgemein, dass eine erste bedeutungsgeladene Erscheinung, „ein erster Signifikant, der denknotwendig vorhanden gewesen sein muss, auf ewig unbewusst ist“,8 ur-verdrängt ist, so als hätte eine Ur-Hexen-Mutter (fachlich gesagt: der Signifikant, der/das Bezeichnende, einer ursprünglich kastrierten Mutter) dem Kind einen maßlosen Schrecken eingejagt. Diese Kluft, diese Spaltung des Subjekts macht den Anfang des gesamtpsychischen Lebens aus. Indisch-yogisch ausgedrückt bedeutet dies, dass man so viel und so lange meditieren muss, bis man auch noch die obersten Chakras (psychophysischer Körperzentren) transzendiert hat und weiter und weiter irgendwo hinauf muss, was abenteuerlich klingt.9
Oft war das Sitzen am Fluss für Shayan auch nur ein einfaches Selbstgespräch. Manchmal schwammen Blätter, Äste, ein Stück Papier, ein Wasservogel, eine Dose oder gar ein Tierkadaver in der Mitte der Strömung, und Shayan flüsterte sich und den Wellen dabei etwas zu. „Du wirst bis zum Meer kommen“, murmelte er einem kleinen Baumstamm nach, der an ihm vorbeitrieb. „Vielleicht bleibst du aber auch vorher am Ufer stecken, nein, du kommst weiter, beeil dich.“ Das Monologisieren lernen schon kleinste Kinder, auch wenn sie noch gar nicht sprechen können. Zu Hause, abends im Bett, stammeln sie irgendetwas vor sich hin und wenn jemand zur Türe hereinkommt, verstummen sie sofort. Da soll niemand dabei sein, das Einlullen, Hin- und Herräumen ist wie das Vorbeiströmen eines Flusses ein privates Spiel, eine kindliche Meditation. Auch hier ist man der Niedrige, der amHöchsten teilhat.
Trotzdem dominiert hier noch das ‚Strahlt“ und nicht das ‚Spricht‘. Das Sprechen ist noch naiv, traumhaft, spielerisch und nicht das der Ketten wahrer Bedeutungskörper, kraftvoller Signifikanten. So schließt auch ‚Spiritualität‘ meist jene oft zu naive Gläubigkeit ein, die eine „ozeanische“ Tiefe im Gefühlsleben zu erreichen vermag, eine Beseeltheit, der Freud zu recht große Skepsis entgegenbrachte.10 Spätestens hier natürlich (wir Abendländer sagen „natürlich“ statt ‚spirituell’) beginnt es sich zu zeigen, dass die westliche Wissenschaft notwendig ist, wenn sie ein Unbewusstes definiert, indem sie sagt, dass es „strukturiert ist wie eine Sprache, w i e die Sprache des Anderen“. W i e: es geht nur um ein Wie, es ist keine übliche Sprache, sondern eben die der Signifikantenketten, der Kombination der Triebe und ihre Steuerung. Das/der Andere ist ein Sprechendes Nichts, ein Sprechender Niemand, ein reines Es Spricht.
Einmal hatte Shayan ein Missbrauchserlebnis, wenn auch eines der harmloseren Art. Ein älterer Mann, der häufig an dem besagten Fluss spazieren ging, suchte Kontakt zu Shayan, tätschelte und umarmte ihn in einer Weise, die Shayan recht unangenehm war, aber er getraute sich nicht etwas dagegen zu sagen oder zu unternehmen. Erst nach einiger Zeit sprang er auf und lief davon. Man muss die anfängliche Passivität als die Schattenseite des Respekts vor dem Alter und als Ausdruck der jugendlichen Unerfahrenheit und Unsicherheit deuten, denn viele Jahre später schämte Shayan sich dafür, bei diesen Annäherungen mehr oder weniger mitgemacht zu haben. Stets ist es der Selbstvorwurf sich gegen zu weit gehende Intimitäten nicht gewehrt zu haben, der quält und genauso kränkend ist wie der Missbrauch selbst.
Die „ozeanischen“ Gefühle suggerieren die Eins eines universalen Genießens, in das sich Shayan Amand vielleicht in vordergründiger Form zu verstricken drohte, wenn er diese malerische und doch leere, diese stimmungsvolle und doch monotone Umwelt in sich aufsog, um mit ihrer roten Sonne nach oben zu fliegen, um dann von einem einsamen, alten, nach Nähe süchtigen Mann in die schäbige Realität der Menschen heruntergeholt zu werden. Das Unbewusste dagegen ‚Spricht’ genauso wie das der obersten Chakras, wenn auch in einem fremden Jargon, in den schwer verständlichen Zeichen einer ‚Tiefensprache’ oder in Symptomen wie dem der Hilflosigkeit und Scham zum Beispiel. Es ‚Spricht’ so anders, dass man den Kern des Unbewussten eben die Sprache des Anderen genannt hat. Des unbewusst Anderen in jedem Menschen, was ich auch eine Kombination des ‚Strahlt‘ und ‚Spricht‘ in einer primären Form nenne. Denn Nichts und Niemand ist dennoch ein ‚Strahlen‘, das eben ‚Sprechen‘ kann, über das Shayan noch nicht verfügte und mit dem er sich noch nicht verteidigen konnte.
Dieses, dieser Andere bestand bei Shayan in der Verinnerlichung seines Babu, seiner Mutter, der Natur, seines Freundes Arun und noch vieler weiterer mehr. Verinnerlicht ergeben sie alle zusammen das, was ihn nachts von einem Tiger, einem Heiligen, einem Dickicht aus Ginsterbüschen, Schilf und Banyanbäumen, einem fremden Kathakalitänzer oder einem bösen Flussgeist träumen ließen. Shayan vermied es später wieder an die erwähnte Stelle am Fluss zu gehen, wo er den alten Mann getroffen hatte und suchte sich einen anderen Platz.
Trotzdem war in Shayans Seele das Helle und das Dunkle, das Aggressive und das Erotische, Tod und Lust bereits irgendwie weiterhin da. Auch ein Bad im Ganges hatte sich Shayan nie zugetraut, wie er mir später erzählte. Da gab es eine unergründliche Angst. Vor was, vor wem? Im dunklen amourösen Untergrund des Flusses schwamm nicht nur ein Baumstamm und ein Tierkadaver mit hinunter, sondern bereits auch das eigene Fremde, flossen auch nach ihm greifende knöchrige Hände oder Bilder der frühen Mutter mit hinab, die wie Kali oder Durga, Göttinnen der Finsternis, ihre eigenen Kinder frisst.11
Was Shayan an den Fluss trieb, war also vielleicht nur eine Flucht vor all dem, das er nicht verstand: Die Familie, die er noch gar nicht als den Zusammenschluss von missmutigem Vater, überforderter Mutter und seinen planlosen Geschwistern hätte bezeichnen können, indem sie ihm zwar alle keinen großen Halt boten, aber irgendwie doch existenziell für ihn da waren, beständig, kohärent, rein pragmatisch. Babus scheinbare Stärke, seine physische und geistige Besonderheit, seine fast wie krankhaft glänzenden Augen, die Hoffnung, Zukunft und offenbar zuverlässige Visionen versprachen, aber eben auch nur das. Auch ihm konnte er nicht viel von sich und seinen Gedanken erzählen. Die tödlichen Traumen der Kindheit sind da, und die kindliche Lebendigkeit muss sie überspielen.
Mit seinem wackeligen, alten und rostigen Fahrrad radelte Shayan später fast jeden Tag an eine verwunschene Stelle, an der der Ganges sich in mehrere Arme aufzweigt, bevor er weiter zur Schule nach Haridwar fuhr. Dort traf er dann seine Freunde, und nach dem Unterricht spielten sie auf einem leergelassenen Gelände Fußball. So sehr ja Cricket ein Traum von ihm gewesen war, wandte die Jugend und auch er sich zunehmend dem weniger eleganten, aber dafür direkterem, aggressiveren Fußball zu. Mit seinem Freund Arun blödelten sie dann noch eine Weile herum oder versuchten am Markt eine Papaya zu klauen oder an einem dieser nach außen offenen, kleinen und völlig überstapelten Bücherläden in ein paar Schmöker zu schauen.
Indische Jungs werden bis zum vierten-fünften Lebensjahr irrsinnig verwöhnt. Man hält die Kinder bis zu diesem Alter für besonders ‚rein‘ und sagt, dass die Götter in ihnen wohnen. Dass dies besonders für das männliche Kind gilt, mag für uns im Westen befremdlich klingen, aber es findet sich durchaus eine Parallelität bei uns. Die Freud’schen Geschlechts-Theorien, denen zufolge Junge und Mädchen in eben diesem Alter eine sogenannte ‚phallische Phase‘ ihrer Entwicklung durchlaufen, scheint genauso eine Bevorzugung des Männlichen zu beinhalten. Das Wort ‚phallisch‘ bezieht sich nämlich auf den Signifikanten einer mehr am Männlichen orientierten Kraft, Aktivität, Turgeszenz, Wichtigtuerei und Potenz.12 Dieser Signifikant gilt aber für beide Geschlechter gleichermaßen, was eben zeigt, dass er nicht von der Anatomie abhängig ist, auch wenn Freud – Napoleon zitierend – einmal sagte, ‚Anatomie ist Schicksal‘. Sie ist dies wohl nur zum Teil und vielmehr von menschlichen, unbewussten und nicht ganz vorurteilsfreien Regeln dominiert.
Überhaupt sind Kinder in Indien äußerst wichtig, denn nur dadurch hat man Ansehen, und in den ländlichen Regionen stellen sie auch eine bedeutende Arbeitskraft dar. Nach der frühen Kindheit aber herrscht umso mehr ein strenges und leistungsbezogenes Regime über sie. Eine enorm traditionalistische Gesellschaft wacht darüber, dass Kinder hauptsächlich die patristisch geordnete Hierarchie zu lernen haben. Dabei hatte Shayan noch Glück. Er entstammte zwar nicht einer Brahmanen Familie wie es Hermann Hesse seinem Siddhartha zukommen ließ – worauf ich schon wegen meines Buchtitels noch ausführlich zurückkommen werde – sondern einer kaufmännischen Mittelschicht, und dies zudem in der Nähe einer Großstadt wie Haridwar, wo sich größere schulische und soziale Möglichkeiten fanden, gar nicht zu reden von der erwähnten Bedeutung Haridwars als hinduistischer Pilgerstätte mit der größten Kumbh Mela Indiens.
Shayans Familie gehörte also in etwa dem mittleren Drittel der indischen Gesellschaft an. Shayan hatte noch eine jüngere Schwester, Lani, und einen noch jüngeren Bruder, Tarik. Vor allem aber war sein Freud Arun für ihn wichtig, der im gleichen Ort wohnte, aber mit dem Bus zur Schule fuhr. So konnte Shayan seine Meditationen machen ohne dass Arun davon wusste. Denn irgendwie war es Shayan unangenehm, selbst seinem besten Freund davon zu erzählen. Irgendwie war das eine Sache zwischen Babu und ihm, ein Faszinosum zwischen dem Jungen und dem ganz Großen, ein Generationengeheimnis oder auch nur eine kuriose Idee. Schließlich wirkte Babu wie das unbedeutende und auch schon physisch faltig-knöcherige Hausfaktotum, war in Wirklichkeit aber der enigmatische Mittelpunkt der Familie. Keiner wusste das so genau.
So sehr die indischen Jungs also zu übermäßigem Respekt und Ehrfurcht vor dem Alter erzogen wurden, so sehr empfanden Shayan und Arun mit zunehmendem Alter gegenüber den verknöcherten Priestern und religiösen Buchgelehrten mehr und mehr Desinteresse, Spott und Häme. Sie experimentierten mit sich selber. Vor langem hatten sie sich einmal hinter einem Gebüsch die Hosen heruntergezogen, hatten sich unter Kichern und Kreischen dreimal um die eigene Achse gedreht, die Hosen wieder hochgezogen und waren dann davongelaufen. Ein Exhibitionismus à deux, den sonst niemand sehen sollte, aber er galt dennoch all denen, die nur Regeln, Gesetze und Vorschriften erließen und diese auch noch mit Gewalt durchsetzen wollten. Und es befreite auch von alten Traumata.
Einmal allerdings wären Arun und Shayan fast von der Schule geflogen. Arun hatte einer vor ihm in der Schule sitzenden Schülerin eine kleine Blindschleiche von hinten in die Bluse gesteckt, grauenvoll. Die Schülerin sprang schreiend auf, riss sich die Bluse vom Leib, was bei allen Jungs zu pöbelhaftem Lachen führte. Shayan wurde als Mittäter identifiziert und so bekamen beide harte Strafen. Nur der Einspruch eines Lehrers, der beide wegen ihrer guten Leistungen in seinem Fach schätzte, konnte verhindern, dass man sie von der Schule verwies. Shayan bereute dies alles zutiefst, gab aber seine Mitschuld zu, da er den ‚blindworm‘ wie man das Tier mit englischem Namen in Indien nennt, selbst gefangen und zu Arun gebracht hatte.