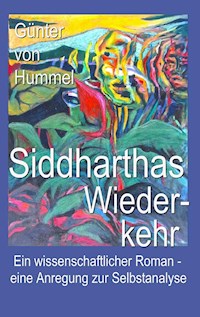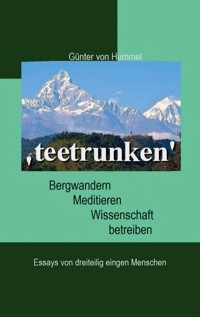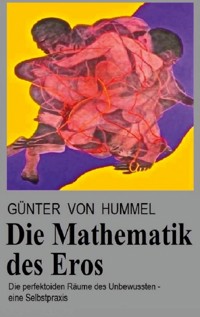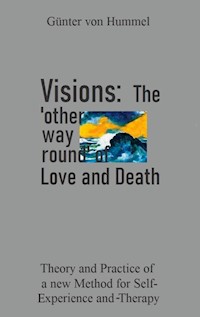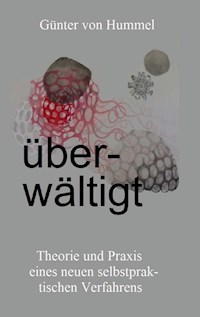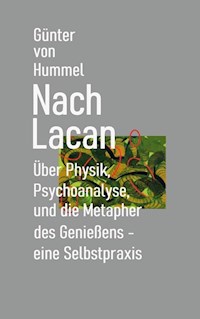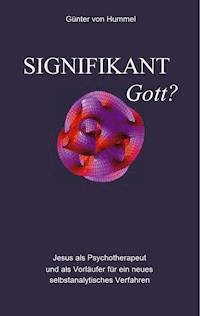
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Ausgangspunkt ist der Gedanke, dass Jesus ein Vorläufer der modernen Psychotherapie, ja der Psychoanalyse war. Umgekehrt kann man durch ein psychoanalytisches Sprechen, dass die Kernpunkte der "Jesus-Therapie" aufnimmt, zu einem Verfahren kommen, das beide Verfahren in einer neuen, kompakten Form übermittelt, so dass diese als direktes psychotherapeutisches Verfahren ähnlich dem Autogenen Training geübt werden kann. Dazu werden auch andere Wissenschaften und insbesondere und in sehr kritischer Weise die Theologie herangezogen. Der Untertitel, dass Gott ein "unsterbliches Gerücht" ist, stammt von einem christlichen Philosophen und darf nicht negativ verstanden werden. Vielmehr eignet sich ein kritischer Bezug auf das uns noch so stark bestimmende christliche Denken gerade dazu, eine innere Schlüssigkeit in der Argumentation zu akzentuieren. Das ist ein neuer psycho-theologischer Ansatz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort: Gott und die Psychoanalyse
Es
Strahlt /
Es
Spricht
2.1 Die ‚Jesus-Therapie‘
2.2 Übertragungsliebe
2.3 Der Gott der Philosophen
2.4 Wissenschaft / Meditation
Gott und
Formel-Wort
3.1 Sokrates, die Therapie und die Frauen
3.2 Die Ehebrecherin und die Metapher des Genießens
3.3 Die Urobjekte
3.4 Theorie / Praxis
Formel-Wort
und Wissenschaft
4.1 Theologie
4.2 Jesus, eine Psychobiographie
4.3 Transsubstanziation
Literaturverzeichnis
I. Vorwort: Gott und die Psychoanalyse
Die Gespräche von Jesus mit den Frauen, der Kanaanäerin, der blutflüssigen Frau, der Maria von Bethanien, der Ehebrecherin, der Sünderin bei Simon dem Pharisäer und der Samariterin am Brunnen, sowie seine therapeutischen Interventionen bei einem Blinden und bei Lazarus, zeigen ihn als Vorläufer der modernen Psychotherapie. Indem man zu ihm zurückgeht, lässt sich jedoch auch ein Schritt nach vorne über die herkömmliche therapeutische Analyse hinaus zu einem neuen, selbstanalytischen und -therapeutischen Verfahren gehen, das ich hier vorstellen will. Freilich gibt es Unterschiede, aber in der elemenatren Struktur des Unbewussten und im Umgang mit der zugrundeliegenden Psychodynamik finden sich Gemeinsamkeiten, die man – ohne die Religion zu sehr bemühen zu müssen – in eigenständiger Therapie nutzen kann.
Von religiösen Gefühlen, ja vom „ozeanischen“ Gefühl, sprach der Schriftsteller R. Rolland anlässlich eines Besuches bei S. Freud.1 Rolland wollte Freud überzeugen, dass dieses „ozeanische“ Gefühl der wesentlichste Zugang zum Seelenleben des Menschen sei, wogegen Freud weiter seine Ansicht verteidigte, die menschliche Seele müsse wissenschaftlich und mit nüchterner Skepsis erforscht werden. Unter dem „ozeanischen“ Gefühl verstand Rolland eine alles durchdringende Gewissheit gefühlsmäßiger, religiöser Art. Er hatte diese Erfahrung affektiv ekstatischer und mystischer Einheit bei den indischen Heiligen Ramakrishna und Vivekananda gemacht, und immerhin war Freud doch davon so beeindruckt, dass er mehrmals in seinen Schriften auf diese Erfahrung einging. Ganz lösen konnte er das Problem nicht, dass es doch gerade auch bei seinen Forschungen um die großen, wichtigen Gefühle der frühesten Kindheit ging (also um die Lebensphase, auf die Freud das Hauptaugenmerk seiner Untersuchungen richtete), und die noch zersplittert, noch so diffus sind, dass sie nicht in einer persönlichen Individualität und subjektbezogener Ganzheit erfahren werden können. Ganz früh ist der Mensch seelisch noch wie gespalten2 und lernt erst mühsam sein Ich aufzubauen und seine Strebungen und Gefühle so halbwegs zu einer Persönlichkeit zusammenzuhalten.
Der französische Psychoanalytiker J. Lacan sprach diesbezüglich von der Erfahrung des „Zerstückelten Körpers“ im Kleinkindesalter. Beim Tier korrelieren durch seine Instinkte Innen- und Außenwelt viel stärker, während das Kleinkind zappelt, etwas fühlt, wieder hampelt und etwas anderes fühlt etc. und so erst lange braucht, um eine innere Konstanz herzustellen. Auch wenn die Mutter dahinschmilzt, weil das Kind sie anstrahlt, muss man denken, dass es auch einen Karton, auf dem zwei augengleiche Punkte aufgemalt sind, gleichermaßen anlächelt. Derartige reale Illusionen zeigen eben an, dass das Kind noch lange kein konstantes Ich besitzt. Und selbst wenn man ein konstantes und gefestigtes Ich hat, kann man sich in seinen Gefühlen irren, auch wenn einige moderne Autoren eine ganzheitlich erfahrbare „Gefühlsintelligenz“ (emotionale Intelligenz) behaupten. Angeblich würde man – schreiben sie – mit seinen Gefühlen, so intensiv sie auch sein mögen, von diesen selbst ausgehend in einer derart intelligenten Weise so umgehen können, dass man gedankliche Rationalität weitgehendst entbehren kann.3,4
All dies klingt nicht sehr plausibel. Natürlich ging Freud nicht fehl, schon aus dem Sprachgebrauch des Wortes „ozeanisch” eine starke Komponente der Übertreibung, der Eigenliebe, des – wie er es nannte – Narzissmus heraus zu hören. Die übergroßen, allzu starken Gefühle blieben ihm verdächtig, dass sich dahinter infantile Wünsche verbergen könnten, und dass die Grandiosität dieser Gefühle also nicht haltbar ist. Dennoch müssen wir die Ebene großer und wichtiger Gefühle nicht verlassen, wenn wir der Freud’schen Wissenschaft weiter folgen wollen. Denn es gibt ja auch Gefühle, die groß mehr in ihrer Bedeutung als in ihrer Intensität sind, wo es also mehr um ein wichtiges Gefühl geht, als um ein starkes, ekstatisches oder gar „ozeanisches“ Gefühl.
Nicht umsonst fahren wir heute so oft in die Länder der sogenannten Dritten Welt, weil wir dort auf Menschen treffen, die zwar nichts haben, aber die irgendwie glücklich zu sein scheinen, indem sie irgendwie eingebettet sind in eine vielleicht etwas schlichte, manchmal sogar naive aber doch recht positive Grundstimmung. Diese Menschen sind von einem derartig positiven Gefühl getragen, weil sie, wie die indische Schriftstellerin A. Roy sagt, den „Gott der kleinen Dinge” lieben.5 Sie hat nicht vom ”Gott der kleinen Leute” gesprochen, was doch naheliegender gewesen wäre in einem südindischen Staat wie Kerala, wo man einen sozialen Retter bräuchte, einen Fürsprecher der Armen, einen Gott der absoluten Habenichtse.
Nein, es geht darum, dass die Menschen dort von den kleinen Dingen leben, vom Geruch des Sandelholzes, von den Geräuschen des Waldes, von einem Lächeln, von einem Blick! Irgendwie erzeugt das bei ihnen eine Grundstimmung, eine Grunderfahrung von Stimmigkeit, die A. Roy zurecht einen Gott nennt, d. h. ein wichtiges Gefühl, eine ständige duftende und raunende Metapher, eine enigmatische Lust. Die gläubigen Inder, sagt auch der Schriftsteller V. S. Naipaul, können schon aus der Hoffnung, aus dem Glauben, ja aus dem Dasein selbst, eine Lust, starke positive Gefühle und ein unmittelbares Genießen ziehen, und das gibt ihnen Halt.
Aber wie R. Rollands „ozeanisches Gefühl“ mutet diese Lust manchmal fast psychotisch an, denn trotz all den Kleine-Dinge-Gott-Gefühlen kann man in diesen Dritte-Welt-Ländern die großen existenziellen und zivilisatorischen Probleme nicht übersehen. All diese Beschreibungen einer wichtigen, positiven Stimmigkeit im Gefühlsleben dieser Gläubigen sind nur eine Annäherung, sind selbst wieder nur Mythos und Metapher, wo ich doch hier gerade Wissenschaft vorlegen will, auch wenn dies etwas paradox klingt: eine Wissenschaft des wichtigen Gefühls. Oder – wenn ich die Psychoanalyse mit heranziehe – könnte ich auch sagen: eine der Liebe, diesem wichtigen Gefühl, unterstellte Wissenschaft. Denn für die psychoanalytische Wissenschaft gibt es kein sachliches Objekt. Man muss sie mit Liebe ausüben. Auch die kleinen Dinge werden ja nur von der Liebe, mit der sie betrachtet und verwendet werden, zusammengehalten, und all dies überträgt sich eben dann auf einen Gott.
Der Gott der kleinen Dinge ist also liebenswert, weil die Menschen in Kerala nichts anderes haben als ihn und weil sich für diese Menschen in den wenigen, kleinen, bescheidenen Dingen wirklich ein Gott befindet. Wir dagegen, wir in unserer Ersten Welt, können mit Gott, ja schon mit dem Wort Gott oft nichts mehr anfangen, geschweige, dass diese Vokabel, dass diese Buchstaben G, o und zweimal t passen würden zu den großen Sachen, zu diesem Übermaß an Dingen und Materie, mit der wir uns dauernd umgeben und vollstopfen. Gott ist vielleicht grundsätzlich nur einer der bescheidenen Verhältnisse, ein Gott der großen, klotzigen und übertechnisierten Sachen existiert nicht. Ja, können dieses G, dieses o und diese t heutzutage überhaupt noch das bedeuten, was sie bedeuten sollen oder einmal bedeutet haben? Ich zerlege Ihn in seine Buchstaben, weil ich in diesem Buch eine Wissenschaft der Zeichen nutzen werde.
Hat das so stark gefühlsbetonte G-utturale, das sonor klingende o tiefgründiger Ehrfurcht und Staunens und der schnittige Imperativ der beiden t noch jene authentische Unmittelbarkeit und Lebendigkeit wie vor ein paar hundert oder gar tausend Jahren? Ist nicht die geistige und physische Umwelt, das Existenzielle des Menschen so anders geworden, dass diese Phoneme, Bedeutungszeichen und Signifikanten – oder wie man die wissenschaftlichen Einheiten, die wir für unsere Betrachtung benötigen, heute auch immer nennen mag – neu definiert, gewertet, gewichtet und „gewortet“ werden müssten? Denn all die neuen Wissenschaften haben doch nur noch einen Rest von diesem früher großgeschriebenen GOTT übrig gelassen und haben Begriffe wie Allmächtigkeit und Allwissenheit als unhaltbar herausgestellt.6 Auch der Gott der großen Namen und Titel, der aufgemotzten Bekundungen und violetten Fahnenschwenkens ist uns suspekt geworden. Eben deswegen sind nur noch ein G, ein o und zwei t geblieben, signifikante Einheiten, linguistische Kürzel, ein Schimmer jenes Namens aller Namen, den Nietzsche somit zu Recht hat sterben lassen wollen?
Wohl aus diesem Grund, dem des Zweifels, lässt auch James Joyce seinen Hauptprotagonisten Stefan Dädalus im Priesterseminar zu Dublin räsonieren, wie wohl God in den verschiedenen Sprachen ausgedrückt immer der gleiche sein könne. Schließlich resigniert er: “God remained always the same God and God`s real name was God.“ 7 Wer Gott heißt ist eben Gott, daran kann nichts falsch sein, und doch wird Stefan Dädalus samt seinem Autor daran irre. Der eine, weil er nicht Priester werden will, der andere (J. Joyce selbst), weil er den rigiden Katholizismus (speziell den darin enthaltenen –ismus) nie ganz überwinden konnte. Gott, Togt, G-tot, sein wahrer Name verbirgt sich in der Psycholinguistik seiner Anagrammatik. Gottot, wie Nietzsche es sich vorstellte oder Godot, auf den Beckett seine Schauspieler warten lässt. Abgenutzte, verbrauchte, verschlissene G –odd`s!? Alle diese Buchstabenspiele sollen uns nur dem Wesen einer Zeichen-Wissenschaft näher bringen, um von da ausgehend dem wichtigen Gefühl seine ganze Kraft und Klarheit wieder zurückgeben zu können.
Denn freilich ist Er nicht gänzlich gestorben, weil – wie ich mit diesen Buchstaben- und Kürzel-Schreibweisen andeuten will – die Zeichen nicht gestorben sind, in denen man nicht nur Ihn sondern überhaupt alles ruft, schreibt und kommuniziert. Schon Nietzsche hatte gesagt, dass „wir Gott nicht loswerden, weil wir noch an die Grammatik glauben“ und der katholische Theologe und Philosoph R. Spaemann nannte Gott in diesem Sinne sogar ein „unsterbliches Gerücht“. Dieser Ausdruck ist nicht negativ gemeint, im Gegenteil, genau damit ist – wenn auch poetischer, feuilletonistischer – das gemeint, was ich mit meiner Psycholinguistik auszudrücken versuche: Er, dieser großgeschriebene E und r ist vorwiegend und offensichtlich ein nicht umzubringendes Gerücht, ein hinter vorgehaltener Hand getuschelter aber ewiger Name, eine nicht auslöschbare Chiffre.
Und gerade darin liegt sogar eine geheime Wirksamkeit. Nichts weckt die Neugier, nichts das Interesse mehr als eine Verschlüsselung, ein enigmatisches Spiel mit den Zeichen, ein Wispern und Geraune. All dies konzentriert sich in einer Ordnung der Zeichen und in den Regeln einer Grammatik, nicht von Tatsachen, wie eben Nietzsche meinte, sondern in der Ordnung der Signifikanten, der wissenschaftlichen Bedeutungseinheiten und Bestimmer. Spaemanns Ausdruck vom Gott als einem unsterblichen Gerücht ist also somit konstruktiv und positiv gemeint, etwas anderes hätte man ohnehin von einem so knochentrockenen und traditionalistischen Katholiken wie Spaemann gar nicht erwarten können.
Ich möchte also eine einfache Orientierung an den Anfang stellen: Go tt als eine Kombination von Signifikanten, von Bezeichnern, von Bedeutungseinheiten. Ein Zeichen ist etwas für jemand, aber ein Zeichen anstelle von jemand, ein Subjekt-Zeichen, ist ein Signifikant.8 Da liegt der wesentliche Unterschied. Als die Bezeichnung Gott auftauchte, gab es noch keine moderne Wissenschaft. Man fasste in diesem Namen die Begegnung oder Erinnerung an einen großen Ahnen, den ersten Menschen oder Helden oder die „Vision eines Vaters der Menschheit“ mit dem grundlegenden Schöpfungsbegriff der Dinge zusammen und zwar eben in einer mythischen Form. Diese mythische Form personalisierte den Namen, gab ihm den Anschein einer lebenden Person, die eine Stimme hatte und die Gebote, Gnade und Strafe, Güte und Zorn, Politik und Therapie vereinte.9 Ich möchte jedoch die Dinge und die Namen nicht mehr in solch einer mythischen Form, sondern mit einer Wissenschaft von den Zeichen, den Bedeutungseinheiten, den Signifikanten ordnen. Ein solches Vorgehen könnte heutzutage sogar eine größere Chance für G, o, und tt sein, als die alten, herkömmlichen theophanischen Bilder oder gar diese Groß- und Mächtig-Schreibung samt dem dazugehörigen Pathos konfessioneller Religionen zu verwenden, die inzwischen so viel an Glauben verloren haben.
Der einzelne Signifikant hat keine Bedeutung, erst im Zusammenwirken zweier oder dreier von ihnen kommt eine Bedeutung zustande, die den Menschen in seiner Subjektbezogenheit, in einer Wissenschaft vom Subjekt erfasst. Hier lässt sich nichts sachlich oder gar geisteswissenschaftlich objektivieren. Nach Lacan sind alle Dinge und Wesen vom Signifikanten geschlagen. Auch der Philosoph M. Gabriel spricht davon, dass alle Objekte nur von ihren „Sinnfeldern“ her fassbar sind und nicht als solche, als „Dinge an sich“, ontisch, per se sozusagen aufgefasst werden können. Von daher, und nur von daher will ich zeigen, wie man das „unsterbliche Gerücht“ und das wichtige Gefühl trotz seiner subjektbezogenen Bestimmtheit fassbar machen kann.
Ein Beispiel: In Lk 10;38-41 und 11; 27-28 trifft Jesus auf eine Frau namens Martha, die ein Problem mit diesen Signifikanten hat. Sie ist etwas kapriziös, betont den Mutter-Signifikanten, den weiblich-mütterlichen Komplex, aber Jesus beharrt auf dem Vater-Namen. Es gilt nur eins, sagt er in etwa zu Martha, der Signifikant, das Vater-Wort in dir selbst. Exakt das muss man hören. Jesus hebt, wie ich noch an vielen anderen Gesprächen mit den Frauen zeigen will, stets die Wichtigkeit der Frau heraus, aber er will, dass sie das authentische Wort in sich hören, so wie er es selbst erfahren hat. An dieser Stelle erwähnt Jesus zwar das Wort Gottes, selbst redet er jedoch stets vom Vater, diesem groß zu schreibenden Anderen in ihm selbst, diesen bedeutenden Namen, Ur-Signifikanten, dessen psychoanalytische Bedeutung ich auf den nächsten Seiten erklären will. Nur selten bezeichnet sich Jesus als von Gott gesandt wie in Joh 8; 42.
Dass die Signifikanten heilen können kann man jedoch am besten in der Geschichte von Jesus und der Tochter des Jairus sehen. Jairus ist Synagogenvorsteher und von daher sicher auch ein strenger, ultraorthodoxer Vater. Die Autorin F. Kiefer hat klar erkannt,10 dass dem zwölfjährigen Mädchen in einem derartigen Haus und bei solch einem Familienoberhaupt eine starre Konventionalehe droht und sie sich wohl deswegen in eine schwere affektive Störung mit katatonischen Begleiterscheinungen oder hysterischer Lähmung geradezu hineinmanövriert hat. Sie war also nicht tot, wie die lärmende Menge um Jairus herum beklagte. Jesus fasste sie an und sagte in einem warmen, zärtlichen Tonfall „Talita Kumi“, was man mit „Ich sage dir, steh auf“ übersetzt hat, aber es könnte auch ein rätselhaftes ähnliches Wort gewesen sein, vielleicht eher Segnungsmetapher. Denn ein solcher, noch dazu von einem jungen Mann in warmherzigem Ton gesprochener Satz könnte eine ganz andere Wirkung gehabt haben, als die harte, apodiktische Rede des Synagogendirektors, der seine Familie nur herumkommandiert.
Schon vorher, beim Eintreten in das Haus des Jairus hatte Jesus auf die positive Übertragung hingewiesen, die Voraussetzung für die Heilung des Patienten ist. Der Patient muss von der Qualität des Therapeuten überzeugt sein, er muss fest glauben, vertrauen. Danach, wenn die Leute alle ihre ‚freien Assoziationen‘ beigetragen haben, indem sie durcheinander reden und sagen, dass das Mädchen schon gestorben ist und dass es gar keinen Sinn mehr macht einen Therapeuten zu holen, dass sie weinen und lachen, wie es bei Lukas heißt,11 kann Jesus dieses Deutungswort sprechen: „Du wirst aufstehen können, wenn ich das Wort spreche“, das Losungswort, das Identitätswort, „Rivka“. Denn es gibt Autoren, die behaupten, dies sei der Name des Mädchens gewesen,12 und die gehaltvolle Anrufung des Eigennamens (es heißt ausdrücklich, dass Jesus einen Ruf ausstößt) hat große Wirkung.
Der Signifikant (hier: Satzinhalt) erweckt ein Subjekt in Bezug auf einen anderen Signifikanten (hier: segnender Tonfall, gesprochen von einem jungen Therapeuten), sagt Lacan. Das Subjekt ‚Frau‘ wird in dem Mädchen erweckt, das sich nun nicht mehr als ‚Objekt‘ der Ultraorthodoxie und der gesellschaftlichen Strenge erfahren muss. Und weil die psychoanalytische Deutung dieses Falles nicht so schwierig war, veranlasste Jesus, dass man von der therapeutischen Hilfe, die er erbracht hatte, nichts der Menge draußen erzählen sollte. So etwas hätte nur stark idealisierende Übertragungen auf ihn ausgelöst, und das kann kein Therapeut gebrauchen. Mit solch einer Einstellung sind ja Jairus und dessen Frau schon laut lamentierend an Jesus herangetreten. Zum Schluss zog Jesus Jairus‘ Tochter noch bei der Hand zu sich (eine Geste der Körpertherapie, wie sie in der klassischen Psychoanalyse zwar nicht gehandhabt wird, aber hier sicher äußerst geeignet war) und machte so die Therapie perfekt.
Ja, Jesus versteht sich sogar noch auf einen Abschluss der Therapie, der bekanntlich in der Psychoanalyse immer etwas schwierig ist. Wie beendet man eine Psychoanalyse? Schließlich darf der Therapeut ja nicht von sich aus etwas tun oder anordnen. Er darf nichts beanspruchen oder wollen, auch nicht die Heilung, denn das wichtigste ist, die Initiative dem Patienten zu überlassen. Doch was tun, wenn der Patient mit der Therapie nicht aufhört? Das Ende der Therapie stellt sich nicht immer ‚natürlich‘ sein und so werden oft Versuche unterschiedlichster Art empfohlen, meistens ein extra dazu angesetztes Gespräch, in dem das Thema einfach direkt verhandelt wird. Jesus macht es jedenfalls sehr geschickt. Er sagt, man solle dem Mädchen jetzt etwas zu essen geben, und so wurde von ihrer Mutter sicher eine große Tafel hergerichtet, an der alle sich zusammensetzten, um den Übergang ins normale Leben zu gestalten. Mag sein, dass diese Anweisung von Jesus ein bisschen verhaltentherapeutisch klingt, aber bei seiner mehr aktiven analytischen Psychotherapie kann er sich einen Griff in die Trickkiste der Verhaltenstherapeuten leisten.
Wenn die christlichen Theologen die göttliche Sohnschaft von Jesus erklären wollen, benutzen sie z. B. oft den Begriff der Ontologie, der Wissenschaft vom Sein. Christus ist natürlich nicht biologisch Gottes Sohn, aber auch nicht nur irgendwie transzendental, imaginär, bildhaft geistig. Diese vier Buchstaben, das G, o, und zweimal t, fügen, ja schreiben sich in das Ontische, in das Sein als solches ein, das nicht unbedingt identisch ist mit dem rein Physikalischen, Materiellen, aber eben auch nicht mit einer Fiktion, einer von vornherein geistig genannten Einheit. Gott ist dann eben essentiell Einschreibung des Seins in das Sein, und ist dadurch bestimmt, dass Er dem Nichts radikal gegenübersteht. In diesem Ontischen gibt es dann folglich auch eine Vater- und Sohnschaft, indem das eine Sein vom anderen abhängt, ihm nachgefolgt ist, sekundäres Sein vom primären Sein ist. Gegen solche Auffassungen kann man nur mit Mühe logisch argumentieren. Für diese religiösen Ontologen ist Gott eben Gott, weil das Sein das Sein ist, weil ist ist ist. Gott ist sozusagen der „Gottist“, der Gottseiende seiner selbst. Fertig. Der ontologische Gottesbegriff, aufgebracht von Anselm von Canterbury, hat somit also auch seine Tücken. Denn was macht man mit ihm? Wie wird er plötzlich zum Christen-Gott?
Bekanntlich hat sich noch nie ein Mensch mit derartigen Logos-Spielen zufrieden gegeben. So fällt zum Beispiel schon bei dem Gott des Moses diese schwer verständliche Seins-Verdopplung auf: „Ehyeh Asher Ehyeh“, „Ich bin, der ich bin“, soll Er damals gesagt haben (oder: „Ich werde sein, der ich sein werde“). Die Psychoanalytikerin D. Zeligs hat sehr plastisch herausgestellt, dass es nicht der Gott ist, der dies gesagt hat, sondern das Unbewusste des in sich zerrissenen, gespaltenen, mit sich selbst ringenden Moses. Zwei mächtige Vater-Figuren, Vater-Symbole, Vater-Signifikanten wirkten nämlich in ihm zu- und gegeneinander. Das eine bezog sich auf die ägyptische Vater-Metapher (der Pharao und der Gott Echnatons), das andere auf den hebräischen und den midianitischen Gott (der spätere Jahwe). 13 Um diesen Konflikt zu bewältigen „visiert“ Moses einen eigenen, den „neutralen“, kompromisshaften Über-Vater (eine Art Über-Ich), den großen Anderen seiner selbst, zu einem – praktisch neuen – eigenen, personalen Gott. 14
Er „visiert“ das, was so Anders in ihm selbst ist, seinen inneren Widerspruch im „brennenden Dornbusch“ als einen einheitlichen, den Widerspruch lösenden, monotheistischen Gott, wie es auch Rolland mit seinem ‚Ozeanischen‘ versucht hat. Auch in den späteren, oft ja sehr skurrilen Dialogen tritt bei Moses diese Projektion des Seins, diese Seins-Verdoppelung in ständigen Rettungsvisionen zu Tage. Gott ist der seelisch Andere in Moses selbst, sein eigenes Umgekehrtes, Unbewusstes, das ihn aus seiner Verzweiflung und Spaltung als neue Über-Vater-Metapher rettet. Dabei hilft ihm insbesondere sein Eingebettetsein in die Gruppe, ins Volk, wie es viele Religionshistoriker beschrieben haben. Lacan spricht diesbezüglich vom groß zu schreibenden Anderen als dem Zentrum des Unbewussten, dem Ort der Sprachbildung, der Signifikanten. Das Unbewusste ist die Sprache des Anderen, sagt er. Für die reine Theorie mag es egal sein, welche Namen man gebraucht, für therapeutische Zwecke ist jedoch die Lacansche Nomenklatur besser. Denn man kann die Entstehung dieses Anderen aus den elterlichen und urelterlichen Signifikanten wie sie sich in den frühesten Jahren dem Kind eingraviert haben genau verfolgen.
Die Signifikanten sind etwas, das das Sein in den Schatten stellt und dafür aber – sozusagen auf der anderen Seite – das Symbol, das Zeichen, den eigentlichen Namen auferstehen lässt, in dem das menschliche Subjekt seine Anerkennung sucht. Für das Subjekt Mensch ist nicht das Sein allein wichtig, sondern die Bestätigung, die Anerkennung, die Würdigung seiner selbst. Der Signifikant hat etwas von einem Es Verlautet, einem Es Spricht an sich, auch wenn man nicht gleich weiß, wer oder was hier verlautet oder spricht. Man fühlt sich tatsächlich wieder an so etwas wie ein Gerücht erinnert. Etwas Spricht, sagt aber nicht ganz genau, was gemeint ist. Der Signifikant steht so auch einer Verkündigung nahe, ohne dass man weiß in welchem Namen und Rahmen etwas verkündet wird. Es geht einfach um Freuds Begriff des Es, das man sich als Frage vorstellen muss, Es, das Subjekt? Ist Es?17 Ja, Es ist, ‚Ex-ist‘. Um eine namentliche und gültige Verkündigung zu haben, muss diese Frage sich jedoch einem Verfahren stellen, in dem die Kombination der Signifikanten eine fassbare, hörbare Form annehmen. Dieses selbst zu übende, selbstanalytische Verfahren werde ich in den nächsten Kapiteln beschreiben.
Gott ist unbewusst, sagen die Psychoanalytiker, und das Unbewusste ist die Sprache des Fremd-Vertrauten, des Heimisch-Unheimlichen, des Umgekehrten, des Spricht der Andersheit. Bei Moses versteht dieses Spricht jedenfalls die Sache in Spannung zu halten, denn obwohl es für ihn bald klar zu sein scheint, dass es sich um den Gott der Väter handelt, der hier redet (oder sagen wir einmal neutraler „Etwas Göttliches“), dringt er doch stets auf die Enthüllung von dessen Namen. Und tatsächlich: bis zum Schluss versteht Es, dieses Gotthafte, seinen Namen zu verbergen! Immer wieder weicht Es der endgültigen Nennung seines Namens aus.
Es verkündet nur und sagt nicht woher und warum. Moses befindet sich im Stadium eines hilflosen Kindes, das zu seiner Mutter noch nicht sprechen kann und so mit diesem befremdlichen Anderen in eine schwierige Kommunikation eintreten muss. Es Spricht, aber Es Strahlt auch, denn sein Antlitz ist heller, blendender Schein. Es ist gerade diese Doppelnatur, die so wesentlich ist. Auch bei Jakobs Kampf mit dem himmlischen Unbekannten verhält es sich so. Jakob fürchtet einen Krieg mit seinem Bruder Esau. Im Morgengrauen vor dem Zusammentreffen ringt plötzlich ein Mann mit ihm. Verzweifelt frägt Jakob ihn mehrmals nach seinem Namen. Der Fremde sagt, dass Jakob Israel gewinnen wird, denn er habe schon mit Gott und den Menschen gestritten, aber seinen Namen verrät er ebenfalls nicht. Schließlich soll es Gott gewesen sein, konstatiert die Bibel und Jakob konstatiert es mit ihr.
Man muss kein Psychoanalytiker sein, um zu deuten, mit wem der noch schlaftrunkene und einen Angriff Esaus fürchtende Jakob plötzlich ringt. Es ist das Alter Ego, klar, das zuerst einmal mit Esau zu tun hat. Jakob ringt mit seinem Bruder-Schatten, der sich in ihm aufgebaut hat schon seit der Zeit, wo er Esau für ein Linsengericht dessen Erstgeburtsrecht abgeluchst hat. Und später hat er dann auch noch den Vater ausgetrickst, belogen und betrogen. Vor seinem altersschwachen Vater hing er sich ein Ziegenfell um, damit der ihn abtastende Alte glauben sollte, er sei Esau, und log ihm dies auch noch vor, um den Nachfolgersegen zu bekommen. Kein Wunder, dass Esau ihm Rache schwörte und töten wollte. Jakob hat eine Kampfes-„Vision“ gehabt, einen Klartraum oder irgendetwas Ähnliches im Moment dieser hohen Anspannung vor dem Bruderkrieg. Doch dann entpuppt sich dieser mit ihm ringende Andere als nicht so negativ, wenn auch übermächtig. Schließlich ist Jakob sich sicher, dass es Gott war. An Esau hat er keinen Moment gedacht, was psychologisch doch so nahe gelegen wäre. Er hat eine Selbstsublimation (innerpsychische Erhöhung, Verfeinerung) erreicht, eine antizipierte Überwindung des Bruderkampfes, eine therapeutische Lösung, eine Heilung. Das Alter Ego hat sich in den Anderen verwandelt und hüllt sich so in ein bedeutendes, wichtiges Gefühl ein, ohne klare Begriffe dazu zu liefern, aber man kann mit ihm ringen. Im Halbtraum oder in der Therapie. Seltsam, dass Theologen solche Szenen bei dem heutigen psychoneurologischen Wissen nicht anders deuten können, als dass sie einfach in Gottesrufe ausbrechen.
Auf jeden Fall geht es also nicht einfach nur um ein Sein, um eine Ontologie, sondern um ein Bedeuten, um ein „Wesenhaftes“, um ein Es Strahlt und Es Spricht, wenn ich dies einmal so verkürzt sagen darf. Wer spürt nicht, dass hier plötzlich ein Subjekt im Spiel ist, die Welt eines universal Imaginären, des „ultrasubjektiv Strahlenden“ wie Lacan sagt und auch des universal Symbolischen, die Welt der Haspel- und Posaunen-Worte, der Laut-Zeichen, der „Spreche“ und der Sage wirklicher Bedeutungseinheiten und nicht nur eine Ontologie? Beides in stetiger Alternanz stehend, so wie Lacan auch seinen Standardsatz sagen konnte: Ein Signifikant ist ein Subjekt für einen anderen Signifikanten. Zwischen dem Signifikanten Strahlt (blendenden Antlitz, Gesicht, das man nie schauen konnte) und dem Signifikanten Spricht (Verkündigung, Stimme aus dem Off), entsteht das gläubige Subjekt. Immerhin.
Die theologischen Statements wie etwa der „personale Selbsterschließungs-Beweis“ oder das „eschatologische, reflexe Zu-sichselber-Kommen der offenbarenden Selbstmitteilung“,18 sind demgegenüber wenig glaubensfördernd und genügen uns heute auch aus anderen Gründen nicht mehr so recht. Es klingt ein wenig nach Zauberei. Zu sehr haben heutzutage Psychologen und Neurowissenschaftler, Psychoanalytiker und Linguisten halluzinationsähnliche Gottes-Erscheinungen wie bei Moses und Jakob als ein psycho-physisches Phänomen beschrieben, das ganz gewiss einen hohen Wert hat und den Menschen damals Rettung und Führung war. Aber die abstrakte theologische Intellektualität ist kein Ersatz. Wir Jetzigen brauchen den Beweis, der an das herankäme, was wir heute eben den wissenschaftlichen, ans Mathematische herangehenden Beweis nennen. So ein Beweis, so eine Wissenschaft stört nicht das wichtige Gefühl, ersetzt aber zum großen Teil den früher für so wesentlich gehaltenen Glauben und auch die theologischen Spekulationen. Ich werde im Theologiekapitel noch ausführlich dazu Stellung nehmen. Vielleicht muss man diesen religiösen, fundamentaltheologischen Glauben an etwas ganz Bestimmtes vom unmittelbaren, simplen und primären Glauben unterscheiden, auch wenn beide nicht für das Darüberhinausgehende ausreichen.
Fides, der Glaube als solcher
Der primäre Glaube hängt mit der primären Wahrnehmung zusammen, die beim Menschen nicht mehr einfach ein instinktiv gesteuerter Sinnesvorgang, sondern ein an die Lust, an das Strahlt (weil es vorwiegend optisch ist) gekoppelter Erkennens-Glaube ist. Freud sprach diesbezüglich von der „Wahrnehmungsidentität“, man war also psychisch identisch mit dem, was man wahrnahm, besser: was man als den einen, den charakteristischen Zug an den Objekten wahrnahm. Der Psychoanalytiker N. Symington – den ich später noch weiter zitieren werde – spricht gar direkt von der „Wahrnehmungsliebe“ (so entstand ja auch ein Gott bei den Wahrnehmungen der „kleinen Dinge“). Für solche Menschen ist dann eben wahrnehmendes Existieren ein Glaubensakt, aber auch ein notwendiger Glaubensakt. Denn an was hätte man sich orientieren sollen? Glaube stützt sich vielleicht überhaupt auf die Tatsache, dass die Menschen primär glauben, vertrauen, bona fide sind, indem dies eine Hoffnung ist, die – wie ich vorhin schon zitierte – Lust verspricht. Auch wenn wir heute durch komplexere Glaubensweisen überformt sind, so haben wir doch alle auch noch basal Anteil an diesem ursprünglichen und schlichten Primärglauben, der erst einmal für unsere Beziehungen zur Welt und untereinander ganz wichtig ist. Ich setze ihn nochmals in Bezug zu dem Es Strahlt, in dem das eigentliche Es Spricht noch nicht genug ausgebildet ist.
Bei Freud gibt es keine Definition des Glaubens. Er unterscheidet den eher künstlich aufgesetzten, religiösen Glauben von der Gläubigkeit (Leichtgläubigkeit, die bei ihm auch Vertrauensseligkeit ist). Das Wort Vertrauen als einer Art des primären Glaubens, wie ich es gerade oben konstatiert habe, kommt bei Freud überhaupt nicht vor. Für ihn existiert also eher das, was er Identifikation nennt, Primäridentifikation. Man identifiziert sich wie erwähnt anfangs mit einem bedeutenden, charakteristischen Zug von der Mutter oder sonst etwas. Es gibt Bindung, Bindungsliebe im Zusammenhang mit der Mutter, aber selbst diese ist bei Freud nicht immer so von gesichertem Vertrauen gekrönt, denn schon früh gibt es auch Konflikte, Ängste und grenzenlose Unsicherheit. Vereinfacht gesagt fängt für Freud der etwas gefestigtere Glaube wohl erst da an, wo das „mütterliche Objekt“, ihre stillende Brust nämlich, als verinnerlicht und nunmehr „psychische Objekt“ symbolisch wird, d. h. wo man ihm einen Namen gibt: Ma, Mam, Mama, ein paar Laute nur, die das „Objekt“ symbolisieren. Auch das ein Gerücht, das bei manchen Menschen, nämlich Neurotikern, unsterblich scheint. Auch das nur ein Gesicht zwischen den Signifikanten, wie geschnitten.
Lacan bietet hinsichtlich all dieser Probleme eine einfache Lösung an. Er geht von einem grundlegenden Mangel aus, auf den der Mensch gleich anfänglich trifft und der sich auch mathematisch ausdrücken lässt, indem nach Cantor die Eins nicht eine positive Zahl ist, sondern eine „leere Menge“. Die Eins existiert, sie ist Menge, aber als solche enthält sie keine Elemente und ist also leer. Oder: eine Eins repräsentiert eine Null für eine andere Eins, und so ist der Mensch mit einem grundsätzlichen Mangel konfrontiert, mit dem des Null-Eins-Abstandes als undefiniertem. Für die psychoanalytische Wissenschaft ist Gott somit eine solche Menge, keine feste und klare Eins, über die die Menschen sich schon immer in ihrer Kritik beklagt haben: wie kann Gott dies oder jenes zulassen, grausame Kriege, entsetzliches Leid, verheerende Ungerechtigkeiten! Die Psychoanalyse weicht diesem Mangel, dieser Leere nicht aus. Sie erweckt im Menschen ein Sprechen, mit dem er über diese Leere hinausgehen und wirklich zu zählen beginnen kann. Denn der Patient wie auch der Analytiker sind nur eine Eins, die sich gegenseitig die Null repräsentieren, aber weil der Patient bis zum Geht-Nicht-Mehr reden kann und man daraus, aus den Nullstellen, Erkenntnisse gewinnen kann, verändert sich der Null-Eins-Abstand zu einer klaren Größe, mit der man präzise zu rechnen vermag.
So könnte man auch sagen, in Moses drängte ein unbewusster “Vatermangel“, eine „Vatersehnsucht“, diesen Gott zur Entäußerung, zum Spricht, und die „Wahrnehmungsliebe“ war sein Strahlt. Ich benutze diese beiden Ausdrücke als Grund-Signifikanten, da sie sich in den Grund-Signifikanten der Psychoanalyse wiederspiegeln oder ihnen entsprechen. So ist das Strahlt auch gut bei den Nonnen zu sehen, die in Liebeslust als Bräute Christi erblühten, ja physisch spürbar feurig entflammten. Wenn da nicht strahlende „Lieb-ido“ im Spiel war! Man muss es so schreiben, denn es ging ja nicht um Sex, sondern um eine subtile Erotik, ohne die selbst die Religion eben langweilig wäre. Bei den mystischen Nonnen war Christus das Spricht, die Erotik das Strahlt. Ich werde dies noch deutlicher in den Dialogen, die Jesus mit den verschiedensten Frauen (Samariterin am Brunnen, Ehebrecherin, etc.) führte, kommentieren. Jesus war in keinster Weise ein so unerotischer Mensch wie er uns dargestellt wurde. Und auch Moses war nicht einfach nur vom Rûach, vom „Heiligen Geist“ jüdischer Konvention erfasst – wie v. Stosch meint – sondern auch in dem erotischen Spannungsfeld zwischen seiner Frau Zippora und seiner Schwester Mirjam. Mirjam soll schwer eifersüchtig gewesen sein, sie war überhaupt eine eher wilde, verführerische und von magischen Kräften und vielleicht auch Inzestphantasien besessene Frau.19 Davon wollen Theologen natürlich nichts wissen. Aber gehen wir langsam vor.
Was den gerade erwähnten grundsätzlichen Glauben angeht, kommt es mir also in diesem Buch weder darauf an, was man glaubt und wie man glaubt, sondern ich will hier genauso wie vorhin mit dem Signifikanten G, o, tt, mit dieser Zeichenkombination, auch auf die Zeichenkombination des G, l, au, b und en verweisen, also nur auf das grundsätzliche Credo hinweisen, den elementaren Kredit, den wir geben, den wir einzahlen auf ein so oder so gemachtes und ungesichertes Konto unseres Seins. Ich will mich einer Buchstaben-Psychologie bedienen, an die ich glauben kann und muss, denn ich benutze sie ja. Denn wenn ich das Ganze auch nur ein bisschen von den Sprach- und Humanwissenschaften oder speziell von dem psychoanalytischen konjekturalwissenschaftlichen Verfahren her angehen will, gelingt mir vielleicht dieser Sprung vom Strahlt der Offenbarung zum Spricht vollgültiger Sätze, vom primären und fast blinden Credo (dieser vielleicht primären Gläubigkeit) als der These und vom Überbau-Credo einer Konfession (dem religiösen Glauben) als der Antithese zur neu gefassten Synthese des Gl, au und be und n (ich muss am Anfang derartige Lettern-Spiele verwenden, weil ich sie dann später durch ein wissenschaftlich fundiertes Lettern-Werk ablösen und damit wirklichen Glauben, d. h. ein Wissen, begründen kann). Ich will dem Namen, der sich aus den Zeichen G, o und dem dazugesetzten zweifachen t ergibt, durch ein wissenschaftliches Verfahren eine neue Chance geben.20 Für dieses Verfahren, dem ich den Namen Analytische Psychokatharsis gebe, werden dann eben auch Buchstaben, oder noch besser B(r)uchstaben gebraucht.21 Damit sind wieder Schnittstellen, Wortüberlappungen, bzw. Kürzel in Wortverbindungen gemeint, auf die ich noch eingehen werde.
Denn solches Vorgehen ist dringend notwendig. E. O. Wilson, neben A. Mayr der bekannteste Biologe der letzten Zeit, erklärte in einem Interview, dass wir keinen Gott brauchen, weil wir bereits ein „moralisches Gehirn haben“, das uns zudem von „allen Fesseln befreit.“ Wie angedeutet, ich bin weder Theist noch Atheist, ich will einen dritten Weg zeigen, der sich zudem gut wissenschaftlich darstellen lässt. Denn die Aussage Wilsons ist natürlich ziemlich unintelligent. Jeder, aber wirklich jeder weiß, dass unser zwar hochkomplexes aber letztlich doch biologisches Gehirn weder moralisch noch amoralisch ist. Unser Gehirn hat nicht verhindert, dass wir im erst gerade zurückliegenden Jahrhundert ca. einhundert Millionen Menschen auf zum Teil grausamste Weise in Kriegen oder sonst wie umgebracht haben. Auch Tiere können grausam sein, aber die perverse Art von Grausamkeit, die wir Sadismus kennen, gibt es nur beim Menschen und seinem „moralischen Gehirn.“
Für den Psychoanalytiker ist Gott also unbewusst, er ist der (das) unbewusst Andere in uns. Er „ist ein Körper ohne Gestalt“, d. h. körperhaft erfahrbar, aber ohne jede definitive Zuschreibung.22 Einem Psychoanalytiker ergeht es selber sowie dem bereits zitierten Moses: er kennt das Unbewusste, das blendende Strahlt, und sodann hört er die „freien Assoziationen“ seines Patienten, d. h. die Einfälle aus dem Off (Träume, Erinnerungen, Phantasien, Geständnisse (Spricht), die dem Patienten herausrutschen),23 Er steht also damit dieser Doppelnatur des Strahlt / Spricht gegenüber so wie Jakob vor dem Schatten dieses Esau-Anderen. Für Freud, der sich stets ein Atheist nannte, war Gott nichts anderes als der nach jenem rätselhaften Mord am Vater durch posthume Schuldgefühle zu einem Gott erhöhte Ahn. Gott also als überhöhter und gleichzeitig toter Vater. Als schuldgesteuerter erhöhter Ur-Ahn, der sich in der Offenbarung halluzinatorisch wieder verwirklicht.
Doch lässt sich aus den Freud’schen Schriften noch eine andere These herauslesen, die uns den Gott nicht so sehr vermiest und auf die ich mich mehr stützen werde. Nicht nur das zwanghafte oder auch hysterische Ich-Ideal, das aus dem Zusammenwirken von Es und Über-Ich24 entsteht, hat eine Beziehung zu Gott. „Mit Hilfe der Über-Ichs“, schreibt Freud nämlich, „schöpft [das Ich] auch in einer für uns noch dunklen Weise aus den im Es angehäuften Erfahrungen der Vorzeit.“25 Diese „dunkle Weise“ hat etwas mit unseren Signifikanten zu tun, und ich muss sie daher etwas zu erhellen versuchen. Sie wird uns zwar nicht den Gott der Dinge früherer Zeiten, der ein Gott der kleinen Dinge (und dann auch der großen Namen) war, in perfekter Form wieder zurückgeben, aber einen idealen Zugang zu diesem Anderen als solchem, diesem Unbewussten in uns selbst, könnte uns die Aufhellung jener „dunklen Weise“ durchaus ermöglichen, egal ob wir dafür dann das G, o und tt verwenden oder nicht. Denn im tiefsten Sinne war Freud, der sich so intensiv mit dem „Mann Moses“ beschäftigte und der in späteren Jahren die Wurzeln seiner jüdischen Zugehörigkeit nicht mehr so ganz wie früher verleugnen wollte, nicht wirklich atheistisch. Er hielt nur an dem Kastrationskomplex als dem universellsten Komplex schlechthin fest und so ist ihm eine Integration der wichtigen, großen Gefühle, wie ich es hier verstehen will, in seine Wissenschaft nicht gelungen.
Um es gleich vorwegzunehmen: Meine hier vorgestellte These klingt umgekehrt als die der herkömmlichen Theologien. Nicht Gott „sagt sich uns geistig im Logos zu“,26 sondern heutzutage müssen wir den Logos wissenschaftlich durchdringen, um daraus jenen Anderen in der Form des Strahlt / Spricht in uns hervorzurufen, ja zu erschaffen und dadurch dieses „unsterbliche Gerücht“ neu in uns selbst ergründen und entmystifizieren.27 Wir müssen Ihn/Es in uns erwecken und nicht in äußeren Formen der Verehrung idolatrisieren. Wir müssen Ihn/Es mit einer wissenschaftlichen Methode kreativ in uns selbst erfahrbar machen. Im Grunde genommen war dies immer schon so, dass Gott eine Erhellung, ein körperhaft spürbarer Auftrag des Subjekts und im Subjekt war und nicht irgendwelcher objektiver Arrangements.28 In gewisser Weise erzeugt ja bereits die Tatsache des Sprechens allein (des Schreibens, Nennens, etc.) die Hypothese eines bedeutenden Anderen. Dem Sprechen wohnt nämlich ein eigenes, ihm typisches Gedächtnis inne – eben das der Signifikanten, der Subjekt-Zeichen.
Indem in einer Symbol-Kette mit vier (oder mehr) Momenten es immer den Platz des „ausgeschlossenen Moments”, des „toten Signifikanten” gibt, entsteht gerade aus diesem Toten, diesem Nichts, der Druck nach einer besonderen Bedeutungsschöpfung, die Entstehung des Ganze, der Sinn.29 Gott darf mit Lust und Sexuellem nichts zu tun haben, um Schöpfer dieser Welt zu sein.30 Eben diese Stelle muss leer bleiben, tot. Dass es diesen Gott oder auch dieses unbe-wusst Andere (geschrieben mit großem A) gibt, hat also einfach etwas damit zu tun, dass es eben nur Subjekt-Zeichen gibt, Signifikanten, die sich lediglich den Dingen entsprechend, relational – und nicht statisch zueinander – kombinieren. Das ist alles. Und will man zu Gott kommen, nun, dann muss man Ihn eben ganz subjektbezogen, ganz bei sich selbst und in sich selbst zustande bringen und nirgendwo sonst. Wie gesagt, man muss Ihn dabei nicht Gott nennen, man kann es auch bei der Vermutungswissenschaft belassen oder durch die Anwendung der Analytischen Psychokatharsis aus sich selbst heraus einen Namen erfahren. Diesen Logos kann man sich dann selbst zusagen, denn er wird mehr Bestand haben, als der nur von außen herangetragene.
In diesem Buch will ich in erster Linie das neue therapeutische Verfahren vorstellen, das die „dunkle Weise“ zwischen Es und Über-Ich, zwischen den Signifikanten G, o und tt und den Dingen, zwischen Strahlt und Spricht, zwischen Logos als geistiger Zusage und Logos als Zusage aus dem Unbewussten – oder von was wir auch immer ausgehen wollen – erhellen soll. Dies geschieht mit Hilfe einer eigenen, gesonderten signifikanten Schreibung (Formel-Worte), die ich in der Beschreibung des Umschlagseitenbildes bereits erwähnt habe. Es geht es um ein Element aus der Psychoanalyse Lacans, das den zentralen Teil meines Therapieverfahrens darstellt. Ich will das wichtige Gefühl mit der Präzision topologischer Bahnen (linea maximalis) ausgestattet wiederfinden.31 Dazu werde ich aus der traditionellen Schreibung der „Punkt-Flecken“32 G, o und zweimal t schöpfen. Just die Dialoge von Jesus nämlich eignen sich hervorragend dazu, die Zeichen, besser: die Signifikanten des Glaubens mit denen der Wissenschaft zu verbinden.
Denn sie sind in einer direkten, „aktiven“ Art von Psychoanalyse verfasst, wie wir sie heute eher vermeiden, aber doch im Zusammenhang mit dem Freud’schen Vorgehen sehen können. Mich interessiert somit vorwiegend der Heiler Jesus (oder auch der Heiler Moses), nicht der Gottes-Sohn (oder der Auserwählte), und der Therapeut, nicht der Glaubenslehrer. Über den Therapeuten werden wir viel besser einen Vergleich zwischen damals und heute, zwischen Jesus (und anderen Religionsstiftern) und Freud herstellen können, als wenn wir uns nur an so Gegensätzliches wie Glaube und Wissenschaft, an Gott und die Dinge und allein die Zeichen halten. Uns soll es um die Wahrheit als Ursache gehen, als