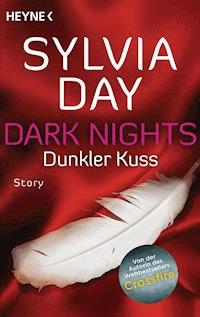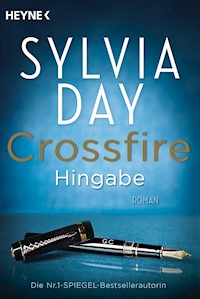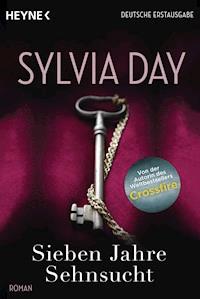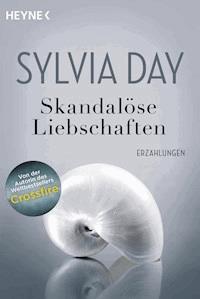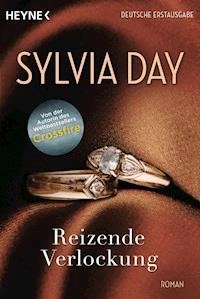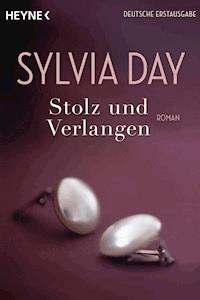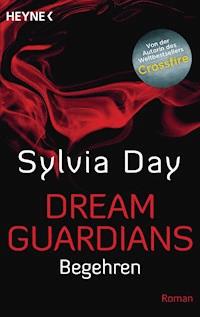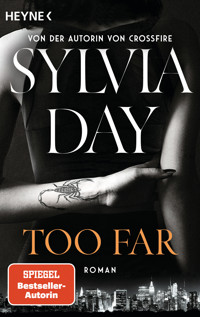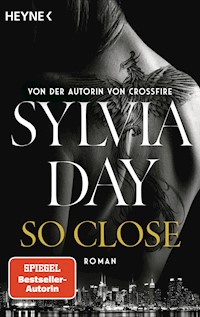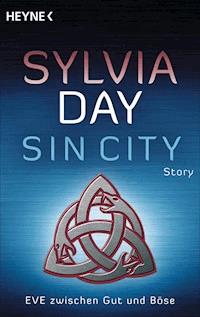9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Erotik
- Serie: Die Georgian-Reihe
- Sprache: Deutsch
Maria Winter ist jung, reich und schön. Trotzdem wird sie die »eiskalte Witwe« genannt, denn ihre beiden Ehemänner starben einst unter mysteriösen Umständen. Es hält sich das hartnäckige Gerücht, dass Lady Winter an ihrem Tod nicht ganz unschuldig ist. Tatsächlich treibt aber ihr Stiefvater Lord Welton ein perfi des Spiel mit ihr. Als er Lady Winter auf den Piraten Christopher St. John ansetzt, der die Todesfälle undercover aufklären soll, stimmt sie widerwillig zu. Doch schon bei Ihrer ersten Begegnung spürt sie ein nie gekanntes Verlangen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
DAS BUCH
»Bitte vielmals um Verzeihung«, murmelte eine aufregend heisere Stimme so dicht an ihrem Ohr, dass sie die Schwingung spürte.
Diese Stimme brachte sie dazu, zu erstarren und den Atem anzuhalten. Reglos stand sie da und spürte, wie all ihre Sinne ungewöhnlich intensiv zum Leben erwachten. Eindrücke stürmten auf sie ein – eine harte Brust an ihrem Rücken, ein fester Arm, der um ihre Brust geschlungen war, eine Hand an ihrer Taille und ein durchdringender Geruch nach Bergamotte, vermischt mit herbem Männerduft. Er ließ sie nicht los, im Gegenteil: Sein Griff wurde noch fester.
»Lassen Sie mich los«, sagte sie leise, aber herrisch.
»Wenn ich so weit bin.«
DIE AUTORIN
Die Nummer-1-Bestsellerautorin Sylvia Day stand mit ihrem Werk an der Spitze der New York Times-Bestsellerliste sowie 21 internationaler Listen. Sie hat über 20 preisgekrönte Romane geschrieben, die in mehr als 40 Sprachen übersetzt wurden. Weltweit werden ihre Romane millionenfach verkauft, die Serie CROSSFIRE ist derzeit als TV-Verfilmung in Planung. Sylvia Day wurde nominiert für den Goodreads Choice Award in der Kategorie bester Autor.
Besuchen Sie die Autorin unter ww.sylviaday.com, facebook.com/
authorsylviaday und twitter.com/sylday.
LIEFERBARE TITEL
Crossfire. Versuchung
Crossfire. Offenbarung
Crossfire. Erfüllung
Geliebter Fremder
Sieben Jahre Sehnsucht
Dream Guardians – Verlangen
Stolz und Verlangen
Eine Frage des Verlangens
Dream Guardians – Begehren
Sylvia Day
SPIEL DER LEIDENSCHAFT
Roman
Aus dem Amerikanischen
von Marie Rahn
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe PASSION FOR THE GAME
erschien bei Penguin Books Ltd, New York
Vollständige deutsche Erstausgabe 09/2014
Copyright © 2007 by Sylvia Day
Copyright © 2014 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München
unter Verwendung von © shutterstock/djgis
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-641-12356-7V003
www.heyne.de
Der göttlichen Verlegerin Kate Duffy.
Für alles, besonders aber,
weil sie meine Bücher genauso liebt wie ich.
Ich schreibe leidenschaftlich gerne für sie.
Kapitel 1
»Wenn alle Todesengel so hinreißend wären wie du, würden die Männer bei dir zum Sterben Schlange stehen.«
Lady Maria Winter ließ den Deckel ihres emaillierten Döschens mit den Schönheitspflästerchen entschieden zuschnappen. Der Mann, den sie im Spiegel gesehen hatte, war ihr so zuwider, dass sich ihr Magen krampfte. Sie holte tief Luft und hielt den Blick auf die Bühne gerichtet, doch ihre Aufmerksamkeit galt ganz dem unvergleichlich gut aussehenden Schönling, der etwas hinten versteckt in ihrer Loge saß.
»Du kommst auch noch an die Reihe«, murmelte sie, bewahrte aber wegen der vielen in ihre Richtung gewandten Lorgnetten Haltung. An diesem Abend hatte sie sich für purpurrote Seide entschieden, die durch die zarte schwarze Spitze an ihren ellbogenlangen Ärmeln noch betont wurde. Purpur war ihre Lieblingsfarbe, nicht nur weil es den Farben ihrer spanischen Herkunft schmeichelte – dunkle Haare, dunkle Augen, olivfarbener Teint –, sondern auch, weil es eine stille Warnung war. Blutvergießen. Gefahr.
Die Winterwitwe, tuschelten die Zuschauer. Zwei Männer hatte sie ins Grab gebracht … bislang.
Sie war ein Todesengel. Das war nur allzu wahr. Alle um sie herum starben, außer dem Mann, dessen Tod sie ersehnte.
Als sie ein leises Lachen hinter sich hörte, bekam sie eine Gänsehaut. »Da muss schon jemand anderer kommen, meine liebe Stieftochter, um mir meinen gerechten Lohn zu überbringen.«
»Dein Lohn wird meine Klinge in deinem Herzen sein«, zischte sie.
»Ja, aber dann wirst du deine Schwester niemals wiedersehen, dabei ist sie fast mündig.«
»Wage es nicht, mir zu drohen, Welton. Sobald Amelia verheiratet ist, weiß ich, wo sie ist, und dann brauche ich dich nicht mehr lebendig. Denk daran, bevor du in Versuchung gerätst, ihr das Gleiche anzutun wie mir.«
»Ich könnte sie als Sklavin verkaufen«, sagte er gedehnt.
»Du irrst dich, wenn du meinst, daran hätte ich nicht schon gedacht.« Sie bauschte die Spitze an ihrem Ellbogen und brachte ein leichtes Lächeln zustande, das ihr Entsetzen verbarg. »Ich würde davon erfahren. Und dann wärst du tot.«
Als sie spürte, wie er erstarrte, wurde ihr Lächeln echt. Sechzehn war sie gewesen, als Welton ihr Leben beendete. Nur die Vorfreude auf den Tag ihrer Vergeltung half ihr, nicht aufzugeben, wenn die Verzweiflung wegen ihrer Schwester sie zu entmutigen drohte.
»St. John.«
Der Name hing zwischen ihnen in der Luft.
Maria stockte der Atem. »Christopher St. John?«
Es überraschte sie nur noch selten etwas. Mit sechsundzwanzig glaubte sie, fast alles gesehen und fast alles getan zu haben. »Er hat zwar Geld, doch eine Ehe mit ihm würde mich ruinieren, und du könntest mich nicht mehr für deine Ziele benutzen.«
»Eine Ehe ist diesmal nicht notwendig. Ich habe Lord Winters Vermächtnis noch nicht aufgebraucht. Hier geht es lediglich um Informationen. Ich glaube, man will St. John einen Tauschhandel vorschlagen. Ich möchte, dass du herausfindest, was sie mit ihm vorhaben, und vor allem, wer seine Freilassung aus dem Gefängnis arrangiert hat.«
Maria strich sich über den purpurroten Stoff, der sich um ihre Beine bauschte. Ihre unglücklichen Ehemänner waren beide Agenten der Krone gewesen, was sie für ihren Stiefvater höchst nützlich machten. Außerdem waren sie Adlige und Besitzer eines großen Vermögens gewesen, das sie nach ihrem frühzeitigen Ableben ihr hinterlassen hatten – zu Weltons Verfügung.
Maria hob den Kopf, blickte sich im Theater um und bemerkte gedankenverloren den sich kräuselnden Rauch der Kerzen und die Goldverzierungen, die im Licht schimmerten. Der Sopran auf der Bühne kämpfte um Aufmerksamkeit, denn niemand war gekommen, um die Sängerin zu hören. Der Adel kam nur, um zu sehen und gesehen zu werden.
»Interessant«, murmelte Maria, weil ihr ein Bild des beliebten Freibeuters in den Sinn kam. Er war ungewöhnlich attraktiv und genauso tödlich wie sie. Seine Heldentaten waren allgemein bekannt, einige davon jedoch so haarsträubend, dass sie kaum wahr sein konnten. St. John war Gegenstand überaus leidenschaftlicher Diskussionen, und es wurden zahlreiche Wetten darauf abgeschlossen, wie lange er noch seinen Kopf aus der Schlinge ziehen konnte.
»Es muss tatsächlich ein verzweifelter Schritt gewesen sein, ihn zu verschonen. All die Jahre hat man nach einem unwiderlegbaren Beweis für seine Verbrechen gesucht, und nun, da es so weit ist, wird er begnadigt. Ich wage zu behaupten, dass darüber niemand erfreut ist.«
»Ist mir egal, wie man das findet«, erwiderte Welton knapp. »Ich will nur wissen, wen ich deswegen erpressen kann.«
»So viel Vertrauen hast du also in meine Fähigkeiten«, spöttelte sie und verbarg damit, dass ihr die Galle hochkam. Wenn sie daran dachte, was sie alles hatte tun müssen, um einen Mann zu schützen und zu unterstützen, den sie verabscheute … Doch dann hob sie ihr Kinn. Nicht ihrem Stiefvater galten ihr Schutz und ihre Unterstützung. Er musste lediglich am Leben bleiben, denn wenn er umkam, würde sie Amelia niemals wiederfinden.
Welton ignorierte ihren Spott. »Hast du eine Ahnung, wie viel diese Information wert wäre?«
Sie nickte fast unmerklich, weil sie sich der gierigen Blicke bewusst war, die jeder ihrer Bewegungen folgten. Die ganze Gesellschaft wusste, dass ihre Ehemänner keines natürlichen Todes gestorben waren. Aber es gab keine Beweise. Obwohl man von ihrer Schuld überzeugt war, wurde sie mit morbidem Interesse in die vornehmsten Häuser eingeladen. Sie war berüchtigt. Und nichts belebte eine Gesellschaft so wie der Ruch von Gefahr.
»Wie finde ich ihn?«
»Du hast doch deine Mittel.« Er stand auf und ragte drohend im Schatten über ihr, doch Maria duckte sich nicht. Abgesehen von Amelias Schicksal machte ihr nichts mehr Angst.
Weltons Finger zupften an einer ihrer Locken. »Das Haar deiner Schwester ist deinem so ähnlich. Selbst durch den Puder glänzt es noch.«
»Verschwinde.«
Sein Lachen hallte noch nach, als er die Vorhänge geteilt hatte und hinaus auf den Gang getreten war. Wie viele Jahre würde sie dieses Lachen noch erdulden müssen? Die Ermittler, die für sie arbeiteten, lieferten ihr kaum einen wertvollen Hinweis. Hier und da hieß es, ihre Schwester sei gesehen worden, doch nie war es eine heiße Spur. So oft meinte sie schon, ihr Ziel erreicht zu haben … aber Welton war ihr immer einen Schritt voraus.
Während auf sein Geheiß ihre Seele mit jedem Tag schwärzer wurde.
»Lassen Sie sich nicht von ihrem Erscheinungsbild täuschen. Ja, sie wirkt klein und zierlich, doch sie ist eine Giftschlange, die nur darauf wartet zuzubeißen.«
Christopher St. John setzte sich bequemer in seinen Sessel und missachtete den Agenten der Krone, der die Loge mit ihm teilte. Sein Blick war magnetisch angezogen von der purpurrot gekleideten Frau, die auf der gegenüberliegenden Seite des Theaters saß. Da er sein ganzes Leben in der niedrigen Gesellschaft verbracht hatte, erkannte er eine verwandte Seele schon von Weitem.
Lady Winter trug zwar ein Kleid, das die Wärme und Heißblütigkeit spanischer Sirenen versprach, doch sie war so frostig wie ihr Name. Und sein »Auftrag« war es, sich in ihr Leben zu schleichen, sie für ihn zu erwärmen und dann genug über sie zu erfahren, um sie an seiner statt hängen zu lassen.
Das war ein abscheulicher Handel. Aber seiner Einschätzung nach nur fair. Er war ein Freibeuter und Dieb und sie eine geldgierige und blutdurstige Harpyie.
»Es arbeiten mindestens ein Dutzend Männer für sie«, erklärte Viscount Sedgewick. »Manche beobachten die Kais, andere streifen durchs Land. Ihr Interesse an der Agency ist eindeutig und gefährlich. Sie steht Ihnen in nichts nach, wenn es darum geht, Chaos zu schaffen. Daher wird sie zu einem Angebot Ihrerseits gewiss nicht Nein sagen.«
Christopher seufzte; die Aussicht, das Bett mit der schönen Winterwitwe zu teilen, lockte ihn nicht im Geringsten. Er kannte Frauen wie sie: Sie waren viel zu sehr um ihr Aussehen besorgt, um zügellose Leidenschaft zu genießen. Ihr Lebensunterhalt hing davon ab, reiche Verehrer anzuziehen. Daher konnte sie nicht daran interessiert sein, ins Schwitzen zu geraten oder sich übermäßig anzustrengen. Schließlich konnte dabei ihre Frisur ruiniert werden.
Gähnend fragte er: »Kann ich jetzt gehen, Mylord?«
Sedgewick schüttelte den Kopf. »Sie müssen sofort anfangen, sonst ist die Chance vertan.«
Nur mit großer Mühe konnte sich Christopher eine Erwiderung verkneifen. Die Agency würde sehr schnell bemerken, dass er nach niemandes Pfeife tanzte. »Überlassen Sie die Einzelheiten mir. Sie möchten, dass ich sowohl geschäftliche als auch persönliche Beziehungen mit Lady Winter pflege, und das werde ich auch.«
Damit stand er auf und richtete beiläufig seinen Rock. »Wie auch immer: Sie ist eine Frau, die finanzielle Sicherheit über eine Ehe zu gewinnen sucht, daher kann ich als Junggeselle nicht zuerst um sie freien und dann weitermachen, wenn ich sie erst im Bett habe. Stattdessen werde ich mit dem Geschäftlichen beginnen müssen, um unsere Beziehung mit Beischlaf zu besiegeln. So macht man das.«
»Sie sind erschreckend«, sagte Sedgewick trocken.
Christopher warf einen Blick über seine Schulter, als er den schwarzen Vorhang zur Seite schob. »Es wäre klug von Ihnen, das nicht zu vergessen.«
Maria war angespannt und nervös, weil sie ein Gefühl überkam, als würde ein Raubtier sie taxieren. Sie wandte den Kopf hin und her und betrachtete forschend jede Loge ihr gegenüber, konnte jedoch nichts entdecken. Dennoch hatte sie nur ihren Instinkten zu verdanken, dass sie noch am Leben war, und sie vertraute ihnen blind.
Irgendjemandes Interesse war mehr als nur Neugier.
Leise Männerstimmen im Gang hinter ihr zogen ihre Aufmerksamkeit von ihrer erfolglosen Suche ab. Andere hätten nur das Gemurmel im Zuschauerraum unter ihr und den tragenden Gesang auf der Bühne gehört, aber sie war eine Jägerin mit geschärften Sinnen.
»Die Loge der Winterwitwe.«
»Ah …«, murmelte ein Mann mit wissender Stimme. »Sie ist das Risiko für ein paar Stunden wert. Sie ist unvergleichlich, eine Göttin unter Frauen.«
Maria schnaubte. Das war ihr Fluch.
Die unschuldige Freude, die sie einst über ihre außerordentliche Schönheit empfunden hatte, war an dem Tag verpufft, als ihr Stiefvater sie lüstern ansah und sagte: »Du wirst mir ein Vermögen einbringen, Kleines.«
Das war ein weiterer innerer Tod in ihrem kurzen Leben gewesen.
Der erste war der ihres geliebten Vaters gewesen. Sie hatte ihn als lebenslustigen, vitalen, schneidigen Mann in Erinnerung, der oft lachte und ihre spanische Mutter anbetete. Dann wurde er krank und siechte dahin. Später sollte Maria mit den Anzeichen einer Vergiftung vertraut werden. Damals aber kannte sie nur Angst und Verwirrung, die noch zunahmen, als ihre Mutter ihr einen dunkelhaarigen, gut aussehenden Mann vorstellte, der ihren Vater ersetzen sollte.
»Maria, mein Kind«, hatte Cecille mit ihrem leichten Akzent gesagt, »dies ist Viscount Welton. Wir wollen heiraten.«
Diesen Namen hatte sie schon einmal gehört. Der Mann war der beste Freund ihres Vaters gewesen. Warum ihre Mutter wieder heiraten wollte, konnte sie sich in ihrer Unerfahrenheit nicht vorstellen. Hatte ihr Vater ihr so wenig bedeutet?
»Er möchte dich auf die besten Schulen schicken«, lautete die Erklärung. »Du wirst die Zukunft bekommen, die dein Vater sich für dich gewünscht hat.«
Man würde sie wegschicken. Mehr hörte sie nicht.
Die Hochzeit fand statt, und Lord Welton nahm sie mit in ein Haus, das einer mittelalterlichen Burg ähnelte. Maria hasste es. Es war kalt, zugig und unheimlich und erinnerte in nichts an das schöne Zuhause, in dem sie bislang gewohnt hatte.
Welton zeugte mit seiner neuen Frau eine Tochter und verschwand kurz danach. Maria wurde auf das Internat geschickt, und er ging nach London, wo er nach Herzenslust soff, herumhurte und das Geld ihres Vaters verspielte. Ihre Mutter wurde immer blasser und dünner, und dann fiel ihr das Haar aus. Ihre Krankheit wurde bis zum letzten Moment vor Maria geheim gehalten.
Erst als das Ende nahe war, wurde nach ihr geschickt. Als sie ins Haus ihres Stiefvaters zurückkehrte, war die Viscountess Welton nur noch ein Schatten der Frau, die sie noch ein paar Monate zuvor gewesen war. Ihre Lebendigkeit war ebenso entschwunden wie das Vermögen ihres Mannes.
»Maria, mein Schatz«, flüsterte sie auf dem Totenbett und sah sie mit ihren dunklen Augen flehentlich an, »vergib mir. Welton war nach dem Tod deines Vaters so liebenswürdig. Ich habe nicht hinter seine Fassade gesehen.«
»Es wird alles wieder gut, Mama«, hatte sie gelogen. »Du wirst wieder gesund werden, und dann verlassen wir ihn.«
»Nein. Du musst …«
»Bitte sag nichts mehr. Du brauchst Ruhe.«
Aber der Griff ihrer Mutter war ungewöhnlich fest für eine so geschwächte Frau und verriet, wie dringend ihr Anliegen war. »Du musst deine Schwester vor ihm beschützen. Es ist ihm ganz gleich, dass sie sein eigen Fleisch und Blut ist. Er wird sie genauso benutzen, wie er mich benutzt hat. Und auch dich wird er benutzen wollen. Amelia ist nicht so stark wie du. Sie hat nichts von der Stärke deines Vaters.«
Bestürzt hatte sie ihre Mutter angestarrt. In den zehn Jahren, in denen Cecille zum zweiten Mal verheiratet war, hatte Maria vieles gelernt, doch vor allem, dass sich unter Lord Weltons unvergleichlich attraktivem Äußeren der Teufel verbarg.
»Ich bin noch zu jung«, hauchte sie unter Tränen. Sie hatte einen Großteil ihres Lebens im Internat verbracht und war dazu ausgebildet worden, eine Frau zu werden, die Welton ausbeuten konnte. Aber bei ihren gelegentlichen Besuchen hatte sie beobachtet, wie der Viscount ihre Mutter mit gehässigen Spötteleien gedemütigt hatte. Die Dienerschaft hatte ihr von Gebrüll und Schmerzensschreien berichtet. Von Verletzungen. Blut. Wochenlanger Bettruhe nach seiner Abreise.
Die siebenjährige Amelia blieb ängstlich und allein in ihrem Zimmer, wenn ihr Vater da war. Keine Gouvernante hielt es lange bei ihnen aus.
»Ja, das bist du«, flüsterte Cecille mit bleichen Lippen und rot geweinten Augen. »Wenn ich gehe, hinterlasse ich dir all meine Stärke. Du wirst mich in dir spüren, meine süße Maria, und deinen Vater. Wir werden dir helfen.«
Diese Worte waren das Einzige, woran sie sich in den folgenden Jahren klammern konnte.
»Ist sie tot?«, hatte Welton nur gefragt, als Maria aus ihrem Zimmer kam. Seine grünen Augen waren bar jeden Gefühls gewesen.
»Ja.« Sie wartete mit angehaltenem Atem und zitternden Händen.
»Dann entscheide du über die Arrangements.«
Nickend wandte sie sich ab. Das Schleifen ihrer Röcke aus schwerer Seide war unnatürlich laut in der tödlichen Stille des Hauses.
»Maria.« Seine Stimme klang bedrohlich sanft.
Sie blieb stehen, wandte sich wieder um und betrachtete ihren Stiefvater im neu gewonnenen Wissen über das Ausmaß seiner Bösartigkeit. Abwesend bemerkte sie die breiten Schultern, die schmalen Hüften und die langen Beine, die so viele Frauen unwiderstehlich fanden. Trotz seiner Gefühlskälte war er mit seinen grünen Augen, den dunklen Haaren und dem verwegenen Lächeln einer der attraktivsten Männer, die sie je gesehen hatte. Das war das Geschenk des Teufels für seine pechschwarze Seele.
»Erzähl du Amelia von Cecilles Tod, ja? Ich bin schon spät dran und habe keine Zeit mehr.«
Amelia.
Verzweifelt dachte Maria an die vor ihr liegende Aufgabe. Zusätzlich zu dem lähmenden Schmerz über den Verlust ihrer Mutter drückte sie der Auftrag ihres Stiefvaters fast zu Boden. Aber die Stärke, die ihre Mutter ihr versprochen hatte, bewirkte, dass sie sich aufrichtete und ihr Kinn hob.
Welton lachte, als er das sah. »Ich wusste, du würdest perfekt sein. Das macht den Ärger mit deiner Mutter wett.« Sie sah, wie er auf dem Absatz kehrtmachte, die Treppe zum Hauptgang hinunterging und seine Frau einfach von sich abschüttelte.
Wie konnte sie ihrer Schwester den Schicksalsschlag so schonend wie möglich beibringen? Im Gegensatz zu Maria hatte Amelia keine glücklichen Erinnerungen, an denen sie sich festhalten konnte. Jetzt war die Kleine eine Waise, denn ihr Vater schenkte ihr so wenig Aufmerksamkeit, dass er auch hätte tot sein können.
»Hallo, Schätzchen«, sagte Maria leise, als sie das Zimmer ihrer Schwester betrat und sich auf den Aufprall des kleinen Körpers, der ihr entgegenstürzte, gefasst machte.
»Maria!«
Es war überflüssig zu erwähnen, dass ihre Mutter soeben verstorben war. Maria drückte ihre Schwester an sich und ging mit ihr zu dem in dunkelblauer Seide gehaltenen Bett, das einen schönen Kontrast zu den mit hellblauem Damast bezogenen Wänden bildete. Sie wiegte das weinende Kind in ihren Armen und vergoss ein paar stille Tränen. Nun hatten sie nur noch einander.
»Was machen wir jetzt?«, fragte Amelia mit ihrer lieblichen Stimme.
»Überleben«, antwortete Maria knapp. »Und zusammenbleiben. Ich werde dich beschützen. Zweifle niemals daran.«
Sie schliefen ein. Als sie aufwachte, war Amelia verschwunden.
Und ihr Leben hatte sich für immer verändert.
Nun drängte es Maria plötzlich, sich in Bewegung zu setzen. Sie stand auf, schob den Vorhang beiseite und trat auf den Gang hinaus. Die beiden Lakaien, die zu beiden Seiten der Loge Wache standen, um übereifrige Verehrer abzuwehren, nahmen Habachtstellung ein. »Das ist meine Kutsche«, sagte sie zu einem. Er eilte davon.
Auf einmal jedoch stieß sie jemand ziemlich heftig von hinten an, und als sie taumelte, wurde sie an einen harten Körper gedrückt.
»Bitte vielmals um Verzeihung«, murmelte eine aufregend heisere Stimme so dicht an ihrem Ohr, dass sie die Schwingung spürte.
Diese Stimme brachte sie dazu zu erstarren und den Atem anzuhalten. Reglos stand sie da und spürte, wie all ihre Sinne ungewöhnlich intensiv zum Leben erwachten. Eindrücke stürmten auf sie ein – eine harte Brust an ihrem Rücken, ein fester Arm, der um ihre Brust geschlungen war, eine Hand an ihrer Taille und ein durchdringender Geruch nach Bergamotte, vermischt mit herbem Männerduft. Er ließ sie nicht los, im Gegenteil: Sein Griff wurde noch fester.
»Lassen Sie mich los«, sagte sie leise, aber herrisch.
»Wenn ich so weit bin.«
Seine nackte Hand legte sich auf ihre Kehle. Die Rubine an ihrer Halskette wurden so warm, bis sie fast brannten. Schwielige Fingerspitzen streichelten ihre Halsschlagader, bis sich ihr Puls beschleunigte. Dies alles tat der Mann so selbstbewusst und ohne jegliches Zaudern, als hätte er das Recht, sie zu liebkosen, wann und wo auch immer er es wollte, selbst in der Öffentlichkeit. Und doch war er unleugbar sanft. Trotz seines festen Griffs konnte sie sich ihm entwinden, wenn sie das wollte, aber sie regte sich nicht, weil ihre Gliedmaßen sich plötzlich schlaff anfühlten.
Mit ihrem Blick befahl sie dem anderen Lakaien, ihr irgendwie zu Hilfe zu eilen. Der Diener sah allerdings mit weit aufgerissenen Augen hinter sie und schluckte hart. Dann schaute er weg.
Sie seufzte. Offenbar würde sie sich selbst retten müssen.
Wieder einmal.
Ihre nächste Handlung war halb instinktiv, halb bewusst. Sie legte ihrem Angreifer die Hand über seine und ließ ihn die scharfe Spitze der Klinge spüren, die sie in einem eigens dafür angefertigten Ring trug. Der Mann erstarrte, aber gleich darauf lachte er. »Ich liebe Überraschungen.«
»Das kann ich von mir nicht behaupten.«
»Haben Sie etwa Angst?«, forderte er sie heraus.
»Ja. Davor, dass Blut auf mein Kleid kommt«, gab sie zurück. »Es ist eines meiner Lieblingskleider.«
»Ach, dann würde es aber zum Blut an Ihren Händen passen« – er hielt inne und fuhr ihr mit der Zunge über ihre Ohrmuschel, worauf sie hochrot wurde und erschauerte –, »und an meinen.«
»Wer sind Sie?«
»Wer auch immer Ihnen nützlich sein könnte.«
Maria holte tief Luft und drückte ihren vom Korsett flach gedrückten Busen gegen seinen unnachgiebigen Unterarm. Ihr gingen schneller Fragen durch den Kopf, als sie sie erfassen konnte. »Ich habe alles, was ich brauche.«
Als er sie losließ, strich er ihr mit den Fingern über die nackte Haut oberhalb ihres Mieders. Ihre Haut prickelte, und sie bekam eine Gänsehaut. »Sollten Sie es sich anders überlegen«, sagte er mit seiner kratzigen Stimme, »dann kommen Sie zu mir.«
Er trat zurück, worauf sie mit fliegenden Röcken herumwirbelte und ihn ansah.
Gekonnt verbarg sie ihre Verblüffung. Die Bilder in den Zeitungen wurden ihm nicht im Mindesten gerecht. Er hatte blonde Locken, eine sonnengebräunte Haut, strahlend blaue Augen und die fein gemeißelten Züge eines Engels. Seine Lippen waren zwar schmal, doch von Meisterhand erschaffen. Sein Antlitz war so atemberaubend schön, dass es sie entwaffnete. Es rief tiefstes Vertrauen hervor, aber die berechnende Kälte seines Blicks warnte sie, dass dies ein Fehler war.
Während sie ihn betrachtete, bemerkte sie, dass sie beide die Aufmerksamkeit der anderen Zuschauer im Gang weckten, aber sie konnte ihren Blick nicht von ihm abwenden. Sie war wie verzaubert von dem Mann, der so selbstsicher, ja, arrogant vor ihr stand. »St. John.«
Er verneigte sich in aller Form und lächelte, doch das Lächeln erreichte nicht seine Augen – umwerfende Augen, die noch durchdringender durch die Schatten wirkten, die sie umgaben. Er war kein Mann, der viel oder gut schlief. »Ich bin geschmeichelt, dass Sie mich erkennen.«
»Was genau sollte mir denn fehlen?«
»Vielleicht genau das, wonach Ihre Männer suchen?«
Seine Bemerkung erwischte sie kalt, und sie konnte es nicht verbergen. »Was wissen Sie?«
»Zu viel«, antwortete er glatt und sah sie forschend an. Wie gebannt starrte sie auf seine Lippen, die sich sinnlich verzogen. »Und doch nicht genug. Aber vielleicht können wir gemeinsam unsere Ziele erreichen.«
»Welches ist denn Ihr Ziel?«
Wie kam es, dass er sich ihr so kurz nach Weltons Verschwinden näherte? Das konnte doch kein Zufall sein.
»Rache«, sagte er, und dieses Wort sprach er so beiläufig aus, dass sie sich fragte, ob er innerlich genauso tot war wie sie. Das musste er, da er ein Leben als Verbrecher führte. Keine Schuld, keine Reue, kein Gewissen. »Die Agency hat sich einmal zu oft in mein Leben gemischt.«
»Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen.«
»Ach, nicht? Sehr schade.« Er trat um sie herum und neigte sich im Gehen zu ihr. »Sollten Sie es herausfinden, stehe ich zu Ihrer Verfügung.«
Einen Moment lang sperrte sie sich dagegen, sich umzudrehen und ihm nachzublicken. Doch der Moment verging, und dann starrte sie ihm begierig nach. Nichts entging ihr, weder seine Größe noch seine breiten Schultern noch seine elegante Kleidung und die hohen Schuhe. So wie er angezogen war, konnte er nicht unerkannt in der Menge verschwinden, die sich auf dem Gang tummelte. Das helle Gelb seines Rocks und seiner Hose hoben sich von den dunkleren Farben der anderen Theaterbesucher ab. In ihren Augen wirkte er wie ein Sonnengott, eine leuchtende, übermächtige Präsenz. Sein lässiger Gang verbarg nicht die Gefahr, die er ausstrahlte – eine Tatsache, die auch den rasch ausweichenden Besuchern nicht entgangen war.
Jetzt begriff sie, warum alle so fasziniert von ihm waren.
Schließlich wandte sich Maria zum Lakaien. »Kommen Sie mit.«
»Mylady«, rief dieser flehentlich, worauf sie innehielt, »bitte verzeihen Sie mir.« Der junge Mann sah aus, als sei ihm sterbenselend. Seine dunklen Haare fielen ihm in das noch sehr unreife Gesicht. Ohne seine Livree hätte man sofort gesehen, dass er im Grunde noch ein Junge war.
»Was soll ich Ihnen denn verzeihen?«, fragte sie mit hochgezogenen Augenbrauen.
»Dass ich Ihnen nicht geholfen habe.«
Sie gab etwas von ihrer stolzen Haltung auf. Als sie die Hand ausstreckte und ihn am Ellbogen berührte, schrak er zusammen. »Ich bin nicht wütend auf Sie. Sie hatten Angst, was ich gut nachvollziehen kann.«
»Wirklich?«
Sie seufzte und drückte sanft seinen Ellbogen, bevor sie ihn losließ. »Wirklich.«
Es zerriss ihr das Herz, als er sie dankbar anlächelte. War sie je so … offen gewesen? Manchmal fühlte sie sich vollkommen von der Welt abgeschnitten.
Rache. Mehr als dieses Ziel hatte sie nicht. Rache war es, woran sie beim Aufwachen dachte und wenn sie abends im Bett lag. Das Bedürfnis nach Vergeltung war die Kraft, die ihr das Blut durch die Adern pumpte und ihre Lunge mit Luft füllte.
Und Christopher St. John konnte derjenige sein, durch den sie sie erlangen konnte.
Noch kurz zuvor war er ein notwendiges Übel gewesen, das sie so schnell wie möglich hinter sich hatte bringen wollen. Doch jetzt waren die Möglichkeiten mehr als reine Intrigen; sie waren verführerisch. Es würde sorgfältiger Planung bedürfen, um ihre perfiden Ideen in die Tat umzusetzen, aber zweifellos konnte sie das schaffen.
Zum ersten Mal seit sehr langer Zeit lächelte sie.
Christopher entfernte sich leise pfeifend von Lady Winter, spürte aber ihren bohrenden Blick. Eigentlich hatte er nicht geplant, mit ihr zu sprechen. Er hatte lediglich gehofft, sie von Nahem zu sehen und herauszufinden, wie gut sie sich schützte. Es war ein wunderbarer Zufall gewesen, dass sie just in diesem Moment ihre Loge verlassen hatte. Sie hatten sich nicht nur kennengelernt, sondern er hatte sie sogar berührt, sie im Arm gehalten und den Duft ihrer Haut gerochen.
Jetzt befürchtete er nicht mehr, es würde im Bett langweilig mit ihr werden – nicht, nachdem er die Spitze der verborgenen Klinge gespürt hatte. Doch darüber hinaus war mehr als nur sein körperliches Interesse geweckt. Sie war jünger als angenommen, die Haut unter Puder und Schönheitspflästerchen war faltenlos, und ihre schönen dunklen Augen verrieten sowohl Vorsicht als auch Neugier. Lady Winter war noch nicht vollkommen abgestumpft. Wie war das möglich, wenn alle Welt dachte, sie hätte mindestens zwei Männer umgebracht?
Das würde er herausfinden. Die Agency war an ihr mehr interessiert als an ihm. Das allein war schon höchst faszinierend.
Als Christopher das Theater verließ, fiel ihm die schwarze Kutsche mit dem Wappen der Winters auf. Er blieb neben ihr stehen. Dann machte er eine kaum merkliche Handbewegung und vergewisserte sich, dass sein Befehl zumindest von einem seiner in der Umgebung postierten Männer gesehen worden war. Die Kutsche würde bis auf Weiteres beschattet werden. Er wollte wissen, wohin die schöne Lady ging.
»Dieses Wochenende bin ich bei der Gesellschaft im Landhaus der Harwicks«, sagte er zu dem Kutscher, der ihn stocksteif und mit aufgerissenen Augen anstarrte. »Sorgen Sie dafür, dass die Lady das erfährt.«
Als der Mann eifrig nickte, lächelte Christopher zufrieden.
Zum ersten Mal seit sehr langer Zeit hatte er etwas, worauf er sich freuen konnte.
Kapitel 2
»Es besteht die Möglichkeit, dass sie in die Sklaverei verkauft wurde.«
Maria hielt vor dem Kamin inne und starrte durchdringend auf ihren Ermittler und ehemaligen Geliebten. Simon Quinn trug eine bunte Seidenrobe, die sich vorne teilte, sodass sein gebräunter Brustkorb zu sehen war. Seine verblüffend blauen Augen bildeten einen auffallenden Kontrast zu seiner dunklen Haut und den schwarzen Haaren. Vom Äußeren her ein typischer Ire. Das genaue Gegenteil des blonden St. John, mehrere Jahre jünger noch dazu, doch auf seine Weise genauso gut aussehend.
Abgesehen von seiner angeborenen sexuellen Anziehungskraft wirkte Simon ziemlich harmlos. Nur der durchdringende Blick, mit dem er seine Umgebung erforschte, gab einen Hinweis auf seinen gefährlichen Lebenswandel. Im Laufe ihrer Beziehung hatte er jedes Gesetz gebrochen.
Genau wie sie.
»Merkwürdig, dass du das ausgerechnet heute Abend erwähnst«, murmelte sie. »Welton hat eben genau dasselbe zu mir gesagt.«
»Das verheißt nichts Gutes, oder?«
»Reine Mutmaßungen reichen nicht aus, Simon. Finde den Beweis dafür. Dann können wir Welton umbringen und Amelia suchen.«
Das Feuer hinter ihr wärmte erst ihren Morgenmantel und dann ihre Beine, dass es schon fast unerträglich war, aber innerlich war ihr vor lauter Entsetzen eiskalt. Ihr wurde übel von den Gedanken, die ihr durch den Kopf gingen. Wie sollte sie Amelia jemals finden, wenn sie irgendwohin verschleppt worden war?
Simon hob die Augenbrauen. »Wenn wir die Suche über die Grenzen Englands hinaus ausweiten, schwinden die Chancen, sie zu finden, aber beträchtlich.«
Maria hob den Sirup in ihrer Hand an ihre Lippen, trank ihn, um sich zu stärken, und stellte das kleine Glas dann auf den Kaminsims. Sie betrachtete den Raum und tröstete sich wieder einmal am Anblick der Holzvertäfelung und der dunkelgrünen Vorhänge. Es war ein äußerst maskulin wirkendes Studierzimmer, und der Effekt bezweckte zweierlei. Erstens sorgte es für eine drückende Stimmung, in der alles belanglose Geplapper erstarb. Und zweitens vermittelte es ihr ein Gefühl der Kontrolle, wonach sie sich verzweifelt sehnte. Auch wenn sie sich oft vorkam wie eine Marionette, die Welton tanzen ließ – hier gab sie die Befehle.
Sie zuckte die Achseln und ging wieder so unruhig hin und her, dass ihr schwarzer Morgenmantel ihr um die Knöchel wirbelte. »Du tust so, als gäbe es noch etwas anderes, wofür ich lebte.«
»Aber du wirst doch noch Ziele haben, die du erreichen willst!« Als Simon aufstand, ragte er über ihr, wie fast jeder. »Etwas Angenehmeres als den Tod.«
»Ohne Amelia kann ich mir keine Zukunft vorstellen.«
»Möglich wäre es aber schon. Du würdest nicht schwächer werden, nur weil du dir etwas Besseres erhoffst.«
Sie schoss ihm aus zusammengekniffenen Augen einen so kalten Blick zu, dass die meisten davor zurückgezuckt wären. Aber Simon lachte nur. Er hatte einst das Bett mit ihr geteilt und damit auch die unvermeidlichen häuslichen Zwistigkeiten erlebt, die mit der Rolle des Geliebten einhergingen.
Maria seufzte und blickte zu dem Porträt ihres ersten Gatten, das an einer breiten Schnur an der Wand hing. Es zeigte einen korpulenten Mann mit rosigen Wangen und strahlend grünen Augen.
»Ich vermisse Dayton«, gestand sie und verharrte, »und seine Unterstützung.«
Der Earl of Dayton hatte sie vor dem völligen Ruin gerettet. Der gutmütige Witwer hatte Welton durchschaut und sie gerettet, indem er einen hohen Preis für ein junges Mädchen bezahlt hatte, das gut seine Enkelin hätte sein können. Von ihm hatte sie alles gelernt, was man wissen musste, um zu überleben – zum Beispiel den perfekten Umgang mit Waffen.
»Wir sorgen dafür, dass er gerächt wird«, murmelte Simon. »Das verspreche ich dir.«
Maria rollte ihre Schultern nach hinten, in dem vergeblichen Versuch, ihre Anspannung zu lösen. Dann ging sie zu ihrem Schreibtisch und ließ sich müde auf ihren Stuhl sinken. »Was ist mit St. John? Kann er mir von Nutzen sein?«
»Natürlich. Mit dem, was er weiß, könnte er jedem von Nutzen sein. Aber für ihn muss auch etwas herausspringen. Er ist nicht gerade für seine Wohltätigkeit bekannt.«
Sie umklammerte die geschnitzten Armlehnen ihres Stuhls. »Beischlaf kann es nicht sein. Wer so aussieht wie er, muss tausend Frauen an der Hand haben.«
»Das ist wohl wahr. Er ist für seine Ausschweifungen berühmt.«
Simon ging zur Anrichte, schenkte sich selbst ein Glas ein und lehnte sich mit seinen schmalen Hüften gegen das Möbelstück. Zwar wirkte er stets nonchalant, blieb dabei aber immer wachsam. Das wusste sie und schätzte es sehr.
»Ich kann nur vermuten, dass sein Interesse durch den Tod deiner Ehemänner und durch ihre Verbindung zur Agency geweckt wurde.«
Sie nickte, weil sie das auch schon gedacht hatte. Sie konnte kein anderes Motiv für St. Johns Annäherungsversuche finden als den Wunsch, sie genauso zu benutzen wie Welton – für eine abscheuliche Aufgabe, bei der weibliche List erforderlich war. Doch sicher konnten das auch andere Frauen, die ihm näherstanden, mit gleichem Erfolg übernehmen, oder nicht? »Wie ist er noch geschnappt worden? Ich frage mich, wieso er nach all den Jahren doch noch einen Fehler gemacht hat.«
»Soweit ich weiß, hat er keinen gemacht. Es wurde ein Informant aufgetrieben, der bereit war, gegen ihn auszusagen.«
»Einer, der im guten Glauben dazu bereit ist?«, fragte sie sanft und dachte an die kurze Zeitspanne, die sie mit dem Freibeuter verbracht hatte. Er war höchst selbstsicher, und das konnte nur ein Mann ohne Angst sein. Außerdem war er ein Mann, den sich nur ein Narr zum Feind machen würde. »Oder einer, der dazu gezwungen wurde?«
»Höchstwahrscheinlich Letzteres. Aber ich frage mal nach.«
»Ja, tu das.« Maria spielte mit der Ecke eines Pergaments auf ihrem Schreibtisch. Ihr Blick ruhte auf der glitzernden bernsteinfarbenen Flüssigkeit in Simons Hand und wanderte dann höher, erfasste seine breiten Schultern und seine kräftigen Arme.
»Ich wünschte, ich könnte dir mehr helfen.« Das war eindeutig aufrichtig gemeint.
»Kennst du eine Frau, die wir damit betrauen könnten, sich an Welton heranzumachen?«
Simon, der gerade sein Glas zum Mund hatte führen wollen, hielt inne, und ein Lächeln breitete sich langsam über sein Gesicht. »Mein Gott, du bist unglaublich. Dayton hat dich gut ausgebildet.«
»Also kann ich hoffen, ja? Welton hat eine Vorliebe für Blondinen.«
Wenn ihre Mutter das nur gewusst hätte.
»Ich werde wohl schnellstens eine suchen.«
Maria lehnte den Kopf zurück und schloss die Augen.
»Mhuirnín?«
»Ja?« Sie hörte, wie das Glas auf der Anrichte abgestellt wurde, und dann seinen gleichmäßigen, sicheren Schritt. Sie seufzte, weil sie sich unwillkürlich getröstet fühlte, obwohl sie sich dagegen wehrte.
»Zeit fürs Bett.« Er legte seine große Hand über ihre, die immer noch die Armlehne umklammerte, und der intensive Geruch seiner Haut drang in ihre Nase. Sandelholz. Simon pur.
»Es gibt noch so vieles zu bedenken«, protestierte sie und öffnete ihre Augen gerade so weit, um ihn anzusehen.
»Das kann bis morgen warten, ganz gleich, was es ist.« Er zog sie zu sich hoch, und als sie taumelte, drückte er sie an sich und umfing sie mit seiner Wärme. »Du weißt, ich werde nicht nachgeben, bis du tust, was ich sage.«
Ihr Körper wollte mit seinem verschmelzen, doch Maria kniff die Augen zu, um gegen den Drang anzukämpfen.
Unwillkürlich erinnerte sie sich, wie es war, wenn er sich auf ihr und in ihr bewegte – etwas, das sie vor über einem Jahr beendet hatte. Als seine Berührung ihr mehr zu bedeuten begann als rein körperliches Vergnügen, hatte sie ihre Beziehung gelöst. Trost oder gar Zufriedenheit konnte sie sich nicht leisten. Dennoch wohnte Simon weiterhin in ihrem Haus. Sie weigerte sich, ihn zu lieben, schickte ihn aber auch nicht fort. Sie betete ihn an und schätzte seine Freundschaft sowie sein Wissen über die Schwächen der guten Gesellschaft.
»Deine Regeln sind mir bekannt.« Seine Hände strichen ihr über den Rücken.
Und sie wusste, dass sie ihm nicht gefielen. Er begehrte sie nach wie vor. Das spürte sie sogar jetzt, als er sich hart gegen ihren Leib drückte. Das Verlangen eines jüngeren Mannes.
»Wenn ich ein besserer Mensch wäre, würde ich dich fortschicken.«
Simon seufzte, den Mund in ihr Haar gedrückt, und umschlang sie noch fester. »Hast du denn in all den Jahren, die wir zusammen sind, gar nichts gelernt? Du könntest mich nicht fortschicken. Ich verdanke dir mein Leben.«
»Du übertreibst«, sagte sie mahnend und dachte an ihre erste Begegnung. Er hatte in einer Gasse gestanden, allein vor einem Dutzend Gegner. Und er hatte mit einer Wildheit gekämpft, die sie gleichzeitig erschreckte und erregte. Fast wäre sie weitergefahren, da sie in jener dunklen Nacht einer Spur von Amelia nachgehen wollte, die vielversprechender als die meisten war. Doch ihr Gewissen ließ nicht zu, diesen ungleichen Kampf zu ignorieren.
Also hatte sie Schwert und Pistole gezückt und mit mehreren ihrer Männer die Angreifer in die Flucht geschlagen. Simon, verletzt und blutüberströmt, hatte sie dennoch heftig dafür beschimpft. Er brauche keine Hilfe, hatte er gesagt.
Daraufhin war er vor ihr zusammengebrochen.
Ursprünglich hatte sie nur ihr Gewissen erleichtern und ihn nach einem Bad wieder fortschicken wollen. Dann war er aus dem Bad aufgetaucht: hinreißend und atemberaubend männlich. Und sie hatte ihn bei sich behalten.
Simon trat einen Schritt zurück und lächelte ironisch, als könnte er ihre Gedanken lesen. »Ich würde wieder gegen ein Dutzend Männer kämpfen – gegen Hunderte sogar –, wenn du mich nur wieder in dein Bett ließest.«
Maria schüttelte den Kopf. »Du bist unverbesserlich und viel zu triebhaft.«
»Zu triebhaft kann man gar nicht sein«, sagte er lachend und drängte sie mit einer Hand auf ihrem Poansatz zur Tür. »Du wirst mich nicht davon abbringen, dich ins Bett zu bringen. Du brauchst Ruhe und süße Träume.«
»Ah, hast du denn gar nichts über mich gelernt?«, fragte sie, als sie auf den Flur traten und dann die Treppe hinaufgingen. »Ich möchte nicht träumen. Dann ist das Aufwachen so deprimierend.«
»Eines Tages wird alles gut werden«, sagte er mit leiser, überzeugter Stimme. »Das verspreche ich dir.«
Sie gähnte, und dann keuchte sie auf, weil er sie auf seine starken Arme hob. Kurz darauf wurde sie schon mit einem kurzen Kuss auf die Stirn ins Bett gesteckt. Nachdem Simon mit einem leisen Klicken der Tür zum Nachbarzimmer verschwunden war, konnte sie sich endlich entspannen.
Doch es waren die blauen Augen eines anderen, die sie bis in den Schlaf verfolgten.
»Guten Abend, Sir.«
Christopher nickte seinem Butler zu. Von seinem Salon auf der linken Seite drang durch die geöffneten Türflügel raues Gelächter bis zu ihm in die Eingangshalle.
»Schicken Sie Philip sofort zu mir«, befahl er leise und gab dem Butler Hut und Handschuhe.
»Sehr wohl, Sir.«
Er strebte zur Treppe und kam dabei an der lärmenden Gruppe seiner Männer und ihrer Gefährtinnen vorbei. Sie riefen nach ihm, und er blieb einen Moment auf der Schwelle stehen, um die Menschen zu betrachten, die er als seine Familie ansah. Sie feierten seine Freilassung – das Glück des Teufels nannten sie es –, doch auf ihn wartete Arbeit. Wenn er sich seine gegenwärtige Freiheit erhalten wollte, musste noch viel ermittelt und erreicht werden.
»Viel Spaß«, wünschte er, bevor er unter dem lauten Protest der anderen in den ersten Stock stieg.
Er kam in seine Privatgemächer und fing mit der Hilfe seines Kammerdieners an, sich auszuziehen. Gerade streifte er seine Weste ab, als der junge Mann, nach dem er verlangt hatte, leise an die Tür klopfte und auf seine Aufforderung hin eintrat.
»Was hast du herausbekommen?«, fragte Christopher ohne weitere Einleitung.
»So viel man an einem Tag erfahren kann.« Philip zerrte an seiner Krawatte und fing an, unruhig hin und her zu gehen. Das Hellgrün seines Rocks und seiner Hose bildete einen leuchtenden Kontrast zu dem bedruckten Leder, das die Wände bedeckte.
»Wie oft muss ich dir noch sagen, du sollst nicht so zappeln?«, mahnte Christopher. »Es verrät eine Schwäche, die geradezu danach schreit, ausgenutzt zu werden.«
»Tut mir leid.« Der junge Mann rückte seine Brille zurecht und hustete.
»Du musst dich nicht entschuldigen. Lass es einfach. Häng nicht so herum, steh gerade, und sieh mir direkt in die Augen wie ein Ebenbürtiger.«
»Aber ich bin dir nicht ebenbürtig!«, protestierte Philip, hielt inne und sah einen Moment lang wieder so aus wie der Fünfjährige, der einst verwaist, verprügelt und halb verhungert auf seiner Türschwelle erschienen war.
»Nein, das bist du nicht«, bestätigte Christopher und hielt seine Arme wie gewünscht, damit er leichter ausgezogen werden konnte, »aber du musst versuchen, dich mir gegenüber so zu verhalten. Hier und überall auf der Welt muss man sich Respekt verdienen. Niemand wird ihn dir erweisen, weil du nett und anständig bist. Im Gegenteil: Viele Idioten haben nur deshalb Erfolg, weil sie sich benehmen, als hätten sie ein Anrecht darauf.«
»Ja, Sir.« Philip straffte die Schultern und hob das Kinn.
Christopher lächelte. Der Junge würde schon noch ein Mann werden. Einer, der auf eigenen Füßen stehen und auch die schlimmsten Schicksalsschläge einstecken konnte. »Ausgezeichnet. Doch jetzt erzähl.«
»Lady Winter ist sechsundzwanzig, zweimal verwitwet, und keiner ihrer Männer hat mehr als zwei Jahre bei ihr überlebt.«
Kopfschüttelnd bemerkte Christopher: »Kannst du mit etwas anfangen, was ich noch nicht weiß, und dann auch so weitermachen?«
Philip wurde rot.
»Du musst nicht nervös werden, vergiss nur nie, dass Zeit kostbar ist und du willst, dass andere die Zeit mit dir als wertvoll betrachten. Daher solltest du immer mit der Information beginnen, die am wahrscheinlichsten Interesse weckt. Dann machst du von dort aus weiter.«
Philip holte tief Luft und stieß hervor: »Sie hat einen Geliebten, der bei ihr wohnt.«
»Ah …« Christopher verharrte, weil er der Vorstellung einer zugänglicheren Lady Winter nachhing, einer vom Liebesspiel ermatteten und zufriedenen Frau. Das scharfe Zupfen seines Kammerdieners an seinem Hosenbund riss ihn aus seiner Versunkenheit. Er knöpfte seinen Hosenlatz auf, räusperte sich und sagte: »Das ist schon besser.«
»Oh, gut! Ich konnte nicht viel mehr herausfinden, als dass er Ire ist, aber er ist Mitglied ihres Haushalts, seit Lord Winter vor zwei Jahren verstarb.«
Zwei Jahre ging das also schon so.
»Außerdem habe ich etwas über ihre Beziehung zu ihrem Stiefvater Lord Welton herausgefunden, das ich seltsam finde.«
»Seltsam?«, fragte Christopher.
»Ja, der Diener, mit dem ich sprach, erwähnte, dass er sie häufig besucht. Ich finde das merkwürdig.«
»Vielleicht weil die Beziehung zu deinem Stiefvater weniger eng war?«
»Vielleicht.«
Christopher schob seine Arme durch die Ärmel des Morgenmantels, den sein Kammerdiener ihm hinhielt. »Thompson, bringen Sie Beth und Angelica zu mir.«
Der Kammerdiener verneigte sich leicht, bevor er gehorchte, und Christopher ging vom Ankleide- ins Wohnzimmer. »Was wissen wir über ihre Finanzen?«, fragte er über die Schulter hinweg.
»Im Moment eigentlich nichts«, antwortete Philip, der ihm folgte, »aber das wird morgen früh nachgeholt. Sie wirkt, als wäre sie gut bei Kasse, also frage ich mich, wieso sie meint, sie müsste sich auf so grässliche Weise Geld beschaffen.«
»Hast du genügend Beweise, um zu dem Schluss zu kommen, dass sie schuldig ist?«
»Äh … nein.«
»Reine Mutmaßungen reichen nicht aus, Philip. Finde den Beweis dafür.«
»Ja, Sir.«
Zwei Jahre ging das also schon so. Das bewies, dass sie zu Gefühlen fähig war. Eine Frau teilte nicht so lange die körperlichen Freuden mit einem Mann, ohne ihn zumindest ein wenig ins Herz zu schließen. »Erzähl mir von Welton.«
»Ein Prasser, der einen Großteil seiner Zeit mit Glücksspielen und Huren verbringt.«
»Wo?«
»Im White’s und im Bernadette’s.«
»Vorlieben?«
»Hasardspiel und Blondinen.«
»Gut gemacht«, lächelte Christopher. »Ich weiß es zu schätzen, wie viel du in den wenigen Stunden erreicht hast.«
»Dein Leben hängt davon ab«, sagte Philip schlicht. »Aber an deiner Stelle hätte ich jemanden mit mehr Erfahrung losgeschickt.«
»Du warst so weit.«
»Dem würde ich widersprechen, aber in jedem Fall bin ich dankbar.«
Christopher winkte ab, bevor er zu dem Walnusstischchen mit einer Reihe Karaffen ging und sich ein Glas Wasser einschenkte. »Welchen Nutzen hättest du für mich, wenn du unerfahren bliebest?«
»Ja, genau, du denkst nur an deinen Vorteil«, sagte Philip trocken und lehnte sich an den Kamin. »Gott behüte, dass mein Wohlbefinden auf einen Anfall von Großzügigkeit zurückzuführen wäre. Allerdings sollte ich erwähnen, dass diese Anfälle häufiger vorkommen, da alle unter diesem Dach hin und wieder in den Genuss kommen.«
Christopher schnaubte und leerte sein Glas. »Bitte höre auf, meinen Charakter derart zu verunglimpfen. Es ist ziemlich unhöflich, mich so zu verleugnen.«
Philip besaß die Kühnheit, die Augen zu verdrehen. »Dein furchterregender Ruf ist hart verdient worden und hat sich etliche Male als wahr erwiesen. Nur weil du dich um die Streuner dieser Welt kümmerst, tauchen weder versenkte Schiffe wieder vom Meeresgrund auf, noch wird gestohlene Fracht zurückerstattet oder erwachen Dummköpfe, die sich dir widersetzten, wieder zum Leben. Also besteht kein Grund zur Sorge. Trotz meiner ewigen Dankbarkeit bleibst du so berüchtigt wie eh und je.«
»Unverschämter Bastard.«
Der junge Mann lächelte, doch dann wurden sie von einem leisen Klopfen an der Tür gestört.
»Herein«, rief Christopher und neigte leicht den Kopf, um eine stattliche Blondine und eine zierliche, aber kurvenreiche Brünette zu begrüßen. »Ach, schön. Ich habe Verwendung für euch.«
»Du hast uns gefehlt«, erwiderte Beth und warf verführerisch ihre blonde Haarmähne über die Schulter. Angelica zwinkerte nur. Sie war die zurückhaltendere, außer beim Vögeln. Dann war ihre Sprache derber als die seiner Seemänner.
»Verzeihung«, mischte Philip sich mit gerunzelter Stirn ein. »Woher wusstest du, dass Welton keine Vorliebe für Rothaarige hat?«
»Wie kommst du darauf, dass die beiden nicht meinetwegen hier sind?«, konterte Christopher.
»Weil ich hier bin und du konzentriert wirkst. Du vermischst nie Geschäftliches mit Privatem.«
»Vielleicht sind Geschäftliches und Privates diesmal das Gleiche, mein junger Philip.«
Philip kniff seine grauen Augen hinter seiner Brille zusammen. Man sah ihm an, dass er angestrengt nachdachte. Genau dies hatte auch zuerst Christophers Aufmerksamkeit geweckt. Ein heller Kopf war immer nützlich.
Er stellte sein Glas ab und ließ sich in den nächsten Ohrensessel sinken. »Ladys, ich muss euch um etwas bitten.«
»Was immer du brauchst«, gurrte Angelica, »werden wir dir, wie du weißt, besorgen.«
»Danke«, erwiderte er freundlich, weil er gewusst hatte, sie würden alles für ihn tun. In seinem Haushalt galt Loyalität für alle. Er hätte für jeden Einzelnen in seiner Obhut sein Leben gegeben, und genau dasselbe würden sie auch für ihn tun.
»Morgen kommt die Schneiderin, um euch neu auszustatten.« Er musste lächeln, als er das Aufglimmen von Gier in ihren Augen sah. »Beth, du wirst Lord Weltons intimste Vertraute werden.«
Die Blondine nickte, worauf ihr großer, ungestützter Busen unter ihrer hellblauen Robe erzitterte.
»Und ich?«, fragte Angelica und verzog voller Vorfreude ihren rot geschminkten Mund.
»Du, meine dunkeläugige Schönheit, wirst, wenn nötig, als Ablenkung dienen.«
Er wusste nicht, ob Lady Winter ihren Geliebten mit ihrem Reichtum, ihrer Schönheit oder mit beidem hielt. Da er kein Risiko eingehen wollte, hoffte er, Angelicas exotisches Äußeres und die sorgfältig errichtete Fassade von Reichtum würden seinen Rivalen von ihr fortlocken. Angelicas Schönheit war nicht annähernd so raffiniert wie die der Winterwitwe, doch sie war ziemlich üppig gebaut und zeugte von spanischem Blut. Bei gedämpftem Licht würde sie durchgehen.
Christopher rieb sich über die winzige Wunde an seinem Handgelenk, die Lady Winters Ring hinterlassen hatte, und ertappte sich dabei, dass er sich nach der berüchtigten Verführerin sehnte. Sie war unwiderstehlich, eine zerbrechliche Erscheinung mit einem leidenschaftlichen Temperament. Er wusste ohne jeden Zweifel, dass sein Leben weitaus interessanter werden würde als in letzter Zeit. Es war fast deprimierend, dass er noch ein paar Tage warten musste, bevor er wieder Kontakt mit ihr aufnehmen konnte.
In der Zwischenzeit war sein Verlangen erwacht, war er doch wochenlang eingesperrt gewesen und hatte weibliche Gesellschaft entbehren müssen. Ganz sicher war dies der einzige Grund, warum er mit solcher Leidenschaft an die Winterwitwe dachte. Denn eigentlich war sie nur eine Aufgabe, die er erledigen musste, mehr nicht.
Aber als er die Hand hob und seine Besucher hinausschickte, sagte er langsam: »Du nicht, Angelica. Ich möchte, dass du bei mir bleibst.«
Sie fuhr sich mit der Zunge über die Lippen.
»Schließ die Tür ab, Liebes. Und dann dämpfe das Licht.«
Christopher seufzte, als es im Zimmer dunkler wurde. Sie war nicht Lady Winter. Bei gedämpftem Licht würde sie allerdings für sie durchgehen.
Kapitel 3
»Darf ich dir all die Dinge aufzählen, die ich an dir anbete, mhuirnín?«
Maria verzog ihren Mund zu einem schwachen Lächeln und schüttelte den Kopf. Simon fläzte sich auf der Bank ihr gegenüber. Seine große Gestalt steckte in wunderschönem cremefarbenem Satin mit goldbestickten Blüten. Vor dem Hintergrund eines stillen Sees und grünen Grases leuchteten seine blauen Augen besonders eindrucksvoll.
»Nein?«, sagte er gedehnt. »Nun gut. Dann vielleicht nur eines? Ich bete es an, wie du dein Kinn reckst, wenn du die Winterwitwe spielst. Und die eisblaue Seide mit der weißen Spitze ist geradezu ein Geniestreich.«
Ihr Lächeln wurde breiter. Sie war nervös, und Simon, der bemerkt hatte, dass sie ständig ihren Sonnenschirm drehte, wollte sie ablenken. Hinter ihr ragte das eindrucksvolle Herrenhaus des Earls und der Countess of Harwick empor, unter dessen Dach sie die nächsten drei Tage verbringen würde. »Das wird so erwartet, mein lieber Simon. Wir wollen doch nicht unsere Gastgeberin enttäuschen.«
»Natürlich nicht. Ich finde es ja auch höchst amüsant. Aber was plant die berüchtigte Witwe denn für dieses Wochenende?«
»Wer kann das so früh schon sagen?«, murmelte sie und ließ ihren Blick über die anderen Gäste wandern. Manche saßen wie sie auf einer Bank, die Frauen lesend oder stickend. Ein paar Gentlemen standen auf dem Rasen zusammen. »Einen kleinen Aufruhr? Eine winzige Intrige?«
»Ein paar Liebesspiele?«
»Simon«, mahnte sie.