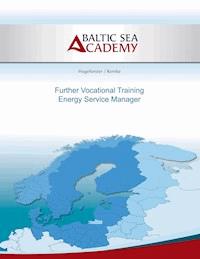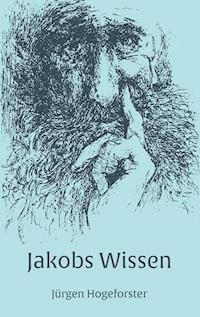Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein betagter Mann bittet seine zwei erwachsenen Kinder, ihn die noch verbleibenden drei Tage bis zu seinem Tod zu begleiten. Den entsetzten Kindern bleibt keine Wahl, diesem letzten Willen in einem abgeschiedenen Tal der Rocky Mountains zu entsprechen. Der Vater schildert ihnen seinen Lebensweg, der immer wieder neue abenteuerliche Richtungen einschlägt. Beginnend mit der Geburt auf einer einsamen Insel und einem Studium des Lebens in verschiedenen Erdteilen, entführt der Vater seine Kinder auf eine merkwürdige Reise zu einem deutschen Arzt im Kaukasus, in die Schneewüsten Kanadas, in die Gluthitze der Sahara, zu einem teuflischen Betrug in Mittelamerika bis hin zu einer Kathedrale mit einem merkwürdigen Grab in Polen. Ein mysteriöser Adler begleitet diese Lebensreise und veranlasst den Vater zu der dringenden Bitte, seine Kinder sollen ihm helfen, auf dem Gipfel des Adlerfelsens - wie bei der Wandlung einer Raupe zum Schmetterling - seinen Tod durch Übergang in einen anderen Zustand zu finden. Die spannende Reise durch ein ereignisreiches Leben vermittelt den Kindern Erkenntnisse zu aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen und zur Gestaltung der Zukunft. Schließlich erfahren sie in einem Spiel des Lebens, das ein Harlekin unter einer mächtigen hohlen Eiche in Nordpolen aufführt, Geheimnis und Bedeutung von Adler, Schmetterling und Narr. Die spannende Reise durch ein ereignisreiches Leben vermittelt den Kindern Erkenntnisse zu aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen und zur Gestaltung der Zukunft. Schließlich erfahren sie in einem Spiel des Lebens, das ein Harlekin unter einer mächtigen hohlen Eiche in Nordpolen aufführt, Geheimnis und Bedeutung von Adler, Schmetterling und Narr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch, das in einem Zeitraum von dreißig Jahren entstand, ist mit herzlichem Dank allen gewidmet, die das erfüllte Spiel meines Lebens ermöglichten.
Das Buch
Ein betagter Mann bittet seine zwei erwachsenen Kinder, ihn die noch verbleibenden drei Tage bis zu seinem Tod zu begleiten. Den entsetzten Kindern bleibt keine Wahl, diesem letzten Willen in einem abgeschiedenen Tal der Rocky Mountains zu entsprechen. Der Vater schildert ihnen seinen Lebensweg, der immer wieder neue abenteuerliche Richtungen einschlägt. Beginnend mit der Geburt auf einer einsamen Insel und einem Studium des Lebens in verschiedenen Erdteilen, entführt der Vater seine Kinder auf eine merkwürdige Reise zu einem deutschen Arzt im Kaukasus, in die Schneewüsten Kanadas, in die Gluthitze der Sahara, zu einem teuflischen Betrug in Mittelamerika bis hin zu einer Kathedrale mit einem merkwürdigen Grab in Polen. Ein mysteriöser Adler begleitet diese Lebensreise und veranlasst den Vater zu der dringenden Bitte, seine Kinder sollen ihm helfen, auf dem Gipfel des Adlerfelsens – wie bei der Wandlung einer Raupe zum Schmetterling – seinen Tod durch Übergang in einen anderen Zustand zu finden.
Die spannende Reise durch ein ereignisreiches Leben vermittelt den Kindern Erkenntnisse zu aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen und zur Gestaltung der Zukunft. Schließlich erfahren sie in einem Spiel des Lebens, das ein Harlekin unter einer mächtigen hohlen Eiche in Nordpolen aufführt, Geheimnis und Bedeutung von Adler, Schmetterling und Narr.
Der Autor
Jürgen Hogeforster wurde 1943 am linken Niederrhein geboren. Nach einer Ausbildung und Tätigkeit als Landwirt, einem Ingenieurstudium, Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie Promotion hat er bis heute sieben ganz unterschiedliche Berufe ausgeübt und immer Berufung gefunden. Daneben bezeichnet er sich als Erzähler von Märchen für Erwachsene. Jürgen Hogeforster ist nebenberuflich journalistisch tätig, gestaltete und moderierte eine monatliche Fernsehsendung und hat zahlreiche Fachbücher und verschiedene Erzählungen und Romane publiziert.
Adler
Die Kraft, die das Schicksal aller Lebewesen regiert, heißt der Adler, nicht weil sie ein Adler wäre oder irgendetwas mit einem Adler zu tun hätte, sondern weil sie dem Sehenden, der sie sieht, als ein unermesslich großer schwarzer Adler erscheint, aufrechtstehend, wie ein Adler steht, und bis in die Unendlichkeit aufragend. (Don Juan)
Man nennt es Adler, nicht weil die Menschen, die in diesem Zustand leben, einem Adler gleichen, sondern ihr Leben wie den Flug eines Adlers gestalten, der frei am Himmel schwebt und Weite erobert, die Welt hinter den Bergen, die den Horizont verstellen. Diese andere Sichtweise ist für ihn Wirklichkeit, für andere fernab der Realität. Es ist ein Leben, das die Abenteuer des Trampelpfades der Sicherheit des Karussells vorzieht.
Schmetterling
Wenn die Raupen wüssten, was einmal sein wird, wenn sie erst Schmetterlinge sind, sie würden ganz anders leben: froher, zuversichtlicher und hoffnungsvoller. Der Tod ist nicht das Letzte. Der Schmetterling ist das Symbol der Verwandlung. Das Leben endet nicht, es wird verändert. (Heinrich Böll)
Der Schmetterling ist Sinnbild der Wiedergeburt und Unsterblichkeit. Deshalb nennt man die Seele von Adler und Narr Schmetterling.
Narr
Der Narr verkörpert die Möglichkeit, über die scheinbaren Grenzen des Ichs in einen außergewöhnlichen Bereich vorzudringen. Er ist weder in seinem Wissen befangen noch in der Angst, sich bloßzustellen. Immer ist er bereit zu lernen und das Außergewöhnliche zu verwirklichen. Seine Offenheit und sein Vertrauen in die eigene Erfahrung führen den Menschen jedoch ganz in den Fluss des Lebens. Sie ermöglichen es, einen einzigartigen Weg zu gehen. (Friedemann Wieland)
Inhalt
VORSPIEL
RIEN NE VA PLUS
ERSTER AKT: ALS ADLER GEBOREN UND NARR GEWORDEN
ZWISCHENSPIEL I: ADLER
ZWEITER AKT: SUCHE NACH DEM SELBST
ZWISCHENSPIEL II: GEISTVOLL
DRITTER AKT: LIEBE, WENN DU KANNST
ZWISCHENSPIEL III: WIEDERGEBURT
VIERTER AKT: DAVID GEGEN GOLIATH
ZWISCHENSPIEL IV: WEGWEISER
FÜNFTER AKT: SCHMETTERLINGE LEBEN ZWEIMAL
ZWISCHENSPIEL V: KINDERSPIEL
SECHSTER AKT: LIEBE IN PARALLELEN WELTEN
LETZTER AKT: SÜßE MELODIE DES TODES
NACHSPIEL
Vorspiel
Das Theaterspiel des Lebens beginnt lange bevor sich der Vorhang zum ersten Akt öffnet. Bereits einige Zeit vor dem Spiel muss das Drehbuch geschrieben werden, ein Regisseur wird engagiert, Schauspieler werden ausgewählt. Vor allem muss ein Produzent gefunden werden, der das Lebensstück herausbringt, der es den Künstlern überhaupt erst erlaubt, auf der Bühne des Lebens zu spielen. Dann beginnen die Proben, sehr lange Proben, denn der Mensch benötigt wie kein anderes Lebewesen lange Anpassungszeiten, bis er selbstständig sein Leben spielen kann.
Schließlich ist es so weit. Die Zuschauer sitzen erwartungsvoll im Theatersaal. Der Vorhang hebt sich zur Premiere. Die Helden betreten die Bühne des Lebens. Das Spiel beginnt.
Alles ist bestens vorbereitet. Das Spiel spult sich wie vorgegeben ab. Natürlich können die Schauspieler patzen, einmal ihren Text vergessen, die Beleuchtung kann ausfallen. Vielleicht gibt der Dirigent seinem Orchester einen falschen Einsatz, ein Requisit zerbricht oder ein Kostüm ist unpassend – alles eher Kleinigkeiten. Der Ablauf des Stücks ist längst vorgegeben. Nun geht nichts mehr, die Kugel rollt, die Spieler des Lebens sollen nun alles geben, das Beste aus dem Stoff machen.
Der Vorhang senkt sich zu einer kleinen Lebenspause. Es bleibt dunkel im Theatersaal, die Zuschauer räuspern sich, flüstern, hüsteln.
Ein neuer Anlauf, der Vorhang hebt sich zum nächsten Akt. Ein Narr tritt hinaus in die Welt, erwachsen zwar, doch unbekümmert wie ein kleines Kind. Ihm begegnet die Liebe, er verspielt sie, ihn locken die Abenteuer des Lebens, er verschiebt die Liebe auf ein späteres Leben.
Erneut senkt sich der Vorhang. Auf der Lebensbühne wird umgebaut. Die Zuschauer werden ungeduldig, sind unzufrieden mit dem Lebensspiel, hoffen auf eine Steigerung im nächsten Akt. Die Schauspieler sind verwirrt. Sie hatten auf ein großes Lebensspiel gehofft, ihre ursprünglichen Ziele schwinden dahin, sind vergessen. Sie kämpfen sich durchs Leben. Adler und Narr, im Kampf miteinander verstrickt, können nur noch durch einen wahren Künstler des Lebens gerettet werden.
Große Pause im Theaterspiel des Lebens. Einige Zuschauer verlassen enttäuscht die Aufführung. Andere sind wenig berührt, nippen gelangweilt am Sekt. Wieder andere debattieren erregt über das Stück, sie würden alles anders, alles viel besser machen. Der nächste Akt wird eingeläutet. Es ist schon spät geworden im Spiel des Lebens. Die Akteure sammeln ihre ganzen Kräfte. Sie wollen mit ihrem Lebensstück überzeugen, wollen gewinnen, als große Stars gefeiert werden. Adler und Narr finden zueinander, vereinigen sich in einer Person. Nun kann das Leben beginnen.
Doch das Spiel ist aus. Der Vorhang senkt sich für immer.
Doch damit ist das Schauspiel des Lebens keineswegs beendet. Das Spiel ist nur gemacht. Nach dem Spiel heißt es: Nichts geht mehr. Rien ne va plus. Die Spieler haben ihren Einsatz gemacht, sie können nichts mehr tun – nur noch den Lauf der Kugel im Roulette beobachten und abwarten, ob sie gewinnen oder verlieren. Nun haben die Zuschauer das Wort. Werden sie begeistert applaudieren oder das Theaterspiel des Lebens mit lauten Buhrufen untergehen lassen?
Die Richter sind unerbittlich. Die spitzen Federn der Kritiker entscheiden über das wahre Schicksal der Akteure. Werden sie ob ihres schlechten Spiels in die Bedeutungslosigkeit zurückfallen und dann in weiteren Lebensspielen auf Provinzbühnen tingeln müssen? Oder hat ihr Lebensspiel so sehr gefallen, dass sie das Theaterstück des Lebens unzählige Male wieder aufführen, zu gefeierten Lebenskünstlern werden und immer höher hinaufsteigen?
Das Theater ist leer. Zuschauer, Kritiker, Schauspieler, Regisseur, Beleuchter, alle sind gegangen. Nur einer ist noch dort. Er saß schon immer hier und wird immer dort sitzen. Er hat das letzte Wort. Man nennt ihn den Zeitstückler. Ein Harlekin, er teilt die Zeit auf und verborgt sie für neue Aufführungen des Lebens.
Rien ne va plus
Das telefonisch aufgegebene Telegramm bestand nur aus drei Worten: „Bitte kommt sofort.“
Es erreichte Elisabeth Achterath an ihrem Wohnort in Hamburg. Innerhalb von vier Stunden hatte sie eine Betreuung für ihre beiden kleinen Kinder organisiert, ihrem Mann die plötzliche Abreise erklärt, einen Koffer gepackt, Flüge gebucht und sich mit ihrem Bruder abgestimmt. Erst vom Flughafen aus rief sie ihren Arbeitgeber, einen namhaften Hamburger Verlag, an und erklärte kurz, dass sie sofort für unbestimmte Zeit verreisen müsse. Ihr Chef erklärte wortreich, dass eine so herausragende Führungskraft wie sie nicht einfach auf unbestimmte Dauer verschwinden könne. Dies könnte sich nachteilig auf ihre weitere Karriere auswirken oder gar ihren Anstellungsvertrag in Frage stellen. Doch daran verschwendete die junge Frau Achterath keine Gedanken und erwiderte nur: „Mein Vater hat mir in einem Telegramm mitgeteilt, bitte komm sofort! Das muss als Grund genügen.“ Und unterbrach die Verbindung.
Arnulf Achterath erhielt das kurze Telegramm auf einer Tagung in St. Petersburg. Er verließ sofort den Konferenzsaal, rief zunächst seine Frau an und teilte ihr seine plötzliche Reise nach Kanada mit. Dann telefonierte er mit seiner Sekretärin, informierte sie über seine längere Abwesenheit, ordnete an, alle Termine auf unbestimmte Zeit zu verschieben und bat um die Buchung der Flüge. Auf die erschreckte Frage: „Wie lange werden Sie fortbleiben?“ antwortete er nur kurz: „Das weiß ich nicht, es kann durchaus ein paar Wochen dauern. Aber dies ist nun für mich wichtiger als alles andere auf der Welt.“ Dann kehrte er zur Tagung zurück, hielt dort seinen mit Spannung erwarteten Vortrag. Nach Abklingen des brausenden Beifalls bat er um Entschuldigung, dass eine Diskussion leider nicht stattfinden könne, da er sofort abreisen müsse.
Die Geschwister trafen sich in Vancouver auf dem Flughafen. Elisabeth Achterath, die zwei Stunden früher als ihr Bruder gelandet war, hatte bereits einen Mietwagen organisiert, sodass sie sich sofort nach der Ankunft auf den langen Weg in die Rocky Mountains machen konnten. Kurze Pausen legten sie nur zum Tanken ein. Sie wechselten sich beim Fahren ab und aßen etwas Obst und Gebäck während der Fahrt.
Sie schafften es an diesem Tag noch bis Clearwater. Sie mieteten sich in einem kleinen Motel direkt an der Hauptstraße ein, und obwohl es bereits nach 22 Uhr war, nahmen sie noch ein kurzes Bad in dem winzigen Swimmingpool.
Durch die Zeitverschiebungen fanden sie nicht viel Ruhe, setzten gleichwohl am nächsten Morgen bereits um 6 Uhr 30 ihre Fahrt fort. Im Motel hatten sie nur eine Tasse Kaffee und etwas Gebäck bekommen. So legten sie gegen elf Uhr in Mt. Robson eine kurze Rast ein und genossen ein ausgiebiges Frühstück mit Spiegeleiern, Bratkartoffeln und Pfannkuchen.
Die Weiterfahrt verlief schweigend, jeder hing seinen Gedanken nach. Am Vortag hatten sie alle Neuigkeiten ausgetauscht und dabei nur kurz das Telegramm ihres Vaters angesprochen. Er lebte nun schon neun Jahre in der abgeschiedenen Wildnis am Moon Lake. Seit vier Jahren hatten sie ihn nicht mehr gesehen und abgesehen von einigen unregelmäßigen, kurzen Telefonaten auch nicht mehr gesprochen. Wenn ihr Vater, der kürzlich das 91. Lebensjahr vollendet hatte, plötzlich ein solches Telegramm schickte, musste es wirklich wichtig sein. Sie wollten über die Gründe nicht weiter spekulieren, sich irgendwelchen Phantasien hingeben. Schon bald würden sie es herausfinden.
Sie folgten weiter dem Highway 16, entlang brausender Flüsse und klarer Seen, durch ausgedehnte Wälder, und immer vor sich die schneebedeckten Gipfel, die sie magisch anzogen. Der Highway war nur wenig befahren. Nur hin und wieder gab es einen kleinen Stau, wenn Bären, Wapitis oder Bergschafe am Straßenrand auftauchten und die Touristen ihre Kameras zückten. Gegen vierzehn Uhr erreichten sie Jasper, hielten sich hier aber nur kurz auf, um detaillierte Karten mit allen kleinen Straßen und Wanderwegen zu erwerben.
Der Highway 16 Richtung Edmonton schlängelte sich nun am mächtigen Athabasca River entlang. Die Schneeschmelze hatte schon vor Wochen eingesetzt, und nun führte der Fluss graue, überschäumende Wassermassen mit sich. Obwohl sie schnell ihr Ziel erreichen wollten und ihnen noch die mühevolle Suche nach dem Moon Lake bevorstand, nahmen sie sich die Zeit, sich im Fluss etwas zu erfrischen. Die mächtige Strömung zerrte an ihren bloßen Füßen und Unterschenkeln. Das Wasser war eiskalt, und nach wenigen Minuten schmerzten ihre Füße so sehr, dass sie schnell wieder das Wasser verlassen mussten. Danach setzte ein wohltuendes Kribbeln ein, als das Blut wieder in ihre Füße strömte. Sie wiederholten die Prozedur mehrfach und setzten dann erfrischt und lebendig ihre Fahrt fort. In Pocahontas verließen sie den Yellowhead Highway, bogen nach Süden ab und folgten dann viele Kilometer der Straße 22. Dann begann die mühevolle Suche mit Hilfe der Generalstabskarten. Sie orientierten sich an Flussläufen, bogen auf schmale Schotterstraßen ein und fuhren schließlich auf unbefestigten Wegen, die sich atemberaubend an Berghängen dahinzogen und durch tiefe Schluchten führten. Nachdem sie einige Male mühevoll wenden und zurückfahren mussten, weil sie irgendwo eine falsche Abzweigung genommen hatten, erreichten sie gegen einundzwanzig Uhr die kleine Indianer-Siedlung Redwood Meadows.
Hierhin verirrte sich nie ein Tourist. Das ganze Dorf bestand nur aus sieben einfachen Holzhäusern, und hier endeten alle mit dem Auto befahrbaren Straßen. In den Rocky Mountains ist es abends immer sehr lange hell. Aber um diese Uhrzeit würde unten in der tiefen Schlucht, die zum Moon Lake führte, tiefe Finsternis herrschen. Deshalb übernachteten sie bei einer Indianerfamilie, die mit ihrem Vater eng verbunden war und ihn regelmäßig mit Lebensmitteln und allem Notwendigen versorgte. Den alten Indianer, den alle nur „Chief“ nannten, verband eine intensive Freundschaft mit ihrem Vater. Seine erwachsene Enkeltochter kochte für ihren Vater zweimal in der Woche, putzte das Haus und erledigte seine Wäsche.
Am nächsten Morgen waren sie bereits um 7 Uhr mit Chief und seiner Enkeltochter wieder unterwegs. Lebensmittel und das Gepäck der Geschwister trugen zwei Pferde. Sie durchwanderten zunächst einen dichten Wald, bis sie schließlich eine tiefe Schlucht erreichten, die ein reißender Fluss bis zu 120 Meter tief in die Felsen gegraben hatte. Nach einer kurzen Ruhepause machten sie sich an den abenteuerlichen Abstieg in den Canyon hinein. Auf halber Höhe schlängelte sich ein schmaler Pfad an den senkrecht abfallenden Felsen entlang. Manchmal führte der Pfad steil aufwärts bis zum Schluchtrand und fiel dann wieder in die Tiefe bis zum tosenden Wasser. Die Felswände über ihnen rückten immer näher zusammen, bis oben nur noch durch einen schmalen Spalt ein Streifen des blauen Himmels zu sehen war. Unten auf dem Canyon-Grund durchschritten sie einen längeren Tunnel, bis sie schließlich ein steinernes Tor erreichten, das den Blick in ein weites Hochtal frei gab. Das Tal wurde beherrscht von einem großen See, der von den Gletschern der über dreitausend Meter hohen Berge, die dem Canyon gegenüberlagen, gespeist wurde. Das kristallklare Wasser des Sees schimmerte im hellen Sonnenlicht durch die mitgeführten Sedimente smaragdgrün. An einigen Stellen reichte der dichte Wald bis zum Seeufer, an anderen Stellen befanden sich ausgedehnte Freiflächen. Auf einer der größten Lichtungen direkt am Ufer des Moon Lakes steht das Haus von Henrik Achterath mit einem grandiosen Blick bis hin zu den weißen Gletscherbergen auf der gegenüberliegenden Seeseite.
Elisabeth und Arnulf Achterath haben das Ziel ihrer so plötzlichen Reise erreicht. In fast andächtiger Stille stehen sie am Ausgang der Schlucht, schauen in dieses einzigartige Tal und atmen förmlich dessen ausstrahlende Harmonie, Frieden und Ruhe ein. Sie können das Haus ihres Vaters mit seiner höchst eigenwilligen Bauweise gut ausmachen. Es gibt wohl kein zweites Haus in den Rocky Mountains, das in so klassischer vierseitiger Pyramidenform errichtet ist. Die Pyramide hat drei Stockwerke. Im dritten Stock, oben in der Spitze, befindet sich das Arbeitszimmer ihres Vaters. Die gesamte Südseite des Pyramidenhauses, dem See zugewandt, besteht aus Glaswänden. Im ersten Obergeschoss ist eine breite Holzveranda angebaut, deren Boden zugleich das Dach für eine darunter liegende Terrasse bildet.
Sie erreichen schnell das Haus und finden ihren Vater auf der Terrasse, in einem Schaukelstuhl sitzend, genüsslich seine Pfeife rauchen. Der Alte erhebt sich mühsam und kommt ihnen mit schlurfenden Schritten entgegen. Vater und Kinder überfällt eine seltsame Scheu, die Elisabeth als erste überwindet, indem sie ihren Vater herzlich umarmt.
„Schön, dass du da bist, Prinzessin Elisabeth“, brummelt der Alte in ihren Haaren. Mit seinem Sohn tauscht er einen festen Händedruck aus und begrüßt ihn mit den Worten: „Hallo Sir Arnulf“, als würden sie sich täglich sehen.
Der Alte schwankt ein bisschen und muss sich schnell wieder setzen. Besorgt schauen seine Kinder ihn an. Sein Haar ist immer noch voll, nun aber schneeweiß. Sein grauer Vollbart reicht ihm bis zur Brust und verdeckt das halbe Gesicht, in das Sonne und Wind viele Falten und Furchen gegraben haben, die zugleich in Verbindung mit der gekrümmten Körperhaltung Schmerzen verkünden. Nur die blauen, klaren Augen blitzen wach und lebendig. In die aufkommende Verlegenheit hinein sagt der Alte: „Am besten nehmt ihr erst einmal ein Bad im See. Das wird euch nach der langen Reise guttun. Und wie ich Kachina kenne, wird sie euch gern begleiten.“
Die junge Indianerin stimmt lachend zu: „Schließlich bedeutet mein Name Kachina ‚Geist der unsichtbaren Lebenskräfte‘, die jetzt eine Erfrischung gut gebrauchen können.“
Henrik Achterath nennt Chief bei seinem richtigen Indianernamen „Antinanco“. Er bietet ihm von seinem Tabak an, und mit rauchenden Pfeifen machen sie es sich auf der Terrasse bequem. Währenddessen stürzen die anderen zum See. Das Wasser ist eiskalt. Aber als sie einmal darin sind, fühlen sie sich wohl, spüren förmlich die Energie des Wassers in ihre Körper strömen und trennen sich nach einer halben Stunde nur schwer von dem erfrischenden Bad.
Nachdem die Koffer ausgepackt sind und gemeinsam ein einfaches Mittagessen verzehrt wurde, macht sich Kachina im Haus zu schaffen, während die drei Achteraths und Antinanco in bequemen Stühlen auf der Terrasse sitzen. „Ich freue mich sehr, dass ihr da seid“, wendet Henrik Achterath sich an seine beiden Kinder, „ich war sicher, dass ihr kommen würdet, habe aber gar nicht so schnell mit euch gerechnet.“
Arnulf und Elisabeth berichten kurz, wie sie alles stehen und liegen gelassen haben, und von ihrer Reise. Doch dann ist es mit ihrer Geduld am Ende: „Warum hast du uns gebeten, sofort zu kommen? Dir scheint es nicht so gut zu gehen, bist du krank?“
Henrik Achterath blickt lange auf den See hinaus und antwortet dann mit leiser, jedoch fester Stimme: „Ich habe nicht mehr lange zu leben. Ich werde in vier Tagen sterben und möchte gern die letzten Stunden gemeinsam mit euch verbringen.“
Die Kinder sind bestürzt: „Was fehlt dir? Welche Krankheit hast du? Warum bist du nicht im Krankenhaus? Hier in deiner abgeschiedenen Wildnis gibt es doch keine ärztliche Versorgung. Hast du dich wenigstens von einem Arzt untersuchen lassen?“
Der Vater lächelt: „Was soll ich mit einem Arzt oder gar im Krankenhaus? Ich gehe täglich in meinem Körper selbst spazieren, weiß genau, was mir fehlt. Ich weiß, wann meine Zeit gekommen ist.“
In die Empörung und Bestürzung seiner Kinder hinein sagt Henrik Achterath: „Außerdem habe ich Antinanco, sein Name bedeutet ‚Adler der Sonne‘. Er hat einen klaren, alles erkennenden Blick. Er weiß viel mehr als die studierten Ärzte, denn er trägt das gesamte Wissen vieler Generationen von Indianern, die im Einklang mit der Natur lebten, in sich. Von Antinanco habe ich in den vergangenen zehn Jahren mehr gelernt als während meines ganzen Lebens zuvor. Er und auch Kachina haben mir bereits vor Wochen meine todbringende Krankheit angesehen, ohne dass ich dazu ein Wort verlieren musste. Antinanco, lieber Freund, bitte erkläre es meinen Kindern.“
„Ich bin ein Medizinmann. Ihr mögt darüber lachen, aber über unzählige Generationen wurde das Heil- und Erfahrungswissen stets mündlich weitergegeben und wird nun von mir gehütet. Ich bin ein alter Mann, nun schon 97 Jahre alt. Die letzten Jahre gemeinsam mit eurem Vater waren für mich eine besonders kostbare Zeit. Doch nun ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Die alten Indianer wussten immer, wann sie sterben würden, und haben sich und ihre Familien darauf vorbereitet. Ich selbst werde noch in diesem Jahr sterben und eurem Vater folgen. Im Bauch eures Vaters hat sich ein Hoka, ein Dachs, eingenistet. Er ist listig und frisst sich mit Gewalt, Macht und Zorn durch die Eingeweide. Der Hoka verursacht große Schmerzen. Da hilft keine Medizin, keine Operation. Es ist so, wie es ist.“
Der alte Indianer hatte mit sehr ruhiger Stimme zu ihnen gesprochen. Doch in Elisabeth und Arnulf lösen seine festen Worte Orkanstürme aus. Sie mögen das Unausweichliche nicht einsehen, spüren eine unendliche Trauer in sich und fühlen sich hilflos ausgeliefert. Schließlich fordert Henrik Achterath sie auf: „Schaut euch einmal mit dem Fernglas genau den Berg auf der Westseite des Sees an.“
Die Kinder folgen wortlos. „Da oben auf dem Gipfel sitzt ein mächtiger Adler“, stellt Elisabeth fest. „Jetzt erhebt er sich in die Lüfte und zieht weite Kreise über den See und die Berge“, ergänzt Arnulf. Aber was hat der Adler mit dem bevorstehenden Tod ihres Vaters zu tun?
Antinanco klärt sie auf: „Eine alte indianische Weisheit besagt: ‚Du musst die Dinge mit dem Auge in deinem Herzen ansehen, nicht mit dem Auge in deinem Kopf.‘ Wenn ihr das tut, dann werdet ihr erkennen, dass der Adler das Totemtier, das Krafttier eures Vaters ist. Das Totemtier begleitet das gesamte Leben eines Menschen. Er nimmt auch die Eigenschaften seines Krafttieres an. Der Adler steht für Aufstieg, Behändigkeit, Schnelligkeit, aber auch für Machthunger. Ein Adler ist tapfer, intelligent. Er hat kämpferische Kraft und erkennt die Wirklichkeit. Der Kampf eures Vaters neigt sich nun dem Ende zu, und er sieht auch diese Wirklichkeit.“
„Ja, der Adler ist gekommen“, führt der alte Achterath diese Gedanken fort. „Ich werde in wenigen Tagen mit ihm in ein neues Leben, in eine andere Wirklichkeit fliegen. Und ihr beide werdet mich bitte in drei Tagen mit einem Pferd dort oben auf den Gipfel bringen, damit ich meine letzte Reise in diesem Leben antreten kann.“
„Du bist total verrückt geworden. Wir können doch nicht einfach zuschauen, wie du da oben in den Felsen stirbst“, fährt es aus Elisabeth heraus.
„Warum denn nicht?“, entgegnet Henrik Achterath heiter. „Es ist doch völlig gleichgültig, ob ich in einem Krankenhaus, hier zu Hause in meinem Bett oder auf meinem Lieblingsplatz oben auf dem Berg sterbe. Der Tod ist doch etwas ganz Natürliches, er gehört selbstverständlich zu unserem Leben. Beides gehört zusammen. Ich habe ein sehr erfülltes Leben gehabt, habe zwei wunderbare Kinder und auch bereits Enkelkinder. Die Kette reißt also nicht ab. Mich ängstigt mein Tod nicht. Er ist doch nur ein Übergang in eine andere Daseinsform. Und dieser Übergang wird mir auf meinem Lieblingsplatz oben auf dem Berg besonders gut gelingen.“
Nach längerem Schweigen fügt er hinzu: „Diese letzte Bitte dürft ihr mir nicht abschlagen. Was ihr nach meinem Tod mit meinem Körper, den ich dann nicht mehr benötige, macht, ist mir gleichgültig. Ihr könnt ihn dort oben liegen lassen oder irgendwo vergraben. Nur diesen letzten Weg möchte ich gemeinsam mit euch zurücklegen. Ich tue es mit Freuden, und ihr solltet es auch so halten. Bitte!“
Diese Bestimmtheit und Sicherheit lindern die Trauer und Zweifel der Kinder. Es graust ihnen zwar, aber sie fühlen in sich das sichere Wissen, dass es genauso geschehen wird. Arnulf, der beherrschter als seine Schwester ist, fragt nach: „Warum ist dort oben auf dem Berggipfel dein Lieblingsplatz? Warum willst du ausgerechnet dort sterben?“
Im alten Achterath wird der Dachs wach, er mästet sich erneut an dessen Eingeweiden. Heftige Schmerzwellen durchfahren seinen Körper, Krämpfe schütteln ihn. Als die Kinder aufspringen und zur Hilfe eilen wollen, hebt er nur abwehrend die Hände, wispert: „Nein, lasst nur. Es ist gleich wieder vorbei, der Hoka ist schnell satt.“ Und atmet mit tiefen Zügen in den Schmerz hinein. Dies bringt rasch Linderung.
Derweil beschreibt Antinanco den Berggipfel.
Oben von der Spitze, in direkter Nähe des Adlerhorsts, hat man einen wunderbaren, ungestörten Blick über die ganze Landschaft. Auf einer Steinbank sitzend, spürt man die massive Energie des Felsens und ebenso die starke Leichtigkeit des Windes direkt in sich. Man ist dem Himmel, der Sonne so nahe, verfolgt ihre Bahn und sieht sie glutrot hinter den Gletscherbergen versinken. Ungefiltert bewundert man den Zauber der weiten Sternenwelt. Man erfährt die Gewissheit, dass alles eins ist, alles in einem großen Kreislauf miteinander verbunden ist und nie etwas vollständig endet. Sonne und Mond, Tag und Nacht, Leben und Tod, Mensch und Totemtier – alles gehört zusammen. Vor allem: Dort oben ist man der verwirrenden Welt entrückt, taucht ein in die Wirklichkeit und erkennt mit klarem Blick die eigene Wahrheit. Man ist erfüllt von Frieden und heiterer Gelassenheit. Und natürlich ist dort oben Henrik Achterath seinem Totemtier, dem Adler, so nahe, bis schließlich Adler und Mensch eins werden können.
„Als wir zum ersten Mal gemeinsam dort oben waren“, fährt der alte Indianer fort, „haben wir drei Tage und zwei Nächte auf dem Gipfel verbracht. Wir spürten keinen Hunger und keinen Durst. Den Abstieg haben wir im Flug verbracht. Wir sind praktisch mit einer zuvor nie gekannten Leichtigkeit wie ein Adler ins Tal geflogen. Damals haben wir begonnen, die Erfahrungen und Kenntnisse unserer verschiedenen Kulturen auszutauschen, und haben viel voneinander gelernt. Euer Vater hat mir damals von Dantes Göttlicher Komödie erzählt. Was Dante in seiner großen Weltliteratur beschreibt, beispielsweise die drei Jenseitsbereiche, die Jenseitsführer, die Jenseitsreise, der Läuterungsberg oder den Baum der Erkenntnis, zeigen eine erstaunliche Übereinstimmung mit den Kulturen und Überlieferungen der alten Indianer. Dante kannte keine indianischen Traditionen, wusste nicht einmal, dass es in einem von seinem Italien weit entfernten Kontinent Indianer gab. Und kein Indianer wusste etwas von Dante. Gleichwohl gelangten sie zu übereinstimmenden Erkenntnissen. Wenn man einmal das ganze Schmuck- und Beiwerk fortnimmt, stellt man fest, dass die Kernaussagen aller Kulturen und Religionen auf der ganzen Welt mit unterschiedlichen Worten das Gleiche besagen. Dann gelangt man zur letzten, einzig wahren Wirklichkeit.“
In das tiefe Schweigen hinein erinnert sich Henrik Achterath: „Es war für uns ein Erkenntnis- und Läuterungsprozess. Entsprechend dem Läuterungsberg der göttlichen Komödie nennen wir beide unseren Berggipfel ‚Dantes View‘. Wir haben dort viel Zeit miteinander verbracht, haben das Diesseits durchforscht und Jenseitsreisen angetreten. Deshalb will ich dort in eurer liebevollen Begleitung die letzte Reise meines jetzigen Lebens antreten.“
Und alle vier wissen, so wird es geschehen.
Es ist später Nachmittag geworden. Nach einem herzlichen Abschied machen sich der alte Indianer und seine Enkeltochter auf den Heimweg. Die beiden Freunde umarmen sich kurz. „Gute Reise, lieber Freund. Ich werde dir noch in diesem Jahr folgen“, gibt Antinanco seinem Freund mit auf den Weg. „Ich weiß“, erwidert Henrik Achterath kurz, „wir sehen uns auf Dantes View.“
Beide lachen herzhaft!
„Schade, dass die beiden uns verlassen und dass wir erst jetzt mit dir über die Dinge, die dein Leben ausmachen, reden können. Ich würde so gern noch vieles von dir erfahren“, wendet sich Arnulf an seinen Vater. „Mir geht es ebenso“, stellt die Schwester fest, „ich habe noch so viele Fragen. Was hat es mit dem Adler als deinem Totemtier auf sich? Wie ist er in dein Leben getreten? Wie hat er dich beeinflusst?“
„Dafür haben wir die nächsten drei Tage Zeit“, erwidert der Vater. „Ich möchte euch aus meinem Leben erzählen, so wie ich es sehen kann. Ich will euch nicht zu irgendetwas bekehren, nicht meine Erfahrungen und Sichtweisen aufzwingen. Sondern nur meine Verrücktheiten anbieten, und ihr könnt selbst herausfinden, was davon für euch brauchbar ist.“
Dann beginnt Henrik Achterath aus seinem Leben zu erzählen: „Meine Geburt verlief bereits genauso dramatisch, wie ihr vorhin meinen bevorstehenden Tod empfunden habt …“
Erster Akt: Als Adler geboren und Narr geworden
Vor zwei Stunden, als es in der Hütte während der hereinbrechenden Dämmerung immer dunkler geworden war, hatten sie die Frau auf den rohen Küchentisch gelegt und mit einem breiten Lederriemen vom Pferdegeschirr auf dem Tisch festgebunden, damit sie nicht herunterfallen konnte. Am frühen Morgen hatten die Wehen mit einer solchen Heftigkeit eingesetzt, dass die Schwangere gequält aufschrie, sich aufbäumte, um den Schmerzen zu entgehen, die sie schier auseinanderzureißen drohten. Den ganzen langen Tag hatte sie in dem düsteren, engen Alkoven gelegen, mit jeder Wehe gedrückt und gepresst. Doch das Kind in ihrem Leib wollte sie nicht loslassen. Am späten Nachmittag war ihr heftiges Stöhnen in ein klägliches Wimmern übergegangen. Noch immer tobten die Wehen durch ihren Körper. Doch die Frau hatte einfach keine Kraft mehr, ließ sich von den Schmerzen in ihrem Leib willenlos treiben wie auf den Wellen eines stürmischen Meeres.
Da hatten sie ihr Mann und ihre alte Mutter aus dem stickigen Alkoven herausgeholt und auf den Küchentisch gelegt, um ihr besser helfen zu können. Mit jeder Wehe presste ihr Mann mit all seiner Kraft auf den zu einer Tonne gewölbten Bauch der Frau. Unter seinen Händen schien der gespannte Leib zerspringen zu wollen wie ein überreifer Kürbis in der Mittagshitze eines sonnigen Herbsttages. Währenddessen versuchten die Hände ihrer alten Mutter, das Kind in ihr zu erfassen, zerrten und schoben in ihr herum, um dem Kind die richtige Lage zu geben.
Der ganze Raum wurde nur von dem Feuer in dem offenen Kamin beleuchtet. Die Flammen tanzten und zuckten wie Dämonen auf dem Leib der Gebärenden. Wie mit langen Fingern zerrte der Widerschein des Feuers an dem harten Bauch, als wollten sie das ungeborene Kind entreißen und der Frau endlich Linderung geben.
Mit vor Angst und Schrecken geweiteten Augen starrten die vier erstgeborenen Kinder der Frau auf das Leiden ihrer geliebten Mutter. Drei Jungen im Alter von zehn, acht und sechs Jahren drängten sich in einem finsteren Winkel des Raumes Schutz suchend aneinander. Entsetzt wandte sich das älteste Kind, ein zwölfjähriges Mädchen, ab. Sie hatte Backsteine im Kamin erhitzt und an den Seiten ihrer Mutter auf dem Tisch aufgestapelt, um ihr Wärme zu geben. Unentwegt wechselte sie die Steine aus. In den Pausen dazwischen hielt sie den Kopf ihrer Mutter umklammert, starrte wortlos in die ermatteten, geweiteten Pupillen und wischte mit zärtlichen Bewegungen den Schweiß aus dem Gesicht der Gebärenden.
In dem Raum wurde kein Wort gewechselt. Die Luft war erfüllt von dem gepressten Atem und stoßweisen Stöhnen der Mutter. Dazwischen klang nur das Klirren der Kuhketten und das Schnauben der Pferde von der angrenzenden Diele herein. Die armselige Moorkate bestand nur aus zwei Räumen, der großen Viehdiele und dem einfach eingerichteten Raum mit dem offenen Kamin, der zugleich Küche, Wohn- und Schlafzimmer war.
Die alte Frau hatte es aufgegeben, sich an ihrer leidenden Tochter zu schaffen zu machen. Stumm sah sie ihren Schwiegersohn an und schüttelte kaum merklich den Kopf, als wollte sie sagen: Es gibt keine Hoffnung mehr.
Der Mann beugte sich tief über das Gesicht seiner Frau, die mit dem ungeborenen Leben in ihrem Leib kämpfte und dabei immer mehr von ihrer eigenen Lebenskraft verlor. In dem Blick des Mannes lag eine unendliche Traurigkeit. Seine Hilflosigkeit ließ ihn schluchzen, und seine abgearbeiteten, schwieligen Hände verkrampften sich zu Fäusten, sodass die Knöchel schneeweiß aus der ledernen Haut hervortraten. Als wolle er das verzweifelte Schluchzen in sich unterdrücken, küsste er den offenen, stöhnenden Mund seiner Frau. So sanft, wie sich ein Schmetterling auf einer Blüte niederließ, so berührten seine spröden Lippen den verzerrten und nach Luft schnappenden Mund. In diesem kaum spürbaren Kuss lagen so viel Zärtlichkeit und Liebe, wie es keine Worte ausdrücken könnten. Diese leichte Berührung schien der Frau neue Kraft zu geben. Und mit einer neuen Anstrengung bäumte sie sich auf, um endlich das Kind aus ihrem Leib herauszupressen.
Die alte Mutter war währenddessen in die hintere Ecke des Raumes geschlurft, kniete dort vor einem einfachen Kruzifix und flehte inbrünstig ihren Gott an, das Leben ihrer Tochter und des ungeborenen Kindes zu erhalten. Plötzlich verstummte ihr Gebet. Sie reckte den greisen Kopf weit nach vorn, als wolle sie dem schwachen Laut, den sie weit draußen im Moor zu hören geglaubt hatte, entgegeneilen. Plötzlich war ein uraltes, längst vergessenes Wissen in ihr, füllte ihren Körper ganz aus und entfachte tief in ihrem Inneren ein Feuer, das ihre Augen voll neuer Energie erstrahlen ließ. Mit einer Behändigkeit, die man diesem ausgemergelten, gekrümmten Körper nicht zugetraut hätte, schnellte die Alte herum, umklammerte mit ungeahnter Kraft den Arm ihres Schwiegersohnes und stieß hervor: „Jetzt wird das Kind leben. Es wird alles gut. Ich habe draußen im Moor den Ruf des Adlers gehört. Er verkündete mir das neue Leben.“
Der Mann schüttelte verwirrt den Kopf. Er verstand die Greisin nicht. All seine Gedanken galten seiner Frau, die dort, auf dem Küchentisch liegend, mit seinem Kind im Leibe kämpfte. So entgegnete er nur mechanisch: „Was soll das Gefasel vom Schrei des Adlers? Bist du ganz von Sinnen?“
Doch die Alte ließ nicht locker: „Doch, der Adler ist da. Erinnere dich an den Adler in deinem Familienwappen. Nun ist der Adler hier. Er lebt. Und auch mein Enkel wird leben.“
Verständnislos starrte der Mann die Alte an. Sein Blick streifte ihren krummen Rücken, fiel auf die klauenartigen Hände, die seinen Arm umklammert hielten. ‚Wie eine Hexe‘, schoss es ihm durch den Kopf. Dann sah er das Lodern in ihren Augen, die wie glühende Kohlen in ihn hineinbrannten, ihn mit Macht festhielten und lenkten. Er spürte eine unbändige Kraft, die plötzlich von dieser alten Frau ausging und die er mit jedem Atemzug tief in sich einzog. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, wandten sie sich wieder seiner Frau auf dem Küchentisch zu, deren Körper von einer neuen Schmerzwelle ergriffen und durchgeschüttelt wurde. Mit vereinten Kräften zerrten und pressten sie. Mit letzter Anstrengung bäumte sich die Frau auf dem Tisch auf und presste so stark, dass die Adern an ihrem Hals wie Taue hervortraten. Mit einem Schrei: „Der Adler ist da!“, fiel sie kraftlos zurück.
Und mit einem verständnislosen Gedanken: ‚Wie kommt es, dass der Adler in der Nacht jagt?‘, hörte nun auch der Mann den Schrei des Adlers. Zugleich spürte er unter seinen kräftigen Händen den Druck des Leibes seiner Frau nachgeben und sah, wie seine Schwiegermutter mit einem Triumphschrei ein neues Leben aus dem sterbenden Körper seiner Frau zog.
Der angsterfüllte Aufschrei seiner beiden Söhne in der Ecke ließ den Mann herumfahren. Mit aufgerissenen Mündern und vor Schreck geweiteten Augen starrten sie auf das Fenster. Und da sah auch der Mann, vom schwachen Licht des flackernden Feuers im Kamin erhellt, draußen am Fenster die mächtigen Schwingen des Adlers wie einen Geist vorbeihuschen und mit einem letzten durchdringenden Schrei in den nahenden Morgen verschwinden.
Waren es wirklich die Schwingen des Adlers oder nur die Zweige der mächtigen Kiefer im Hof, die vom Nachtwind getrieben an den Fensterscheiben kratzten? War es der Jagdschrei des Adlers oder der erste Lebensschrei seines neugeborenen Sohnes?
Während die Alte das Neugeborene versorgte, in einer blechernen Wanne am Kamin badete und in graue, handgewebte Leinen wickelte, kümmerte der Mann sich liebevoll um seine Frau. „Wir haben einen gesunden, kräftigen Sohn“, raunte er ihr zu. Sie lächelte nur matt. In ihr war keine Kraft mehr, um ihrem Mann zu antworten. Nun drängten sich auch die vier Kinder in die Nähe des Küchentisches. Mit unendlicher Zärtlichkeit streichelten sie die verschwitzten Arme und eingefallenen Wangen der Mutter, ergriffen besorgt ihre Hände, als könnten sie damit das ausströmende Leben in dem sterbenden Körper festhalten und den Tod vertreiben, der bereits vor Stunden lautlos die Kate betreten hatte und geduldig wartete, bis seine Zeit gekommen war.
Auch der Mann spürte, dass mit dem neuen Leben zugleich der Tod den engen Raum ausfüllte. Dicke, schwere Tränen traten aus seinen Augen, suchten sich in dem zerfurchten Gesicht einen Weg, sprangen wie das Quellwasser im Bachbett über Runzeln und Falten, um schließlich durch das dicke Gestrüpp seines Bartes zu fließen und von den Bartspitzen auf die Wangen seiner geliebten Frau zu fallen. Die Frau wandte den Kopf und schaute in die blauen, gütigen Augen ihres Mannes, die nun alle Klarheit verloren und von unseliger Trauer getrübt waren. Plötzlich waren sie beide allein in diesem Raum. Für eine kurze Ewigkeit hielten sich ihre Augen fest und tauschten in Sekunden wortlos das miteinander aus, wozu sonst ein ganzes Leben nicht ausreicht.
Der Mann musste sich tief über die flüsternden Lippen bücken, um die schwachen Worte seiner Frau zu verstehen.
„Ich gehe nun heim. Wir können unserem Schicksal nicht entgehen. Mich hat die Vergangenheit eingeholt. Und ich zahle nun den Preis gern, denn das Leben mit dir ist für mich jeden Preis wert. Nur, dein Leben wollte ich nie zerstören. Denn ich liebe dich mehr als mein eigenes Leben.“
Der Mann verstand den Sinn dieser Worte nicht sogleich. Erst als er den Augen seiner Frau folgte und gemeinsam mit ihr eine Reise in die innere Vergangenheit antrat, tauchten tief vergrabene Bilder auf, und er verstand, dass diese Bilder ihr ganzes Leben fesselten.
Seit Menschengedenken lebten die Achteraths auf der abgeschiedenen Insel. Sie bewirtschafteten das Land zwischen Heide und Egelsberg, und im Laufe von zig Generationen war der Hof zu einem stattlichen Gut gewachsen. Die großen Gebäude glichen einer Festung, hier lebten freie Bauern auf freiem Land.
Der Hof war ehemals als Lehen abgabepflichtig an das Kloster der Insel. In den alten Geschäftsbüchern des Klosters konnte die Geschichte der Achteraths über Jahrhunderte zurückverfolgt werden. Die erste Erwähnung des Namens Achterath findet sich im Jahre 1301. Die Feststellung „Wir von 1301“ wurde zwar in der Familie Achterath nie ausgesprochen, war jedoch ein prägendes Element, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde und das Leben der Menschen dieser Familie bestimmte. Über sieben Jahrhunderte hatten die Mönche akribisch festgehalten, wie viele Scheffel Weizen oder wie viele Fuder Schlagholz die Achteraths jährlich dem Kloster – früher als verpflichtende Abgabe und später als freiwilligen Zins – leisteten. Mit jeder geschäftlichen Eintragung waren zugleich aktuelle Ereignisse auf dem Hof Achterath festgehalten worden. So findet sich verbunden mit dem Eintrag „2 Fässer Branntwein geliefert“ die Bemerkung: „Am 11. März 1611 starb der Bauer auf dem Hof, der 253 Hufen umfasst. Am 16. März 1611 heiratet die junge Witwe den Nachbar-Bauern, nun ist das Anwesen 377 Hufen groß.“
Für die Achteraths war der Hof ihr Leben, er stand immer an erster Stelle. Die Ehepartner wurden danach von den Eltern ausgesucht, was für den Hof gut war und dem Stand der Familie entsprach. So heiratete auch Ende des 19. Jahrhunderts Balthasar Achterath seine Cousine Elisabeth Achterath, sodass zwei stattliche Anwesen der Familie zusammenkamen. Mit ihrem Fleiß und Können entwickelten sie ihr Erbe zum größten, ansehnlichen Gut, das fortan nur noch die „Perle der Insel“ genannt wurde.
Kein Mann der Familie war je in den vielen Generationen älter als 60 Jahre geworden, während ihre Ehefrauen fast regelmäßig ein biblisches Alter erreichten. So auch Balthasar Achterath. Er verunglückte schwer mit einem Pferdefuhrwerk, zog sich im Krankenbett eine Lungenentzündung zu und starb im Alter von 57 Jahren. Das Gut leitete fortan die Witwe Elisabeth Achterath mit Unterstützung eines Verwalters.
Elisabeth war eine sehr gläubige Frau, die im Gedankengut der evangelischen Kirche der Insel lebte. Sie führte das große Gut mit strenger Hand und ließ sich dabei beraten von ihrem Schwiegersohn, dem Mann ihrer ältesten Tochter, der ebenso streng im Glauben lebte. Dem angestammten Hoferben, ihrem Sohn Hermann Achterath, mochte sie das Gut nicht anvertrauen, denn Hermann hatte sich der Ehe mit der einzigen Tochter eines Nachbarhofes, die bereits zwischen den Eltern fest verabredet war, strikt verweigert. Wer so verantwortungslos handelte, die Familientradition erstmalig brach und nicht durch Heirat das Gut vergrößerte, konnte in ihren Augen nicht Eigentümer werden. Die Mutter drohte ihrem Sohn gar damit, ihn zu enterben und das Gut in die Hände des jüngeren Bruders Franz zu geben.
Doch auch Franz fügte sich nicht dem Willen seiner Mutter, folgte vielmehr dem Vorbild seines Bruders. Franz hatte sich in eine hübsche junge Frau verliebt, die leider aber von einem sehr kleinen Hof stammte und so nicht dem Stand der Achteraths entsprach. Davon ließ Franz sich nicht beirren. Er floh mit seiner Angebeteten in die Schweiz, um dort zu heiraten und später auf die Insel zurückzukehren, wenn sich dort die Wogen geglättet hätten. Ob dieser unverzeihlichen Sünde mietete Elisabeth Achterath kurzerhand ein Flugzeug, erreichte die Schweiz noch vor dem entflohenen Paar, vereitelte die geplante Heirat und brachte Braut und Bräutigam auf die Insel zurück. Doch Franz‘ Geliebte war bereits schwanger. Die Beseitigung dieses ungeheuerlichen Fehltrittes, der unbedingt vor aller Welt geheim gehalten werden musste, ließ sich Elisabeth Achterath fünf Hektar besten Ackerlandes kosten. Mit dem Vater der jungen Frau wurden eine entsprechende Schenkung und eine sofortige Heirat der gerade Neunzehnjährigen mit einem anderen Bauern, der auf der Insel einen kleinen Hof bewirtschaftete, verabredet. Die schwangere Frau fügte sich in ihr Schicksal und vollzog diese Eheschließung. Franz Achterath meldete sich daraufhin freiwillig zum Militär. Er starb einige Jahre später im Zweiten Weltkrieg in Russland.
Um den Namen der Familie Achterath auch für künftige Generationen zu erhalten, verblieb so nur noch Sohn Hermann. Er hatte sich in eine junge, sehr hübsche Frau verliebt, die als Kellnerin in einer Gaststätte auf der Insel arbeitete. Sie entstammte einer Arbeiterfamilie aus Ostpreußen, die vor dreißig Jahren in ein Industriegebiet auf dem Festland in der Nähe der Insel gezogen war, um dort im Bergbau ihr karges Auskommen zu finden. Eine Ehe mit dieser Frau verstieß in Elisabeth Achteraths Augen gegen alle Jahrhunderte gültigen Regeln und bewährten Traditionen der Familie. Die junge Frau war gewiss sehr hübsch, jedoch bettelarm, konnte kein Land, konnte überhaupt nichts in die Ehe einbringen, verstand nichts von Landwirtschaft und arbeitete dann noch in dem Sündenpfuhl einer Gaststätte. Einer solchen Ehe widersetzte sich Elisabeth Achterath mit allen Kräften und holte immer wieder ihren Sohn Hermann mit ihren beiden Schäferhunden gewaltsam von einem Besuch aus der Gaststätte zurück. Hermann beugte sich nicht dem starken Willen seiner Mutter, die schließlich vorschlug, dass die junge Frau ein Lehrjahr in der Landwirtschaft auf dem Festland absolvieren solle. Danach könne man weitersehen.
Elisabeth Achterath hoffte, dass die junge Frau das harte Lehrjahr in der Landwirtschaft nie durchstehen und die Zeit der Trennung die Glut der Liebe erkalten lassen würde. Sie unterschätzte die Kraft der Liebe. Die junge Frau bestand die landwirtschaftliche Ausbildung glänzend. Danach heiratete das junge Paar heimlich gegen den Willen der Mutter. Die junge Frau wurde schnell schwanger. Elisabeth Achterath verbannte daraufhin ihren Sohn vom elterlichen Gut und vermachte ihm eine kleine Moorkate mit wenigen Hektar kargen Landes.
Erstmalig waren die ungeschriebenen Gesetze der Familie gebrochen worden. Elisabeth Achterath handelte in ihrer religiösen Überzeugung, dass der Herr es richtet und seine Wege unergründlich und voller Weisheit sind. Ihr Sohn Hermann hatte gegen die Familientradition verstoßen, etwas zusammengefügt, was nicht zusammengehört. So war es der Wille des Herrn, dass der eigentliche Erbe des stolzen Gutes, Hermann Achterath, mit seiner jungen Frau in der armseligen Moorkate landete. Seine Schwiegermutter zog zu ihnen, um bei der harten Landarbeit sowie im Haushalt mit fünf Kindern, die in der Moorkate das Licht der Welt erblickten, zu helfen.
Der Mann und die sterbende Frau kehrten von ihrer Reise in die Vergangenheit in die Enge der Moorkate zurück.
„Ich danke dir. Es war ein gutes Leben an deiner Seite“, flüsterte die Frau. Hilflos schaute ihr Mann sie an. Und mit einer verzweifelten Geste wies er in den Raum, als wolle er sagen: ‚Wofür dankst du mir? Für diese armselige Kate? Für ein Leben voller Entbehrung?‘
„Für deine Liebe“, wisperte sie, „für deine Liebe.“ Und in ihren Augen sah er die überzeugende Klarheit und das Leuchten der Augen des jungen Mädchens, das er vor vielen Jahren zum ersten Mal geküsst hatte. Liebevoll nahm er sie in seine Arme, hielt sie fest an sich gedrückt und brachte sein Ohr ganz in die Nähe ihres Mundes, um ihr abgerissenes Flüstern zu verstehen.
„Du musst Licht machen ... Es ist so dunkel hier ...“, bis sie begriff, dass das Dunkel in ihrem Inneren war, unaufhaltsam in ihr aufstieg und von ihrem Körper Besitz ergriff. Aus weiter Ferne vernahm sie die zärtlichen Worte ihres Mannes: „Adieu, meine große Liebe. Bald sind wir wieder zusammen und werden uns nie wieder loslassen.“
Die Worte blieben immer weiter zurück. Sie tauchte in eine strahlende Helligkeit ein, in der nichts, gar nichts mehr Bedeutung hatte.
Stunden später, als sie die Tote gewaschen, eingekleidet und im Alkoven aufgebahrt hatten, waren der Mann und seine Kinder im Morgengrauen erschöpft eingeschlafen. Nur die alte Frau machte sich noch in der Hütte zu schaffen. Sie wickelte das Neugeborene in ein warmes Tuch, steckte es unter ihren weiten Umhang und stahl sich aus der Kate. Zielstrebig lief sie mit dem Kind im Arm über Äcker und Wiesen, tief ins Moor hinein. Dichte Nebelschwaden stiegen aus dem Moor empor, hüllten die Alte gespensterhaft ein. Doch unbeirrt nahm sie ihren Weg, zog wie weite, flatternde Schleier den Nebel hinter sich her und erreichte endlich den Fuß einer über fünfhundert Jahre alten Mooreiche. Oben, in schwindelnder Höhe der mächtigen Baumkrone, hatte der Adler in den letzten Wochen seinen Horst gebaut. Niemand außer der Alten wusste davon. Und nun sah sie im ersten Dämmerlicht des heraufziehenden Tages, oben auf dem Horstrand, schemenhaft den Adler stehen. Mit weit ausgestreckten Armen hielt sie dem Adler das Kind entgegen und sprach beschwörend mit fester, durchdringender Stimme: „Hier bringe ich dir meinen Enkelsohn. Er ist frei geboren wie ein Adler. Kein Fluch lastet auf ihm. Er ist frei. Er wird ein Adler.“
Noch immer hielt die Alte das Kind empor. Und wie als Bestätigung ihrer Worte streckte das Neugeborene seine geballten Hände aus dem Umhang hervor dem Adler entgegen.
Mit dem Dunst stiegen aus dem Moor graue, verschwommene Nebelgestalten und tanzten geisterhaft im seichten Morgenwind. Die Gestalten wurden immer größer und drohender. Immer enger schloss sich der wilde Tänzerkreis um die Mooreiche. Gierige, zerfranste Arme griffen nach der Alten, zupften am schützenden Umhang des Kindes, flatterten fort, um bald mit noch mehr Armen und noch mehr gierigen Händen wiederzukommen.
Die Alte presste das Neugeborene fest an ihre Brust, wickelte es in ihren weiten Umhang ein, um es vor dem Zugriff der Nebelgestalten zu schützen. Da entdeckte sie in einer mächtigen Nebelwand, die direkt auf sie zukam, die gebückte Gestalt von Elisabeth Achterath, der Mutter ihres Schwiegersohnes. Mit sich überschlagender, vor Erregung brechender Stimme schrie die Alte: „Nein, meinen Enkelsohn bekommst du nicht! Du willst einen männlichen Hoferben aus dem Blut der Achteraths haben. Doch du hast dich gegen ihn versündigt, hast seine Mutter auf dem Gewissen. Du hast meine geliebte Tochter verachtet und in die Moorkate verbannt. Aber sie war viel stärker als du und hat nun meinen Enkelsohn geboren. Er ist von deinem und meinem Blut. Er wird stark und königlich sein wie ein Adler, frei und unabhängig. Er wird Henrik heißen, wird deine Willkür durchbrechen. Gestärkt durch mein frisches Blut wird er das durch die Inzucht verseuchte Blut der Achteraths heilen und ein einzigartiges, freies Leben führen.“
Je mehr die Alte schrie und wütete und mit ächzender Zunge einen wahren Wirbelsturm erzeugte, desto mehr zogen sich die finsteren Nebelgestalten zurück, versanken zur Bedeutungslosigkeit im Moor und machten Platz dem Licht des jungen Tages.
In den Windeln des Neugeborenen versteckte die Großmutter ein Erdmännchen, ein blank poliertes kleines Wurzelstück, das die Form eines winzig kleinen Menschenkörpers hatte. Nur die weit abstehenden Arme erinnerten eher an die ausgebreiteten Flügel eines Adlers. Und aus dem runden Kopf der Wurzelverdickung strahlte das heitere Gesicht eines Narren hervor. Dieses Erdmännchen wurde später zum liebsten Spielzeug des Jungen.
So verliefen die ersten Stunden im Leben des neugeborenen Henrik Achterath. Sie sollten sein ganzes weiteres Leben bestimmen.
Sechs Monate nach dem Tod der Mutter verließ die gesamte Familie die Moorkate. Elisabeth Achterath war alt und müde geworden, das große Gut zu leiten. Und da der Stein des Anstoßes, die nicht standesgemäße Schwiegertochter, das Zeitliche gesegnete hatte, durfte Sohn Hermann mit seinen Kindern nun wieder in das Elternhaus zurückkehren. Doch erstmalig in der Geschichte der Familie wurde das Gut geteilt. Viele Generationen zuvor hatten stets das Erbe sorgsam verwaltet und vergrößert. Elisabeth Achterath vermachte nun die Hälfte des Landes zu gleichen Teilen ihren Töchtern, Sohn Hermann erhielt die andere Hälfte mit den großen Gebäuden, die nun angesichts der halbierten Nutzfläche überdimensioniert waren. Zusätzlich musste Hermann Achterath seiner Mutter und seinen Schwestern stattliche Abfindungen zahlen.
Elisabeth Achterath richtete sich auf dem Gut eine Wohnung mit separatem Eingang ein. Sie hatte ihrem Sohn zwar die Heimkehr gestattet, aber sie wollte nicht mit ihm in einem Haushalt zusammenleben. Hermann Achterath blieb Zeit seines Lebens ob seines unverzeihlichen Fehltrittes der Wahl einer falschen Ehefrau von seiner Familie getrennt.
So zog Hermann Achterath mit seinen fünf Kindern auf das nun halbierte Gut. Seine Schwiegermutter blieb allein in der Moorkate zurück, denn sie hatte nie die Nähe der Menschen gesucht und fühlte sich in dieser Abgeschiedenheit am wohlsten. Außerdem war die Kate nicht weit vom Gut entfernt, sodass sie sich trotz der räumlichen Trennung intensiv ihrem jüngsten Enkelkind widmen konnte. In den folgenden Jahren war die alte Frau nur für den jungen Henrik da. Sie gab ihm Liebe und Geborgenheit und entfachte in ihm mit unerschütterlicher Geduld ein erstes Ahnen um die Kraft und Sicherheit in seinem Inneren. Während langer Wintertage und des Abends an seinem Bett erzählte sie uralte Geschichten aus ihrer ostpreußischen Heimat, sang Lieder und vermittelte ihm das in ihr seit Generationen angesammelte Wissen. Die Geschichten der Greisin wurden beherrscht vom Adler und vom Narren. In immer neuen Variationen erzählte sie von der Weisheit der Clowns und von der Freiheit des Adlers. Tief grub sie in das Unbewusste des Knaben ein, zugleich Adler und Narr zu sein.
Sei ein Clown, steig auf den Baum,
pflück dir einen bunten Traum.
Mit solchen einfachen Versen und ebenso fein gesponnenen Geschichten vermittelte sie dem jungen Henrik ein Wissen, das in keinem Lehrbuch der Welt zu finden war. Er nahm die Weisheit der Alten begierig in sich auf wie eine Speise, machte sie zu seinem eigenen Fleisch und Blut. Und je mehr er aß, desto hungriger wurde er.
Zu seinem fünften Geburtstag erhielt der Junge von seiner Großmutter ein besonderes Geschenk. Mitten in der guten Stube, die nur zu besonderen Anlässen wie Weihnachten, Ostern, an Geburtstagen oder zu Familienfeiern betreten wurde, stand eine große Kiste, die so hoch war, dass der Junge sich auf einen Stuhl stellen musste, um den Deckel öffnen zu können. Die Kiste war ganz mit Spreu gefüllt. Es ragte daraus nur der hölzerne Kopf eines Adlers hervor. Es schien fast so, als wolle der Adler aus seinem Ei herausschlüpfen, als hätte sein mächtiger Schnabel den oberen Teil der Schale gesprengt und seinen Kopf befreit. Schnell entfernte der Junge auch den Rest. Was machte es aus, dass die Spreu in der guten Stube herumwirbelte? Da hockte der Adler, aus einem mächtigen Eichenstamm geschnitzt, auf einem Baumstumpf, reckte den Kopf in die Höhe und schaute in die Ferne. Niemanden nahm es Wunder, dass der Junge mit dem Adler sprach, als sei er ein lebendiges verständiges Wesen. Nur viele Jahre später schalt man ihn einen Narren, als er als Erwachsener noch immer mit der hölzernen Figur seines Adlers Zwiesprache hielt.
Tagsüber streifte die Großmutter stundenlang mit dem heranwachsenden Jungen durch das Moor. Sie ließ ihn die wunderbaren Geheimnisse der Natur erleben, erklärte ihm die Heilkraft von Kräutern und Pflanzen und half ihm, den unerschöpflichen Reichtum der Natur zu entdecken und mit natürlicher Einfachheit in sich aufzunehmen.
Abends am Kamin erzählte er dann seinem Vater von seinen Erlebnissen und wurde nicht müde, zu fragen und das Wissen seines Vaters in sich aufzunehmen. Als er von seinem Vater ein Pony geschenkt bekam, war Henrik nicht mehr im Haus zu halten. Von den frühen Morgenstunden bis zum späten Abend durchstreifte er frei wie ein Adler Wälder, Wiesen und immer wieder das weite Moor. Nichts und niemand konnte ihm von dieser Freiheit etwas nehmen. Auch wenn er einmal auf dem Feld oder im Viehstall half, empfand er eine grenzenlose Freiheit. Er tat diese sicherlich nicht leichten Arbeiten gern, fast spielerisch, und entdeckte jeden Tag eine neue Aufgabe, die ihn herausforderte.
Einige Wochen vor seinem sechsten Geburtstag begann seine Schulzeit. Von Anfang an, als er mit seinem Pony am ersten Schultag zur Dorfschule ritt, war er ein Einzelgänger. Er empfand die Schule als starken Einschnitt in sein freies Leben und wusste nichts mit den Häkchen und Kästchen anzufangen, die die Lehrerin den Erstklässlern an die Tafel kritzelte. Dies alles ertrug er mit fast stoischer Gelassenheit, klagte und murrte nie. Doch kaum wandte sich die Lehrerin der zweiten Klasse zu, die im selben Raum unterrichtet wurde, schon stahl er sich aus dem Klassenzimmer und lief mit seinem Pony davon. Stundenlang schaute er beim Dorfschmied zu, half den Bauern auf den Feldern und sog jedes Wort, das er hörte, begierig in sich hinein. Zur Mittagszeit war er dann pünktlich wieder zu Hause, ganz so, als hätte er den Vormittag brav in der Schule verbracht.
Dies ging Wochen und Monate so, denn die Lehrerin hatte es sich in den Kopf gesetzt, ohne die Autorität des Vaters aus diesem Lümmel noch ein nützliches Mitglied der Gesellschaft zu machen. Und jeden Morgen ließ sie den Jungen mit dem Rohrstock schmerzhaft spüren, was sie von seinem boshaften Verlassen der Schule hielt. Viel schlimmer als die Schmerzen der heftigen Hiebe war für Henrik die tiefe Demütigung, wenn er sich vor den höhnisch lachenden Mitschülern herunterbücken musste, um seine gerechte Strafe zu empfangen. Kaum war diese Strafprozedur beendet, nutzte der Junge die nächste kleine Unaufmerksamkeit der Lehrerin, um ihr erneut zu entwischen. Er konnte nicht verstehen, warum er, in der engen Schulbank eingezwängt, tote Buchstaben und nackte Zahlen lernen sollte, wo er doch dort draußen die Wirklichkeit viel schneller und nachhaltiger in sich aufnehmen konnte. Doch so sicher wie das Amen in der Kirche, so folgte am nächsten Morgen in der Schule die Strafe.
„Junge Pferde muss man einbrechen und den eigenen Kopf austreiben“, schrie die Lehrerin und schlug mit jedem Wort auf das Hinterteil und die bloßen Oberschenkel des Jungen ein, bis dicke, blutige Striemen als Zeugnis der pädagogischen Züchtigung übrigblieben. Abends entdeckte die Großmutter diese Striemen, stellte aber keine Fragen und verlor auch kein Wort darüber zum Vater. Jeden Tag bestrich sie nur erneut die blutigen Ergebnisse erzieherischer Kunst mit einer Salbe, die sie selbst aus Ziegenbutter, Gänseschmalz und Kräutern herstellte. Und jedes Mal erzählte sie dem Jungen dann von der Freiheit des Adlers und von der Weisheit der Narren und von der so weit verbreiteten Dummheit, die den größten Teil der Menschheit ausfüllt.
Anscheinend waren die Menschen im Dorf ähnlicher Meinung. Jedenfalls hielt niemand Henrik seine Schulversäumnisse vor, und es sprach auch niemand seinen Vater darauf an. Nur ein alter Bauer meinte einmal: „Der Junge wird später ein guter Landwirt. Er sieht aufmerksam zu und lernt beim Zuschauen.“
Der Altgeselle in der Schmiede war dem Jungen besonders zugetan. Als Henrik wieder einmal die Schule schwänzte und mit dem schweren Hammer auf dem Amboss versuchte, für sein Pony Hufeisen zu schmieden, legte ihm der Altgeselle seine schwieligen Hände auf die Schulter, drehte ihn zu sich herum, schaute ihm fest in die Augen: „Du kannst nicht jeden Tag die Schule schwänzen. Du musst doch etwas lernen. Was soll denn später einmal aus dir werden? Du musst schon hingehen. Auch diese Zeit geht vorbei, und du brauchst die Sache ja nicht gar zu ernst nehmen.“ Und mit einem Schalk in den Augen fügte er hinzu: „Besser fünf Stunden Schule als gar kein Schlaf.“
Die ganze Sache hatte erst ein Ende, als die Lehrerin zum Ende des ersten Schuljahres ihre Erziehungsversuche entnervt aufgab und eines Nachmittags auf dem Gut auftauchte, dem Vater das bösartige Verhalten seines Sohnes grob vorwarf und reihenweise Vorschläge aufzählte, wie man einen solchen Taugenichts zur Räson bringen könne.
Der Vater ließ sich nicht anmerken, dass er von all dem nichts gewusst hatte. Mit ruhiger Gelassenheit hörte er der Lehrerin zu, ohne Fragen zu stellen oder auch nur mit einem Wort auf ihre Vorschläge einzugehen. So viel scheinbare Gleichgültigkeit war für die diplomierte Pädagogin zu viel, und so platzte sie schließlich erbost heraus: „Guter Mann, nun müssen Sie auch mal etwas sagen. Es ist ihr Sohn. Was sollen wir nun mit ihm machen?“
Ruhig und bedächtig antwortete der Vater: „Sie haben recht, es ist mein Sohn. Ich kenne ihn genau. Und ich vertraue ihm. Henrik hat immer bewiesen, dass er aus seinem Verhalten auch selbst die Konsequenzen zieht. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch.“
Damit war das Gespräch für den Vater beendet. Die entsetzte Erziehungskünstlerin schnappte nach Luft wie ein fetter Karpfen, den man an Land gezogen hatte. So viel Unverschämtheit war ihr noch nie untergekommen. Was sollte bloß aus Deutschlands Jugend werden, wenn die Eltern zu so vielen ernsten Vorwürfen nur zu sagen wissen: ‚Ich vertraue meinem Kind.‘ Ihr mächtiger Busen bebte vor Entrüstung, hob und senkte sich wie ein Dampfhammer und schien das enge Mieder sprengen zu wollen. Obwohl oder vielleicht gerade weil sie viele Semester studiert hatte, war sie in diesem Fall mit ihrem Latein am Ende, machte wütend auf dem Absatz kehrt und verließ mit einer donnernd zugeschlagenen Tür das Haus.
Der Vater verlor über diese Angelegenheit zunächst kein Wort, als wäre nichts vorgefallen. Nach dem Abendessen ergriff er die Hand seines Sohnes und sagte: „Komm, Henrik, wir wollen ein wenig spazieren gehen.“
Als sie über die Viehdiele das Haus verließen, wies der Vater auf die wiederkäuenden Kühe und meinte fast beiläufig: „Schau, Henrik, wir haben dieses Vieh bekommen. Wir nutzen ihre Arbeitskraft, ihre Milch und ihr Fleisch. Aber wir haben auch eine Verantwortung gegenüber den Tieren. Wir müssen sie füttern und pflegen. Wenn wir dies nicht tun, unserer Verantwortung gegenüber den Tieren nicht nachkommen, dann werden wir von ihnen auch nichts erhalten können.“