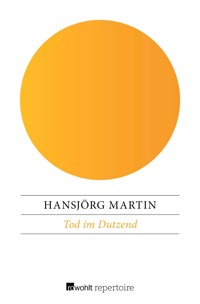9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ludwig Hase muß sterben. Dr. Dieter Skowronnek hat es dem Freund nicht gesagt, aber Walter Bruns und Leo Klipp wissen, daß sie am Skatabend in Zukunft nur zu dritt sein werden. Und Ludwig ahnt es wohl auch. Mitten in die krampfartige Fröhlichkeit des (wie sich später herausstellt) letzten Treffens zu viert hinein teilt er mit, er wolle sein Testament machen – nur so, auf alle Fälle, ja? – und die anderen drei als Erben einsetzen; seine Bibliothek, seine Erstausgaben, die Autographensammlung sollen nicht auf einer Auktion in alle Winde zerstreut werden ... Aus der Peinlichkeit des Augenblicks heraus entsteht spontan eine Idee: Auch jeder der anderen – sie sind gleichfalls anhanglos – soll ein Testament zugunsten der übrigen drei machen. Es ist eher eine ziemlich makabere Schnapsidee, finden sie am anderen Morgen. Aber keiner will das eingestehen, und so treffen sie sich beim Notar. Dann geht Ludwig ins Krankenhaus. Sie operieren ihn gar nicht mehr. Nach ein paar Tagen ist er tot. Nun gibt es zwar den tiefsinnigen Spruch vom Leben, das weitergeht, aber für manche Leute trifft das sozusagen nur bedingt zu. Leo Klipp, Oberkommissar bei der Mordkommission, steht schon wieder vor einer Leiche: ein Einbrecher hat Edith Domaschke erschlagen und ist, trotz der Gegenwehr des Ehemannes, verletzt entkommen. Die Tatumstände erweisen sich als recht befremdlich, und ein Laborbefund stellt Leo Klipp vor ein kriminologisches Rätsel. Viel Zeit zum Skatspielen bleibt da nicht. Aber dann muß Klipp sich dienstlich mit seiner Skatrunde befassen. Im weiteren auch mit Ilselotte Senftleben, und spätestens da zeigt sich, daß für Polizisten Dienstliches sehr private Folgen haben kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Hansjörg Martin
Spiel ohne drei
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Ludwig Hase muß sterben.
Dr. Dieter Skowronnek hat es dem Freund nicht gesagt, aber Walter Bruns und Leo Klipp wissen, daß sie am Skatabend in Zukunft nur zu dritt sein werden. Und Ludwig ahnt es wohl auch. Mitten in die krampfartige Fröhlichkeit des (wie sich später herausstellt) letzten Treffens zu viert hinein teilt er mit, er wolle sein Testament machen – nur so, auf alle Fälle, ja? – und die anderen drei als Erben einsetzen; seine Bibliothek, seine Erstausgaben, die Autographensammlung sollen nicht auf einer Auktion in alle Winde zerstreut werden ... Aus der Peinlichkeit des Augenblicks heraus entsteht spontan eine Idee: Auch jeder der anderen – sie sind gleichfalls anhanglos – soll ein Testament zugunsten der übrigen drei machen.
Es ist eher eine ziemlich makabere Schnapsidee, finden sie am anderen Morgen. Aber keiner will das eingestehen, und so treffen sie sich beim Notar. Dann geht Ludwig ins Krankenhaus. Sie operieren ihn gar nicht mehr. Nach ein paar Tagen ist er tot.
Nun gibt es zwar den tiefsinnigen Spruch vom Leben, das weitergeht, aber für manche Leute trifft das sozusagen nur bedingt zu. Leo Klipp, Oberkommissar bei der Mordkommission, steht schon wieder vor einer Leiche: ein Einbrecher hat Edith Domaschke erschlagen und ist, trotz der Gegenwehr des Ehemannes, verletzt entkommen. Die Tatumstände erweisen sich als recht befremdlich, und ein Laborbefund stellt Leo Klipp vor ein kriminologisches Rätsel.
Über Hansjörg Martin
Hansjörg Martin (1920–1999) war ursprünglich Maler und Graphiker. Nach dem Krieg arbeitete er als Clown, war Bühnenbildner und Dramaturg, dann freier Schriftsteller. Er schrieb Kriminalromane und Kinder- und Jugendbücher.
Inhaltsübersicht
Die Hauptpersonen
Ludwig Hase
stirbt, obgleich dies ein Kriminalroman ist, eines natürlichen Todes.
Dr. Dieter Skowronnek, Walter Bruns
können sich nicht vorstellen, wer ihnen nach dem Leben trachten sollte. Aber jemand tut’s.
Hannes Bragau
kocht schlechten Kaffee und kiebitzt beim Skat.
Arthur Domaschke
sorgt für ein kriminologisches Wunder.
Edith Domaschke
hat keine Chance.
Ilselotte Senftleben
überlegt sich’s noch rechtzeitig.
Dr. Hermann Joste
nimmt manchmal kein Honorar, aber im übrigen, was er kriegen kann.
Grabowski
ist nicht identisch mit dem gleichnamigen Fußballspieler und heißt auch in Wirklichkeit anders.
Bettina
wäscht sich im entscheidenden Moment die Haare.
Oberkommissar Leo Klipp
bewegt sich in verschiedener Hinsicht leicht außerhalb der Legalität – mit Erfolg.
1
Ludwig mischte die Karten. Wir sahen ihm schweigend zu. Es war still in der Gaststube. Nur der Wasserhahn am Spülbecken der Theke tropfte und das Liebespaar, das händchenhaltend neben dem Glasschrank mit den Tischfahnen saß, flüsterte.
Ludwig mischte wie immer sehr sorgfältig, legte zwei etwa gleichgroße Kartenhaufen schräg gegeneinander und ließ die Karten dann elegant mit einer flinken Zauberkünstlerbewegung übereck ineinanderlaufen – wie Zahnräder. Dann schob er den Stapel zusammen, stieß ihn an der Tischkante auf, teilte ihn von neuem und legte die beiden Teile abermals schräg gegeneinander, um sie zum dritten Male ineinander zu fächern.
Seine schmalen Hände mit den feingliedrigen Fingern, den Leberflecken auf dem linken Handrücken und den sich dunkelgrau abzeichnenden Venen unter der Haut, die rauh und pergamenten wirkte – seine schmalen Hände zitterten leicht.
«In Brietz an der Knatter hat sich schon mal einer totgemischt!» sagte Dieter Skowronnek, erschrak, zuckte mit den Mundwinkeln und warf Walter Bruns und mir einen verstörten, hilfesuchenden Blick zu.
Wir wußten alle drei, daß Ludwig bald sterben mußte.
Er selbst wußte es nicht. Vielleicht war es heute schon das letzte Mal, daß er mit uns Skat spielte. Er gab jetzt und zündete sich, als die Karten verteilt waren, eine seiner schwarzen, nach geraspelten Pferdehufen riechenden Zigaretten an.
«Drei Grand Hand», sagte er, inhalierte tief und lehnte sich zurück.
Ich hatte den Pik-Buben, Kreuz-König, Dame, Sieben, die Pik-Zehn blank und den Herz-König mutterseelenallein – aber von Karo As, Zehn, Neun und Acht. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Nicht mal ein richtiges Kontrablatt wegen der blöden blanken Zehn. Auf Verdacht mitzureizen wagte ich nicht, denn ich saß schon mit hundertzwölf im Keller.
Dieter mußte mich reizen, aber das überblickte er nicht. Er überblickte nie, wer wen reizen mußte, obschon wir seit fast fünf Jahren alle vierzehn Tage miteinander spielten. Wenn wir – wie meist und auch heute – zu viert spielten, kam er schon gar nicht mehr zurecht mit der Reihenfolge.
«Nun sag schon bitte ein klitzekleines Wörtchen, Dieter! Wir wollen Weihnachten pünktlich essen», forderte Walter ihn auf und blinzelte mir zu.
«Wer?» Dieter sah von seinem Blatt auf. «Ich?»
«Ei freilich! Wer denn sonst? Der Klapperstorch?» sagte Walter.
Ludwig lachte, verschluckte sich, hustete, bekam einen roten Kopf und preßte sich die flache Hand gegen den Brustkasten.
Hannes, der Wirt, kam von hinten, blieb neben Walter stehen und guckte ihm über die Schulter in die Karten.
«Ein Großmutterspiel», sagte er. «Das gewinnen blinde Großmütter im Schlaf hinterm Ofen!»
«Erzähl uns doch gleich, was er hat!» sagte ich ärgerlich.
Er zog die Schultern hoch und die Mundwinkel nach unten, schloß gekränkt die Augen, schnaufte und watschelte mit dem typischen Gang altgewordener Kellner hinter seine Theke.
«Jetzt spuckt er dir ins Bier!» wisperte Walter.
«Na ja», knurrte ich, «diese dummerhaftigen Kiebitzsprüche …»
«Achtzehn!» sagte Dieter zu mir.
«Achtzehn», wiederholte ich, obwohl das leichtsinnig war mit meiner Karte. Wenn sie mich hängenließen und ich fand im Skat nichts dazu, konnte das ganz leicht in die Hose gehen.
«Zwanzig!» sagte Dieter.
Ich paßte erleichtert.
Walter blickte nachdenklich in sein Blatt, legte den Kopf mit der fast weißen Künstlermähne schief, sah Dieter schräg von unten an, als taxiere er seine Kraft, zog eine richtige kleine Pokerschau ab und sagte schließlich: «Und die Zwo …?»
«Das ist dein Spiel!» gab Dieter zurück, und ich konnte sehen, wie er rechnete, ob und auf welches Spiel vielleicht ein Kontra drin wäre. Er gab leidenschaftlich gern Kontra, obschon es oft nicht angebracht war und meist daran scheiterte, daß er sein Blatt überschätzte. Jetzt verzichtete er darauf, sagte nur: «Ich warne Neugierige!», um Walter zu verunsichern, trank sein Bier aus und klopfte mit dem hübschen, ein bißchen feminin wirkenden Siegelring ans Glas, wobei er hinüber zur Theke blickte.
Hannes, der Wirt, sah auf. Dieter hob das leere Glas. Hannes nickte und griff zum Zapfhahn. Ich wartete, bis Walter zwei Karten gedrückt hatte.
«Wie heißt das Kind?» fragte ich. «Scheint ’ne Zangengeburt zu werden, wie?»
«Piken haben die Kosaken», sagte Walter. «Komm raus, Leo – Karte oder ’n Stück Holz!»
Ich spielte den Herz-König. Dieter tat die Herz-Sieben dazu, Walter übernahm mit dem Herz-As und zog den Alten. Ich opferte meine blanke Zehn, und Dieter warf die Pik-Dame.
«Na also», sagte Walter; «das läuft ja wie Mariechens Näschen!»
«Du kommst schon noch in unser Dorf nach Buttermilch!» drohte ich.
Ludwig hatte sich zurückgelehnt, sah von einem zum andern und lächelte über unsere Sprüche. Er hielt die schwarze Zigarette im Mundwinkel und hatte den Kopf geneigt. Der Rauch kräuselte sich an seinem linken Backenknochen entlang und hing, ehe er sich auflöste, in den silbrigen Haarbüscheln neben der Schläfe. Unter seinen dunklen Augen mit den seltsam gelben Skleren lagen tiefe Schatten.
«Zwei bis drei Monate hat er bestenfalls noch, wenn alles gut geht und das Herz nicht vorher schlapp macht», hatte Dieter uns vor vierzehn Tagen gesagt, als wir uns das letzte Mal zum Skat getroffen hatten. Ludwig war nicht gekommen, weil er zur Buchmesse nach Frankfurt hatte fahren müssen. Dieter war sehr bedrückt gewesen, hatte noch schlechter gespielt als sonst und den ganzen Abend keine seiner üblichen Redensarten losgelassen. Er hatte sogar – und das erstaunte Walter und mich am meisten – ohne jeden Widerspruch eine Runde bestellt und bezahlt, als er nach einem verlorenen Null mit obligatorischem Kontra auf die Schnapszahl 222 gekommen war. 222 Schlechte. Sonst wehrte er sich immer mit Händen und Füßen, wenn es darum ging, Runden zu bezahlen, denn er war geizig wie zwei Unfallversicherungen, obschon seine Praxis blendend ging.
Schließlich, kurz nach elf Uhr abends, als er wieder mal schauderhaft gepatzt und falsch bedient hatte, war mir seine Unkonzentriertheit und Niedergeschlagenheit so auf die Nerven gegangen, daß ich geplatzt war:
«Was, zum Teufel, ist mit dir los, Mensch? Du hockst rum mit einem Gesicht wie saure Sülze bei Regenwetter, spielst wie ein Beknackter und vermiest uns den ganzen Abend! Hast du aus Versehen einen reichen Patienten zu schnell gesundgemacht, der nach langer Behandlung aussah? Oder ist dir ein Krankenschein ins Klo gefallen?»
Walter haute in meine Kerbe: «Oder bist du sauer, weil die Bosse deiner Partei eine so unsäglich dämliche Politik verzapfen?»
«Das halte ich für unwahrscheinlich», hatte ich gesagt. «Dieter merkt das ja nicht. Bauchkneifen und Grippe gibt’s immer, und er liest – wenn überhaupt – doch bloß die Börsenkurse.»
Walter hatte gelacht.
Dieter hatte nicht mitgelacht. Er hatte seine eben aufgenommenen Karten offen auf den Tisch geschmissen, den Kopf in die Hände gestützt und gestöhnt: «Ach – Scheiße!»
Das hatte so resigniert geklungen, daß wir nicht weitergeflachst hatten.
«Ich habe vorige Woche Ludwig untersucht», hatte Dieter nach endlosen zwanzig Sekunden zu berichten begonnen, «er war bei mir in der Sprechstunde, weil er sich nicht wohl fühlte – dauernd müde, keinen Appetit, Rückenschmerzen … Na ja. Ich sollte ihn mal durch meine Mühle drehen, hat er gesagt, und mir das Versprechen abgenommen, ihm ja die Wahrheit zu sagen, wenn’s was Ernstes wäre. Ich hab ihn untersucht. Senkung, Blutbild – na, was man eben so macht … Beim Abhören bin ich schon erschrocken. Dann hab ich ihn vor den Röntgenschirm gestellt. Es ist was Ernstes. Was Todernstes. Er hat ein Lungenkarzinom links … Die ganze linke Seite ist hin. Irreparabel. Ich geb ihm nicht die geringste Chance. Zwei bis drei Monate noch, wie gesagt – wenn das Herz nicht vorher schlapp macht …»
Wir hatten gesessen wie vom Donner gerührt.
«Entschuldige, daß ich dich angemacht habe», sagte ich, nachdem ich mir den Entsetzensfrosch aus der Kehle geräuspert hatte.
«Schon vergessen», sagte Dieter.
«Und … Und hast du es ihm gesagt?» hatte Walter gefragt.
«Nein. Ich konnte nicht», hatte Dieter erwidert.
Ich hatte Hannes, dem Wirt, gewinkt. Der war an unseren Tisch geschlurft gekommen und hatte angesichts unserer düsteren Mienen den dummen Witz verschluckt, den er offenbar hatte machen wollen.
«Stell uns eine Flasche Aquavit her!» hatte ich gesagt.
«Ist … Ist was passiert?» hatte er gefragt.
«Nein!» hatte Walter geknurrt.
Wir waren zusammengeblieben bis lange, lange nach Mitternacht und hatten uns ganz fürchterlich betrunken, weil wir alle drei Angst gehabt hatten, mit unserem Entsetzen allein zu sein. Diese Besäufnis war so ungefähr die scheußlichste gewesen, in die ich jemals geraten war – mal abgesehen von einer wahnsinnigen Marketender-Sekt-Sauferei aus Kochgeschirrdeckeln im Schützengraben vor Woronesch, bei 40 Grad Außentemperatur. Damals war ich so sternhagelvoll gewesen, daß ich sogar den Hunger völlig vergessen hatte. Das kam daher, weil wir für fünfzig Mann Sekt gekriegt hatten und nur noch achtzehn waren. Die anderen hatten bei den Nachtangriffen vorher ins Gras gebissen … Nein, Gras gab es dort gar nicht mehr.
Bis zur Hälfte der ersten Flasche Aquavit hatten wir stumm gesessen. Die Karten hatten auf dem Tisch gelegen. Der Karo-König hatte mich angegrinst, bis ich ihn umdrehte. Dann hatten Walter und ich ein paar Fragen gestellt:
«Und … und eine … eine Orepa … Operation?» hatte Walter – schon mit schwerer Zunge – gefragt.
Dieter hatte den Kopf geschüttelt. «Dazu ist es zu spät.»
«Oder so ’ne Bestrahlungen, Kobalt oder wie …?» hatte ich gefragt.
Dieter hatte nur stumm den Kopf geschüttelt.
«Geht auch nicht mehr?» wollte ich wissen.
«Wär bloß eine Quälerei.»
Walter war, als sein Promillepegel einen bestimmten Stand erreicht hatte, aggressiv geworden. Er wurde, das kannte ich schon, immer zwischen dem fünften und siebten Schnaps aggressiv, und es war dann wichtig, daß man ihn animierte, weiter zu trinken, weil er nach dem elften, zwölften ins heulende Elend kippte. Das war zwar auch nicht so komisch, aber weniger gefährlich.
In seiner aggressiven Phase also hatte er an diesem Skatabend die hellen Augen zusammengekniffen und Dieter angemotzt:
«Scheißkerle seid ihr Doktors alle miteinander … Und eure ganze meni … mezi … medizinische Wissenschaft ist ein Dreck! Bißchen Pulsfühlen und Rezepte schreiben und kluge Gesichter schneiden und Reden schwingen, ernst und überlegen und allwissend – zu mehr langt’s doch nicht, verdammt noch mal! Vielleicht, daß einer noch mit dem Messer umgehen kann und Bäuche aufschneiden oder Damen ausnehmen – aber das ist auch schon das Äußerste! Sonst wißt ihr einen Scheiß! Bloß kassieren … Kassieren könnt ihr alle aus dem Effeff!»
Er hatte sich in eine richtige rotblinde Wut gesteigert. Die restlichen vier, fünf Gäste hatten schon die Köpfe hoch und guckten mit geilen Augen rüber zu uns, weil sie gleich eine Prügelei erwarteten, und Hannes, der Wirt, schob bereits seinen Bauch aus dem Raum hinter der Theke.
Ich war dazwischengegangen:
«Hör auf, Walter!» hatte ich leise und eindringlich gesagt und ihm beruhigend die Hand über seine geballte Faust gelegt. «Komm, hör auf, den Dieter anzumachen, Walter – brems dich!»
«Laß ihn», hatte Dieter gesagt, sich einen neuen Aquavit eingegossen und eine besänftigende Handbewegung gemacht, so wie man sie bei ungezogenen Kindern macht, und damit Walter vollends in Rage gebracht.
«Da – da hast du’s!» hatte er gerufen. «Guck dir diese beschissene Herablassung an! ‹Ihr versteht ja nichts!› heißt das. ‹Wir Ärzte haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Quatscht ihr ruhig. Ihr seid wie die Dorfköter, die den Mond anbellen, wenn ihr an unserer Göttergleichheit zweifelt›, heißt das … Hör doch auf, Dieter – hör doch bloß auf! Du sitzt seit bald sechs Jahren mit uns alle zwei Wochen stundenlang beim Skat und hast nicht gesehen und gemerkt, daß Ludwig, das arme Schwein, krepiert … Da kann ich doch bloß noch lachen! Arzt willst du sein? Arzt? Ein Schuster bist du, ein ganz erbärmlicher Ignorant wie alle deine Scheißkollegen – ja! ‹Zu spät …› Und das wagst du auch noch zu sagen? Mann, vor einem halben Jahr haben wir die irre komische Herrenpartie in die Heide gemacht und zu viert unsere Skatkasse verfressen. Wißt ihr noch? Weißt du noch? – Und da war der Ludwig schon so klapprig und fix hinter der Puste, als wir mit dem runtergefallenen alten Vogelnest Fußball gespielt haben auf der Lichtung … Erinnert ihr euch? Ganz grün war er und kriegte keine Luft – ach, das habt ihr doch gesehen! Blöde Witze haben wir gerissen. Ob er letzte Nacht anderthalbe Nummern gebumst hätte, haben wir ihn gefragt … Ich auch, ja! Aber ich bin ja kein göttergleicher Arzt und Medizinmann, sondern nur ein kleiner, simpler Maler und Papiervollkritzler! Aber du, du hättest ihn da gleich zu ’ner Untersuchung überreden müssen, Dieter – dann wär er vielleicht noch zu retten gewesen. Bloß, du hast nichts gemerkt und dir überhaupt keine Gedanken gemacht und nichts gesehen und nichts unternommen. Der Kellnerin in der Dorfkneipe hast du den Arsch getätschelt und zu uns gesagt, sie hätt’s mit der Schilddrüse, das könnte man an ihrem Hals sehen und an ihren Augen, was weiß ich … Ach, Mann, das ist alles so zum Kotzen!»
Er hatte wieder klar artikuliert. Jetzt hielt er inne, goß sich den Aquavit in den Mund – es war der zehnte – und gleich noch einen, den ich ihm einschenkte. Und dann hatte er planmäßig angefangen zu schluchzen.
«Warum wehrst du dich nicht?» hatte ich Dieter gefragt, der gegen seine Gewohnheit eine Zigarette von mir geraucht und sich mit unbewegtem Gesicht Walters wütende Attacke angehört hatte. «Warum, zum Kuckuck, läßt du ihn so reden und gibst ihm keine drauf?»
«Weil er recht hat», hatte Dieter leise gesagt und bei Hannes drei Bier und eine neue Flasche Aquavit bestellt, die wir auch noch austranken, bis uns der Wirt rausgesetzt und in ein herbeigerufenes Taxi verfrachtet hatte.
Im Auto hatte Dieter mir und Walter vor dem Aussteigen Tabletten gegeben: «Schluckt die vor dem Einschlafen mit viel Wasser!» hatte er gesagt, «damit ihr morgen früh nicht allzu verkatert seid.»
Und Walter hatte daraufhin – in einem neuen, aber nun weinerlichen Anflug von Angriffslust noch gehöhnt: «Tabletten gegen den Kater – großartig, Herr Doktor! Aber nichts für Lungen-CA, was?»
Das war, wie gesagt, vor vierzehn Tagen gewesen. Und heute saßen wir wieder beisammen an unserm Ecktisch in Hannes Bragaus gemütlicher Kneipe ‹Zum Anker› und spielten.
Ludwig war wieder dabei. Er war wahrscheinlich das letzte Mal dabei, denn Dieter hatte ihm nach einer zweiten Untersuchung klargemacht, daß er ins Krankenhaus müsse, weil da «so was wie ein Herd» in der Lunge sei, der «nach Tuberkulose» aussehe … Ohne eine richtige stationäre Behandlung könne das nicht kuriert werden. Ludwig würde also am kommenden Donnerstag ein Bett in einem Zweierzimmer in der Inneren Abteilung des Krankenhauses St. Georg kriegen – und es schien fast so, als freue er sich darauf.
Walter spielte jetzt die Trumpf-Sieben, ich butterte mein Karo-As, und Dieter holte den Stich mit dem Karo-Buben. Das war der sechste Stich. Das Spiel lief reibungslos. Wir hatten keine Möglichkeit zu gewinnen, kamen aber schließlich mit 36 Augen aus dem Schneider.
Ich mußte das nächste Spiel geben, mischte und verteilte die Karten. Während Walter, Ludwig und Dieter ihr Blatt aufnahmen und mit verschiedenen Randbemerkungen und Mienen kommentierten, fragte ich:
«Was machst du denn mit deinem Laden, Ludwig, wenn du jetzt in die Klinik gehst?»
«Den kann ich getrost für die drei, vier Wochen meiner Gehilfin überlassen», erwiderte er. «Das Weihnachtsgeschäft für Bücher setzt kaum vor Mitte November richtig ein – und dann bin ich ja wohl wieder da, sagt der Onkel Doktor.»
«Achtzehn!» sagte Walter zu Dieter. Er sagte es sehr laut. Zu laut für ein normales Reizen. Ich warf Ludwig einen schnellen Blick zu, ob ihm das wohl auch auffiel, aber der war in sein Blatt vertieft.
«Dieter!» rief ich. «Du bist gefragt!»
«Achtzehn? Ja, achtzehn hab ich!» sagte er schnell.
«Grand Hand!» verkündete Walter. «Hat einer mehr?»
«Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf», sagte Ludwig. «Ich würde schenken!»
«Aber mitnichten!» widersprach Dieter. «Das will ich sehen!» und knallte den Kreuz-Buben auf den Tisch.
Walter legte den Karo-Jungen dazu, und Ludwig schmierte das Pik-As. «Hoheeho!» rief er. «Wenn es so aussieht!»
Es wurde ein so aufregendes Spiel, daß wir alle drei für zehn Minuten den Wurm vergaßen, der an unserer Stimmung bis dahin genagt hatte. Als sich nach dem letzten Stich herausstellte, daß zwei Luschen im Skat lagen und Walter nur 60 Augen hatte, gab es das in solchen Fällen übliche Hallo. Der Spieler braucht 61 – mit 60 hat er verloren.
«Auf dem Abtritt in die Hose», grinste ich.
«Gespaltener Arsch ist aller Laster Anfang», sagte Ludwig. Er zählte zur Kontrolle noch mal nach, aber es blieb beim verlorenen Grand Hand.
«Jetzt hättest du Kontra geben müssen!» sagte ich zu Dieter. «Wenn der Hund nicht geschissen hätte, hätt er den Hasen gefangen», sagte Walter. «Danke – es wird auch so teuer genug!»
Ludwig schrieb an, verkündete, daß wir nun noch insgesamt sieben Bockspiele vor uns hätten und sagte, daß wir uns mal um Leo – also um mich – kümmern müßten. Ich sei mit Abstand an der Spitze. So dürfe das wohl nicht weitergehen heute abend.
Als Dieter die Karten zum nächsten Spiel einsammelte, sagte er: «Was halten die Herren von einer Pause zwecks Nahrungsaufnahme?» Er war immer der erste, der ans Essen dachte.
«Ist gebongt», sagte ich.
Die beiden anderen nickten. Dieter rief den Wirt:
«Die Speisekarte, Hannes!»
Wir wählten, bestellten und spielten, bis das Bestellte kam, noch zwei Spiele, von denen Ludwig eines verlor und ich eines sehr knapp gewann – und sicher nicht gewonnen hätte, wenn Dieter statt einer Dame eine Lusche geworfen hätte.
Beim Essen – Dieter und Walter hatten sich Schweinskopfsülze mit Bratkartoffeln und ich mir Schinkenbrot ausgesucht, während Ludwig lustlos in seiner Portion Kartoffelsalat mit Bockwurst herumstocherte – beim Essen also erzählte Walter von einem Mädchen, das er im Bus kennengelernt hatte.
«‹Mädchen› ist vielleicht ein bißchen geprahlt», sagte er; «sie ist sicher schon gut in den Dreißigern – aber sehr süß, sag ich euch!»
«Für Männer in den Fünfzigern sind Frauen in den Dreißigern immer Mädchen», sagte ich.
«Und süß sowieso – wenn sie nicht ‹Opa› zu einem sagen», ergänzte Dieter.
«Hast du sie schon eingeladen, dein Aquarium zu besichtigen?» fragte Ludwig grinsend. Er hatte aufgehört zu essen und zündete sich eine Zigarette an.
«Ißt du das nicht auf?» fragte Dieter und deutete mit der Gabel auf Ludwigs Teller.
«Nein», sagte Ludwig und schob ihm den Teller zu.
«Paß auf, dein Bauch!» warnte ich.
Dieter lachte und machte sich über die halbe Wurst mit Kartoffelsalat her.
«Na, Walter?» bohrte Ludwig. «Wie ist das – hat sie deinen Schleierschwanz schon bewundert?»
«Imponiert er ihr?» fügte Dieter kauend hinzu.
«Oder hält sie mehr von Vögeln?» fragte ich.
«Ihr seid alle miteinander echt doof und richtige Ferkel!» schimpfte Walter. «Das ist nicht so eine, wie ihr sie immer aufreißt!»
«Huhu!» rief Ludwig. «Nur mit dem Ring am Finger und so, wie?»
«Walter als Ehemann in spe – zauberhaft», sagte ich. «Darf ich Blumen streuen bei deiner Hochzeit? Wünscht ihr Rosen, Nelken oder Gänseblümchen?»
«Ich kann dir meinen Frack borgen», sagte Dieter und putzte sorgfältig die Reste von seinem und Ludwigs Teller. «Er ist mir ohnehin zu eng.»
«Das ist allerdings kein Wunder», sagte ich.
Dieter streckte mir die Zunge raus, auf der noch Mayonnaise klebte.
«Man kann euch nichts erzählen», sagte Walter verächtlich, «Irina ist ganz anders als alle, die ich bis jetzt …»
«Oh – Irina!» fiel ich ein.
«Schöner Name», sagte Ludwig.
«Ist sie reich und gesund?» fragte Dieter.
«In deine Sprechstunde würde ich sie sowieso nicht gehen lassen», sagte Walter.
«Ach, Plattfüße erkennt Dieter zur Not auch noch», sagte ich, merkte, daß unsere Frozzelei bereits wieder aufs Glatteis geriet, und lenkte schnell auf ein anderes Thema: «Ich schlag vor, wir widmen uns den Karten, Kamerossen!»
Wir sagten ‹Kamerossen› zueinander, weil wir Worte wie ‹Genossen› aus mancherlei Gründen nicht mehr mochten, von ‹Kameraden› ganz zu schweigen, und weil uns ‹Freunde› zu pathetisch war, obschon wir richtig befreundet waren.
«Augenblick noch», sagte Ludwig.
Hannes kam und räumte ab. Ludwig wartete, bis er weg war. Dann setzte er sich zurecht, wie sich früher die Ritter vor dem Turnier in den Sätteln ihrer Pferde zurechtgesetzt haben mögen und heute die Motorradfahrer zurechtsetzen, die vor den Haustüren ihrer Mädchen ihre Heuler knattern lassen. Man sah ihm an, daß er irgendwas Gewichtiges, vielleicht sogar Feierliches von sich geben wollte und daß er Mühe hatte, einen Anfang zu finden, weil Feierlichkeit in unseren Kreis paßte wie Händels Largo in die Halbzeit eines Fußball-Bundesligaspiels.
Während der halben Minute, die er so saß und herumdruckste, wurde mir klar, wie sehr das Wissen um seinen nahen Tod schon unser Verhältnis zu ihm verändert hatte. Wir hatten ihn nicht mehr einbezogen, als wir uns gegenseitig angefrozzelt hatten, fiel mir auf. Und jeder andere aus unserem Quartett wäre jetzt und hier sofort mit Spott bedacht worden, der so ernste Töne anzuschlagen versucht hätte.
‹Komm zu Potte, Kamerosse!› würde es geheißen haben, oder ‹Los, spuck schon aus, Mann!› oder ‹Nun laß deine Blähungen endlich aus dem Frack!› – oder irgend so was.
Ich überlegte, ob Ludwig wohl gespürt hatte, daß er auf einmal geschont wurde, daß wir mit ihm umgingen, wie wohlwollende Lehrer mit einem Schüler umgehen, von dem sie bereits wissen, wenn er es noch nicht weiß, daß er das Klassenziel nicht erreichen wird. Ich nahm mir vor, dies sofort zu ändern, und wollte ihn gerade auffordern, es nicht so blöd spannend zu machen, da fing er schon an:
«Als Dieter mir gesagt hatte, daß ich ins Krankenhaus und möglicherweise vielleicht auch operiert werden muß», sagte er mit verlegener Miene, «da habe ich mir gedacht, daß so was ja unter Umständen auch mal ins Auge gehen kann, nicht wahr? So ’ne Operation, meine ich …»
«Nun halt aber bitte die werte Luft an, Ludwig!» sagte ich barsch. «Was soll denn da passieren? Ist das so eine schwierige Sache, Dieter?»
Dieter schüttelte den Kopf. «Nein, nein – die Lungenchirurgie ist heutzutage enorm weit, und …»