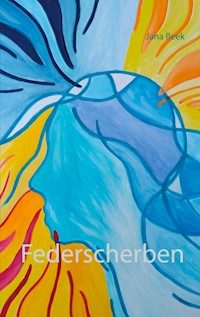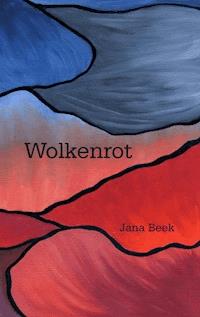Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
In der Fortsetzung von "Wolkenrot" geht es in die gemütliche Kälte Sibiriens, in der die Vergangenheit einen ziemlich schnell einholt und den Himmel in neuen Farben erleuchten lässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
-1-
Der Himmel schimmerte silbrig grau, fast schon metallisch, wölbte sich über die Stadt wie ein Geschwür und brachte die Luft zum Stehen. Ich floh durch die Straßen und sah in den Pfützen die erdrückenden Wolken über mir schwelen.
Als ich schon im Zug saß, kam der nächste Regenschauer und mit ihm das ganze Ungetüm der Troposphäre nieder. Die Tropfen fahl und träge, knisterten leise wie offene Elektrokabel und hinterließen eine sublime Spannung auf der ganzen Erdoberfläche.
Vielleicht waren es auch die Überreste des Sonnensturms, der vor gut zwei Wochen vorbeigefegt war. Ich suchte den Himmel immer noch reflexhaft nach roten Wolken ab, doch es war seitdem grau geblieben, als wäre alle Farbe ausgewaschen worden. So wie der kalte Metallboden unter mir. Stunden oder Tage saß ich darauf und wollte mit dem dumpfen Rattern einfach nur weit weggetragen werden. Weg von allem, weg von dieser Stadt. Weiter in den Norden. Oder Osten. Ich kannte die Route noch nicht einmal. Wichtiger war, dass niemand wusste, wo ich mich aufhielt und ich digital keine Spuren hinterließ. Das erste Mal im Leben hatte ich mein Laptop nicht bei mir. Elektronische Kommunikation interessierte mich so sehr wie die Känguru-Population in Australien. Ich wollte gar keine Kommunikation mehr. Hatte die letzten zwei Wochen darauf hingearbeitet. Erstmal abgewartet, bis meine Wunden halbwegs verheilt waren. In dieser Zeit versucht, so wenig Fragen wie möglich zu beantworten. Der Ansturm war riesig. Jeder wollte wissen, was passiert war. Ich konnte nichts dazu sagen. Und nur noch fliehen, hoffentlich in eine Gegend, in der meine Person irrelevant war.
Bei einem kleinen Ort, dessen Namen und Lage ich nicht kannte, stieg ich aus und fragte mich durch, wo es die nächste Industrieanlage gab. Bei jeder menschlichen Siedlung musste es irgendwas geben, was hergestellt oder angebaut wurde, um es in die Gemeinschaft zu überführen. Sonst hätten diese Menschen keinen Anspruch auf andere Leistungen. Statt Industrie gab es hier vor allem Kartoffel- und Gemüsefelder, die gerade geerntet wurden. Ohne mich zu identifizieren reihte ich mich bei den anderen Helfern ein und stand den ganzen Tag auf dem Feld. Schlief nachts unter einem alten Kastanienbaum. Aß das, was die anderen weggeworfen hatten.
Ich wusste nicht, wie viele Tage vergingen. Es wurde kälter. Anders kalt als in Mitteleuropa, wo ich bisher gelebt hatte. Schon der erste Temperatursturz war beißend und versprach mehr davon. Die Ernte war abgeschlossen. Es ging jetzt um das Verpacken, Verladen und Versenden. Die ganzen Säcke mussten zur Bahnstation getragen werden, wurden dort gelagert. Das machten eigentlich nur noch Männer. Und ich. Mein Rücken schmerzte und fühlte sich verbogen an wie ein alter Besen, aber das war immer noch besser, als nichts zu machen.
Zum Glück sprach mich niemand an. Ich sah wohl abschreckend aus. Ungewaschen. Ungekämmt. Ohne Wechselkleidung. Wie die Vogelscheuchen, die auf den Feldern standen. Ich hatte beschlossen, diesmal keinen Rucksack mitzunehmen. Alles blieb bei Karlh, mein Laptop, meine Kleidung, meine Freunde. Bei einer kurzen Pause setzte ich mich an den Bahnsteig, der Schweiß lief mir über das Gesicht. Dachte an die friedliche Stimmung, die in der Wohnung lag, als ich sie verlassen hatte. Wie ein Verbrecher auf der Flucht fühlte ich mich. In so vielerlei Hinsicht. Wie eine Verräterin, die die anderen – meine Familie, Silas und Karlh – im Stich gelassen hatte. Und statt darüber zu sprechen, was mich so belastete und mir die Eingeweide umdrehte, lief ich weg. Ließ die anderen, die sich vielleicht sorgten, im Ungewissen. Wurde zum Landstreicher, der nicht mehr wirklich Ähnlichkeit zu einem zivilisierten Menschen aufwies.
Ich wischte mir den Schweiß aus dem Gesicht und stand wieder auf. Die Arbeit war ein probates Mittel, um diese Gedanken zu bekämpfen.
Immer wieder kamen Züge, um Kartoffeln, Zwiebeln und Rüben abzutransportieren. Die Nächte wurden länger und kälter. Der Winter begann, sein Versprechen einzulösen. Der Kastanienbaum kein geeigneter Wohnraum mehr. Schließlich sprang ich auf einen der letzten Kartoffelwaggons und ließ mich mitnehmen. Keine Ahnung, wohin.
-2-
Ich konnte nichts dagegen machen, dass gerade die Zugfahrten mich so nostalgisch werden und an die holprigen Reisen von vor ein paar Monaten denken ließen. Die Erinnerungen an die Menschen, Gespräche und Ereignisse ließen sich so schlecht verdrängen. Die Erinnerungen bohrten sich in meine Arme und Beine, ließen mich unruhig auf und ab laufen und im Schlaf hin und her wälzen. Trotz der Ängste und Schmerzen war alles so abenteuerlich und herausfordernd gewesen. Davon war nichts mehr übrig. Ich fühlte mich ausgemergelt, kalt und dunkel. Es gab nur noch ein Ziel. Irgendwo auf dieser Welt eine Ecke zu finden, in der ich unbemerkt mein Dasein fristen konnte.
Als nächstes machte ich Halt in einer Recycling-Anlage für elektronische Geräte. Alles, außer Computer, wurde dort hergestellt oder repariert. Das erste Mal in meinem Leben konnte ich mein Theorie-Ingenieur-Wissen praktisch anwenden. Der Einstieg fiel mir nicht leicht. Als man mich sah, gab man mir neue Kleidung. Das schien auch so eine neue Konstante in meinem Leben zu sein, dass meine Mitmenschen sich gezwungen sahen, mich neu einzukleiden.
Ich versuchte, mich irgendwie in die Arbeitsabläufe einzureihen. Zunächst einfache Aufgaben erledigen wie Kabel aus der Plastikummantelung zu schälen. Die einzelnen Materialien voneinander trennen. Meine Fingerkuppen wurden ganz taub davon. Bei der Fehlerdiagnose wurde es schon schwieriger, da war Teamwork gefragt, ich musste versuchen von den anderen zu lernen, da ich keinen Plan hatte. Lautsprecher, Waschmaschinen, industrielle Großgeräte. Dann kamen aber auch die Fragen. Woher ich kam. Warum ich mich nicht identifizieren wollte. Wieso meine Haare verfilzt waren. Ich zog mich zurück und merkte immer mehr, dass die anderen misstrauisch waren, über mich lachten oder Angst vor mir hatten.
Am letzten Tag kam jemand auf mich zu und fragte mich, ob ich Miera Shulze wäre. In der Halle voller Plastik und Metall wurde es ganz still. Ich sagte natürlich nein und sprang in die nächste Bahn.
-3-
Das Rattern des Zugs war etwas, das so vielschichtig war. Es war Fortbewegung, Sehnsucht und Maschine in einem. Neben der Internetverbindung die einzige Möglichkeit der Horizonterweiterung. Zu Fuß kam man ja nicht weit. Als ich klein war, flößte mir das Geräusch Respekt ein. Noch nie zuvor hatte ich so etwas Lautes gehört und Gewaltiges gesehen. Gleichzeitig kamen die Züge und die Passagiere sowie das Aufgeladene aus einer anderen Welt, waren wie Shuttles zwischen verschiedenen Galaxien. Ich konnte mir niemals vorstellen, jemals dieses Transportmittel zu nutzen, zu ungewiss schien mir so eine Reise. Lieber blieb ich in meinem Heimatort, in dem ich jeden herausgebrochenen Pflasterstein und zugewucherten Zaun kannte. Jedes bewohnte und unbewohnte Haus. Jedes Huhn und jede Gans, die über den Weg trippelten und sich was zum Essen suchten. Jede Wolke, die am Himmel vorbeizog und jeden Donner, der sich über meinem Kopf zusammenbraute.
Bevor ich auch nur den winzigsten Gedanken daran verschwendet hätte, jemals das alles zu verlassen, fing die nächtliche Schlafwandelei an. Als Vorzeichen, subtiler Hinweis meines Körpers auf… irgendwas. Ich wehrte mich lange dagegen. Wollte doch einfach nur den Job meines Vaters in derselben Anlage machen. Im Haus meiner Eltern wohnen bleiben. Maximale Sicherheit. Um nicht verloren zu gehen. Wenn man in den Weiten des Weltalls da draußen verloren ginge, dann… würde man nie mehr ein Zuhause, einen Heimatplaneten oder geschweige denn einen Fixstern finden. Da war ich mir sicher.
Und doch wurde das Rattern irgendwann zu einer Melodie, einem Sirenengesang, einem Weckruf. Immer lauter und eindringlicher. Unüberhörbar und drängend. Quälend. Ich wollte nicht, aber ich musste, es ließ mich nicht mehr los. Das schmerzte. Ich hasste meinen Kopf und Körper dafür, dass er mir intuitiv zuflüsterte, dass ich wegmusste, auch wenn ich das nie vorhatte. Es wurde etwas einfacher, als ich Karlh kennen lernte. Allerdings fragte ich mich jetzt zum ersten Mal, ob ich wirklich zu ihm fahren wollte oder es für mich einfach nur eine willkommene Ausrede war, dem Fernweh nachzugeben. Eine Rechtfertigung für mich und meine Eltern zu haben. Denn jetzt vermisste ich ihn nicht, ich vermisste niemanden mehr. Jetzt war ich zu einem frei schwebenden Himmelskörper geworden, der alle Anziehungskräfte gekappt hatte. So hoffte ich zumindest.
Und wieder hatte mich mein Vehikel zu einem neuen Quadranten gebracht. Ich stieg aus und atmete tief ein. Der Regen hatte nachgelassen. Die Luft war noch feucht. Und irgendwas war anders. Ich schaute mich vom menschenleeren Bahnsteig aus um. Es war sehr flach und ich konnte kilometerweit schauen. Hier und da ein paar Windkraftanlagen, manche waren riesig und gehörten zur älteren Generation, die kleineren waren jüngeren Datums. Aber keine Industrieanlagen. Nur kleinere Häuseransammlungen. Wäldchen. Dazwischen Felder. Und dahinter noch mehr Häuser, aus denen weißer Rauch aufstieg. Ein Fluss durchschnitt die Landschaft. Es wirkte alles so statisch, wie ein Gemälde. Nur die leicht schwankenden Baumwipfel verrieten, dass das keine Kulisse war, sondern zum dreidimensionalen Raum dazu gehörte.
Ich ärgerte mich, denn hier konnte ich nicht arbeiten. Was auch, die Gegend lebte anscheinend von Landwirtschaft. Davon hatte ich genug, ich wollte endlich wieder Technik zwischen meinen Fingern spüren. Und die Windräder brauchten wenig Wartung.
Niedergeschlagen lief ich los. Auf dem Weg fasste ich den Entschluss, so lange zu laufen, bis ich bei der am weitesten entfernten Siedlung ankam. Auch wenn das den ganzen Tag dauerte. Dort war ich sicher gut versteckt vor dieser Welt.
Die Felder, an denen ich vorbei lief, waren schon abgeerntet. Die nackte Erde ragte durchgewühlt nach oben. Dann kamen die ersten Häuser. Ihre Bauweise überraschte mich. Sie waren anscheinend nicht massiv gebaut, sondern aus Holz. Manche merkwürdig windschief. Als ich bei einem Hof Kinder, Hunde und Schafe rumlaufen sah, blieb ich ungläubig stehen. Sie alle spielten zwischen einem Misthaufen, landwirtschaftlichen Geräten und Matschpfützen. Irgendwas stimmte an dem Bild nicht, es schien nicht aus dieser Zeit zu sein. Schafe? Dass Hühner und Gänse in meinem Dorf gehalten wurden, obwohl es verboten war, kannte ich. Aber das?
Ich setzte meinen Weg fort und kam noch an ein paar Höfen vorbei. Sie wurden irgendwann immer weniger und ein größerer Wald setzte ein. Birken, Lerchen, Kiefern. Ganz anders, als der mitteleuropäische Wald, durch den ich geirrt war. Irgendwie höher, stiller, karger. Angst hatte ich keine. Ich folgte immer dem kleinen Pfad hindurch. Manchmal sah ich hier und da gehacktes und aufgeschichtetes Holz. Machte zwischendurch eine Pause und dachte an die Suche nach Silas. Es kam mir vor, als hätte das alles vor Lichtjahren stattgefunden, in einer anderen Zeitrechnung. Ich vermisste ihn vielleicht ein bisschen. Andererseits wusste ich, dass es besser war, wenn unsere Wege sich trennten. Weil ich nicht bereit war, mich auf irgendjemanden einzulassen. Ich hatte im Moment meine eigene Umlaufbahn.
Nach dem Wald kam der Fluss, über den eine Brücke führte. Sie sah nicht sehr vertrauenswürdig aus, ein paar Bretter waren bereits herausgebrochen. Das graue Holz in der Mitte zu einer Kuhle gelaufen mit ihrer eigenen charakteristischen Form wie ein alter Mann. Das Wasser floss gemächlich unter mir durch und glitzerte in den letzten Sonnenstrahlen dieses Tages. Diese Ruhe war geradezu unheimlich und gab mir immer wieder das Gefühl, in einer Bleistiftzeichnung aus dem 17. Jahrhundert gelandet zu sein.
Ich passierte noch eine weitere Siedlung, die bereits kleiner war als die vorangegangenen und schaute, ob es die letzte war. Dahinter waren in der Ferne noch ein paar Häuser zu erkennen. Meine Füße taten mir weh. Ich fragte mich, was ich mir von meiner Wanderung versprach. Was sollte dort sein außer ein paar Bauern? Die warteten bestimmt nicht auf mich.
Trotzdem schleppte ich mich dorthin. Es war schon dunkel, als ich ankam. In einem der Gebäude brannte Licht. Irgendwo bellte ein Fuchs. Etwas abseits entdeckte ich ein Holzhäuschen, das unbewohnt schien. Vorsichtig öffnete ich die Tür, die nur noch an einem Scharnier hing. Innen drin raschelte es kurz auf. Ich schloss die Tür hinter mir und legte mich schlafen.
-4-
Ich konnte kaum zur Ruhe kommen, weil es so fürchterlich kalt war. Egal wie fest ich mich in meine Jacke einwickelte, es fror mich am ganzen Körper. Nur für kurze Zeit nickte ich zwischendrin ein. Und konnte mich am nächsten Morgen kaum bewegen. Meine Muskeln schienen wie erstarrt zu sein, selbst das Atmen fiel mir schwer. Ich fragte mich, warum ich mich in diese Situation gebracht hatte, obwohl ich doch genau wusste, dass die Temperatur mit jeder weiteren Nacht sank und ich über keinen High-Tech-Schlafsack verfügte. Ich kramte meine Hände hervor und sah, dass sie bläulich waren. Es beunruhigte mich, machte mir Angst, rief aber auch eine gewisse Zufriedenheit hervor. In der Hinsicht, dass mein eigenes Scheitern Form angenommen hatte und unabwendbar war. Seit dem Sonnensturm badete ich mich noch mehr als zuvor in Selbstmitleid und jubelte über jedes Indiz meiner Unfähigkeit. Das war das einzige, womit ich mir meine Tat gegen meinen Vater erklären konnte. Ich strich über ebendiese Hand, die das verübt hatte, ihre Haut war dünn und blass geworden. Darunter schimmerte das Blut, das ums Überleben kämpfte. Um in die letzten Winkel meines Körpers kommen zu dürfen, ohne abgeschnitten zu werden. Wie der Zug, der mich in diese letzte Ecke Sibiriens gebracht hatte, bevor der Anschluss vielleicht für immer abgestellt wurde.
Ich raffte mich auf und wankte nach draußen, konnte meine Füße nicht mehr lokalisieren. Konnte niemanden sehen. Spürte, wie ein Druck in mir aufstieg und gleich dazu führen konnte, dass mir schwarz vor Augen wurde. Ein altbekanntes Gefühl. Lief schnell zu einem der Häuser und blieb vor der massiven Holztür stehen. Atmete schwer. Ich hatte noch nie jemanden um Hilfe gefragt. Konnte das bisher umschiffen. Angst vor der Ablehnung. Wäre bisher lieber gestorben, als das zu tun. Vielleicht merkte ich, dass Sterben nicht so einfach war, wie ich mir das all die Jahre vorgestellt hatte. Heute war nicht der Tag, an dem ich erfrieren wollte. Ich nahm die Türklinke in die Hand und drückte sie runter. Wollte die Tür öffnen, aber sie klemmte. Jemand half von der anderen Seite nach. Eine Frau stand vor mir und sah mich an.
Ich kam mir vor wie die schmutzigste und erbärmlichste Kreatur auf der ganzen Welt. Starrte auf ihren Pullover, dessen Muster sich vor meinen flimmernden Augen auflöste. Keiner von uns beiden wusste, was zu tun war. Plusgrade kamen aus der Stube zu mir rüber geweht.
„Kann ich mich aufwärmen?“, fragte ich schließlich in der Lautstärke einer Maus.
Es dauerte gefühlte drei Jahre, bis eine Antwort kam.
„Ja“, sagte sie und trat zu Seite.
Ich lief herein, sie schloss die Tür hinter mir. In der nächstbesten Ecke sank ich zu Boden und wurde schließlich von meinem klapprigen Kreislauf überwältigt. Nur noch graue Farbfelder vor meinen Augen, zwischendurch ein Aufblitzen wie von Sternen. Dafür spürte ich die warme Luft um mich herum. Mehr brauchte ich in diesem Moment nicht.
Schon nach kurzer Zeit fingen meine Füße und Hände an zu kribbeln. Es war nicht angenehm, es schmerzte. Begleitet von dem starken Bedürfnis, meine Extremitäten zu schütteln, um dieses Gefühl loszuwerden. Ich rutschte auf den Holzdielen hin und her, rieb mir die Hände und konnte mich einfach nicht kontrollieren.
Die Frau kam zu mir und reichte mir eine Schüssel. Ich hatte zuerst Angst, diese anzufassen, weil sie so dampfte und ich mich nicht verbrennen wollte. Sah, dass die Finger, die die Keramikschale hielten, rissig und vernarbt waren, die Nägel kurz und stumpf. Dann nahm ich das Gefäß und trank daraus. Es schmeckte gewöhnungsbedürftig, fühlte sich in meinem Inneren aber gut an. Warm. Sättigend. Mein Zittern wurde weniger.
„Bist du auf der Flucht?“, fragte die Frau mit einem mir bisher unbekannten starken Akzent.
Ich schaute sie an. Hätte gar nicht sagen können, wie alt sie war. Vielleicht etwas älter als ich? Sie hatte einen emotionslosen Gesichtsausdruck, den ich so noch nie bei einem Menschen gesehen hatte.
„Ja“, erwiderte ich und richtete mich etwas auf.
„Ich auch“, sagte sie und seufzte. „Ich weiß nur nicht vor was…“
In diesem Moment ging die Tür neben mir wieder auf und zwei Kinder und ein Mann kamen hereingestürmt. Ich stand schnell auf, um nicht wie ein Bettvorleger auf dem Boden herumzuliegen.
Wir starrten uns alle etwas erschreckt an.
„Hallo“, flüsterte ich schließlich, „ich bin neu hier und wollte fragen, ob ich in der Hütte nebenan wohnen und euch bei der Arbeit helfen kann.“
„Was?“, sagte der Mann und zog seine Augenbrauen nach oben. Sie verschwanden unter seiner Fellmütze.
„Ja“, sagte das eine Mädchen, das so acht Jahre alt sein musste. „Du kannst uns bei den Schafen helfen. Soll ich sie dir zeigen?“
Der Mann sagte etwas in einer Sprache, die nicht englisch war. Das schockte mich erstmal. Wie konnte das sein? Ich hatte gelernt, dass alle anderen Sprachen ausgestorben waren. Es klang so merkwürdig, viel melodiöser, weicher. Zwischen ihm und der Frau entwickelte sich ein längeres Gespräch, auch die Kinder machten mit. Währenddessen zogen sie ihre Schuhe aus und wärmten sich die Hände an dem Kachelofen. Dann drehten sie sich beide um und musterten mich. Es waren zwei Mädchen mit kleinem Altersabstand. Beide hatten kurze braune Haare und rote Bäckchen. Sie machten einen zufriedenen und aufgeschlossenen Eindruck.
„Okay“, sagte der Mann schließlich und wandte sich an mich. „Du kannst nebenan wohnen. Ich zeige dir alles.“
-5-
In den nächsten Wochen setzten Peter und ich mein Häuschen in Stand, flickten das Dach, reparierten die Tür und den Kachelofen. Dann brachte er mir alles über Schafe bei, Füttern, sauber machen, melken, Hufe schneiden, medizinische Versorgung. Ich lernte mein Wasser aus dem Brunnen zu holen, Holz im Wald zu sichten, zu hacken und aufzuschichten, Butter, Sahne und Käse herzustellen. Solange kein Schnee lag, die Tiere auf die Weiden zu bringen und wieder einzusammeln. Es gab auf dem Hof noch vereinzelte Kühe, Ziegen und Hühner, aber am meisten die Schafe.