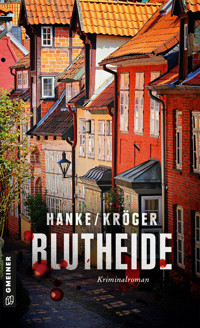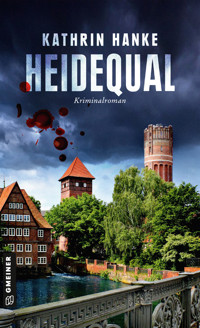Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Die Zeit der Freibeuter um 1367. In einer stürmischen Vollmondnacht wird das Mädchen Ava geboren. Unter widrigen Umständen wächst die Kleine isoliert im ostfriesischen Brookmerland bei ihrer Großmutter Edda auf. Diese weiht sie nicht nur in die Heilpflanzenkunde ein, sondern vor allem in die Welt der nordischen Götter. Als Edda bei einem Überfall getötet wird, kann Ava entkommen. Sie schlägt sich bis ins mecklenburgische Wismar durch, wo sie auf einen jungen Mann trifft: Klaus Störtebeker.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kathrin Hanke
Störtebekers Piratin
Eine Liebe zur Zeit der Hanse
Zum Buch
Die Legende vor der Legende Die Zeit der Freibeuter um 1367. Unter widrigsten Umständen kommt die kleine Ava nahe des Ewigen Meers in Ostfriesland zur Welt. Kurz nach ihrer Geburt verlässt die Mutter die Einöde ohne ihre Tochter, sodass die Kleine bei ihrer Großmutter Edda zu einem jungen Mädchen heranwächst. Dann wird Edda bei einem Überfall getötet – und ihr Mörder hat es auch auf Ava abgesehen. Doch sie kann fliehen und schlägt sich bis nach Mecklenburg in die Hansestadt Wismar durch, da sie glaubt, dort sicher zu sein. Hier trifft Ava auf Klaus Störtebeker. Der Sohn eines Gastwirts nimmt das Mädchen unter seinen Schutz, da taucht plötzlich Eddas Mörder in Wismar auf …
Klaus Störtebeker ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten seiner Zeit im norddeutschen Raum, doch wie kam es dazu? Kathrin Hanke erzählt die Legende vor der Legende. Gekonnt verknüpft sie historische Fakten mit den Volkssagen über den Meister der Piraten und lässt ihn auf Ava treffen, die selbstsichere junge Frau, die an seiner Seite kämpft, lebt und liebt.
Kathrin Hanke wurde in Hamburg geboren. Nach dem Studium der Kulturwissenschaften in Lüneburg machte sie aus ihrer Leidenschaft, dem Schreiben, ihren Beruf – sie schrieb als freie Mitarbeiterin Berichte für den Hörfunk und Zeitungen, arbeitete als Ghostwriterin sowie als Werbetexterin. Heute lebt Kathrin Hanke nach Stationen in anderen Städten mit ihrer Familie als freie Autorin in ihrer Heimatstadt Hamburg. Für ihre Bücher begibt sie sich immer wieder auf die Spuren historischer Figuren, da sie gern Fiktion mit wahren Begebenheiten verknüpft. Sie ist Mitglied bei HOMER, der Autorenvereinigung Historische Literatur e.V. sowie im Syndikat, der Autorengruppe deutschsprachiger Kriminalliteratur. Besuchen Sie die Autorin unter: www.kathrinhanke.com.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Hamburgs dunkle Seiten (2019)
Die Engelmacherin von St. Pauli (2018)
Die Giftmörderin Grete Beier (2017)
Zusammen mit Claudia Kröger:
Heidefluch (2019)
So kocht Lüneburg (2018)
Mordheide (2018)
Heidezorn (2017)
Wermutstropfen (2016)
Heideglut (2016)
Mörderische Lüneburger Heide (2015)
Eisheide (2015)
Heidegrab (2014)
Blutheide (2013)
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2019
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung der Bilder von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lucas_Cranach_the_Elder_-_Judith_with_the_Head_of_Holofernes_-_Google_Art_Project.jpg
und https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hendrik_Cornelisz._Vroom_-_The_Arrival_of_Elector_Frederick_V_of_the_Palatinate_and_Elizabeth_Stuart.jpg
und https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Norvegia_Regnum_-_no-nb_krt_00704.jpg
Druck: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-6116-3
Widmung
Für meine Eltern
1. Kapitel – 1367 nach Christi
»Über Stock und Stein«
Diese Redewendung wurde bereits um 1300 genutzt und meint so viel wie »über alle Hindernisse hinweg oder auch querfeldein«. Sie erinnert an die schlechten Wege, die von Wurzeln und oftmals auch umgestürzten Baumstämmen oder abgebrochenen Ästen, eben Stöcken, und natürlich auch von großen wie kleinen Steinen gespickt waren. Andere beziehen die Redensart auf Grenzzeichen, die im Mittelalter sowohl aus hölzernen Stöckern als auch aus Steinen bestanden haben.
5. November 1367, im Moor zwischen dem Brookmer- und Harlingerland
Die Äste schlugen ihr hart ins Gesicht, doch sie registrierte es kaum. Und selbst wenn, hätte sie es einfach hingenommen. Sie kämpfte sich ganz bewusst durch das engmaschige Gestrüpp und war nicht auf dem Pfad geblieben, der ihr zwar die dicken Kratzer auf Stirn und Wangen erspart hätte, sie andererseits jedoch nicht wie die kräftigen Arme eines Vaters schützend umhüllt und vor den fremden Blicken und noch weitaus Schlimmerem bewahrt hätte. Wäre sie dem Pfad weiter gefolgt, wäre sie für ihre Jäger eine zu leichte Beute gewesen. Bald würden sie jedoch keine Büsche mehr schützen können, denn dann begannen die von Wasserläufen durchbrochenen Sümpfe, in denen nur noch vereinzelt hohe Sträucher standen, die einen Menschen verbergen konnten. Ihr blieb jedoch kein anderer Weg, nur die Hoffnung, dass ihre Verfolger sie nicht in dem Feuchtgebiet, in dem Gefahren lauerten, gegen die kein Schwert ankam und das grausamer sein konnte als Menschenhände, vermuteten und die entgegengesetzte Richtung zurück in den Wald einschlagen würden.
Geske atmete schwer. Sie spürte, wie eine kleine Welle des Schmerzes ihren Unterleib durchzog und hielt erschrocken für einen Moment inne. Konnte das sein? War es jetzt schon so weit? Die junge Frau hatte erst in ein paar Tagen damit gerechnet. Sie hockte sich hin und fühlte ihren hart gewordenen Bauch. Der Schmerz breitete sich in ihren Eingeweiden aus und lief bis in ihren Rücken hinein, von wo aus er sich dann so schnell, wie er gekommen war, wieder verflüchtigte. Die Magd setzte sich erneut in Bewegung. Die kurze Zwangspause hatte ihr gezeigt, wie müde und erschöpft sie war. Sie war inzwischen seit knapp einer Woche unterwegs. Dabei war sie stets auf der Hut gewesen und hatte einige Umwege in Kauf genommen, um sich im Verborgenen zu halten. Vielleicht hätte sie das nicht tun sollen, dann hätte sie es noch rechtzeitig geschafft und es wäre nicht hier bereits losgegangen. Allerdings hatte sie schon direkt bei ihrem Aufbruch in Hamburg gemerkt, dass ihr jemand folgte. Zunächst hatte sie gedacht, es seien diese jungen Kerle, vor denen sie sich einfach nur sorgsam in Acht nehmen musste. So wählte sie ihren Weg durch die Hansestadt derart, dass sie immer dort entlangging, wo auch viele andere Menschen unterwegs waren, so, wie es geraten wurde. Seit einiger Zeit war es bekannt, dass sich junge Männer aus vermögendem Haus ihre Langeweile damit vertrieben, durch die Gassen zu ziehen, um sich an jungen Frauen zu vergehen. Sie schnappten sich die Mädchen am helllichten Tag von der Straße weg, verschleppten sie in einen Hauseingang, unter eine Brücke oder – auch das hatte Geske gehört – sperrten sie für Tage in eine Kammer, und fielen nacheinander wie die Tiere über ihr Opfer her, wobei sie sich auch noch gegenseitig anfeuerten. Wenn die Männer fertig waren oder die Lust an dem Mädchen verloren hatten, ließen sie es einfach liegen. Bei ihren Vergehen waren sie immer vermummt und keiner kannte ihre genaue Identität. Einzig dass sie Söhne von wohlhabenden Bürgern wie Kaufmännern und Ratsherren waren, hatten manche Mädchen aus ihren Gesprächen, ihrer Ausdrucksweise und ihrer teuren Kleidung geschlossen. So ermahnten die Väter ihre Töchter und die Ehemänner ihre Frauen, nicht allein das Haus zu verlassen.
Das Haus von Geskes Herrschaft lag zwar nicht in der Gegend, in der die Vermummten ihr Unwesen trieben, schließlich wohnten sie selbst dort, dennoch hatte die Magd an sie gedacht, als sie das Kaufmannshaus am Burstah verlassen und bald darauf den Verdacht gehabt hatte, dass ihr jemand hinterherschlich.
Ein weiteres Mal musste Geske innehalten. Der erneute Schmerz in ihrem Unterleib baute sich, wie davor auch, nur langsam auf. Je weiter er sich ausdehnte, desto mehr nahm er auch an Intensität zu, die stärker war als beim ersten Mal. Bald hatte er scheinbar ihre gesamte Körpermitte bis in deren letzten Winkel erfasst und sie hätte gern geschrien, um ihm etwas entgegenzusetzen. Schnell steckte sie sich die Faust in den Mund, während sie sich gleichzeitig zusammenkrümmte und abwartete, dass ihre Qualen ihren Höhepunkt erreichten, um dann, wie zuvor auch, wieder abzuebben. Schon vorhin, als sie noch durch den Wald gewandert war, waren immer mal wieder kleine Wellen durch ihren Unterleib gezogen, die ihren Bauch hatten hart werden lassen. Sie hatte angenommen, dass sie durch die Strapazen der Wanderung und auch durch ihre Nahrung, die lediglich aus altem Brot und Wasser bestand, hervorgerufen worden waren. Woher hätte sie es auch besser wissen sollen? Jetzt ahnte sie jedoch in ihrer Pein, dass es lediglich die Vorboten gewesen waren. Als es endlich vorbei war, blieb sie in der Hocke. Sie wollte einen Augenblick verschnaufen – sie war so müde. Gerade als sie nach einer kleinen Weile wieder aufstehen wollte, um weiterzugehen, baute sich erneut eine Welle in ihr auf und übermannte sie. Diese war noch heftiger als die zuvor und die junge Frau dachte, sie könnte es kaum aushalten. Abermals hob sie ihre Faust und schob sie sich in den Mund, um keinen Laut von sich zu geben, und dann, nach einer scheinbaren Ewigkeit, kam endlich wieder die Erleichterung, als wäre nichts gewesen.
Geske richtete sich auf. Ihre Faust hatte sie blutig gebissen, doch das kümmerte sie nicht. Sie ahnte, dass sie schnell machen musste, wenn sie ihr Kind nicht hier, mutterseelenallein, bekommen wollte. Bald war sie im Sumpfgebiet, der Baumbestand wurde bereits lichter, und dann hatte sie ihr Ziel fast erreicht – zumindest, wenn sie den richtigen Weg genommen hatte. Sie hatte das Gebiet einmal gut gekannt, aber das war lange her. Inzwischen hatte sich vieles verändert und sie ahnte nur noch die ungefähre Richtung, die sie einschlagen musste, da die Natur in diesem Landstrich einem stetigen Wandel unterlag. Vor allem das Wasser des Meeres suchte sich unermüdlich seinen Weg ins Landesinnere und grub sich beharrlich neue Schneisen. Deshalb musste sie Acht geben, nicht geradewegs ins Moor zu laufen und darin elendig für immer in die Tiefe der Erde hinabgesogen zu werden.
Wäre es nach ihr gegangen, hätte sie das Kind in Hamburg in ihrer Stube zur Welt gebracht, doch die Hausherrin hatte das nicht erlaubt. Bislang hatte sie jede unverheiratete schwangere Magd vor der Geburt weggeschickt. Über die Jahre waren es drei gewesen und keine von ihnen war zurückgekehrt. Das hatte ihr die Köchin, die schon seit Beginn der Haushaltsgründung bei der Herrschaft arbeitete, erzählt, als sie eines Morgens mitbekommen hatte, wie Geske sich hinter dem Haus erbrach. Die Herrin, Juliane Spiekermann, hatte die Köchin aus dem Haus ihrer Eltern mitgenommen, als sie die Ehe mit Wilhelm Spiekermann eingegangen war. Beide stammten aus angesehenen Hamburger Kaufmannsfamilien und Juliane hatte ihrem Gatten im Laufe der Jahre drei Söhne geboren.
Geske hatte sich ihre eigenen Gedanken darüber gemacht, warum die Mägde nach ihrer Niederkunft nicht mehr zu den Spiekermanns zurückgekehrt waren. Zunächst hatte sie angenommen, die jungen Frauen hätten sich mit den Vätern ihrer Kinder zusammengetan, hatte dies aber wieder verworfen. Schließlich hätten sie dann, schon bevor der prallgefüllte Bauch zu sehen gewesen war, bei der Herrschaft um die Erlaubnis zur Heirat fragen können. Inzwischen glaubte Geske, dass die anderen Mägde zu ihren Familien heimgegangen waren oder sie waren nicht zurückgekehrt, weil sie sich schämten, da sie das Kind verkauft hatten, damit es auf einem Hof als Leibeigener sein Leben verbrachte. Natürlich gab es auch die Möglichkeit, dass die Frauen bei der Geburt gestorben waren, aber daran wollte Geske nicht denken, damals nicht und jetzt, hier in der Einöde, schon überhaupt nicht. Doch abgesehen vom Sterben, das in Gottes Hand lag, waren die anderen Möglichkeiten für sie nie in Betracht gekommen. Ab dem Moment, als sie geahnt hatte, dass ein Kind in ihr heranwuchs, hatte sie gehofft, mit ihm – wenn es erst lebend geboren war – ihrem ganz eigenen Plan vom Leben einen erheblichen Schritt näher zu kommen. Dann hatte die Herrin sie jedoch zu sich gerufen. Juliane Spiekermann hatte auf ihren bereits leicht gewölbten Bauch gesehen, und in diesem Augenblick hatte sich das Kind in ihrem Leib zum ersten Mal geregt – so als wollte es dem bohrenden Blick ausweichen. Geske hatte geschluckt und unwillkürlich die Hand schützend auf ihre Rundung gelegt. Die Herrin hatte nicht gefragt, wer der Vater war, und sie war dankbar dafür gewesen, weil sie sonst hätte lügen müssen. Dennoch war sich Geske in jenem Moment plötzlich sicher gewesen, dass sie aus dem Haus gejagt werden würde, und ihr wurde zugleich klar, dass es ihren Vorgängerinnen ebenso ergangen war und sie nicht von selbst gegangen waren. Ganz abgesehen davon, dass sie als Unverheiratete sichtbar unkeusch gewesen war, machte die gottesfürchtige Juliane Spiekermann nicht den Eindruck, als würde sie es dulden, dass ihre Magd sich neben der Arbeit im Haushalt noch um ihr eigenes Kind kümmerte. Zu ihrer Überraschung hatte Juliane Spiekermann ihr dann allerdings den Vorschlag gemacht, dass sie ihr Kind in der Heimat gebären sollte, um dann, wenn sie wieder bei Kräften war, gemeinsam mit ihm zu den Spiekermanns zurückzukehren. Geske hatte ihr Glück kaum fassen können. Sie verstand zwar nicht so ganz, warum sie zu ihrer Niederkunft nach Ostfriesland zurückkehren sollte, um dann doch wieder hierherzukommen, doch dem Ton der Herrin hatte sie angemerkt, dass sie nicht widersprechen sollte. Natürlich hatte sie später darüber nachgedacht, dem Willen der Herrin nicht Folge zu leisten und irgendwo in Hamburg das Kind zur Welt zu bringen, dann hatte sie sich aber nicht getraut. Schließlich war die Herrin eine über jeden Zweifel erhabene Christin, und wer wusste schon, ob sie nicht eine ganz besondere Verbindung zu Gott hatte. So ähnlich wie ein Pfarrer. Den hinterging man auch nicht.
»Du musst dir nach deiner Rückkehr keine Sorgen um dein Kind machen. Es wird hier bei dir im Haus bleiben können. Und während du deinen Pflichten nachkommst, kann die Köchin in der Küche auf dein Kind achtgeben. Glaub mir, alles wird gut. Aber bitte verstehe, dass ich hier im Haus keine Niederkunft dulden kann. Gott liebt alle Kinder, aber die Leute werden reden, weil du unverheiratet bist. Wenn du aber mit dem Kind aus deiner Heimat zurück bist, werden wir sagen, dass der Vater des Kindes von dort kommt und du ihn geheiratet hast, er jedoch plötzlich gestorben ist. Das wird das Beste für alle sein«, hatte Juliane Spiekermann ihren vorherigen Worten Nachdruck verliehen und obwohl Geske sich fragte, wer diese Geschichte glauben sollte, hatte sie erleichtert genickt. Hauptsache, sie konnte mit ihrem Kind wieder hierherkommen, der Rest würde sich dann schon ergeben, hatte sie gedacht und dachte es auch jetzt inmitten des Sumpfes. Dafür mussten das Kind und sie allerdings am Leben bleiben.
Vor fünf Tagen, als ihr stetig gewachsener Bauch es kaum noch zuließ, dass sie ihren Aufgaben im Haus nachkam, war sie aufgebrochen. Nur die Köchin und die Herrin hatten davon Kenntnis, da sie Juliane Spiekermann hatte versprechen müssen, niemandem sonst von ihrer Abmachung zu erzählen. Warum das Juliane Spiekermann so wichtig war, wusste Geske nicht. Die Münzen, die sie ihr Woche für Woche bis zu ihrem Aufbruch für ihr Schweigen aushändigte, hatte sie allerdings gern entgegengenommen und sich tatsächlich niemandem anvertraut. Noch nicht einmal Wilhelm Spiekermann. Zu Beginn hatte sie es aus Berechnung nicht getan – auch sie hatte kein Interesse daran, dass der Herr von ihrem Gespräch mit seiner Ehefrau erfuhr – und dann war er sowieso weg gewesen. Er begleitete gerade seinen jüngsten Sohn, den zwölfjährigen Johannes, nach Nowgorod. Hier war das östlichste Kontor der Hanse angesiedelt, der Sankt-Peter-Hof, wo Johannes seine praktische Ausbildung zum Hansekaufmann aufnehmen und deswegen die nächsten Jahre verbringen würde. Im Anschluss sollte er in das Geschäft des Vaters einsteigen. Das alles hatte Wilhelm Spiekermann Geske vor seiner Abreise erzählt. Er hatte ihr noch viel mehr erzählt. Es war schön gewesen und hatte ihr die Kraft gegeben, trotz seiner Abwesenheit durchzuhalten – erst die für sie immer beschwerlicher werdende Arbeit im Haushalt und jetzt ihre Wanderung. Hoffentlich fand sie bald die Heimstatt ihrer Mutter, damit sie dort unter geübten und vertrauten Händen ihr Kind gebären konnte. Und bald darauf würde sie mit ihrem Neugeborenen, so, wie mit Juliane Spiekermann vereinbart, wieder nach Hamburg zurückkehren und nicht wie die anderen Mägde ausbleiben.
Es begann zu dämmern. Geske fröstelte. Sie war zwar in diesem Landstrich geboren, doch hatte sie sich hier schon als kleines Mädchen fehl am Platz gefühlt. Das hätte sie auch getan, wenn ihre Mutter sie nicht in der Einsamkeit, sondern in einer der Siedlungen großgezogen hätte. Sie war für das raue und einfache Leben in Ostfriesland nicht geschaffen. Sie wollte etwas Besseres für sich. Immer schon. So war sie mit 13 Jahren aufgebrochen und hatte sich alleine bis in die Hansestadt durchgeschlagen. Dort, auf dem Hopfenmarkt, hatte sie die Köchin der Spiekermanns kennengelernt – der älteren Frau war der Kartoffelkorb heruntergefallen und Geske hatte ihr geholfen, die Erdknollen wieder einzusammeln. Sie waren ins Gespräch gekommen, sie hatte erzählt, dass sie eine Arbeit suche und die Köchin hatte sie sofort unter ihre Fittiche genommen. Mit den Worten »Nicht dass du noch in die falschen Hände gerätst« hatte die Köchin sie mit in das Kaufmannshaus am Burstah genommen und ihr nach einem Gespräch mit der Hausherrin gesagt, dass sie bleiben konnte. Sie fragte sich, wie ihre Mutter reagierte, wenn sie bald wieder in deren Eingang stand. Sie war damals ohne Abschied mitten in der Nacht verschwunden.
Abermals kam eine Wehe. Dieses Mal war sie so heftig, dass Geske meinte, es nicht ertragen zu können. Sie schmeckte das Blut ihrer schnell in den Mund geschobenen Faust auf ihrer Zunge, doch das machte ihr nichts, denn im selben Augenblick spürte sie, wie es zwischen ihren Oberschenkeln warm wurde und Wasser aus ihr herauslief. Was war das? Würde jetzt das Kind hinterherkommen? Geske wurde schwindelig und gleich darauf schwarz vor Augen, obwohl die Sonne noch ihr letztes Licht auf den Flecken Erde hinunterschickte. Die Magd sackte in sich zusammen. In ihrer Ohnmacht bekam sie nicht mehr mit, wie eine Gestalt vorsichtig aus dem Dickicht heraus auf sie zutrat.
In der Nacht vom 5. auf den 6. November 1367, eine Höhle im Brookmerland
Edda senkte den großen Holzlöffel in den Kessel, der an einem Dreifuß über der Feuerstelle hing, und rührte die im heißen Wasser schwimmenden Leinenlappen noch einmal um, bevor sie sie mithilfe des Löffels herausfischte und auf ein neben der Schlafstatt ausgebreitetes Tuch legte. Dann griff sie in ein kleines Körbchen und klaubte etwa eine Handvoll Kamillenblüten daraus. Es waren die letzten aus ihrem Vorrat. Sie hatte sie bereits im Mai, etwa fünf Tage nach der Blüte, gepflückt und getrocknet. Sie war froh, wenigstens noch einen Rest übrig zu haben, und nahm sich vor, im nächsten Jahr mehr zu sammeln, während sie die Blüten über die abgekochten und langsam wieder abkühlenden Lappen streute. Sie würde die Lappen bald brauchen und wollte vorbereitet sein, wenn es so weit war. Und die Blüten würden ihr Übriges tun. Hoffentlich. Die Alten hatten die Kamille dem Gott des Lichts, Baldur, geweiht. Warum, wusste Edda nicht, vielleicht, weil sie so rein und dabei strahlend aussah in ihrer Winzigkeit? Aber sie wusste, dass der Duft der Kamille beruhigend wirkte und half, dass Wunden sich nicht entzündeten.
Edda ließ ihren Blick über die Gestalt gleiten, die mit geschlossenen Augen auf den Fellen lag. Sie hatte die Felle auf das Tuch, das das Strohlager bedeckte und auf dem sie selbst sonst ruhte, geworfen, damit es wärmer für die Daliegende war. Sie glich ihr wie keine Zweite und dennoch wusste Edda, dass sie unterschiedlicher kaum sein konnten. Das lag keineswegs an der Anzahl an Jahren, die sie beide trennten. Es waren fast auf den Tag genau 16 Jahre, die Edda älter war, und gerade als ihre Gedanken nun in die Vergangenheit abschweifen wollten, verzog sich das Gesicht der Jüngeren und ihre Augen öffneten sich. Ihr Mund ging auf und sie entließ einen langgezogenen klagenden Schrei, der Edda erschauern ließ. Nicht weil es ihr graute oder sie nicht wusste, was sie tun sollte – sie hatte schon so einige Frauen ähnlich schreien hören und ihnen geholfen. Auch sie selbst hatte es einst getan. Ihr Herz krampfte sich zusammen, weil es ihre Tochter war, die da vor ihr lag und das ertragen musste, was so viele Frauen vor ihr erduldet hatten und auch noch nach ihr erdulden würden. Und als ihre Mutter fühlte Edda jeden Schmerz, der Geske in diesen Augenblicken heimsuchte, mit. Wie gern hätte sie ihrer Tochter die Qualen abgenommen und für sie ausgehalten, doch das lag nicht in ihrer Macht. Wenigstens konnte sie sie lindern. Zuvor musste sie jedoch überprüfen, wie weit fortgeschritten die Geburt war. Die Wehen kamen bereits in regelmäßigen kurzen Abständen. Als Edda Geske am Rande des Sumpfes gefunden hatte, war das noch nicht so gewesen. Doch inzwischen war mindestens eine Stunde, wenn nicht mehr, vergangen. Die Sonne war vom Himmel verschwunden und der Mond hatte ihren Platz eingenommen. Er war rund wie der Bauch von Geske.
Im ersten Augenblick hatte Edda ihre Tochter nicht erkannt. Sie war gerade beim Torfstechen im Bruchwald gewesen, als sie hinter einer Böschung eine Bewegung wahrgenommen hatte. Sie hatte ihren Korb, in dem sie den Torf sammelte, abgestellt und sich vorsichtig näher geschlichen. Der Torf diente ihr als Brennstoff zusätzlich zum Holz, jedoch roch ein Torffeuer recht stark und deshalb verwendete sie ihn nur, wenn das vorrätige Holz in ihrer Höhle knapp wurde. Vor allem aber nutzte sie Torf für ihre Gelenke, die gerade im Winter häufiger schmerzten. Sie legte dann jeweils einen Placken auf die betroffenen Stellen, umwickelte ihn mit einem Lappen und bald darauf entfaltete sich eine wohltuende Wärme, die tief in ihre Knochen eindrang. Edda strich ihrer Tochter sanft über die Wange. Abgesehen von ihrer Schwangerschaft hatte Geske sich auch sonst stark verändert, seit sie sie das letzte Mal gesehen hatte. Natürlich hatte sie sich in den vergangenen Jahren von einem jungen Mädchen zu einer Frau hin entwickelt, aber das war es nicht allein. Trotz des Glücks unter ihrem Herzen war Geskes Gesicht eingefallen und grau. Früher war Eddas Tochter eher rundlich gewesen und hatte stets einen rosigen Hautton gehabt. Ihr volles blondes Haar hatte immer mit der Sonne um die Wette geglänzt, doch jetzt wirkte es strohig und zerrupft, das konnte nicht allein von der Schwangerschaft herrühren. Obwohl Geske damals fast ohne Abschied und in aller Heimlichkeit gegangen war, hatte Edda geahnt, dass ihre Tochter ihr Glück in der Stadt suchen würde. Geske hatte sich nie mit Ostfriesland verbunden gefühlt und auch nicht mit der Natur, obgleich diese ihr eine relativ sichere Heimat geboten hatte. Edda gab sich selbst die Schuld daran. Immerhin hatte sie ihre Tochter aus der Gemeinschaft herausgerissen, so dass sie allein mit ihr in der Isolation hatte aufwachsen müssen. Es war für sie beide sicherer gewesen, dennoch hatte sie Geske um ein Aufwachsen in der Dorfgemeinschaft und vor allem um Freundschaften mit Gleichaltrigen gebracht. Darüber hinaus war das Leben mitten im Wald und dem angrenzenden Moor hart. Natürlich hätte Edda ihre Tochter auch in die Obhut einer der Dorffrauen geben und allein weggehen können, doch das hätte Geske sicher nicht vor der Gefahr bewahrt, die als ihre Tochter auf sie lauerte und irgendwann unerwartet aus dem Schatten heraustreten würde. Darum würde Edda es jederzeit wieder so machen wie damals. Als Geske etwas älter gewesen war, hatte sie versucht, es ihr zu erklären. Sie hatte es auch verstanden, dennoch hatte Geske sich gegen das Leben, das Edda für sie beide gewählt hatte, innerlich aufgelehnt. Das war schon so, als sie noch ein ganz kleines Mädchen gewesen war. Geske hatte stets lieber ihre hübsche Gestalt im spiegelnden Wasser bewundert, anstatt Kräuter zu sammeln. Dabei hatte sie das Dorfleben und damit die Eitelkeiten, die Menschen untereinander zutage brachten, niemals kennengelernt. Edda strich ihrer Tochter ein weiteres Mal über die Wange. Sie hatte den Heimatflecken mit ihr verlassen, als Geske erst wenige Wochen alt gewesen war. Es war zur Sommerzeit. Edda war damals instinktiv mit ihrer Tochter in die Sumpflandschaft gegangen, die von einem schmalen Streifen Wald umgeben war, in den sie sich zum Übernachten begeben hatte. Eines Abends hatte sie die Höhle entdeckt. Es war ein Zufall gewesen und sie hatte nahezu sofort für sich beschlossen, zu bleiben. In früheren Zeiten schien die Höhle von Wölfen oder wenigstens von einem genutzt worden zu sein, wie Edda anhand von Knochenresten vermutet hatte. Zudem hatte sie ganz in der Nähe im Moor einen toten Wolf entdeckt. Sie nahm an, dass er auf der Suche nach einem eigenen Revier auf Wanderung gewesen war und in der Höhle, so wie sie und Geske, Unterschlupf gefunden hatte. Vielleicht hatte er sogar bleiben wollen, war dann jedoch verhungert, da er einen verletzten Hinterlauf hatte und nicht mehr jagen konnte. Bei seinem Anblick war Edda sich sicher gewesen, dass Fenrir, der im Sumpf lebende Dämon in Wolfsgestalt und Sohn der Riesin Angrboda und des Feuergotts Loki, ihr ein Zeichen gesandt hatte und sie ab jetzt unter seinen Schutz nahm. Aus Dankbarkeit hatte sie den jungen, durch sein Moorgrab unversehrten Wolf in die Höhle geschleppt, ihm das Fell abgezogen, es zum Trocknen aufgespannt und es ihrer Tochter im darauffolgenden Winter als wärmende Decke gegeben. Auf diese Weise hatte Edda Fenrir gezeigt, dass sie seinen Schutz annahm. Den Wolfskopf trennte sie von seinem Rumpf und steckte ihn auf einen Pfahl, den sie zwischen Sumpf und Höhle aufstellte. Sie vergaß keinen Tag, als Opfergabe ein Stück Fleisch neben ihn zu legen. Die abgeschnittene Pfote des verletzten Wolfsbeins trug sie in einem Beutel, den sie an ein langes Lederband geknüpft hatte, das sie sich wiederum um den Hals gehängt hatte, als Talisman stets bei sich. Sie griff mehrmals am Tag an den Beutel, um Fenrir für ihr Leben zu danken. Auch jetzt umfasste sie ihn und murmelte dazu leise: »Danke, dass du mir meine Tochter wiedergebracht hast.«
Nachdem Edda Geske aus dem Sumpf heraus in die Höhle gebracht und auf das Lager gebettet hatte, hatte sie sie untersucht. Schweigend. Und auch vorher hatten sie keine Worte ausgetauscht: Als Geske im Sumpf aus ihrer Ohnmacht erwacht war, hatte sie das Gesicht ihrer Mutter stumm, aber mit staunenden Augen betrachtet und Edda hatte ebenfalls nichts gesagt, sondern sie nur liebevoll angelächelt, während sie ihr ein paar Haare aus der Stirn strich. Zu mehr war ihr keine Zeit geblieben. Eine weitere Wehe hatte Geske überrollt, sie das Gesicht vor Schmerz verziehen und erstickt wimmern lassen. Danach hatte ihre Tochter sich eilig aufrichten wollen, doch war ihr Körper dafür zu schwach gewesen. Ängstlich wie ein waidwundes Reh hatte sie ihre Mutter angeblickt und Edda hatte gespürt, dass dieser Blick nichts mit der normalen Furcht einer Erstgebärenden vor dem, was noch kommen würde, zu tun gehabt hatte. Flink hatte sie Geske unter den Armen gepackt, ihr hochgeholfen und sich beeilt, mit ihr zur Höhle zu kommen. Sie hatten zweimal anhalten müssen, um Wehen vorüberziehen zu lassen, und da hatte Edda die Faust ihrer Tochter gesehen. Die Handknöchel waren bis hinunter auf die weißen Gelenke blutig aufgebissen. In der Höhle hatte Edda die Hand ihrer Tochter verbunden und ihr ein hartes Stück Holz gegeben, auf das diese auch jetzt wieder biss, während sie versuchte, ihr Kind aus sich herauszupressen. Edda nahm einen der mit Kamille getränkten Lappen und fragte sich, was ihre Tochter angetrieben hatte, zurück zu ihr zu kommen und dabei zu riskieren, auf dem Weg hierher fast ihr Kind allein im Sumpf zur Welt zu bringen. Sie würde Geske später fragen, wenn das Kind aus ihrem Leib heraus war und sie hoffentlich noch lebte. Das viele Blut, das Geske bisher allein hier in der Höhle verloren hatte, sprach eher dagegen, aber die ältere Frau hatte in ihrem bisherigen Leben gelernt, die Hoffnung erst dann aufzugeben, wenn etwas unwiderruflich war. Sie stellte die Beine ihrer Tochter auf, spreizte sie auseinander und wusch etwas von dem Blut und Schleim, der aus Geske herausgekommen war, von deren Schenkeln. Währenddessen sang sie leise eine alte Weise, von der sie nicht wusste, woher sie kam, da sie von Generation zu Generation unter den Frauen in ihrer Familie weitergegeben worden war. Die Überlieferung besagte, dass die Weise nicht nur den Alten Göttern huldigte, sondern es vor allem erlaubte, mit ihnen in Verbindung zu treten. Und so schickte Edda mit den leise intonierten, melodisch aneinandergereihten Worten, die sich unablässig wiederholten, ihre Gedanken nach dem Göttersitz Asgard und bat, Geske am Leben zu lassen und auch das Kind in Geskes Leib nicht in die Unterwelt zu holen. Doch der Gesang hatte noch eine andere, viel direktere Wirkung: Er lullte denjenigen, der ihn auf Erden hörte, ein, nahm ihm Schmerz und Furcht und brachte ihn für einen Moment in die Zwischenwelt. So geschah es auch gerade mit Geske, die ihre Lider wieder geschlossen hatte und deren Gesichtszüge nun deutlich entspannter als eben noch waren. Edda beendete die Waschung von Geskes Beinen und legte, weiterhin summend, eine Hand mit leichtem Druck auf Geskes gewölbten Bauch. Die andere Hand schob sie in die Öffnung zwischen deren Schenkel. Was sie im Leib ihrer Tochter fühlte, ließ sie für einen Moment tief einatmen und ihren Gesang unterbrechen. Sie hatte es vermutet und jetzt Gewissheit. Das Kind lag falsch. Sie hätte in diesem Stadium der Geburt den kleinen Kopf fühlen müssen, stattdessen konnte sie die angewinkelten Beinchen des Kleinen fassen. Edda wusste, dass sie keine Zeit verlieren und handeln musste, sonst riskierte sie den Tod des noch Ungeborenen, zumal auch Geske enorm geschwächt war. Sie würde jetzt versuchen, schnell das Kind zu holen, und danach konnte sie Geske stärken und ihre Blutungen stillen. Die ältere Frau nahm ihren Gesang wieder auf. Nun brauchte sie umso mehr den Beistand der Götter, und Geske, die in diesem Moment unter einer weiteren Wehe vom Schmerz gerüttelt wurde, würde er weiterhin betören. Die wohltuenden Klänge, die tief in Eddas Kehle entstanden und ihren gesamten Körper ausfüllten, leiteten sie an, das zu tun, was getan werden musste.
6. November 1367, am Ewigen Meer
Edda stand auf dem Bohlenweg, der durch das Moor führte, und schaute zum nächtlichen Himmel hinauf. Der volle Mond – umgeben von einem Meer aus funkelnden Sternen, die sich auf dem Wasser spiegelten und an sich wiegende Glühwürmchen erinnerten – hatte ihr den Weg geleuchtet. Außerdem hatte ihr ein schmaler, flackernder Streifen in weiter Ferne zwar kein zusätzliches Licht, aber wenigstens eine Orientierungshilfe geboten – die Siedlung feierte das Winternachtsfest. Auch sie selbst hatte bereits am Morgen, als sie noch nicht gewusst hatte, dass der Abend ihr ihre Tochter zurückbringen würde, alles für ihr eigenes kleines Fest vorbereitet. Doch das würde warten müssen, zuvor hatte sie noch etwas zu erledigen und musste sich darüber hinaus um ihre Tochter kümmern. Ein plötzlicher Gedanke blitzte in ihrem Kopf auf. Was, wenn Geske und ihr Kind nicht durch Zufall heute bei ihr angekommen waren? Sollten sie die Opfergabe sein? Edda schüttelte ihren Kopf, als wollte sie eine lästige Fliege verjagen, und richtete ihren Blick wieder auf den flackernden Streifen, das Feuer, das die Siedlungsbewohner entfacht hatten. Alle waren dort versammelt und würden dem Beginn des Winters, den Ahnen und den Göttern, vor allem Hel, deren Zeit jetzt anbrach, huldigen. Der Frühling gehörte Freya, der Göttin der Fruchtbarkeit, und der Sommer Frigg, der Hüterin des Herdfeuers und Haushalts. Hel aber war die Totengöttin, die Herrscherin der Unterwelt, von Helheim, das, fernab vom Licht der Sonne, tief unter der Erde lag und wo alles Sein entstand und wohin alles auch wieder zurückkehrte. Ab morgen, nach dem Winternachtsfest, würden sich die Menschen auf Erden deswegen in ihre Hütten zurückziehen und wie die Tiere für sich bleiben, um Kraft zu sammeln. Edda erinnerte sich für einen kurzen Moment wehmütig an die Zeit, als auch sie noch bei ihren Leuten gewesen war und eine feste Rolle während der Zeremonien innegehabt hatte. In diesem Jahr wurde das Vollmondfest recht spät abgehalten – sie schrieben den 6. November im Jahr 1367, ein Datum, das sie sicher niemals vergessen würde, dachte Edda und raffte ihre Schultern, um ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen. Wie Geske wohl reagieren würde, wenn Edda zurückkam? Ob sie dann überhaupt noch reagieren konnte? In die Augenwinkel der Mutter stahlen sich Tränen hinein, die sie, fast schon grob zu sich selbst, mit dem Handrücken wegwischte. Sie seufzte. Geske hatte das Bewusstsein verloren, nachdem sie das Kind aus ihr herausgeholt hatte. Es hatte lange gedauert und als das Kind mit den Füßen zuerst aus ihrer Tochter gekommen war, war es blau wie die See nach einem heftigen Regen gewesen. Die dicke, noch pulsierende Nabelschnur hatte sich um seinen Hals gewickelt. Das Kind hatte nicht geschrien und sich auch sonst nicht geregt. Edda hatte gewusst, was das bedeutete. Ihre Enkelin – das Kind war ein Mädchen – war tot geboren. Sie hatte sie beiseite in einen bereits hergerichteten Weidenkorb gebettet. Es war der Korb, den sie gerade durch die Nacht trug und der fürs Erste das Kinderbettchen hatte sein sollen, jetzt aber für immer ein Totenbett war. Edda schluckte und so sehr sie ihre Augen auch senken wollte, um noch einmal ihre Enkelin zu betrachten, zwang sie sich doch, es nicht zu tun. Sie wollte ihr Herz nicht schwerer machen, als es bereits war. Die Kleine hatte ihren Mund und die Augen bereits bei ihrer Geburt geschlossen gehabt, so dass Edda es nun nicht tun musste, damit die ausgehauchte Seele nicht wieder in den Körper zurückkehrte, sondern auf den Schwingen des Seelenvogels hinüber in die andere Welt gleiten konnte. Edda schluckte ein weiteres Mal und lenkte nun doch ihren Blick in den Korb. Dabei kam es der älteren Frau so vor, als strahlte der Mond eigens auf ihre so ruhig daliegende Enkelin, die in dem sanften Licht aufzuleuchten schien. Edda fühlte sich seltsam berührt. Behutsam strich sie dem toten Kind über den blonden Flaum auf dem kleinen Kopf. Dann knüpfte sie das Lederband mit der Wolfspfote von ihrem Hals und legte es dem Kind um – das war das Mindeste, was sie für die Kleine noch tun konnte, bevor sie sie auf ihre Reise schickte. Sie musste sich sputen, denn sie wollte Geske in ihrem Zustand nicht zu lange allein lassen.
Bevor sie die Höhle verlassen hatte, hatte sie ihre Tochter gewaschen und die Lippen mit dem Absud von Bohnenkraut, das sie vor längerer Zeit von einem fahrenden Händler gegen einen ihrer Körbe eingetauscht hatte, benetzt. Sie hatte das Kraut zuvor nicht gekannt, da es von weit her aus dem Süden der Welt, vom Mittelmeer her, kam, aber sie hatte es genommen, da der Mann ihr versichert hatte, dass es belebend wirke. Inzwischen hatte Edda herausgefunden, dass es auch Entzündungen bekämpfte, doch sie verwendete es nur sparsam. Sie wusste schließlich nicht, ob sie dem Händler noch einmal begegnen würde, und die wenigen anderen Händler, die sie bisher nach dem Kraut gefragt hatte, kannten es nicht einmal. Auch bei Geske hatte die Pflanze ihre Wirkung nicht verfehlt und ihre Lebensgeister angeregt. Sie war aus ihrer Bewusstlosigkeit wiedererwacht und hatte nach einem kurzen Augenblick der Orientierungslosigkeit ihr Kind sehen wollen. Edda hatte ihrer Tochter behutsam über die Stirn gestrichen und ihr sanft geantwortet: »Nein, Liebes, Hel hat es in ihre geschmückten Hallen geholt. Behalte es so in Erinnerung, wie du es in dir gespürt hast, und nicht, wie es jetzt aussieht. In deinem Leib war es noch dein Kind, jetzt ist es nur mehr eine Hülle.«
»Hel?«, hatte Geske mit schwacher Stimme gefragt, doch Edda hatte die Erschütterung herausgehört, oder war es eher Enttäuschung gewesen? Noch immer war Edda sich da nicht sicher, allerdings war es auch nicht wichtig. Ihre Tochter hatte ihr Kind, das sie viele Monate unter ihrem Herzen getragen und das sie sogar dazu bewogen hatte, wieder in die Heimat zurückzukehren, verloren und das bedeutete großes Leid. Eddas Herz krampfte sich bei diesem Gedanken zusammen und sie litt mit ihrer Tochter, denn sie wusste, dass diese Wunde niemals ganz verheilen würde. Darum hatte sie Geske in der Höhle das tote Kind auch nicht gezeigt. Sie hatte nicht gewollt, dass ihre stark geschwächte Tochter dem Tod so direkt ins Antlitz sah.
»Ja, Hel«, hatte Edda erwidert. »Sie liebt Kinder und wird gut zu ihm sein.«
Edda hatte dies nicht nur so dahingesagt, um ihre Tochter zu beruhigen, sie glaubte an dieses freundliche Bild der Göttin. Sie hatte bewusst nicht von dem Christengott gesprochen, obwohl Geske wahrscheinlich in ihrer Zeit in der Fremde mit ihm gelebt hatte. So, wie die Menschen es inzwischen taten. Hier in Ostfriesland war es anders. Die Menschen in den Siedlungen beteten zum Christengott, ließen jedoch auch nicht von den Alten Göttern ab, wie sich in ihren Festen auch heute wieder zeigte. Unwillkürlich sah Edda zum entfernten Feuerschein. Sie selbst war auch zur Christin erzogen, damit sie und ihre Familie vor dem immer mächtiger werdenden Klerus nicht auffielen. Ihre Großmutter war es jedoch gewesen, die ihr die Alten Götter nahegebracht hatte. Sie hatte ihr auch die Weise vorgesungen und sie in die Heilkräuterkunde eingeweiht. Jetzt war sie selbst eine Großmutter. Eine Großmutter von einer Totgeburt, die in einer Vollmondnacht am Rande des Ewigen Meers stand, um ihre Enkeltochter in Hels Reich zu schicken. Edda hoffte inständig, dass sie mit ihrem Glauben an die Göttin recht hatte. Es wurden die unterschiedlichsten Dinge über die Herrscherin der Anderswelt erzählt. Die einen fürchteten sie als grausame Totengöttin, die anderen verehrten sie als die Mutter allen Lebens, denn dort, wo es den Tod gab, musste vorher das Leben sein und umgekehrt, damit der Kreislauf stabil blieb. Edda atmete einmal tief ein und wieder aus. Wie es auch war, es war nun nicht mehr zu ändern. Das Kind war tot und trotz ihrer Traurigkeit und so schwer es ihr auch fiel, anerkannte Edda den Tod als Teil eines Ganzen. Sie hatte diese Erkenntnis schmerzlich lernen müssen und war den Göttern dankbar, dass sie ihr dadurch überraschend wenigstens noch Zeit mit ihrer Tochter geschenkt hatten, zu der es sie jetzt in die Höhle zog. Hoffentlich war Geske in der Zwischenzeit nicht wieder in ihren Dämmerzustand zurückgefallen oder sogar ganz entschlafen, um ihrem Säugling zu folgen. Edda hatte sie mit den Worten verlassen: »Ich schicke das Kleine jetzt auf seine Reise. Es wird nicht lange dauern, ich bin bald wieder bei dir.«
Geske hatte nahezu unmerklich mit dem Kopf genickt und Edda hatte das als Einverständnis gedeutet. Sie hatte sich vom Lager ihrer Tochter erhoben, eine Kutte über ihr Leinenkleid gezogen und darüber noch ein dickes Wolltuch gewickelt. Dann hatte sie behände einen Topf mit heißen Kohlen gefüllt und in einen Beutel trockenen Torf und Reisig gesteckt. Samt dem Beutel, dem Topf und dem Weidenkorb mit dem darin liegenden reglosen Bündel hatte sie die Höhle verlassen. Der Topf stand jetzt neben ihr, während sie hier am Ewigen Meer, dem ausgedehnten Hochmoor, wieder die alte Weise anstimmte. Bis auf die Sterne, die auf den Wellen des eben noch ruhigen, jetzt aber vom Wind gepeitschten Wassers hin und her sprangen, lag der Moorsee schwarz und bedrohlich vor ihr. Sie ging in die Knie, holte aus dem Beutel das Reisig, das sie über die Kohlen streute, und pustete in den Kohlentopf, woraufhin sich das trockene Gestrüpp schnell entzündete. Dann gab sie den Torf hinzu. Nachdem auch dieser Feuer gefangen hatte und es im Topf ordentlich loderte, umwickelte sie ihre Hände mit dem Wolltuch, das sie trug, griff den Topf und schüttete seinen Inhalt in einen kleinen Kahn, der am Ufer vertäut lag. Es schien Edda fast, als würde er geduldig darauf warten, bis sie alles hergerichtet hatte, damit er mit dem Kind aufbrechen konnte. Es dauerte nicht lange, bis sich die Glut aus dem Topf in das Holz des Kahns gefressen und dieser Feuer gefangen hatte. Als die Flammen schon an den niedrigen Innenwänden hochzüngelten, stand die ältere Frau, noch immer leise singend, auf und holte den Weidenkorb heran. Sie schaute nicht noch einmal hinein, als sie ihn in das brennende Gefährt setzte. Dafür blickten ihre Augen suchend auf den Bohlen herum, bis sie im Lichtschein einen passenden Stein am Rand entdeckte. Sie nahm ihn auf und steckte ihn vorerst in die Tasche ihrer Kutte. Dann band sie den Kahn los, gab ihm einen Schubs und sah ihm nach, wie er mit seiner jungen Fracht auf den See hinausschipperte. Jetzt sang sie nicht mehr.
Der Kahn war noch keine drei Meter entfernt, als eine Windbö in ihn hineinwirbelte und die Flammen daraufhin hoch emporschossen. Edda drehte sich weg. Sie hatte getan, was getan werden musste. Wäre das Kleine schon älter gewesen, hätte sie ihm noch nach dem Brauch der Alten die Fuß- und Fingernägel geschnitten – aus den Nägeln der Toten, so war es überliefert, wurde das Totenschiff Naglfar gezimmert. Auch die sonst üblichen Totenschuhe hatte Edda weggelassen. Das Neugeborene konnte noch nicht laufen und es brauchte keine Schuhe, damit ihm der steinige Weg zu Hel leichter fiel. Bereits vorhin in der Höhle hatte Edda mit sich gehadert, ob sie das Kind wenigstens für einen oder zwei Tage aufbahren sollte, dann hatte sie sich jedoch dagegen entschieden. Es war noch rein und unschuldig und Hel schien das Kind schnell bei sich haben zu wollen, sonst hätte sie ihm schließlich etwas mehr Lebenszeit auf Erden geschenkt. Darüber hinaus hatte Edda sachlich gedacht: Obwohl der Körper so klein war, hätte sein Leichengeruch Tiere angelockt und mit diesen möglicherweise auch die Verfolger von Geske, von denen sich die ältere Frau inzwischen sicher war, dass es sie gab. Geske hatte nichts gesagt, aber sie hatte sich in ihrem Dämmerzustand zwei- oder dreimal auf ihrem Lager hin und her geworfen und ängstlich gewimmert. Edda hatte herausgehört, dass es nichts mit den Schmerzen der Geburt zu tun gehabt hatte, und sich ihre Gedanken gemacht. Immerhin hatte sie ihre Tochter beim Moor gefunden und es hatte dort so ausgesehen, als hätte Geske sich hinter einem Busch versteckt. Aber vor wem? Auch Edda war einst geflohen, doch dass diese Leute ihre Tochter aufgespürt hatten, konnte sich die ältere Frau nicht vorstellen. Oder sollte es doch so gewesen sein? Edda hatte in jedem Fall kein Risiko eingehen wollen und deswegen den kleinen Leichnam bereits jetzt von ihrem Unterschlupf hierher gebracht. Traurig verließ sie Schritt für Schritt den See, der ihre Enkelin auf seinen Wellen zu Hel tragen würde. Noch immer fragte sie sich, ob sie richtig gehandelt hatte, tröstete sich jedoch über ihre Unsicherheit hinweg, denn soweit sie wusste, waren sich auch die Götter bei Neugeborenen, die während oder kurz nach ihrer Geburt starben, nicht einig, da deren Existenz für den Augenblick ihrer Geburt zwischen den Welten lag. So brauchte Edda sich jetzt auch nicht zu grämen, dass sie das tote Kind nicht dreimal umschritten hatte, bevor sie es dem Wasser übergeben hatte, das es in die Unterwelt bringen sollte. Dafür hatte sie jedoch den Stein als Denkstein aus ihrer Kutte hinterhergeworfen – wer weiß, irgendwo würde er vielleicht wieder ans Ufer gespült werden und einem anderen Lebewesen den Weg weisen.
Edda fröstelte. Der Wind hatte wieder zugenommen, er pfiff durch das Schilf und peitschte über den See, so dass in den Ohren der Frau ein schriller Gesang der Natur ankam, der sie noch mehr erschaudern ließ.
Dieselbe Nacht, an anderer Stelle im Brookmerland
Durch die Vollmondnacht tönte der Ruf eines wilden Tieres. Es konnte aber auch das Geräusch des Windes sein, der seit einer Weile böig über das Land pfiff, das ihm ebenso fremd war wie die Zwerge, die als Gaukler immer mal wieder in Hamburg ihre Späße trieben. Wenn er sie erblickte, konnte er vor Neugier und zugleich Abneigung nicht die Augen von ihnen lassen. Genauso ging es ihm hier mit der ostfriesischen Landschaft. Auf der Landseite waren da die Marsch, das Moor und die Geest und auf der Seeseite das Meer, welches sich regelmäßig so weit zurückzog, dass nur noch die kleinen Pfützen und Priele daran erinnerten, wie kurz zuvor die Wassermassen den sandigen Boden verdeckt und gewaltige Wellen ihr Spiel getrieben hatten. Natürlich kannte er Ebbe und Flut von zu Hause. Auch die Elbe unterlag den Gezeiten, doch hier, in Ostfriesland, wurde man sich allein mit einem Blick auf das weite Watt schnell bewusst, was für eine kleine Kreatur der Mensch doch war.
Er stoppte sein Pferd und seine Männer taten es ihm gleich. Für einen Moment legte er den Kopf in den Nacken und schloss seine Augen. Fast schien es so, als würden die Windböen aus der Erde zu ihm allein hochsteigen, um ihn zu umwirbeln und in sich gefangen zu nehmen. Ihn schauderte. Ob diese Wahrnehmung vom Met herrührte, den er vorhin auf diesem Heidenfest getrunken hatte? Er und seine Männer waren durch Zufall dort hineingeraten. Sie hatten irgendwann auf ihrer Jagd die Spur verloren und als die Dämmerung zur Nacht geworden war, hatten sie ihre Pferde gewendet, um den Heimweg einzuschlagen, denn er war sich sicher, dass seine Beute in ihrem Zustand und in diesem unwirtlichen Landstrich nicht überleben würde, wenn sie nicht bereits das Zeitliche gesegnet hatte. Und genau darum ging es ihm, denn das war sein Auftrag. Natürlich ärgerte er sich darüber, nicht schon früher zugeschlagen zu haben, damit er jetzt Gewissheit hätte. Möglichkeiten wären vorhanden gewesen, doch er hatte bis zum Sumpf warten wollen, um sie im Moor einfach loszuwerden und nicht irgendwo verscharren zu müssen.
Er seufzte. Jetzt war es, wie es war und er hatte ein anderes Problem. Irgendwie musste er aus dieser Unwirtlichkeit wieder herausfinden, ohne selbst Schaden zu nehmen. Wahrscheinlich hätten er und seine Leute ebenso den falschen Weg gewählt, wenn es nicht bereits dunkel gewesen wäre, doch im Finstern hatten sie sich in dieser Landschaft überhaupt nicht orientieren können. Zwar hatte er ohnehin nicht vorgehabt, die Nacht durchzureiten, doch dann hatte er sich von der Natur gezwungen gefühlt, allen eine Pause zu gönnen. Aus einer Regung heraus hatte er jedoch kein Nachtlager in dieser unberechenbaren Wildnis aufschlagen wollen und so waren sie dorthin geritten, wo sie aufgrund von flackernden Feuern eine Siedlung vermuteten und auf eine Herberge hofften. Tatsächlich waren sie auf eine Menschenansammlung gestoßen, die jedoch vor dem Dorf, das auf einer Warft errichtet war, ihre Feuer aufgeschichtet hatte und etwas feierte, was sich ihm erst später erschlossen hatte. Natürlich waren er und seine Männer schon aufgrund ihrer Kleidung sofort als ferne Städter erkannt worden und die Menschen waren ihnen gegenüber reserviert gewesen, hatten sie aber geduldet. Gegen ein paar Münzen hatten sie Met bekommen, womit sie das trockene Brot, das sie in ihren Satteltaschen als Proviant mit sich trugen, heruntergespült hatten. Sie hatten sich in eine Ecke zurückgezogen und das Treiben der Ostfriesen verfolgt. Erst nach einer Weile begriff er, dass die Einheimischen ein Fest für ihre Alten Götter feierten, obwohl er auf einem Dach des Dorfes ein Kreuz ausgemacht hatte. Er selbst war durch und durch Christ, so wie es sich gehörte, und hatte einen mächtigen Schreck bekommen, wohinein er geraten war. Das verbarg er jedoch vor seinen Männern. Er hatte absolut kein gutes Gefühl gehabt. Was würde Gott von ihm denken? Würde dieser jetzt meinen, dass er den Heidengöttern huldigte, und deshalb zornig werden? Jetzt, hier auf seinem Pferd, während der Wind ihn auf so merkwürdige Weise umpfiff, fragte er sich das erneut. Immerhin hatte er mit einem Abtrünnigen gesprochen und gemeinsam das Glas erhoben, denn gerade, als er aufgestanden war, um die heidnische Feier zu verlassen, war der Häuptling auf ihn zugetreten. Sie hatten sich einander vorgestellt und er hatte erfahren, dass sein Gegenüber Keno I. tom Brok war. Der Familienname tom Brok hatte ihm sofort etwas gesagt und er hatte den Mann aufmerksam gemustert, ohne dass er unhöflich geworden wäre. Keno I. war um einen Kopf kleiner als er selbst und trotzdem strahlte der Häuptling eine gewisse Größe aus. Die tom Broks waren ein angesehenes und auch vermögendes Geschlecht in Ostfriesland und mindestens einer der Vorfahren von Keno I. war ein Konsul gewesen. Er hatte Keno I. tom Brok im flackernden Feuerschein seinen Respekt bekundet und sich innerlich geehrt gefühlt, dass der Mann in ihm ebenso einen Edlen erkannt hatte und ihm seine Gastfreundschaft anbot. Er hatte noch einen weiteren Krug Met getrunken, danach indes wieder aufgesattelt. Das, was auf dem Platz anscheinend an Riten durchgeführt wurde, hatte ihm nicht gefallen und auch seinen Männern war diese Geisterbeschwörung nicht geheuer gewesen – sie alle wollten Gott keinesfalls herausfordern, indem sie unter diesen Wilden ihr Lager aufschlugen. So waren sie wieder in die Nacht hineingeritten und nun stand er hier mit seinem Ross, schaute in die glitzernde Schwärze und spürte den Wind. Der Honigwein war ihm definitiv zu Kopf gestiegen, aber das taten die Humpen Bier auch, die er sonst so trank. Konnte es sein, dass diese Ostfriesen irgendetwas beigemischt hatten? Immerhin waren sie auf einem Fest zu Ehren ihrer heidnischen Götter gewesen. Er kannte sich mit dem Heidentum nicht aus und wollte es auch nicht. Abrupt drehte er sich zu seinen Männern um, die stumm darauf warteten, was er entscheiden würde. Kam es ihm nur so vor, oder waren sie nicht so nervös wie er? War er etwa heimgesucht worden? Ihm lief ein kalter Schauer über den Rücken und ungeachtet dessen, dass es dunkel war und das Tier sich in dieser auch am Tage unübersichtlichen Natur verletzen konnte, trieb er spontan sein Pferd an – ihm war, als wäre nicht er heute noch der Jäger gewesen, sondern als säße ihm der Teufel im Nacken.
Wenige Zeit später am Ewigen Meer
Schnellen Schrittes ging Edda den Bohlensteg zurück, fast schon rannte sie. Unter ihren Füßen fühlte sie mit jedem Auftritt, wie das Holz unter ihr mitschwang. Sie brauchte keine Fackel, sie kannte den Weg im Schlaf und die Beleuchtung durch den Nachthimmel reichte ihr nach wie vor völlig. Sie hatte es jetzt eilig, zurück zu ihrer Tochter zu kommen. Ihr war noch immer fröstelig, doch sie hatte das unbestimmte Gefühl, dass dies nicht von dem zunehmenden Wind hervorgerufen wurde, sondern aus ihrem Innern kam. Als hätte sie eine Vorahnung, ohne jedoch zu wissen, wovon. Aber sie war sich sicher, dass irgendetwas passieren würde, und was lag da näher, als dass es mit ihrer Tochter zu tun hatte? In der Regel träumte sie einschneidende Geschehnisse vorab. Auch ihre Vertreibung und die darauffolgende Flucht damals aus der Gemeinschaft hatte sie bereits einige Tage vor den Ereignissen geträumt und so war sie gewappnet gewesen. Dieses Mal hatte sie allerdings nichts geträumt oder zumindest keine Vorzeichen gesehen. Im Gegenteil, sie hatte in den letzten Tagen von sich selbst als kleinem Mädchen geträumt, wie sie im herrlichen Sonnenlicht glücklich durch das Feuchtgebiet gestreift war oder Beeren im Wald gesammelt und in einem See gebadet hatte.